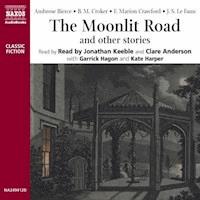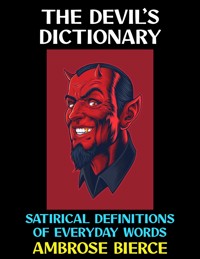Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elster Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ambrose Bierce ist neben Edgar Allan Poe und H. P. Lovecraft der Pionier der modernen Horror- und phantastischen Literatur. Im Gegensatz zu Poe und Lovecraft hat Bierce allerdings in seinen Horrorgeschichten eine gehörige Portion eigener Erfahrung beigesteuert - eine bittere Jugend in Ohio und seine schrecklichen Erlebnisse während des Amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865). Seine zum Teil geradezu alptraumhaften Geschichten sind geprägt von kühlem Sarkasmus und bitterer Lakonik. Gisbert Haefs hat Bierce' Horrorgeschichten neu übersetzt und zusammengestellt. Das Buch folgt dem Band 3 der von Haefs herausgegebenen Werksausgabe und wurde von ihm noch einmal durchgesehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ambrose Bierce Horrorgeschichten
Ambrose Bierce Werke in vier Bänden
Herausgegeben von Gisbert Haefs
Band 3 Horrorgeschichten
Ambrose Bierce
Horrorgeschichten
Herausgegeben von Gisbert Haefs
Aus dem Amerikanischen von Gisbert Haefs
Mit einem Vorwort von Elisabeth Bronfen
Elster Verlag • Zürich
© 2015 by Elster Verlagsbuchhandlung AG, Zürich Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiserVerwertung, vorbehalten. Vervielfältigungen des Werkes oder von Teilen des Werkes sind auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichenBestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie sind grundsätzlich vergütungspflichtig.
Elster Verlagsbuchhandlung AG Hofackerstrasse 13, CH 8032 Zürich Telefon 0041 (0)44 385 55 10, Fax 0041 (0)44 305 55 [email protected] ISBN 978-3-907668-96-2 Lektorat: Smilla Schär Umschlag: Alex Werth nach einem Konzept der dreh gmbh, Zürich Umschlagbild: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin Gesetzt aus Adobe Garamond 10/13, LW 5
Inhalt
Vorwort von Elisabeth Bronfen
Der Mann aus der Nase
Ein Abenteuer in Brownville
Der berühmte Gilson-Nachlass
Der Bewerber
Ein Totenwächter
Der Mann und die Schlange
Ein furchtbares Scheusal
Die angemessene Umgebung
Das vernagelte Fenster
Eine Dame aus Redhorse
Die Augen des Panthers
Halpin Fraysers Tod
Das Geheimnis von Macarger’s Gulch
In einer Sommernacht
Die Straße im Mondlicht
Diagnose Exitus
Moxons Herr
Ein Zwilling
Das Spuktal
Eine Kruke Sirup
Staley Flemings Halluzination
Ein Baby-Tramp
Nächtliche Vorkommnisse in Deadman’s Gulch
Jenseits der Mauer
Ein psychologischer Schiffbruch
Der mittlere Zeh des rechten Fußes
John Mortonsons Begräbnis
Das Reich des Unwirklichen
John Bartines Uhr
Das verdammte Ding
Haita, der Schäfer
Ein Bewohner von Carcosa
Der Fremde
Anwesend beim Erhängen
Eine kalte Begrüßung
Eine drahtlose Botschaft
Eine Festnahme
Die Fichteninsel
Eine fruchtlose Recherche
Haus mit Kletterpflanze
Bei Old Man Eckert
Das Geisterhaus
Das Ding in Nolan
Schwierigkeiten beim Überqueren eines Feldes
Ein unbeendetes Rennen
Charles Ashmores Fährte
Anhang
Editorische Notiz von Gisbert Haefs
Anmerkungen
Vorwort
Elisabeth Bronfen
Nicht ohne Grund hat Gisbert Haefs, der Herausgeber von Bierce’ Werken, der Zusammenstellung der Erzählungen die Überschrift «Horrorgeschichten» gegeben. Das lateinische Wort «Horror» (Schrecken) umfasst den Schrecken genauso wie das Grauen und das Entsetzen ebenso wie den Schauer über ähnliche, nie erlebte oder empfundene Dinge, die als bedrohlich und das eigene Leben gefährdend empfunden werden. Und Ambrose Bierce hat hier zweifellos einiges zu bieten.
Aber neben der interessanten Frage, weshalb solche Erzählungen sich einer ungebrochenen Beliebtheit erfreuen, bleibt in Bierce’ Fall zu erörtern, weshalb der Schrecken häufig von Personen hervorgerufen wird, die eigentlich tot sind, aber aber gleichwohl wieder erscheinen und die Lebenden in heillosen Schrecken versetzen. Für sie sind diese Geister Gespenster, die mit den Lebenden in unheilvoller Weise verbunden sind.
In Wahrigs Deutschem Wörterbuch findet man unter dem Eintrag «Gespenst» neben der Definition «Verlockung [(gi)spannst] als Synonym das Wort ‹Geist›». Dieser Begriff wiederum teilt sich in zwei Bedeutungsstränge auf. Einerseits wird Geist als Hauch, als Atem und somit als Träger des Lebens verstanden. Ein Mensch zu sein heißt, einen Geist zu haben, eine singuläre Vorstellungsgabe, welche im Gegensatz zur Seele zu verstehen ist. Zugleich spricht man vom Geist einer Epoche, sodass sich in den Spukgeschichten, in denen Ambrose Bierce das Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit makabrem Witz zeichnet, ein ganz persönlicher Blick auf dieses «gülderne Zeitalter» nach dem Bürgerkrieg mit jener kollektiven Befindlichkeit trifft, welche unter wachsender Prosperität diese große nationale Katastrophe auszublenden suchte.
In den gespenstischen Vorfällen, um die sowohl seine erste veröffentlichte Geschichtssammlung In the Midst of Life (Tales of Soldiers and Civilians) wie auch die unter dem Titel Can Such Things Be? versammelten Erzählungen kreisen, lassen sich – liest man sie gegen den Strich – Rückschlüsse auf das kollektive Imaginäre einer Zeit schließen, die wir heute als stille Vorbereitung auf den ersten Weltkrieg, welcher 1914 in Europa ausbrach, begreifen. Für das Selbstverständnis der amerikanischen Nation bahnte sich um diese Jahrhundertwende geistig etwas an, was zugleich das noch nicht abgeschlossene Kapitel des Kampfes um deren Wiedervereinigung mit neuer Kraft belebte.
Denn an der Redewendung «seinen Geist aufgeben» wird jener zweite Bedeutungsstrang ersichtlich, der das Gespenst als Verkörperung eines ruhelosen Geistes begreift. Der Tod stellt den Augenblick im Leben des Menschen dar, in dem der Geist zusammen mit der Seele den Körper verlässt und in einen rein immateriellen Zustand übergeht, während der Leib langsam verwest und sich in Staub auflöst. Die Trennung zwischen der sterblichen physischen Existenz und den unsterblichen geistigen Fähigkeiten des Menschen hat von jeher einen Glauben daran genährt, dass in der Gestalt eines Gespenstes die abgeschiedene Seele einer verstorbenen Person zu den Überlebenden zurückkehren kann. Der Geist als Wiedergänger macht die Trennung zwischen Leben und Tod rückgängig, verflüssigt den Gegensatz zwischen irdischer und überirdischer Erscheinung. Erfährt in der Form eines ästhetischen Gebildes wie den Kurzgeschichten Ambrose Bierce’ der Geist einer Epoche sein Nachleben, flackert dort auch das geisterhafte Überleben der Vergangenheit in der Gegenwart auf. Die Phantome, die dort zuhauf erscheinen, fungieren als Verkörperung jener aus dem Bereich des Todes zurückgekehrten Verstorbenen, die mit ihrer Erscheinung in ihrer Nachwelt einzugreifen suchen: als Verlockung und als Mahnung.
Der Geist als Grundprinzip des Lebens ist auch jene Eigenschaft des Menschen, welche ihn nach dem Tod in der Welt der Überlebenden weiter wirken lässt. Als dessen Verkörperung macht das Gespenst die unsaubere Schnittfläche zwischen belebten und unbelebten Körpern sichtbar; zwischen singulärer Person und ihrer Verdoppelung, zwischen Ableben und Auferstehen. Weder Mensch noch kein Mensch, verunsichert das Gespenst im Kern den Begriff des Menschseins und verkörpert somit jenes Unheimliche, von dem Sigmund Freud in seinem für die Literaturkritik zentralen Aufsatz behauptet, dieser Begriff würde sich in seiner Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickeln, bis er endlich mit seinem Gegensatz zusammenfällt. Als Wesen, welches zwar nicht lebendig, zugleich aber auch nicht unzweideutig tot ist, stört das Gespenst jedoch nicht nur die Unterscheidung zwischen den Lebenden und den Toten. Indem es, vor allem in der Literatur, als Inbegriff des Unheimlichen erscheint, lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf ein der irdischen Existenz im Wesen eingeschriebenes Paradox: Jede Vorstellung dessen, was der Mensch als geistiges und physisches Wesen ist, nährt sich von einem vorgängigen Nichtsein, aus dem und in Abgrenzung zu dem der Mensch seine Bedeutung bezieht. Wir sind in der Welt nur für begrenzte Zeit, können die Heimat wie den Körper nur für eine bestimmte, endliche Zeit bewohnen.
Gespenster, die in den Spukgeschichten Ambrose Bierce’ zurückkehren, um die Aufmerksamkeit der Lebenden auf noch offene Geschäfte zu lenken, welche die Überlebenden zu verleugnen oder verdrängen suchen – sei es ein zurückliegender Mord oder die kollektiven Toten eines öffentlich ausgetragenen Widerstreits – machen die Narben vergangener Wunden wieder spürbar. Noch pointierter formuliert: Indem sie die Lebenden heimsuchen, machen diese Gespenster das Heim wörtlich unheimlich. Sie beunruhigen jede Vorstellung einer sicheren Beheimatung in der Welt. Wollen sie nicht aufgrund ihres gewaltsamen Todes in ihren Gräbern ruhen, sind sie zugleich als Verkörperung eines klandestinen Wissens zu verstehen, welches zu den Lesern der güldenen Zeit Amerikas ebenso wie zu uns heute zurückzukehren drängt. Heimsuchung heißt auch, etwas sucht ein Heim. Indem also das Gespenst die Grenze zwischen Leben und Tod offenhält, fungiert es als Mahnzeichen jener Sterblichkeit, welche dem irdischen Leben unweigerlich eingeschrieben ist. Indem es zudem die Grenze zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart offen hält, dient es als Zeichen dafür, das man den Konsequenzen der eigenen Taten nicht entkommen kann, ob als einzelne Person oder als Nation. Schulden müssen beglichen, Schuld auf sich genommen werden.
Zugleich wird das Gespenst seit Shakespeares Sommernachtstraum aber auch zur Denkfigur eines poetischen Prinzips gesetzt. Erinnern wir uns: In seiner berühmten Rede setzt der Fürst Theseus, der den merkwürdigen Geschehnissen im nächtlichen Zauberwald, von denen die Liebenden nach ihrem Aufwachen berichten, wenig Verständnis entgegenbringen will, den Dichter mit dem Träumer und dem Wahnsinnigen gleich. Zwar sind alle drei Figuren Geisterseher, jedoch dem Dichter gelingt es, dem luftigen Nichts einer trügreichen Vision dank seiner Feder einen spezifischen Ort und einen Namen zuzuweisen. In poetische Sprache übersetzt und auf dem Papier in Buchstaben festgehalten erhält jede gespenstische Heimsuchung eine Wohnstätte, von der aus sie zukünftige Leser von neuem aufsuchen und in ihren geisterhaften Bann ziehen kann. Als materielle Verschriftung eines Hirngespinstes verunsichern die literarischen Gespenster jener Schauerliteratur, in dessen Erbe Ambrose Bierce steht, somit noch einen weiteren Gegensatz, nämlich den zwischen Grauen und Faszination. Als Trugbild stellt das Gespenst des Aberglaubens wie der Literatur eine unwiderstehliche Verlockung dar.
*
In seinem «Wörterbuch des Teufels» nennt Ambrose Bierce das Gespenst ein «äußeres, sichtbares Zeichen einer inneren Furcht». Welche persönlichen Geister, lässt sich deshalb fragen, erhalten in seinen Spukgeschichten ein eigenes Heim und einen Namen? In der Welt von Meigs County Ohio, in die er am 24. Juni 1842 hinein geboren wurde, fühlte er sich jedenfalls nie zuhause. Mit der Ausnahme einer seiner Brüder soll dieser jüngste von zehn Kindern eines exzentrischen Bauern seine ganze Familie gehasst haben. Dennoch hat Ambrose Bierce später zugegeben, alles was er besitze, schulde er der großartigen Bibliothek seines Vaters Marcus Aurelius Bierce. Als Fünfzehnjähriger beginnt er seine Wanderjahre, arbeitet zuerst als Setzerlehrling bei der abolistischen Zeitung «The Northern Indianan» in Warsaw, Indiana.
Zwei Jahre später wird er, unter der Obhut seines Onkels, Kadett am Kentucky Military Institute in Franklin Springs. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges am 12. April 1861 schließt er sich sofort der Union Army an und kämpft wacker in diversen Schlachten gegen die konföderierten Truppen, wird mehrfach verwundet und für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Im Januar 1865 tritt er aus Gesundheitsgründen noch vor Kriegsende vom Militärdienst zurück. Eine Weile arbeitete er für das Finanzministerium, anschließend als Landvermesser bei Expeditionen durch Indianerterritorien im Westen und kommt schließlich, zehn Jahre nachdem er seine unliebsame Familie verlassen hatte, in San Francisco an.
Dort beginnt jene Karriere als Journalist und Autor, die er den Rest seines Lebens ausführen wird. In London, wo er für einige Jahre mit seiner Gattin Mary Ellen Day lebt, erhält er für seine bösartigen Kolumnen den Spitznamen «Bitter Bierce».
Nach San Francisco zurückgekehrt arbeitet er als Journalist und Mitherausgeber für Zeitschriften wie «The Argonaut», «The Wasp», «The Wave», wechselt dann 1887 zum Mitarbeiterstab von William Randolph Hearsts «San Francisco Examiner», wo auch viele seiner Spukgeschichten veröffentlicht werden. Jene diffuse innere Furcht, auf die er mit seinen Gespenstergeschichten unermüdlich den Blick des Lesers richtet, könnte man auf die Enttäuschung zurückführen, dass auch nach dem Verlassen seiner Familie ein häusliches Glück ausbleibt: Sein ältester Sohn wird in einer Bar-Schlägerei erschossen, seine Frau verlässt ihn nach langem Ehestreit, sein jüngerer Sohn stirbt an Alkoholismus.
Die erste veröffentliche Sammlung, Tales of Soldiers and Civilians (1891), lässt jedoch mutmaßen, dass es vornehmlich seine Kriegserlebnisse sind, welche so anhaltend seine Faszination für das Geisterhafte genährt haben.
Wird im ersten Teil dieser Sammlung der Bürgerkrieg, die Barbarei, die dieser entfesselte, sowie die aus ihr resultierende Zerstörung der Lebenswelt aller Betroffener als unheimliche Verflüssigung der Grenze zwischen den Toten und den Überlebenden ins Blickfeld gerückt, bildet der zweite Teil dessen Kehrseite. Den Spukgeschichten, die dort erzählt werden, haften ein implizites Wissen des vergangenen Krieges an, auch wenn die schicksalhaften Ereignisse in der zivilen Nachkriegswelt vermeintlich rein persönlicher Natur sind.
Wie Roy Morris in seiner Biographie von Ambrose Bierce festhält, hat dieser bittere Zyniker die unauslöschlichen Narben der großen nationalen Katastrophe den Rest seines Lebens mit sich herumgetragen. Der Bürgerkrieg ist das Erlebnis, von dem, weil Bierce diese Erinnerung nicht unterdrücken wollte (oder konnte), sein ganzes Schreiben zehrt: eine Erfahrung, auf die es zurückgreift und welche er zugleich auch in die Gegenwart holt. Verblüffend offen bringt er das Gefühl, seit dem Rücktritt aus der Armee ein posthumes Leben geführt zu haben, im Gespräch mit einem Freund auf den Punkt: «Wenn ich mich frage, was aus dem jungen Ambrose Bierce geworden ist, der in Chickamauga gekämpft hat,» meinte er lakonisch, «bin ich geneigt zu antworten, er ist tot. Ein kleiner Rest lebt in meiner Erinnerung fort, aber die übrige Person ist tot und ausgelöscht» (zitiert in Morris S. 9). Und weil Bierce durchaus gerne als Gespenst seiner selbst sowohl lebte als auch schrieb, erlaubte ihm die Heimsuchung durch sein früheres, kriegerisches Ich, in jenen Geschichten, in denen keine direkten Kriegserlebnisse verarbeitet werden, etwas aufflackern zu lassen, was er aus der Schlacht erinnert: Das plötzliche Eintreten fataler Zufälle, die jegliche Stabilität des Ichs hinterfragen und den Schutz der Lebenden gegenüber dem Tod fragwürdig erscheinen lassen. Ist dieser im Krieg ubiquitär, so zugleich nicht kalkulierbar. Als Soldat geht man davon aus, dass der Tod jeden überall treffen kann, doch sind es oft unerwartete Dinge, die ihn zuschlagen lassen.
Nachträglich trösten die Überlebenden sich mit der Phrase «Wäre er oder sie doch nur …» Die Macht des Todes, der in Kriegszonen besonders sichtbar regiert, lässt sich, zu einer Geschichte unglaubwürdiger Zufälle verarbeitet, ertragen, weil ihm somit eine scheinbar logische Notwendigkeit zugewiesen wird, deren Gesetz sich der menschlichen Vernunft entzieht. Im Gegenzug gehört es zum Prinzip der Schauerliteratur, dass niemand seiner Vergangenheit entkommen kann, selbst wenn es einem gelingt, diese für eine gewisse Zeit zu verdrängen. Wie die Furien der Antike lassen die Geister derer, die man auf dem Gewissen hat, einen nicht los. Die Verschränkung von Spuk und Krieg, von der sich Bierce’ Œuvre so hartnäckig und ergiebig speist, versteht sich als Warnung, dass vergangene Kriegsgräuel der Welt des Friedens ebenso nachstellen wie jegliche jugendlichen Sünden. Früher oder später muss jeder sich den Konsequenzen seiner Handlungen stellen, und sei es auch nur, indem man diese im Sinne einer Beichte als Gespenstergeschichte erzählt. Weil dort der Tod plötzlich und zugleich von einer höheren gespenstischen Gewalt gesteuert eintrifft, sind Schauergeschichten sowohl furchterregend als auch anziehend. Wenn man gegen die Gespenster, die einen heimsuchen, nichts ausrichten kann, so muss man die Botschaft, die sie überbringen, einfach annehmen.
Für den Künstler Bierce hat es zudem etwas Entlastendes, die eigene Biographie als Spukgeschichte zu fassen. Von sich zu behaupten, im Krieg sein früheres Ich verloren zu haben, erlaubt ihm, sich der Öffentlichkeit gegenüber als romantische Künstlerfigur zu präsentieren. Jene grundsätzliche Entfremdung von der Welt, welche ihn seit seiner Kindheit begleitet, erhält in der Kriegserfahrung eine existentielle Steigerung, auf die er sich anschließend in seiner Tätigkeit als zynischer Geist mit makabrem Witz immer wieder berufen konnte. Seit jeher beflügelt es die Einbildungskraft kritischer Dichter, nicht im gewöhnlichen Alltag sondern der Welt der eigenen Schöpfungen beheimatet zu sein. Dafür ist eine geisterhafte Existenz in der Gegenwart ein angemessener Preis.
Am Schluss hat diese Obsession mit dem Gespenstischen Ambrose Bierce wörtlich eingeholt. Am eigenen Leib vollzieht er jenen Akt eines mysteriösen Verschwindens, den er bereits vorher mehrmals in seinen Spukgeschichten beschrieben hatte. 1913 besucht er die berühmten Schlachtfelder des Bürgerkrieges – Chattanooga, Chickamauga, Nashville, Franklin und Shiloh – alles Orte, wo er selber ein knappes halbes Jahrhundert vorher gekämpft hatte. Dann erzählt er einem Reporter in New Orleans: «Ich bin auf dem Weg nach Mexiko, weil ich die Show mag. Ich mag das Kämpfen, ich will es sehen», und fügt diesem Vorsatz andeutungsreich hinzu: «So viele Dinge könnten zwischen heute und wenn ich zurück komme passieren.»
Aus Chihuahua schreibt er am 26. Dezember einen letzten Brief, der mit dem verheißungsvollen Satz endet: «Ich breche von hier morgen für eine unbekannte Destination auf» (zitiert in Joshi; 850). In der Wildnis Mexikos, jenem Land, welches seit sieben Jahren in einen eigenen Bürgerkrieg verwickelt ist, taucht Ambrose Bierce unter und stirbt dort vermutlich im Jahr 1914. Die Spukgeschichten, die von ihm zurückgeblieben sind, lesen sich als Seismogramme einer Welt zwischen den Kriegen, dessen geisterhafte Berichte gewesene mit einer noch zu kommenden, gewaltsamen Erschütterung der amerikanischen Nation aufzuzeichnen suchen.
*
Die Erzählformel, die Ambrose Bierce immer wieder zum Einsatz bringt, um in seinen Spukgeschichten eine breite Palette an inneren Ängsten auszuschmücken, operiert konsequent mit einer Verschränkung der Zeiten. Die Schilderung eines mysteriösen Geschehens in der Gegenwart wird abgelöst von einer Hintergrundgeschichte, die erklären soll, wie es zu dieser Situation gekommen ist. An die Ausgangssituation zurückgekehrt, fehlt jedoch weiterhin jene sinnstiftende Auflösung, welche man von der Gattung der Geistergeschichte erwarten darf. Das merkwürdige Ereignis wird weder als Trug entlarvt noch befriedigend aufgeklärt. Ein Rest Unerklärtes hallt nach. In einer seiner Meistererzählungen, «Ein Totenwächter» beispielsweise, betritt ein Mann nachts den Raum im Obergeschoß eines leerstehenden Hauses, in dem der Leichnam eines anderen Mannes unter einem Laken aufgebahrt liegt. Zuerst setzt er sich gelassen neben die Leiche und beginnt bei Kerzenlicht zu lesen, bläst dann aber, um seine Lichtquelle zu schonen, die Kerze aus. Sein Vorhaben ist es, im Wechselspiel zwischen einer Erleuchtung und einer Abdunkelung des Zimmers diese Nacht zu verbringen. Zugleich merkt er, dass die Kerze schneller abbrennt, als er gehofft hat.
Ein Schnitt im Erzählfluss, die Montagetechnik des Kinos vorwegnehmend, führt uns in die Vergangenheit zurück, genauer in eine Arztpraxis in San Francisco, wo drei Männer gemeinsam Punsch trinken und eine Wette beschließen. Es gilt zu beweisen, dass kein Mensch von der Furcht, mit der die Lebenden die Toten betrachten, frei sei. Das Experiment, das diese drei Ärzte sich ausdenken, erweist sich als jenes, welches am Anfang der Geschichte bereits geschildert worden ist: Ein Mann soll die ganze Nacht mit einem Leichnam in einem dunklen Raum in einem leeren Haus eingesperrt verbringen, ohne Betttücher, die er sich über den Kopf ziehen kann. Die Frage, ob er verrückt wird oder nicht, entscheidet den Sieger.
Harper nimmt die Herausforderung Helbersons an und nennt einen Bekannten aus New York, Mr. Jarette, dem er dieses Abenteuer zutraut. Doch es schleicht sich ein fataler Zufall in den Ablauf der Ereignisse. Sie brauchen eine Leiche, und weil der dritte im Bund, Mancher, sich an der Wette aus finanziellen Gründen nicht beteiligen kann, stellt er sich selber zum Einsatz. Er ist bereit, die Leiche zu spielen, hat er doch gehört, dass der Proband ihm wie ein Zwillingsbruder ähnelt.
Nun scheinen wir die Situation im nächtlichen Zimmer, zu der die Erzählung im dritten Abschnitt abermals zurückkehrt, zu verstehen. Wir können sogar schmunzeln über den jungen Mann, der sich – entschieden unzufrieden in seiner dunklen Umgebung – jene Furcht, welche ihn langsam überfällt, auszureden sucht. Wir wissen: Selbst wenn wir abergläubisch genug wären, um an die Macht der Toten zu glauben, ihm kann nichts passieren. Die Leiche auf dem Tisch ist keine. Noch schützt uns eine ironische Distanz beim Lesen des Satzes: «Deutlich, unmissverständlich hörte Mr. Jarette hinter sich das leichte, leise Geräusch von Fußschritten, bedächtig, regelmäßig, immer näher!» Dann sind auch wir im Dunkeln gehalten, weil die Erzählung den weiteren Verlauf des nächtlichen Abenteuers auslässt und stattdessen den fatalen Ausgang der Wette ins Blickfeld rückt.
Kurz vor Sonnenuntergang gehen Harper und Helberson zum Tatort, finden dort eine aufgebrachte Menschenmenge vor, einen zu Tode erschreckten Mann, der, scheinbar ohne sie zu sehen, an ihnen vorbei auf die Straße rennt und verschwindet, und einen wirklichen Toten auf dem Tisch. Im Glauben, dass Jarette ihren Freund getötet hätte, reisen die beiden Ärzte noch an diesem Tag nach Europa. Für die bierce’sche Erzählformel entscheidend ist jedoch die unheimliche Pointe, welche erst im Sinne eines Epilogs ganz am Schluss gesetzt wird und dabei mehr offen lässt als erklärt. Sieben Jahre lang müssen die beiden Männer mit dem schlechten Gewissen leben, am Tod ihres Freundes Mancher mitschuldig gewesen zu sein, auch wenn sie in jener fatalen Nacht selber nicht am Tatort waren. Sie haben schon längst ihren Beruf gewechselt und arbeiten jetzt als Spieler in New York City. Dann nimmt ihre innere Furcht plötzlich eine sichtbare Gestalt an. Aus dem Mund desjenigen, der die verrückte Wette überlebt hat, erfahren sie eines Nachmittags im Central Park, was wirklich in jener Nacht passiert ist.
Wie die beiden Spieler hatten auch wir vergessen, dass der Totenwächter und die Leiche sich zum verwechseln ähnlich sahen. Dr. Mancher hat seitdem eine gespenstische Existenz geführt, manchmal sogar den Namen des Verstorbenen angenommen. Im Schlachtfeld des dunklen Zimmers hat er – seinem Autor gleich – sein früheres Ich jedenfalls verloren. Es bleibt unserer Vorstellungskraft überlassen, wie wir uns in Gedanken die kuriose Szene ausmalen, in der ein Mann gegen seine Erwartungen an Furcht stirbt und ein anderer jene Wette, an der er sich nicht beteiligen wollte, am eigenen Leib durchstehen muss. Der fatale Zufall dieser Rollenvertauschung erhält zwar eine Erklärung, doch aus dieser narrativen Auflösung bleibt etwas ausgeschlossen, was uns ebenso heimsucht wie der totgeglaubte Freund die beiden Spieler. Wir sind nun angehalten, darüber nachzudenken, was es heißt, dass die gespielte Leiche einen realen Tod, die reale einen Generaloberamtsarzt hervorgebracht hat. Erst an dieser Stelle begreifen wir: Es ging immer auch um die Wette, wie man eine Gespenstergeschichte erzählt.
*
Ein Jahr nachdem der erste Weltkrieg in Europa ausgebrochen ist, schreibt Freud seine zeitgemäßen Bemerkungen über den veränderten Umgang mit dem Tod, der mit dieser globalen Katastrophe einher ging, und schlägt seinerseits eine aufschlussreiche Brücke zwischen dem Krieg und der Schauerliteratur.
«Die Neigung, den Tod aus der Lebensrechnung auszuschließen, hat so viele andere Verzichte und Ausschließungen im Gefolge,» erklärt er, dass wir in der Welt der Literatur für die Einbuße des Lebens Ersatz suchen: «Dort finden wir noch Menschen, die zu sterben verstehen, ja, die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten.»
Der Krieg wiederum fegt die konventionelle Behandlung des Todes zu Friedenszeiten hinweg. Die Menschen sterben wirklich, und obgleich ein Zufall mit im Spiel ist, so macht die Häufung der Todesfälle dem Eindruck des Zufälligen ein Ende. Dennoch schließt Freud seine Bemerkungen mit einer erstaunlichen Erkenntnis: «Das Leben ist freilich wieder interessant geworden, es hat seinen vollen Inhalt wieder bekommen.» Denn was die Welt des Krieges und die Welt der Fiktion gemein haben, ist eine bezeichnende Gefühlsambivalenz gegenüber dem Tod. So sehr man gezwungen ist, diesen für die Anderen anzuerkennen, so sehr verleugnet man ihn für sich selber. Die Welt des Krieges zwingt uns, laut Freud, wieder Helden zu sein, die an den eigenen Tod nicht glauben, und schlägt dabei eine Brücke zur Welt der Literatur. Dort nämlich sterben wir auch «in der Identifizierung mit dem einen Helden, überleben ihn aber doch und sind bereit, ebenso unbeschädigt ein zweites Mal mit einem anderen Helden zu sterben» (322).
Jene im Krieg gewonnene Haltung, die besagt, dass man sich auf den Tod einrichten müsse, weil dieser auch zu Friedenszeiten nicht abgeleugnet werden dürfe, um dem Leben seinen vollen Inhalt zurückzugeben, wohnt allen Spukgeschichten von Ambrose Bierce inne. Die nächtliche Szene entspricht der hypnotischen Suggestion, der Gedankenübertragung und dem Geistersehen, an welche seine Figuren glauben, ebenso wie der Rache und der Vergeltung, welche die Toten an den Lebenden verüben.
Dabei ergibt sich eine für die literarische Beschäftigung mit dem Unheimlichen bezeichnende Ambivalenz, welche, wie Freud feststellt, für viele Menschen mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Verstorbenen in Erscheinung tritt. Einerseits wird unzweideutig in Erzählungen, die um unheimliche Geschehnisse kreisen, die Allmacht des Todes anerkannt, erweist dieser sich doch als Ausgangs- und Endpunkt aller Spukgeschichten. Andererseits weist das Erscheinen von Gespenstern darauf hin, dass das Überschreiten der Grenze zwischen Leben und Tod reversibel ist. Die Toten finden ein zweites Leben, sind bereit, ein weiteres Mal zusammen mit denjenigen, die sie sich heimzusuchen entschlossen haben, zu sterben. Im Herzen des Unheimlichen ergibt sich somit eine Wechselbeziehung zwischen Angst (weil es gegen den Tod keine Wehr gibt) und Wunsch (weil dieser im Spuk rückgängig gemacht werden kann).
Dabei nimmt Ambrose Bierce die Behauptung Freuds vorweg, dass ein unheimliches Gefühl des Grauens vor allem dann hervorgerufen wird, «wenn eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob etwas belebt oder leblos sei und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt» (245). Die Erzählung «Moxons Herr» wirft bereits mit ihrem Titel diese Unsicherheit auf. Denn der Herr, von dem die Rede ist, entpuppt sich als jener von Moxon hergestellte Automat, mit dem dieser Erfinder eines nachts Schach spielt. Dem Erzähler hatte er gestanden, diese Maschine könne in Wut geraten und grob werden. Offen bleibt bis zum Schluss, ob der Erzähler wirklich Zeuge einer Szene war, in der das leblose Gerät die Ähnlichkeit mit dem Lebenden so weit treibt, dass es aus Wut die Hände um die Kehle seines Erfinders schließt, oder ob der Erzähler deshalb bewusstlos zu Boden gefallen ist, weil das Haus, vom Blitz getroffen, um ihn herum Feuer gefangen hatte. Es könnte durchaus der Fall sein, dass seine überhitzte Fantasie ihn sich diese schreckliche Szene hat einbilden lassen. Viele Jahre später, gesteht er im letzten Satz der Geschichte, ist er weniger überzeugt davon, er hätte dieses Duell wirklich miterlebt.
Auch die Geschichte «Der Mann und die Schlange» lotet die unsaubere Schnittfläche zwischen dem Belebten und dem Unbelebten aus. Hier treffen wir auf einen Mann, der, zu Gast bei einem Schlangenforscher, beim Lesen einer Passage in einem Buch über die Wunder der Wissenschaft, in der die magnetische Kraft des Schlangenblickes heraufbeschworen wird, seinen Blick träumerisch schweifen lässt. Unter seinem Bett erblickt er plötzlich zwei kleine Lichtpunkte und entdeckt unter der Rahmenkante die Windungen einer großen Schlange. So ergriffen ist er von dem Umstand, seine Gedanken hätten plötzlich Gestalt angenommen, dass er dessen Augen eine ominöse, bösartige Bedeutsamkeit zuspricht und einer tödlichen Autosuggestion verfällt.
Wir aber erschrecken erst über den Griff des Gastgebers unters Bett, der neben der Leiche seines Gastes stehend lakonisch fragt: «Wie ist dieses Ding hier hineingekommen?» Eine ausgestopfte Schlange hat tatsächlich die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit getrieben. Nicht jedoch sie hat hypnotische Kräfte (wie der vulgäre Aberglauben behauptet), sondern die Passage in dem Buch, welche den unglücklichen Leser zum magischen Denken angeregt hat, noch bevor er seinen Blick unter das Bett warf. Auch in diesem Fall lässt die Auflösung des Spuks am Ende der Geschichte offen, ob diese fatale Überschätzung der eigenen Vorstellungskraft mehr als nur einen unglücklichen Zufall darstellt. Was die Auflösung allerdings unzweideutig bekräftigt, ist die Macht einer auf die Wirkungskraft einer überhitzten Fantasie setzenden literarischen Gattung: der Schauergeschichte.
*
Erscheint vielen Leute, wie Freud festhält, im allerhöchsten Grade unheimlich, was mit Geistern und Gespenstern zusammenhängt, stellt er zugleich fest, «dass manche moderne Sprachen unseren Ausdruck ‹ein unheimliches Haus› gar nicht anders wiedergeben können als durch die Umschreibung ‹ein Haus, in dem es spukt›» (255). Bei Ambrose Bierce findet sich tatsächlich nur der Begriff haunted houses. An dieser sprachlichen Eigenart lässt sich zugleich die für seine Spukgeschichten maßgebende Verschränkung einer nationalen mit einer persönlichen Wiederkehr der Toten festmachen. Erinnern wir uns: In seiner in Springfield, Illinois, am 16. Juni 1858 gehaltenen Rede prägt Abraham Lincoln jene Denkfigur, die, als er später Präsident der Vereinigten Staaten wurde, den Bürgerkrieg begründen sollte: «A house divided against itself cannot stand» (ein in sich gespaltenes Haus kann nicht aufrecht stehen). Meinte Lincoln damit die Spaltung zwischen Sklaverei und Freiheit, stellt Ambrose Bierce sich für das Amerika nach Kriegsende eine andere Spaltung der als Haus verstandenen Nation vor. Die Häuser, die bei ihm von Verstorbenen heimgesucht werden und diese gegen die Lebenden in Stellung bringen, sind öffentliche Schauplätze. An solch einem kehrt in «Eine Kruke Sirup» Silas Deemer, der am 18. Juli 1863 gestorben war, aus seinem Grab zurück.
Mit kleinen Details lässt der Erzähler, der aus der Distanz von dreißig Jahren über diese «ungerechtfertigte» Wiederkehr eines Toten berichtet, den Krieg im Hintergrund aufflackern. Bereits im zweiten Absatz erklärt er nämlich, Silas Deemer sei «das gewesen, was man in Teilen der Union (die zugegebenermaßen ein freies Land ist) als ‹Krämer› bezeichnet». Um dessen innige Vermählung mit seinem Geschäft deutlich zu machen, erfahren wir ebenfalls, Silas habe «niemals irgendwoanders geschlafen als auf einem Feldbett hinter der Ladentheke», während Mrs. Deemer und die beiden erwachsenen Töchter die oberen Räume des Gebäudes belegten. An diese Wirkungsstätte kehrt er auch innert eines Monats nach seinem Ableben zurück. Dort verkauft er an einem ersprießlichen Sommerabend dem Bankier Alvan Creede einen Krug Ahornsirup. Dessen Gattin meint anfangs noch, er sei das Opfer einer Illusion, die sich leicht darauf zurückführen ließe, dass er zu schwer in der Bank arbeite. Am Abend jedoch spielt sich in Hillbrook, zwei Jahre nach Kriegsausbruch, ein kollektiver Wahn ab. Die Dorfbewohner haben sich vor dem Fenster des Krämerladens versammelt. Von dort aus blicken sie – wie auf eine große Kinoleinwand – auf das hell erleuchtete Ladeninnere, wo an seinem Pult hinter der Theke Silas Deemer, mit einem Geschäftsbuch befasst, deutlich zu sehen ist. Der Tote – darin liegt die implizite Botschaft der Geschichte – will sicherstellen, dass alle noch offenen Rechnungen beglichen worden sind.
Zugleich hat dieser Spuk eine wundersame Wirkung. Der Wiedergänger zieht die Schaulustigen an sich heran, macht seine persönliche Front zur Bühne eines kriegerischen Re-Enactments. Bald lösen sich die Ersten aus der Menge vor dem Laden und überschreiten die Schwelle, wodurch sich ein merkwürdiges Doppelbild ergibt. Der Geist des Verstorbenen steht weiterhin gelassen über seine Bücher gebückt, die Eindringlinge hingegen tappen sichtlich im Dunkeln. Sie kollidieren mit den Gegenständen im Raum und finden nicht zurück. Dennoch zieht es die ganze Masse ins Innere des unheimlichen Hauses, auch wenn keiner später genau erklären kann, welcher Impuls ihn bewegte, über den Eingang zu stürmen. Die Grenze zwischen Zuschauer und Spieler löst sich auf: «Durch subtile spirituelle oder physische Alchimie war Beobachtung zur Handlang verwandelt worden – die Gaffer nahmen jetzt am Schauspiel teil – das Publikum hatte die Bühne besetzt.»
Bei dieser makabren Beschreibung jenes Furors, der aus neugierigen Betrachtern Mitspieler in einem Spektakel macht, in dem sie – einer karnevalesken Darbietung einer Schlacht vergleichbar – unter Fluchen auf einem abgegrenzten Feld wild miteinander zusammenprallen, bleibt ein böser Kommentar über die wirtschaftliche Kehrseite des Krieges von Seiten des bitteren Bierce nicht aus.
Der Bankier, der als einziger mit dem gespenstischen Krämer leiblich in Kontrakt treten konnte, hält zu diesem wilden Treiben seine Distanz. Er allein verharrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite als Zuschauer und wird somit auch der einzige Zeuge einer unglaubwürdigen Doppelvision. Ganz deutlich sieht er die seltsamen Dinge, die sich in dem nur für ihn hell erleuchteten Laden abspielen. Für diejenigen, die sich auf den Spuk unmittelbar eingelassen haben, ist alles pechschwarz: «Es war, als ob jeder einzelne, sowie er durch die Tür hineingeschoben wurde, von Blindheit befallen und durch das Missgeschick rasend gemacht würde. Ziellos und fahrig tasteten sie umher, suchten mit Gewalt einen Weg hinaus gegen die Stürmung, schubsten und rempelten, schlugen auf gut Glück um sich, stürzten und wurden betrampelt, standen auf und trampelten ihrerseits. Sie packten einander an den Kleidern, am Haar, am Bart – sie kämpften wie Tiere, fluchten, schrien, belegten einander mit infamen und obszönen Namen. Als Alvin Creede schließlich den letzten der Reihe in diesen furchtbaren Tumult hatte schreiten sehen, erlosch jählings das Licht, das ihn erhellt hatte, und für ihn war alles ebenso finster wie für die im Laden.» Dem Zuschauer, der mit seinem Kauf den ganzen Spuk in Gang gesetzt hat, bleibt nichts anderes übrig, als sich abzuwenden und diesen unheimlichen Ort schnell zu verlassen. Eine ernüchterndere Beschreibung davon, wie viele Jahre später der Furor des Krieges im kollektiven Bewusstsein nachklingt, kann man sich wiederum kaum vorstellen.
Zugleich spielt diese merkwürdige Szene, in der dem Zuschauer die privilegierte Position eingeräumt wird, auf eine letzte Eigenschaft des Unheimlichen an. Dieses tritt laut Freud immer dann in Erscheinung, «wenn die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt wird, wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher für phantastisch gehalten haben» (258). Neben den Kindern und den Neurotikern neigen vor allem Leser von Spukgeschichten dazu, sich einem magischen Denken hinzugeben, welches im Vergleich zur materiellen die psychische Realität überbetont. So sehr also Bierce’ Gespenstererzählungen den anhaltenden Spuk des Krieges kommentieren, so sehr bieten sie auch eine Reflexion über die emotionale Wirkungskraft der eigenen Gattung. Wenn «Gespenster sehen» sowohl bedeutet, unbegründet Angst zu haben, als auch Dinge zu sehen, die gar nicht da sind, so trifft beides für das Lesen von Schauerliteratur zu. Dort bangen wir unbegründet um das Schicksal einzelner Figuren, sind sie doch nur eine fiktive Instanz. Doch tun wir dies, weil wir beim Lesen davon überzeugt sind, Stimmen zu hören und Gestalten zu sehen, die lediglich als Buchstaben auf dem Papier vor unseren Augen erscheinen. In unserer Vorstellung haben sie die Grenze in die Wirklichkeit passiert, zumindest für die Dauer der Lektüre.
So sind auch wir als Lesende in einer gespenstischen Doppelexistenz gefangen, auf der Schwelle zwischen unserer leiblich erfahrenen Gegenwart und der geistigen Welt, die sich vor unserem inneren Auge wirkungsmächtig auftut. Wie die vielen neurotischen Gestalten in Bierce’ Erzählungen, die, empfänglich für Täuschungen und Halluzinationen, sich von unlauteren Magiern in den Zustand der Hypnose versetzen und sich von ihnen sagen lassen, was sie sehen und hören sollen, so hält auch uns die suggestive Stimme des Erzählers in Bann. Erweist sich somit die Schauerliteratur als Ausdruck des Unheimlichen par excellence, dann deshalb, weil man nie sicher sein kann, ob die Verwischung der Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit nicht doch Auswirkungen auf den gewöhnlichen Alltag haben könnte.
Auch die Erzählung «Die angemessene Umgebung» kreist um eine Wette und folgt der für Bierce typischen Formel einer Mehrzeitigkeit. Zuerst wird uns eine nächtliche Szene vor Augen geführt. In einer Sommernacht geht ein Farmersjunge an einem Haus vorbei, von dem man munkelt, es würde dort spuken. Durch das Fenster erblickt er eine Szene, die zwar Grauen bei ihm auslöst, aber nicht ohne eine Faszination auf ihn auszuüben. Mitten im Raum sitzt regungslos ein Mann an einem Tisch, auf dem einige lose Blätter Papier liegen, und scheint über die Lektüre verstorben zu sein. Der schiere Mut des Entsetzens lässt den verblüfften Jungen sich dem Fenster nähern, auf das der Mann starrt. Dieser springt plötzlich auf, vielleicht vom Schrei einer Eule erwacht, vielleicht aber auch vom Anblick des Gesichtes am Fenster. Er hat dabei zusammen mit dem Tisch die Kerze umgestürzt, sodass die Szene sich im Dunkeln verläuft. Von dem jungen Bauern wissen wir, dass er davongerannt ist. Was aus dem Mann geworden ist, erfahren wir erst, nachdem im zweiten Teil der Geschichte als Hintergrund für diese nächtliche Szene das Streitgespräch zwischen einem Autor und seinem Leser dargeboten wird. Verärgert darüber, dass dieser seine neueste Spukgeschichte während einer morgendlichen Fahrt im Tramwagen liest, fordert Colston den Geschäftsmann Willard Marsh zu einer Mutprobe auf. An einem unheimlichen Ort, «in einem verlassenen Haus – allein – im Wald – in der Nacht», so behauptet der exzentrische Schriftsteller, würde ihn die Lektüre des Manuskripts, welches er in der Tasche hat, regelrecht umbringen.
Sein Leser nimmt die Herausforderung an, kann er sich doch nicht vorstellen, dass ein gespenstisches Werk wirklich ein unbehagliches Gefühl von Übernatürlichem zu vermitteln vermag, egal wie schauerlich der Ort ist, an dem er sie genießt. Die Leiche, die der Bauernbursche mit seinen Gefährten am Tag nach dessen nächtlicher Vision in dem einsamen Haus vorfindet, beweist, dass der Schriftsteller seine Wette gewonnen hat. Das Manuskript, welches die Überlebenden neben dem Toten am Boden vorfinden, befriedigt jedoch ebenso wenig als Erklärung wie die Zeitungsnotiz, die von der plötzlichen geistigen Umnachtung des Schriftstellers berichtet. Der geheimnisvolle Kern, um den diese Spukgeschichte über das Lesen einer Spukgeschichte kreist, wird nicht aufgelöst. Wir müssen uns fragen, welche gespenstische Wirkung das plötzliche Erscheinen des Bauernjungen für den nächtlichen Leser hatte. Meinte er, den verstorbenen Besitzer des Hauses, in dem er sich befand, kraft der Suggestion, die von dem Manuskript ausging, vor sich zu sehen? Oder dachte er, es sei der Schriftsteller selber, der aus seinem Grab zurück gekehrt ist, hatte dieser doch in seinem Text verkündet, er würde in dieser Nacht sterben? Nicht allein vom Ort geht eine übernatürliche Wirkung aus. Fatal wird erst das zufällige Hinzukommen einer Gestalt, mit der keiner gerechnet hatte.
Als Inbegriff dessen was Bierce’ Besessenheit mit dem Gespenstischen ausmacht, bietet diese Spukgeschichte keine uns entlastende Sinnstiftung. Sie hält uns stattdessen an, weiter zu spekulieren. Sie bleibt eine merkwürdige Geschichte über die fatalen Konsequenzen, die das Lesen haben kann, wenn die Phantasie es mit ihrer Nachahmung der Wirklichkeit zu weit treibt. Das heißt aber auch, sie ist es würdig, von uns bemerkt zu werden. Beim Lesen ergibt sich ein Sprung im Gewöhnlichen, aus dem die hypnotische Kraft des Geschriebenen auf uns einwirken kann. Für die Dauer der Lektüre treten wir aus unserem Alltag heraus. Uns allerdings bringt dieser Austausch mit dem Phantastischen nicht um. Wir dürfen uns sogar selber beim Verharren in dieser gespenstischen Welt beobachten. Die ironische Distanz, die wir dabei einnehmen, erhöht regelrecht unseren Genuss.
Benutzte Literatur;
Elisabeth Bronfen: Tiefer als der Tag gedacht. Eine Kulturge schichte der Nacht. München: Hanser Verlag 2008.
Sigmund Freud (1915): «Zeitgemässes über Krieg und Tod». Gesammelte Werke X. Frankfurt a. Main: S. Fischer Ver lag 1946; 324-355.
Sigmund Freud (1919): «Das Unheimliche». Gesammelte Werke XII. Frankfurt a. Main: S. Fischer Verlag 1947; 329-268.
S.T. Joshi (Hg.): Ambrose Bierce. The Devil’s Dictionary, Tales, & Memoires. New York: Library of America 2011.
Roy Morris: Ambrose Bierce. Allein in Schlechter Gesellschaft. Zürich: Haffmans Verlag 1999.
Der Mann aus der Nase
Am Schnittpunkt zweier bestimmter Straßen in jenem Teil von San Francisco, der unter dem ziemlich locker verwendeten Namen North Beach bekannt ist, liegt ein leeres Grundstück, das beinahe eben ist – glatter jedenfalls als die Gründe oder Stücke (leer oder anders) in dieser Gegend sonst. Unmittelbar dahinter, nach Süden, steigt der Boden jedoch steil an; drei in den weichen Fels geschnittene Terrassen brechen die Steigung. Ein Ort für Ziegen und Mittellose; mehrere Familien dieser beiden Klassen bewohnen ihn gemeinsam und einträchtig, «seit Gründung der Stadt». Eine der bescheidenen Behausungen auf der untersten Terrasse ist bemerkenswert wegen ihrer groben Ähnlichkeit mit dem menschlichen Gesicht oder eher eines solchen Abbildes davon, wie ein Junge es aus einem ausgehöhlten Kürbis schneiden mag, ohne die Absicht, seine eigene Rasse zu beleidigen. Die Augen sind zwei runde Fenster, die Nase ist eine Tür, der Mund eine Öffnung darunter, entstanden durch das Entfernen eines Brettes. Stufen oder Schwelle gibt es nicht. Als Gesicht ist dieses Haus zu groß; als Behausung zu klein. Das leere, nichtssagende Starren seiner lid- und brauenlosen Augen ist unheimlich.
Manchmal kommt ein Mann aus der Nase, dreht sich, geht dort vorbei, wo das rechte Ohr sein sollte, bahnt sich einen Weg durch das Gedränge von Kindern und Ziegen, die den engen Gang zwischen den Nachbartüren und dem Rand der Terrasse verstopfen, und erreicht die Straße, indem er eine Reihe tanzender Treppenstufen hinabgeht. Hier bleibt er stehen, um seine Uhr zu konsultieren, und der Fremde, der zufällig vorübergeht, wundert sich, dass es einen Menschen wie den da kümmern kann, wie spät es ist. Längerfristige Beobachtung würde erweisen, dass die Frage der Tageszeit ein wichtiges Element in den Bewegungen des Mannes ist, denn er kommt genau um zwei Uhr nachmittags hervor, dreihundertfünfundsechzig Mal in jedem Jahr.
Nachdem er sicher ist, dass er sich nicht in der Zeit vertan hat, steckt er die Uhr wieder ein und geht schnell nach Süden, die Straße hinauf, zwei Blocks weit, biegt nach rechts, und wenn er sich der nächsten Ecke nähert, heftet er seine Augen auf ein Fenster oben in einem dreistöckigen Gebäude auf der anderen Straßenseite. Es ist ein ziemlich schäbiges Bauwerk, ursprünglich aus roten Ziegeln und nun grau. Es zeigt den Zahn von Zeit und Staub. Als Wohnhaus gebaut, ist es nun eine Fabrik. Ich weiß nicht, was dort hergestellt wird; ich nehme an, die Dinge, die gemeinhin in einer Fabrik gemacht werden. Ich weiß nur, dass das Haus um zwei Uhr nachmittags, an jedem Tag außer sonntags, voll von Aktivitäten und Stimmengewirr ist; das Pulsieren irgendeiner großen Maschine erschüttert es, und immer wieder hört man von der Säge gequältes Holz kreischen. In dem Fenster, auf das der Mann seinen gespannt erwartungsvollen Blick richtet, taucht nie etwas auf; tatsächlich ist die Scheibe derart mit Staub überzogen, dass sie schon längst nicht mehr durchsichtig ist. Der Mann blickt hinauf, ohne stehenzubleiben; er dreht lediglich den Kopf immer weiter nach hinten, wenn er das Gebäude hinter sich lässt. Er geht weiter zur nächsten Ecke, biegt nach links, geht um den Block und kommt zurück, bis er die Stelle schräg gegenüber der Fabrik erreicht – einen Punkt auf seinem Hinweg, den er nun zurückgeht, wobei er mehrmals über seine rechte Schulter hinter sich zum Fenster blickt, solange es in Sicht ist. Seit vielen Jahren hat er, soweit bekannt, niemals seine Strecke geändert oder auch nur eine einzige Neuerung in seine Verfahrensweisen eingeführt. Nach einer Viertelstunde ist er wieder am Mund seiner Behausung, und eine Frau, die seit einiger Zeit in der Nase gestanden hat, hilft ihm ins Haus. Dann sieht man ihn nicht mehr, bis um zwei Uhr am nächsten Nachmittag.
Die Frau ist seine Frau. Sie unterhält sich und ihn, indem sie für die Armen wäscht, unter denen sie leben, zu Preisen, die chinesische und heimische Konkurrenz vernichten.
Der Mann ist etwa siebenundfünfzig Jahre alt, sieht aber sehr viel älter aus. Sein Haar ist todesweiß. Er trägt keinen Bart und ist fast immer frisch rasiert. Seine Hände sind sauber, die Nägel gut gepflegt. Von der Kleidung her ist er deutlich besser als seine Lage, wie diese an der Umgebung und an der Tätigkeit seiner Frau abzulesen ist. Er ist wirklich sehr sauber, wenn auch nicht ganz modisch gekleidet. Der Seidenhut stammt allerspätestens aus dem vorletzten Jahr, und seine peinlichst polierten Stiefel entbehren jeglichen Flickwerks. Ich hörte, dass der Anzug, den er bei seinen fünfzehnminütigen täglichen Ausflügen trägt, nicht der gleiche ist, den er zuhause benutzt. Wie alles andere, was er besitzt, wird der Anzug von der Frau beschafft und in Ordnung gehalten, und er wird erneuert, sooft ihre kargen Möglichkeiten dies erlauben.
Vor dreißig Jahren lebten John Hardshaw und seine Frau auf dem Rincon Hill, in einem der besten Häuser dieses einstmals aristokratischen Viertels. Er war Arzt gewesen; da er jedoch von seinem Vater ein beträchtliches Vermögen geerbt hatte, befasste er sich nicht mehr mit den Leiden seiner Mitkreaturen und fand soviel Arbeit, wie er haben wollte, in der Handhabung seiner eigenen Geschäfte. Er und seine Frau waren sehr kultiviert, und ihr Haus wurde von einer kleinen Gruppe solcher Männer und Frauen frequentiert, auf deren Umgang Personen ihres Geschmacks Wert legen mochten. Soweit diese wussten, waren Mr. und Mrs. Hardshaw miteinander glücklich; ganz sicher war die Frau ihrem gutaussehenden und gebildeten Mann ergeben und überaus stolz auf ihn.
Zu ihren Bekannten gehörten die Barwells – Mann, Frau und zwei kleine Kinder – aus Sacramento. Mr. Barwell war Ingenieur und Bergbaufachmann; seine Pflichten führten ihn viel von zuhause fort und oft nach San Francisco. Bei diesen Gelegenheiten begleitete seine Frau ihn gewöhnlich und verbrachte viel Zeit im Haus ihrer Freundin, Mrs. Hardshaw, immer mit ihren beiden Kindern, die Mrs. Hardshaw, die selbst kinderlos war, ans Herz wuchsen. Unglücklicherweise wuchs gleichermaßen ihrem Ehemann deren Mutter ans Herz – noch sehr viel mehr. Noch unglücklichererweise war diese anziehende Dame minder klug denn schwach.
Gegen drei Uhr an einem Herbstmorgen sah der Beamte Nummer 13 der Polizei von Sacramento einen Mann verstohlen den Hintereingang eines herrschaftlichen Hauses verlassen und nahm ihn sofort fest. Der Mann – er trug einen Schlapphut und einen schäbigen Mantel – bot dem Polizisten einhundert, dann fünfhundert, dann tausend Dollar für seine Freilassung. Da er weniger als die erstgenannte Summe bei sich trug, behandelte der Beamte das Angebot mit tugendhafter Verachtung. Bevor sie das Revier erreichten, war der Gefangene bereit, ihm einen Scheck über zehntausend Dollar zu geben und an eine der Weiden des Flussufers angekettet zu warten, bis der Scheck ausbezahlt war. Da dies nur neuen Spott hervorrief, sagte er überhaupt nichts mehr, gab lediglich einen offensichtlich erfundenen Namen an. Als man ihn im Revier untersuchte, fand man nichts Wertvolles bei ihm außer einem Miniatur-Portrait von Mrs. Barwell – der Dame des Hauses, hinter dem er festgenommen worden war. Der Rahmen war mit kostbaren Diamanten besetzt; und etwas in der Qualität der Unterwäsche des Mannes ließ fruchtloses Bedauern durch den streng unbestechlichen Busen des Beamten Nummer 13 schießen. Der Gefangene trug weder in der Kleidung noch am Leibe etwas, durch das man ihn hätte identifizieren können, und er wurde wegen Einbruchs verhaftet, unter dem Namen, den er angegeben hatte, dem ehrenwerten Namen John K. Smith. Das K. war eine Inspiration, auf die er zweifellos sehr stolz war.
In der Zwischenzeit beschäftigte das mysteriöse Verschwinden von John Hardshaw die Klatschmäuler von Rincon Hill in San Francisco; es wurde sogar in einer der Zeitungen erwähnt. Der Dame, die jenes Journal taktvoll als seine «Witwe» beschrieb, kam es nicht in den Sinn, im städtischen Gefängnis von Sacramento nach ihm zu suchen – einer Stadt, die er, soweit bekannt, niemals aufgesucht hatte. Als John K. Smith wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt und, da er auf die Voruntersuchung verzichtete, dem Gericht zum Verfahren überstellt.
Etwa zwei Wochen vor dem Prozess erfuhr Mrs. Hardshaw durch Zufall, dass ihr Mann unter einem angenommenen Namen in Sacramento in Haft gehalten und des Einbruchs bezichtigt wurde; sie wagte niemandem gegenüber die Angelegenheit zu erwähnen, reiste eilends nach Sacramento, begab sich zum Gefängnis und bat um ein Gespräch mit ihrem Gatten, John K. Smith. Abgehärmt und krank vor Besorgnis, in einem schlichten Reiseumhang, der sie von Hals bis Fuß bedeckte und in dem sie auf dem Dampfer, zu besorgt um zu schlafen, die Nacht verbracht hatte, wirkte sie kaum wie das, was sie war, aber ihr Verhalten sprach stärker für sie als alles, was sie zum Beweis ihres Rechts auf Einlass sagen konnte. Man erlaubte ihr, allein mit ihm zu sprechen.
Was während dieses betrüblichen Gesprächs geschah, kam nie ans Licht; spätere Vorgänge beweisen jedoch, dass Hardshaw einen Weg gefunden hatte, ihren Willen dem seinen zu unterwerfen. Sie verließ das Gefängnis als Frau mit gebrochenem Herzen; sie weigerte sich, auch nur eine einzige Frage zu beantworten, kehrte zurück in ihr trostloses Heim und erneuerte halbherzig ihre Nachforschungen nach ihrem verschwundenen Gatten. Eine Woche später war sie selbst verschwunden; sie war «zurück in die Staaten gegangen» – mehr als das wusste niemand.
Bei seinem Verfahren bekannte der Gefangene sich schuldig – «auf Anraten seines Anwalts», wie der Anwalt sagte. Dennoch bestand der Richter, in dem mehrere ungewöhnliche Umstände Zweifel geweckt hatten, auf der Vernehmung des Beamten Nummer 13 durch den Staatsanwalt, und die Einlassung von Mrs. Barwell, die zu krank war, um dem Verfahren beizuwohnen, wurde der Jury verlesen. Sie war sehr kurz. Mrs. Barwell wusste nichts über die Angelegenheit; nur dies: Das Konterfei sei ihr Eigentum, das sie, wie sie glaube, auf dem Tisch im Salon habe liegenlassen, als sie sich in der Nacht der Festnahme zurückzog. Es sei als Geschenk an ihren Gatten gedacht gewesen, der sich in Geschäften für eine Bergbaugesellschaft damals in Europa aufgehalten habe, wo er noch immer sei.
Das Verhalten dieser Zeugin bei Abgabe der Erklärung in ihrem Wohnhaus wurde später vom Staatsanwalt als höchst außerordentlich bezeichnet. Zweimal hatte sie die Aussage verweigert, und einmal, als nur noch ihre Unterschrift fehlte, hatte sie dem Schreiber die Niederschrift abgenommen und in Stücke gerissen. Sie hatte ihre Kinder an ihr Bett gerufen und sie umarmt, mit überströmenden Augen, sie dann plötzlich aus dem Raum geschickt, die Aussage mit Eid und Unterschrift versehen und war ohnmächtig geworden – «einfach so peng», sagte der Staatsanwalt. In diesem Moment erschien ihr Arzt auf der Szene, nahm die Situation mit einem Blick wahr, packte den Vertreter des Gesetzes am Kragen, stieß ihn auf die Straße und schickte seinen Assistenten mit einem Fußtritt hinterher. Die beleidigte Majestät des Gesetzes machte ihr Recht nicht geltend; das Opfer der Kränkung sagte von alledem vor Gericht kein Wort. Er hatte den Ehrgeiz, seinen Fall zu gewinnen, und die Umstände, unter denen diese Aussage zustandegekommen war, hätten ihr kein Gewicht verliehen, wenn man sie erörtert hätte; und letzten Endes hatte der Mann, der vor Gericht stand, ein nur geringfügig weniger abscheuliches Verbrechen wider die Majestät des Gesetzes begangen als der reizbare Arzt.
Auf Vorschlag des Richters befand die Jury den Angeklagten für schuldig; es blieb ihnen nichts anderes übrig, und der Inhaftierte wurde zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein Verteidiger, der gegen nichts Einwände erhoben und nicht um Milde gebeten – tatsächlich kaum ein Wort gesagt – hatte, schüttelte seinem Klienten die Hand und verließ den Raum. Es war für das ganze Gericht offensichtlich, dass der Angeklagte ihn nur verpflichtet hatte, um das Gericht daran zu hindern, ihm einen Verteidiger zu bestimmen, der möglicherweise darauf bestanden hätte, ihn zu verteidigen.
John Hardshaw saß seine Zeit in San Quentin ab, und als er entlassen wurde, wartete am Gefängnistor seine Frau auf ihn, die aus «den Staaten» zurückgekehrt war, um ihn in Empfang zu nehmen. Es wird angenommen, dass sie sofort nach Europa reisten; jedenfalls wurde eine umfassende Vollmacht für einen noch unter uns weilenden Anwalt – von dem ich viele der Tatsachen dieser schlichten Geschichte erfahren habe – in Paris ausgefertigt. Innerhalb kurzer Zeit verkaufte dieser Anwalt alles, was Hardshaw in Kalifornien besaß, und jahrelang hörte man nichts von dem unglücklichen Paar; viele, an deren Ohren vage und ungenaue Andeutungen über ihre seltsame Geschichte gedrungen waren und die sie gekannt hatten, erinnerten sich jedoch an ihre Persönlichkeiten mit Zuneigung und an ihr Missgeschick mit Mitleid.
Einige Jahre später kehrten sie zurück; beide hatten Vermögen und Mut verloren, er die Gesundheit. Es ist mir nicht gelungen festzustellen, zu welchem Zweck sie zurückkehrten. Einige Zeit lebten sie unter dem Namen Johnson in einem noch ganz reputierlichen Viertel südlich der Market Street, ziemlich abgelegen, und man sah sie nie außerhalb der unmittelbaren Umgebung ihrer Wohnung. Sie müssen noch ein wenig Geld übriggehabt haben, denn soweit bekannt ging der Mann keiner Beschäftigung nach, was ihm sein Gesundheitszustand vermutlich auch nicht erlaubt hätte. Die Ergebenheit der Frau ihrem invaliden Gemahl gegenüber war Gesprächsstoff unter ihren Nachbarn; sie schien immer an seiner Seite zu sein und ihn immer zu stützen und aufzumuntern.
Oft saßen sie stundenlang auf einer der Bänke in einem kleinen Park. Sie las ihm vor, seine Hand in der ihren; bisweilen berührte sie mit leichter Hand seine fahle Stirn, ihre Augen, noch immer wunderschön, hoben sich oft vom Buch, um in die seinen zu schauen, wenn sie irgendeine Bemerkung zum Text machte oder den Band schloss, um seine Stimmung durch Reden zu heben – Reden über was? Niemand belauschte je ein Gespräch zwischen den beiden. Der Leser, der die Geduld besessen hat, ihrer Geschichte bis hierhin zu folgen, findet vielleicht Vergnügen an Mutmaßungen; vermutlich gab es einen Grund, Lauscher zu meiden. Die Haltung des Mannes war die tiefster Trübsal; die Jungen der Gegend, ohne jedes Mitgefühl und mit jenem scharfen Gespür für sichtbare Charakteristika, das seit jeher das junge Männchen unserer Spezies auszeichnet, nannten ihn unter sich bisweilen sogar «Spoony Glum».
Eines Tages begab es sich, dass John Hardshaw vom Geist der Unrast besessen war. Gott weiß, was ihn dorthin führte, wohin er dann ging, aber er überquerte die Market Street und ging immer weiter nach Norden, über die Hügel, dann hinab in die Gegend, die als North Beach bekannt ist. Er wandte sich ziellos nach links und folgte seinen Zehen eine unbekannte Straße entlang, bis er sich gegenüber von etwas befand, was in jener Zeit ein ziemlich prächtiges Wohngebäude war und in dieser eine ziemlich schäbige Fabrik ist. Zufällig blickte er auf und sah an einem offenen Fenster, was er besser nicht gesehen hätte – das Gesicht und die Gestalt von Elvira Barwell. Ihre Augen trafen sich. Mit einem hellen Ausruf wie dem Schrei eines erschreckten Vogels sprang die Dame auf und reckte den Körper halb aus dem Fenster, wobei sie sich auf beiden Seiten am Rahmen festklammerte. Durch den Schrei aufmerksam gemacht, blieben die Leute auf der Straße stehen und blickten auf. Hardshaw stand reglos, sprachlos, seine Augen zwei Flammen. «Vorsicht!», schrie jemand in der Menge, als die Frau sich immer weiter und weiter hinausreckte, dem stummen und unerbittlichen Gesetz der Schwerkraft trotzend, wie sie einst jenem anderen Gesetz getrotzt hatte, das Gott donnernd auf dem Sinai erließ. Durch ihre jähen Bewegungen war ein Sturzbach dunkler Haare von den Schultern herabgeströmt und wurde nun um ihre Wangen geweht, verhüllte fast ihr Gesicht. Einen Moment so, und dann –! Ein furchtbarer Schrei hallte die Straße entlang, als sie das Gleichgewicht verlor und kopfüber aus dem Fenster stürzte, eine wirre wirbelnde Masse aus Rücken, Gliedern, Haar und weißem Gesicht, und mit einem grässlichen Laut und einer Wucht, die noch hundert Fuß entfernt zu spüren war, auf das Pflaster schlug. Einen Moment lang versagten alle Augen den Dienst und wandten sich ab von dem schrecklichen Schauspiel auf dem Gehsteig. Wieder zu diesem Grauen hingezogen, sahen sie es seltsam vermehrt. Ein Mann, barhäuptig, der auf den Pflastersteinen saß, presste den zerbrochenen, blutenden Leib an seine Brust, küsste die zerfleischten Wangen und den strömenden Mund durch ein Wirrwarr nassen Haars, seine eigenen Züge unkenntlich und rot von dem Blut, das ihn halb erstickte und in Rinnsalen aus seinem durchtränkten Bart rann.
Die Aufgabe des Berichterstatters ist fast beendet. Die Barwells waren an ebendiesem Morgen nach zweijähriger Abwesenheit aus Peru zurückgekehrt. Eine Woche später hatte sich der Witwer, nun doppelt trostlos, da die Bedeutung von Hardshaws furchtbarer Bekundung nicht misszuverstehen war, nach ich weiß nicht welchem fernen Hafen eingeschifft; er ist nie wieder zurückgekommen. Hardshaw – nun nicht mehr Johnson – verbrachte ein Jahr im Irrenhaus von Stockton, wo dank des Einflusses mitleidiger Freunde auch seine Frau Aufnahme fand, um ihn pflegen zu können. Als er entlassen wurde, nicht geheilt aber harmlos, kehrten sie in die Stadt zurück; sie schien für immer eine furchtbare Faszination auf beide auszuüben. Einige Zeit lebten sie nahe der Mission Dolores, in einer kaum weniger tiefen Armut als der, die heute ihr Los ist; aber das war zu weit entfernt vom Ziel der täglichen Pilgerfahrt des Mannes. Die Fahrt mit einem Wagen konnten sie sich nicht leisten. Also mietete dieser arme Teufel von einem Engel des Himmels – die Frau dieses Sträflings und Irren – zu einem recht anständigen Preis auf der unteren Terrasse von Goat Hill diesen Schuppen mit dem leeren Gesicht. Von dort bis zu dem Gebäude, das ein Wohnhaus war und eine Fabrik ist, ist es nicht so weit; tatsächlich ist es ein angenehmer Spaziergang, dem eifrigen und fröhlichen Gesichtsausdruck des Mannes nach zu urteilen, wenn er ihn antritt. Der Rückweg scheint ein wenig ermüdend zu sein.
Ein Abenteuer in Brownville
Ich war Lehrer an einer kleinen Landschule nahe Brownville, was, wie jeder weiß, der das Glück hatte, dort zu leben, der Hauptort eines beträchtlichen Teils der schönsten Landschaft Kaliforniens ist. Im Sommer wird die Stadt reichlich frequentiert von jener Klasse von Personen, die die Ortszeitung «Vergnügungssuchende» zu nennen pflegt, die man aber gerechter klassifizieren könnte als «von Krankheit und Ungemach Heimgesuchte». Brownville selbst könnte man übrigens ganz treffend beschreiben als Sommerfrische des letzten Auswegs. Der Ort ist recht gut versehen mit Pensionen; in der am wenigsten schädlichen von diesen vollzog ich zweimal täglich (mein Mittagsmahl nahm ich im Schulgebäude ein) den schlichten Ritus zur Festigung der Verbindung von Seele und Körper. Von diesem «Wirtshaus» (wie die örtliche Zeitung es gern nannte, wenn sie nicht gerade von «Karawanserail» sprach) bis zum Schulgebäude betrug die Entfernung via Karrenstraße etwa eineinhalb Meilen; es gab jedoch einen sehr selten benutzten Pfad, der über eine Kette niedriger, dicht bewaldeter Berge führte und den Weg erheblich verkürzte. Auf diesem Pfad kehrte ich eines Abends später zurück als gewöhnlich. Es war der letzte Tag des Schuljahres, und ich hatte mich fast bis zum Dunkelwerden im Schulgebäude aufgehalten, um über meine Amtsführung einen Rechenschaftsbericht für die Kuratoren zu erstellen – von denen zwei, wie ich voller Stolz überlegte, imstande sein würden, ihn zu lesen, und der dritte (ein Beispiel für die Herrschaft des Geistes über die Materie) würde überstimmt werden, in seiner gewöhnlichen Feindseligkeit gegen den von ihm selbst eingesetzten Schulmeister.
Ich hatte das erste Viertel des Wegs zurückgelegt, als mich die Possen einer Familie von Eidechsen fesselten, die dort wohnten und voll reptilischer Freude ob ihrer Immunität gegenüber dem Ungemach zu sein schienen, das dem Leben im Brownville House eigen war; so setzte ich mich auf einen umgestürzten Baum, um sie zu beobachten. Als ich mich müde gegen einen Ast des knorrigen alten Stammes lehnte, vertiefte sich das Zwielicht im düsteren Wald, der schwache junge Mond begann, sichtbare Schatten zu werfen und die Blätter der Bäume mit einem zarten, aber gespenstischen Licht zu versilbern.
Ich hörte den Klang von Stimmen – die einer Frau, verärgert, heftig, erhoben, gegenüber tiefen männlichen Tönen, voll und musikalisch. Ich strengte die Augen an, spähte durch die düsteren Schatten des Waldes, in der Hoffnung, einen Blick auf die Störer meiner Einsamkeit werfen zu können, konnte aber niemanden sehen. In allen Richtungen hatte ich einige Yards freie Sicht auf den Pfad, und da ich von keinem anderen innerhalb einer halben Meile wusste, meinte ich, die Gehörten müßten von der einen Seite aus dem Wald näher kommen.
Es gab kein Geräusch außer dem der Stimmen, die nun so deutlich waren, dass ich die Wörter verstehen konnte. Die des Mannes übermittelte mir einen Eindruck von Zorn, überreichlich bestätigt durch das, was er sagte.
«Ich will nichts von Drohungen hören; du bist machtlos, wie du sehr wohl weißt. Lass die Dinge so, wie sie sind, oder, bei Gott! ihr werdet beide zu leiden haben.»
«Was meinst du?» – dies war die Stimme der Frau, eine kultivierte Stimme, die Stimme einer Dame. «Du willst uns doch nicht – umbringen.»
Es gab keine Antwort, zumindest keine, die ich hätte hören können. Während des Schweigens spähte ich in den Wald hinein, in der Hoffnung, einen Blick auf die Sprecher zu erhaschen, denn ich war sicher, dass dies eine ernste Angelegenheit sei, bei der gewöhnliche Skrupel nicht zu zählen hatten. Mir schien, dass die Frau in Gefahr war; jedenfalls hatte der Mann eine Bereitschaft zum Mord nicht geleugnet. Wenn ein Mann die Rolle eines potentiellen Meuchelmörders spielt, hat er nicht das Recht, sein Publikum auszuwählen.
Nach einiger Zeit sah ich sie, undeutlich im Mondlicht unter den Bäumen. Der Mann, groß und schlank, schien in Schwarz gekleidet; die Frau trug, so gut ich dies feststellen konnte, einen Umhang aus grauem Material. Offenbar hatten sie meine Anwesenheit im Schatten noch immer nicht bemerkt, wiewohl sie bei Wiederaufnahme ihres Gesprächs aus irgendeinem Grund leiser redeten, sodass ich sie nicht mehr verstehen konnte. Während ich hinblickte, schien die Frau zu Boden zu sinken und flehend die Hände zu heben, wie es oft auf der Bühne geschieht und nie, soweit ich wusste, irgendwo anders, und ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, dass es in diesem Moment geschah. Der Mann heftete seine Augen auf sie; sie schienen im Mondschein trübe zu glitzern, mit einem Ausdruck, der mich mit Besorgnis erfüllte, falls er sie auf mich richten sollte. Ich weiß nicht, welcher Impuls mich bewegte, aber ich sprang auf und trat aus dem Schatten. In diesem Moment verschwanden die Gestalten. Vergebens spähte ich durch die freien Räume zwischen Bäumen und Unterholz. Der Nachtwind ließ die Blätter rascheln; die Eidechsen waren früh zu Bett gegangen, Reptilien mit beispielhaften Angewohnheiten. Der kleine Mond glitt bereits hinter einen schwarzen Berg im Westen.
Ich ging nach Hause, leicht verstörten Geistes und beinahe zweifelnd, ob ich wirklich außer den Eidechsen etwas Lebendes gehört oder gesehen hatte. Alles schien ein wenig seltsam und unheimlich. Es war, als ob unter den verschiedenen Phänomenen, objektiven wie subjektiven, die insgesamt den Vorfall ausmachten, ein unbestimmtes Element gewesen wäre, das seinen zweifelhaften Charakter über alles ausgebreitet – alles mit Unwirklichkeit durchsetzt hatte. Es gefiel mir nicht.
Am Frühstückstisch gab es am nächsten Morgen ein neues Gesicht; mir gegenüber saß eine junge Frau, der ich nur einen flüchtigen Blick zuwarf, als ich mich setzte. Indem sie die hochmögende weibliche Persönlichkeit anredete, die sich dazu herabließ, uns anscheinend zu bedienen, erregte dieses Mädchen bald meine Aufmerksamkeit durch den Klang ihrer Stimme, die sehr, aber doch nicht ganz ähnlich jener war, die vom Abenteuer des Vorabends her noch immer in meinem Gedächtnis murmelte. Einen Moment später betrat ein weiteres Mädchen, ein paar Jahre älter, den Raum und setzte sich zur Linken der anderen, wobei sie ihr einen freundlichen «Guten Morgen» wünschte. Ihre Stimme erschreckte mich: Es war ohne Zweifel die Stimme, an die mich die des ersten Mädchens erinnert hatte. Da saß nun die Dame von der Waldbegebenheit leibhaftig vor mir, «wie sie leibte und lebte».