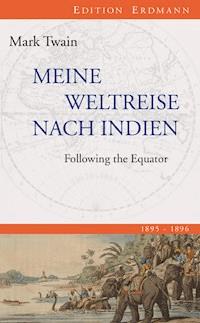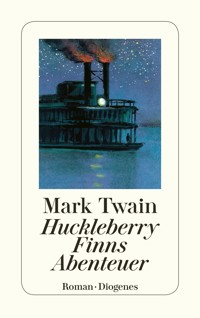
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Unrecht wird dieser Abenteuerroman gemeinhin als Jugendbuch bezeichnet: Es lohnt sich, die Geschichte von Huckleberry und seinem Freund Nigger Jim auch später wieder und wieder zu lesen. In seinem Meisterwerk beleuchtet Mark Twain grundsätzliche Probleme moralischer und ethischer Natur und sprengt damit den Rahmen des Jugendbuches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mark Twain
Huckleberry Finns Abenteuer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Lore Krüger
Mit einem Essay von T.S. Eliot
Diogenes
Zur Beachtung
Personen, die versuchen, ein Motiv in dieser Erzählung zu finden, werden gerichtlich verfolgt; Personen, die versuchen, eine Moral darin zu finden, werden verbannt; Personen, die versuchen, eine Fabel darin zu finden, werden erschossen.
Auf Befehl des Autors für G.G., Kommandant der Artillerie
Zur Erklärung
Im vorliegenden Buch werden eine Anzahl von Dialekten benutzt, nämlich der Negerdialekt von Missouri, die extremste Form des südwestlichen Hinterwäldlerdialekts, der gewöhnliche Pike-County-Dialekt und vier gemilderte Abarten des letzteren. Die Schattierungen sind nicht auf gut Glück und beliebig, sondern sehr sorgfältig vorgenommen worden, mit Hilfe der vertrauenswürdigen Anleitung und Unterstützung durch persönliche Vertrautheit mit diesen verschiedenen Sprachformen.
Ich gebe diese Erklärung, weil ohne sie wohl viele Leser annehmen mögen, daß sich alle Personen bemühen, auf die gleiche Weise zu sprechen, ohne daß es ihnen gelingt.
Der Autor
ERSTES KAPITELIch entdecke Moses und die »Bimsen«
Ihr wißt noch nichts von mir, wenn ihr nicht ein Buch gelesen habt, das sich »Tom Sawyers Abenteuer« nennt, aber das macht nichts. Das Buch hat Mr. Mark Twain geschrieben, und im großen und ganzen hat er dadrin die Wahrheit gesagt. Es gibt zwar Dinge, wo er ’n bißchen geflunkert hat, aber er hat im großen und ganzen die Wahrheit gesagt. Das ist nicht schlimm. Ich habe noch nie jemand gesehen, der nicht hin und wieder mal geschwindelt hätte, außer Tante Polly und die Witwe und vielleicht Mary. Über Tante Polly – das ist Tom seine Tante Polly – und Mary und die Witwe Douglas ist alles in dem Buch berichtet worden, das zum größten Teil ein wahres Buch ist, mit ein paar Flunkereien, wie ich schon gesagt habe.
Nun, das Buch endet folgendermaßen: Tom und ich fanden das Geld, das die Räuber in der Höhle versteckt hatten, und wir wurden dadurch reich. Wir kriegten jeder sechstausend Dollar – alles in Gold. Es war ’ne furchtbare Menge Geld, wie das Ganze da so auf einem Haufen lag. Na, Richter Thatcher nahm’s und legte es gegen Zinsen an, und das brachte uns pro Mann und Tag einen Dollar ein, das ganze Jahr über – so viel, daß man nicht weiß, was man damit anstellen soll. Die Witwe Douglas, die nahm mich als Sohn an und erklärte, sie wollte mich siwilisieren; immerzu im Haus zu wohnen war aber ein schweres Leben, wenn man in Betracht zieht, wie scheußlich regelmäßig und anständig die Witwe in allem war, und als ich’s nicht mehr aushalten konnte, verdrückte ich mich. Ich stieg wieder in meine alten Lumpen und meine Zuckertonne und war frei und zufrieden. Aber Tom Sawyer, der stöberte mich auf und sagte, er wollte ’ne Räuberbande gründen und ich dürfte mitmachen, wenn ich zur Witwe zurückgehen und achtbar sein würde. Da bin ich eben zurückgegangen.
Die Witwe weinte über mich und nannte mich ein armes, verirrtes Lamm und gab mir noch ’ne Menge andere Namen, aber sie hat’s nicht böse gemeint. Sie steckte mich wieder in diese neuen Sachen, und mir blieb nichts andres übrig, als immerzu zu schwitzen und zu schwitzen und mir ganz eingezwängt vorzukommen. Na ja, und dann ging die alte Leier wieder los. Die Witwe läutete eine Glocke zum Abendbrot, und man mußte pünktlich kommen. Wenn man am Tisch angelangt war, durfte man nicht etwa gleich essen, sondern mußte warten, bis die Witwe ihren Kopf runtergebogen und ’n bißchen über das Essen gebrummelt hatte, obwohl gar nichts damit los war. Das heißt, nichts, bloß alles war einzeln gekocht. In ’nem Behälter mit allerlei Resten ist das anders, da vermischt sich alles, und der Saft schwappt so rum, und das schmeckt viel besser.
Nach dem Abendbrot holte sie dann ihr Buch raus und lernte mir was über Moses und die Bimsen, und ich war ordentlich scharf drauf, alles über ihn zu erfahren, aber schließlich verriet sie, daß Moses schon ’ne beträchtliche Weile tot ist; da habe ich mir dann nichts mehr aus ihm gemacht, denn für Tote intressier’ ich mich nicht.
Bald darauf wollte ich rauchen und bat die Witwe, mir’s zu erlauben. Das wollte sie aber nicht. Sie sagte, das wäre ’ne niedrige und unsaubre Angewohnheit, und ich sollte versuchen, es nicht mehr zu tun. So machen’s eben manche Leute. Die sind gegen eine Sache, von der sie keine Ahnung haben. Da zerbrach sie sich den Kopf über Moses, der überhaupt nicht mit ihr verwandt war und niemand was nützte, weil er ja nicht mehr lebte, und mir verübelte sie’s mächtig, weil ich was tat, wo doch was Gutes dran war. Und dabei schnupfte sie; aber das war natürlich richtig, weil sie’s tat.
Miss Watson, ihre Schwester, eine reichlich dürre alte Jungfer mit ’ner Brille auf, war grade zur Witwe gezogen und rückte mir nun mit einer Fibel zu Leibe. Sie ließ mich ungefähr eine Stunde lang ziemlich schwer arbeiten, und dann sorgte die Witwe dafür, daß sie’s ’n bißchen gnädiger machte. Viel länger hätte ich’s auch nicht ausgehalten. Nun war’s eine Stunde lang tödlich langweilig, und ich wurde zapplig. Miss Watson sagte dann: »Leg die Füße nicht hier herauf, Huckleberry«, und: »Sitz nicht so krumm, Huckleberry – sitz grade«, und bald darauf sagte sie: »Reiß den Mund nicht so auf, Huckleberry, und rekele dich nicht so – weshalb versuchst du nicht, dich zu benehmen?« Dann erzählte sie mir über die Hölle, und ich sagte, ich wollte, ich wäre dort. Da wurde sie wütend, aber ich habe mir gar nichts Böses dabei gedacht, ich wollte bloß irgendwohin, ich wollte bloß irgend’ne Abwechslung, egal welche. Sie sagte, es wäre verrucht zu sagen, was ich gesagt hatte, und erklärte, um nichts in der Welt würde sie so was sagen, sie für ihr Teil wollte so leben, daß sie in den Himmel käme. Na, mich hat’s nicht gereizt, dahin zu kommen, wo sie hinkam, und so habe ich mich entschlossen, mich nicht drum zu bemühen. Gesagt hab ich das aber nicht, denn es hätte nur Unannehmlichkeiten gegeben und wär’ zu nichts nütze gewesen.
Jetzt, wo sie mal angefangen hatte, machte sie weiter und erzählte mir alles über den Himmel. Sie sagte, dort hätte man nichts zu tun, als bloß den lieben langen Tag mit ’ner Harfe rumzuspazieren und zu singen, für immer und ewig. Daher hielt ich nicht viel davon. Gesagt hab ich’s aber nicht. Ich fragte sie, ob sie wohl meinte, daß Tom Sawyer dahin käme, und sie sagte, auf keinen Fall. Darüber war ich froh, denn ich wollte, daß er und ich beisammen wären.
Miss Watson piesackte mich weiter, und es wurde ermüdend und eintönig. Nach ’ner Weile holten sie die Nigger rein, und es wurde gebetet, und dann verschwanden alle zu Bett. Ich ging mit einem Kerzenstumpf in mein Zimmer rauf und stellte ihn auf den Tisch. Dann setzte ich mich auf ’nen Stuhl, der am Fenster stand, und versuchte, an was Lustiges zu denken; es hatte aber keinen Zweck. Ich fühlte mich so einsam, daß ich fast wünschte, ich wäre tot. Die Sterne schienen, und die Blätter raschelten so traurig im Wald; in der Ferne hörte ich ’ne Eule um einen Toten schreien, ein Ziegenmelker und ’n Hund wehklagten um jemand, der sterben sollte, der Wind versuchte, mir was zuzuflüstern, aber ich konnte nicht verstehen, was es war, und daher lief’s mir kalt über den Rücken. Dann hörte ich draußen im Wald einen Laut, wie ihn ein Geist von sich gibt, wenn er mitteilen will, was ihm auf der Seele liegt, sich aber nicht verständlich machen kann und deshalb im Grab keine Ruhe findet und jede Nacht klagend herumirren muß. Ich wurde so niedergeschlagen und ängstlich, daß ich wünschte, es wär’ jemand da. Dann krabbelte mir ’ne Spinne über die Schulter; ich schnippste sie fort, und sie landete in der Kerze; und bevor ich mich rühren konnte, war sie schon ganz zusammengeschrumpelt. Mir brauchte nicht erst jemand zu sagen, daß das ein furchtbar böses Vorzeichen war und mir Unglück bringen würde; deshalb hatte ich Angst und schlotterte so, daß mir fast die Sachen vom Leib fielen. Ich stand auf und drehte mich dreimal um mich selbst, dabei bekreuzigte ich mir jedesmal die Brust; dann band ich mir ein kleines Büschel Haare mit ’nem Faden zusammen, um Hexen fernzuhalten. Zutrauen hatte ich freilich nicht zu der Sache. Man tut das, wenn man ein gefundenes Hufeisen wieder verliert, anstatt es über die Tür zu nageln, aber ich hatte nie jemand sagen hören, es wäre ’n Mittel, um Unglück abzuwenden, wenn man ’ne Spinne getötet hat.
Am ganzen Leibe zitternd, setzte ich mich wieder hin und holte meine Pfeife raus, um ein bißchen zu rauchen, denn im Haus war’s jetzt totenstill, und da konnte die Witwe nichts merken. Na, nach langer Zeit hörte ich dann die Turmuhr drüben in der Stadt schlagen, bum, bum, bum … zwölf Schläge – und dann war alles wieder still, noch stiller als vorher. Kurz darauf hörte ich unten im Finstern zwischen den Bäumen einen Zweig knacken – irgendwas bewegte sich. Ich saß still und spitzte die Ohren. Gleich darauf ertönte von da unten ein so leises »Miau! Miau!«, daß ich’s grad noch hören konnte. Das war gut! Ich machte ebenfalls, so leise ich konnte: »Miau! Miau!«, löschte das Licht und kletterte zum Fenster raus auf den Schuppen. Dann ließ ich mich auf den Boden gleiten und kroch rüber zwischen die Bäume, und richtig, da wartete Tom Sawyer auf mich.
ZWEITES KAPITELDer blutige Eid unserer Bande
Auf den Zehenspitzen schlichen wir einen Pfad entlang, der hinten in der Witwe ihrem Garten zwischen den Bäumen durch führte, und bückten uns, damit uns die Zweige nicht den Kopf zerkratzten. Als wir an der Küche vorbeikamen, stolperte ich über ’ne Wurzel, und das machte ein Geräusch. Wir duckten uns hin und waren ganz still. Miss Watson ihr großer Nigger Jim saß in der Küchentür; wir konnten ihn ziemlich deutlich sehen, weil hinter ihm ’n Licht brannte. Er stand auf und streckte ungefähr ’ne Minute lang den Hals, um zu horchen. Dann sagte er: »Wer ’s da?«
Er horchte noch ’ne Weile, dann kam er auf Zehenspitzen raus und stand genau zwischen uns still; wir hätten ihn beinah anfassen können. Na, ’s kam uns wie viele Minuten vor, daß nicht ein Laut zu hören war und wir alle dort so dicht beisammen waren. An meinem Knöchel fing ’ne Stelle an zu jucken, aber ich wagt’s nicht, mich zu kratzen; dann fing mein Ohr an zu jucken, und dann kam mein Rücken dran, genau zwischen den Schultern. Mir war’s, als müßt’ ich sterben, wenn ich mich nicht kratzen könnte. Das habe ich seitdem oft bemerkt. Wenn man mit feinen Leuten zusammen ist oder bei ’nem Begräbnis oder wenn man versucht einzuschlafen und gar nicht müde ist – wenn man irgendwo ist, wo man sich nicht kratzen darf, dann juckt’s einen bestimmt überall an mindestens tausend Stellen.
Nun sagte Jim: »Sag, wer bist ’n du? Wo bist ’n du? Ich will auf der Stelle umfalln, wenn ich nicht was gehört hab. Na, ich weiß, was ich mache. Ich setz mich hier hin und warte, bis ich wieder was höre.«
So setzte er sich also zwischen Tom und mich auf die Erde. Mit dem Rücken lehnte er sich gegen einen Baum, und die Beine streckte er so weit von sich, daß eins davon beinah meins berührte. Jetzt fing meine Nase an zu jucken. Sie juckte so, daß mir die Tränen kamen. Zu kratzen traute ich mich aber nicht. Dann fing sie an, innen zu jucken. Danach juckte mich’s unten. Ich wußte nicht, wie ich stillhalten sollte. Dieses Elend dauerte sechs oder sieben Minuten, mir kam’s aber viel länger vor. Jetzt juckte’s mich an elf verschiedenen Stellen. Ich schätzte, ich könnte es nicht länger als bloß noch ’ne Minute aushalten, aber ich biß die Zähne zusammen und machte mich bereit, es zu versuchen. Grad da fing Jim an, schwer zu atmen; dann schnarchte er – und da fühlte ich mich ziemlich schnell wieder ganz wohl in meiner Haut.
Tom machte mir ’n Zeichen – ’n kleines Geräusch mit dem Mund – und wir krochen auf Händen und Knien davon. Als wir zehn Fuß weit fort waren, flüsterte Tom mit mir und wollte Jim aus Ulk an den Baum binden; aber ich sagte, nein, er könnte dabei aufwachen und Krach schlagen, und dann würden sie merken, daß ich nicht im Hause war. Dann sagte Tom, er hätte nicht genug Kerzen und würde in die Küche schleichen, um noch welche zu holen. Ich wollte nicht gern, daß er’s versuchte. Ich meinte, Jim könnte aufwachen und reinkommen. Aber Tom wollte’s riskieren, und so schlüpften wir rein und holten drei Kerzen, und Tom legte zur Bezahlung fünf Cent auf den Tisch. Dann gingen wir raus, und ich brannte drauf fortzukommen, aber Tom wollte absolut nicht anders, als noch mal auf Händen und Knien dahin kriechen, wo Jim war, und ihm irgend’nen Streich spielen. Ich wartete, und die Zeit kam mir recht lang vor; es war alles so still und einsam.
Sowie Tom zurück war, machten wir uns davon, den Weg runter und um den Gartenzaun rum; schließlich kamen wir auf die steile Spitze vom Hügel, der auf der anderen Seite vom Haus lag. Tom sagte, er hätte Jim den Hut abgesetzt und ihn auf ’nen Ast gehängt, der genau über ihm war, und Jim hätte sich ’n bißchen bewegt, wäre aber nicht aufgewacht. Nachher erzählte Jim, die Hexen hätten ihn verhext und in einen schlafähnlichen Zustand versetzt und wären mit ihm über den ganzen Staat geritten, und dann hätten sie ihn unter den Bäumen wieder abgesetzt und seinen Hut auf ’nen Ast gehängt, um zu zeigen, wer’s gewesen ist. Und als Jim die Sache das nächste Mal erzählte, sagte er, sie hätten ihn bis nach New Orleans runter geritten, und danach dehnte er’s, jedesmal wenn er’s erzählte, weiter und immer weiter aus, bis er schließlich sagte, sie hätten ihn um die ganze Welt geritten und fast zu Tode erschöpft, und sein Rücken wäre von oben bis unten voller Druckstellen vom Sattel gewesen. Jim war grauslich stolz darauf, und er wurde so eingebildet, daß er von den anderen Niggern kaum noch Notiz nehmen wollte. Die Nigger kamen von meilenweit her, um Jim davon erzählen zu hören, und er war geachteter als sonst irgendein Nigger in der Gegend. Fremde Nigger standen mit offenem Mund da und begafften ihn von oben bis unten, grad als ob er ’n Wunder wäre. Nigger sprechen im Dunkeln, wenn sie am Herdfeuer sitzen, immer über Hexen, aber jedesmal, wenn einer davon redete und zu verstehen gab, er wüßte alles über solche Sachen, dann kam zufällig Jim dazu und sagte: »Hm! Was verstehst ’n du von Hexen?«, und dann war dem Nigger das Maul gestopft, und er mußte sich in den Hintergrund verziehen. Das Fünfcentstück trug Jim immer an ’ner Schnur um den Hals und sagte, das wär ’n Amulett, das der Teufel ihm eigenhändig gegeben hätte, und der hätte ihm gesagt, er könnte damit jeden heilen und immer, wenn er wollte, Hexen herbeiholen, er brauchte bloß was zu dem Amulett zu sagen; er hat aber nie erzählt, was er denn zu ihm sagte. Die Nigger aus der ganzen Umgebung kamen und gaben Jim alles, was sie hatten, bloß um das Fünfcentstück mal zu sehen, aber anfassen wollten sie’s nicht, weil der Teufel die Hände drauf gehabt hatte. Als Diener war Jim fast gar nicht mehr zu gebrauchen, so hochnäsig wurde er, weil er den Teufel gesehen hatte und von den Hexen geritten worden war.
Also, wie Tom und ich an den Rand von der Hügelspitze kamen, guckten wir auf das Dorf runter und sahen zwei oder drei Lichter blinken, vielleicht bei Kranken, und die Sterne über uns funkelten wunderschön; unten beim Dorf lag der Fluß; er war ’ne ganze Meile breit und furchtbar still und großartig. Wir gingen den Hügel runter und fanden Jo Harper, Ben Rogers und noch zwei oder drei Jungs, die sich in der alten Gerberei versteckt hatten. Wir machten ein Boot los und ruderten zweieinhalb Meilen weit den Fluß runter, bis zu der großen Erdrutschstelle auf dem Abhang; da gingen wir an Land.
Wir gingen zu ’nem Gebüsch, und Tom ließ alle schwören, das Geheimnis zu wahren; dann zeigte er ihnen ein Loch im Hügel, grad wo das Gebüsch am dichtesten war. Dann zündeten wir die Kerzen an und krochen auf Händen und Knien rein. Etwa zweihundert Yard weit krochen wir, und dann wurde die Höhle breiter. Tom suchte in den Gängen rum und verschwand bald unter ’ner Wand, wo man gar nicht merkte, daß da ’n Loch war. Wir gingen einen engen Gang entlang und kamen dann in ’ne Art Raum, wo’s feucht und klamm und kalt war, und da hielten wir an.
Tom sagte: »Jetzt gründen wir die Räuberbande und nennen sie Tom Sawyers Bande. Jeder, der mitmachen will, muß ’nen Eid ablegen und seinen Namen mit Blut unterschreiben.«
Alle wollten mitmachen. Tom holte also ’n Blatt Papier raus, wo er den Eid daraufgeschrieben hatte, und las ihn vor. Er verpflichtete jeden von den Jungs, zur Bande zu halten und keins von ihren Geheimnissen je zu verraten, und wenn irgendwer irgendeinem von der Bande was tat, dann mußte jeder Junge, dem’s befohlen wurde, diesen Menschen und seine Familie umbringen, und er durfte nicht essen und nicht schlafen, bis er sie getötet und ihnen ein Kreuz in die Brust gehackt hatte, was der Bande ihr Zeichen war. Und keiner, der nicht zur Bande gehörte, durfte das Zeichen benutzen, und wenn er’s doch tat, mußte er belangt werden, und wenn er’s noch mal tat, dann mußte er getötet werden. Und wenn jemand, der zur Bande gehörte, die Geheimnisse verriet, dann mußte er sich die Kehle durchschneiden lassen und seine Leiche verbrennen und die Asche in alle Winde verstreuen lassen, und sein Name mußte mit Blut von der Liste gelöscht werden und durfte von der Bande nie mehr genannt werden, sondern ein Fluch mußte über ihn gesprochen werden, und er sollte für ewig vergessen sein.
Alle sagten, das wäre ein wirklich wunderschöner Eid, und fragten Tom, ob er sich ihn allein ausgedacht hätte. Er sagte, zum Teil, aber der Rest wäre aus Piratenbüchern und Räuberromanen, und jede vornehme Bande hätte so einen.
Einige meinten, es wäre gut, die Familien von den Jungs zu töten, die die Geheimnisse verrieten. Tom sagte, das wäre ’n feiner Gedanke, und so nahm er einen Bleistift und schrieb’s rein.
Dann sagte Ben Rogers: »Huck Finn hier hat ja keine Familie – was machst du denn mit dem?«
»Na, hat er vielleicht nicht ’nen Vater?« sagte Tom Sawyer.
»Ja, einen Vater hat er, aber den kann man doch jetzt nie finden. Früher lag er immer besoffen bei den Schweinen in der Gerberei, aber jetzt ist er schon über ’n Jahr nicht mehr hier in der Gegend gesehen worden.«
Sie berieten darüber und wollten mich schon ausschließen, denn sie sagten, jeder Junge müßte ’ne Familie oder jemand haben, den man töten könnte, sonst wäre die Sache für die anderen nicht recht und billig. Na, keinem fiel was ein, was da zu tun war, keiner wußte mehr weiter, und alle saßen stumm da. Ich wollte schon anfangen zu heulen, da fiel mir aber plötzlich ’n Ausweg ein, und so bot ich ihnen Miss Watson an – die konnten sie töten.
Alle sagten: »Ach, die reicht, die reicht. Geht in Ordnung. Huck kann mitmachen.«
Dann piekten sich alle mit ’ner Nadel in den Finger, um Blut rauszuholen, damit sie unterschreiben konnten, und ich machte mein Zeichen aufs Papier.
»So«, sagte Ben Rogers, »und mit was für Geschäften gibt sich nun die Bande ab?«
»Mit weiter nichts als bloß mit Raub und Totschlag«, antwortete Tom.
»Aber was rauben wir denn aus? Häuser – oder Vieh – oder …«
»Quatsch! Vieh und so was zu stehlen ist doch nicht Raub, das ist ja Einbruch«, sagte Tom Sawyer. »Wir sind doch keine Einbrecher. Das ist nichts Vornehmes. Wir sind Wegelagerer. Wir halten Postkutschen und Wagen auf der Straße an und haben dabei Masken auf, und wir töten die Leute und nehmen ihnen die Uhren und das Geld ab.«
»Müssen wir die Leute immer töten?«
»Natürlich. Das ist das beste. Manche Experten sind anderer Meinung, aber meistens wird’s als das beste angesehen, sie zu töten. Außer ein paar, die ihr hierher in die Höhle bringt und festhaltet, bis sie ausgelöst werden.«
»Ausgelöst? Was ist ’n das?«
»Weiß ich nicht. Aber das macht man. Ich hab’s in Büchern gelesen, und darum müssen wir’s natürlich so machen.«
»Aber wie können wir’s denn machen, wenn wir nicht wissen, was es ist?«
»Na, Teufel noch mal, wir müssen aber. Hab’ ich dir nicht gesagt, daß es in den Büchern steht? Willst du die Sache vielleicht anders machen, als es in den Büchern steht, und alles durcheinanderbringen?«
»Ach, das ist leicht gesagt, Tom Sawyer, aber wie zum Kuckuck sollen denn die Kerle ausgelöst werden, wenn wir nicht wissen, wie man’s mit ihnen macht? Weiter will ich gar nichts sagen. Was schätzt du denn, was das sein kann?«
»Na, ich weiß nicht. Aber wenn wir sie festhalten, bis sie ausgelöst werden, dann heißt das vielleicht, daß wir sie festhalten, bis sie tot sind.«
»Ja, das hört sich nach was an. Das wird gehen. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Wir behalten sie, bis sie zu Tode ausgelöst sind – und ’ne schöne Plage werden sie sein, alles auffressen und immerzu versuchen loszukommen.«
»Was du nur zusammenredest, Ben Rogers. Wie können die denn loskommen, wenn ’ne Wache für sie da ist, die bereit ist, sie niederzuschießen, wenn sie auch nur den kleinen Finger rühren?«
»’ne Wache! Na, das ist ja gut. Da muß also jemand die ganze Nacht wachsitzen und überhaupt nicht schlafen, bloß um die zu bewachen. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Weshalb kann man denn nicht ’nen Knüppel nehmen und sie auslösen, sowie sie hierherkommen?«
»Weil’s in den Büchern so nicht steht – deshalb. Hör mal, Ben Rogers, willst du die Sache so machen, wie’s der Regel entspricht, oder nicht – darauf kommt’s an. Meinst du, die Leute, die die Bücher geschrieben haben, wissen nicht, wie’s richtig gemacht wird? Glaubst du vielleicht, du kannst ihnen was beibringen? So siehst du aus. Nee, mein Bester, wir machen weiter so und lösen sie auf die reguläre Weise aus.«
»Na schön. Mir ist’s wurscht, aber ich sage dir, Quatsch ist es sowieso. Sag mal – töten wir die Frauen auch?«
»Na, Ben Rogers, wenn ich so unwissend wäre wie du, dann würd ich’s mir jedenfalls nicht anmerken lassen. Die Frauen töten? Nee – so was hat man noch nie in den Büchern gelesen. Man holt sie in die Höhle und ist immer schrecklich höflich zu ihnen, und allmählich verlieben sie sich in einen und wollen überhaupt nie mehr nach Hause.«
»Na, wenn’s so ist, bin ich einverstanden, aber ich halt nicht viel davon. Wir werden die Höhle bald so vollgestopft haben mit Weibern und mit Kerlen, die drauf warten, ausgelöst zu werden, daß für die Räuber überhaupt kein Platz mehr drin ist. Aber mach nur, ich sag nichts.«
Der kleine Tommy Barnes war jetzt eingeschlafen, und als sie ihn weckten, fürchtete er sich und weinte und sagte, er wollte nach Haus zu seiner Mama und kein Räuber mehr sein.
Da machten sich alle über ihn lustig und nannten ihn ’ne Heulmemme, und da wurde er wütend und sagte, er wollte gleich losgehen und alle Geheimnisse verraten. Aber Tom gab ihm fünf Cent, damit er den Schnabel hielt, und sagte, wir wollten alle heimgehen und nächste Woche wieder zusammenkommen, jemand ausrauben und ’n paar Leute töten.
Ben Rogers sagte, er könnte nicht oft raus, nur sonntags, und wollte deshalb nächsten Sonntag anfangen; aber alle Jungen sagten, es sonntags zu machen wäre ’ne Sünde, und das entschied die Sache. Sie einigten sich darauf, sobald wie möglich wieder zusammenzukommen und einen Tag festzulegen, und dann wählten wir Tom Sawyer zum obersten Hauptmann und Jo Harper zum Unterhauptmann von der Bande und machten uns auf den Heimweg.
Ich kletterte, kurz bevor der Tag anbrach, auf den Schuppen und kroch zu meinem Fenster rein. Meine neuen Sachen waren ganz mit Talg und Lehm beschmiert, und ich war hundemüde.
DRITTES KAPITELWir lauern den Ah-Rabern auf
Na ja, am Morgen hielt mir die alte Miss Watson wegen meinen Sachen ’ne ordentliche Standpauke, aber die Witwe, die schimpfte nicht, sondern putzte bloß den Talg und den Lehm ab und sah dabei so traurig aus, daß ich dachte, ich würd mich ’ne Weile anständig benehmen, wenn ich das schaffte. Dann nahm mich Miss Watson in die Kammer und betete, aber es kam nichts dabei raus. Sie sagte, ich sollte jeden Tag beten, und um was ich betete, das würde ich bekommen. Das stimmte aber nicht. Ich hab’s versucht. Einmal kriegte ich ’ne Angelschnur, aber eine ohne Haken. Sie nutzte mir überhaupt nichts ohne Haken. Ich versuchte drei-, viermal, die Haken mit Beten zu bekommen, aber irgendwie wollt’s bei mir nicht klappen. Schließlich bat ich eines Tages Miss Watson, es für mich zu versuchen. Aber sie sagte, ich wäre ein Narr. Warum, sagte sie mir nicht, und ich konnte es mir nirgendswie erklären.
Einmal setzte ich mich draußen im Wald hin und dachte lange drüber nach. Ich überlegte mir: Wenn man alles, um was man betet, bekommen kann, warum kriegte dann der Diakon Winn nicht das Geld wieder, das er an Schweinefleisch verloren hatte? Warum konnte dann die Witwe ihre silberne Schnupftabaksdose nicht zurückbekommen, die ihr gestohlen worden war? Warum konnte dann Miss Watson nicht fett werden? Nein, sagte ich mir, da ist nichts dran. Ich ging zur Witwe und erzählte ihr’s, und sie meinte, was man erhalten könnte, wenn man drum betete, wären »geistige Gaben«. Das war mir zu hoch, aber sie erklärte mir, was sie meinte – ich müßte anderen helfen und für andere tun, was nur ich könnte, und mich immerzu um sie kümmern und überhaupt nicht an mich denken. Dadrin war Miss Watson einbegriffen, soweit ich verstand. Ich ging in den Wald raus und dachte lange drüber nach, aber ich konnte keinen Nutzen davon erkennen – außer für die anderen Leute – und so dachte ich schließlich, ich würde mir weiter nicht den Kopf drüber zerbrechen, sondern die Dinge einfach laufen lassen. Manchmal nahm mich die Witwe beiseite und redete über die Vorsehung auf ’ne Weise, daß einem das Wasser im Munde zusammenlief, aber vielleicht nahm mich am nächsten Tag dann Miss Watson vor und haute alles wieder um. Ich dachte mir, offensichtlich gab’s zwei Vorsehungen, und bei der Witwe ihrer würde ’n armer Teufel einigermaßen Aussichten haben, aber wenn ihn Miss Watson ihre kriegte, dann gab’s keine Rettung mehr für ihn. Ich überlegte mir die Sache gründlich und beschloß, ich wollte der Witwe ihrer Vorsehung gehören, wenn die mich haben wollte, obwohl ich mir nicht erklären konnte, wieso sie dabei besser dran wäre als vorher, wo ich doch so unwissend und ziemlich niedrig und gewöhnlich war.
Papa war über ein Jahr nicht gesehen worden, und das war beruhigend für mich; ich wollte ihn nicht mehr sehen. Er verdrosch mich immer, wenn er nüchtern war und mich erwischen konnte, bloß meistens verzog ich mich in den Wald, wenn er da war. Na, so ungefähr um die Zeit wurde er etwa zwölf Meilen oberhalb von der Stadt ersoffen im Fluß aufgefunden, wie die Leute erzählten. Jedenfalls waren sie der Meinung, er wär’s; sagten, der Ersoffene hätte genau seine Größe, Lumpen an und ungewöhnlich langes Haar – alles wie bei Papa –, aber sein Gesicht konnten sie nicht erkennen, weil’s schon so lange im Wasser gelegen hatte, daß es überhaupt nicht mehr wie ’n Gesicht aussah. Sie sagten, er wäre auf dem Rücken im Wasser geschwommen. Sie nahmen ihn und begruben ihn am Ufer. Ich fühlte mich aber nicht lange beruhigt, denn mir fiel was ein. Ich wußte ganz genau, daß ein ersoffener Mann nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Gesicht schwimmt. Daher wußte ich, daß dies gar nicht Papa, sondern ’ne Frau war, die Männersachen anhatte. So war ich also wieder unruhig. Ich dachte mir, der Alte würde schließlich wieder auftauchen, wo ich doch wünschte, daß er nicht käme.
Ungefähr ’nen Monat lang spielten wir ab und zu Räuber, und dann trat ich aus. Das taten alle Jungs. Wir hatten niemand ausgeraubt und keine Leute getötet, sondern bloß so getan. Wir hopsten immer aus dem Wald und stürzten uns auf Schweinehändler und Frauen, die in Karren saßen und Grünzeug zum Markt fuhren, aber wir sperrten nie welche von ihnen ein. Tom Sawyer nannte die Schweine »Barren«, und die Rüben und den Kram nannte er »Juwelen«, und wir gingen in die Höhle und hielten ein Palaver ab über das, was wir alles getan hatten und wieviel Leute wir umgebracht und gezeichnet hatten. Aber ich konnte keinen Gewinn dabei sehen. Einmal schickte Tom ’nen Jungen los, der mit einem brennenden Stock durch die Stadt rennen mußte, was er ’ne Losung nannte (das war das Zeichen für die Bande, sich zu versammeln), und dann sagte er, er hätte geheime Botschaft durch einen von seinen Spionen, daß am nächsten Tag ein ganzer Haufen von spanischen Händlern und reichen Ah-Rabern im Höhlental mit zweihundert Elefanten und sechshundert Kamelen und über tausend Saumtieren lagern wollte, die alle mit Diamanten beladen wären und bloß ’ne Wache von vierhundert Soldaten hätten, und deshalb wollten wir uns in einen Hinterhalt legen, wie er’s nannte, und alle töten und die Sachen einstecken. Er sagte, wir müßten unsere Schwerter und Gewehre aufpolieren und uns bereit machen. Nie konnte er auch nur gegen ’nen Rübenkarren losziehen, ohne die Schwerter und die Gewehre ganz und gar dafür abzuschrubben, trotzdem’s weiter nichts wie Latten und Besenstiele waren und man an ihnen rumschrubben konnte, bis man schwarz wurde, und dann waren sie auch nicht einen Mundvoll Asche mehr wert als vorher. Ich glaubte nicht, daß wir solch ’nen Haufen Spanier und Ah-Raber unterkriegen könnten, aber ich wollte die Kamele und Elefanten sehen, und deshalb war ich am nächsten Tag, Sonnabend, in dem Hinterhalt dabei, und als wir den Befehl erhielten, stürmten wir aus dem Wald und den Hügel hinunter. Aber’s waren keine Spanier und Ah-Raber da, und auch keine Kamele und Elefanten. Es war weiter nichts als ein Picknick, das ’ne Sonntagsschule abhielt, und noch dazu eine Anfängerklasse. Wir wichsten sie auseinander und jagten die Kinder das Tal rauf, aber wir kriegten dabei weiter nichts als bloß ’n paar Pfannkuchen und ein bißchen Marmelade; nur Ben Rogers erwischte ’ne Stoffpuppe und Jo Harper ein Liederbuch und ’n Traktat; aber da mischte sich der Lehrer ins Getümmel und zwang uns, alles hinzuwerfen und zu türmen. Diamanten sah ich nicht und sagte das auch Tom Sawyer. Er meinte, sie wären ja haufenweise dagewesen, und Ah-Raber und Elefanten und alles wäre auch dagewesen. Ich fragte, warum wir sie dann nicht sehen konnten? Er antwortete, wenn ich nicht so unwissend wäre und ’n Buch gelesen hätte, das »Don Quijote« hieß, dann würd’ ich’s wissen, ohne erst noch zu fragen. Er sagte, die ganze Sache wäre durch Zauberei gemacht worden. Hunderte von Soldaten wären dagewesen und Elefanten und Schätze und so weiter, aber wir hätten Feinde, die er Magier nannte, und die hätten alles in ’ne Kleinkindersonntagsschule verwandelt, bloß aus Gemeinheit. Ich sagte, na schön, dann müßten wir eben gegen die Magier losziehen. Tom Sawyer anwortete, ich wäre ’n Kalbskopf.
»Was denkste«, sagte er, »ein Magier könnte ’ne Menge Geister herrufen, und die würden dich wie nichts zerhacken, bevor du piep sagen kannst. Sie sind so groß wie ’n Baum und so dick wie eine Kirche.«
»Gut«, antwortete ich, »wenn nun wir ’n paar Geister dazu kriegen könnten, uns zu helfen – könnten wir die anderen dann nicht erledigen?«
»Und wie willst du die kriegen?«
»Weiß ich nicht. Wie kriegen denn die sie?«
»Die reiben doch eine alte Blechlampe oder ’nen eisernen Ring, und dann kommen die Geister angewetzt, und Donner und Blitz wüten nur so rum, und der Rauch rollt bloß so, und alles, was ihnen befohlen wird, tun die auf der Stelle. Macht denen gar nichts aus, einen Kugelturm bei den Wurzeln auszureißen und ihn ’nem Sonntagsschulleiter übern Kopf zu knallen – oder sonst jemand.«
»Wer macht denn, daß sie so loswetzen?«
»Na der, der die Lampe oder den Ring reibt. Demjenigen, der die Lampe oder den Ring reibt, gehören sie, und sie müssen alles tun, was er sagt. Wenn er ihnen befiehlt, ’nen vierzig Meilen langen Palast aus lauter Diamanten zu bauen und ihn ganz voll mit Kaugummi oder mit was du willst zu füllen und eine Kaisertochter aus China zu holen, damit du sie heiraten kannst, dann müssen sie’s tun – und zwar noch vor dem nächsten Sonnenaufgang. Und mehr noch – sie müssen mit diesem Palast im ganzen Land rumtanzen und den immer dahin stellen, wo du ’n nur hinhaben willst, verstehst du.«
»Na«, sagte ich, »meiner Meinung nach sind sie ’n Rudel Schwachköpfe, weil sie den Palast nicht für sich behalten, anstatt ihn so zu verschleudern. Und außerdem – wenn ich einer von denen wäre, dann würde ich den Mann zum Teufel jagen, anstatt alles stehn- und liegenzulassen und zu ihm zu kommen, bloß weil er ’ne alte Blechlampe reibt.«
»Was du bloß zusammenredst, Huck Finn. Du müßtest doch einfach kommen, wenn er sie reibt, ob du willst oder nicht.«
»Was, und ich so groß wie ’n Baum und so dick wie ’ne Kirche? Na schön, kommen würde ich, aber ich wette, den Mann würde ich auf den höchsten Baum treiben, den’s in der Gegend nur gibt!«
»Quatsch; hat gar keinen Zweck, mit dir zu reden, Huck Finn, du scheinst überhaupt nichts zu wissen – bist ’n vollendeter Schafskopf.«
Ich dachte über all das zwei, drei Tage lang nach, und dann sagte ich mir, ich wollte mal sehen, ob da was dran wäre. Ich nahm mir ’ne alte Blechlampe und einen eisernen Ring und ging in den Wald raus und rieb und rieb, bis ich wie ’n Affe schwitzte, weil ich vorhatte, ’nen Palast zu bauen und ihn dann zu verkaufen; aber’s war zwecklos, von den Geistern kam keiner. Da dachte ich mir, das ganze Gerede war bloß wieder mal eine von Tom Sawyer seinen Schwindeleien. Ich dachte mir, daß er wohl an die Ah-Raber und die Elefanten glaubte, aber was mich betrifft – ich denke anders drüber. Es sah verdammt nach ’ner Sonntagsschulklasse aus.
VIERTES KAPITELDas Orakel mit der Haarkugel
Nun, drei oder vier Monate zogen vorbei, und wir waren jetzt mitten im Winter. Ich war fast die ganze Zeit über zur Schule gegangen und konnte buchstabieren und lesen und auch ’n kleines bißchen schreiben und das kleine Einmaleins aufsagen bis zu sechs mal sieben ist fünfunddreißig, aber ich glaube, weiter würde ich nie kommen, und wenn ich ewig lebte. Für Mathematik intressiere ich mich sowieso nicht.
Zuerst haßte ich die Schule, aber nach und nach war ich so weit, daß ich sie aushalten konnte. Immer, wenn ich ungewöhnlich müde wurde, schwänzte ich, und die Prügel, die ich dann am nächsten Tag bezog, taten mir gut und munterten mich auf. Je länger ich also zur Schule ging, desto leichter wurde es. Auch an der Witwe ihre Methoden gewöhnte ich mich einigermaßen, und sie fielen mir nicht mehr so auf den Wecker. In ’nem Haus zu wohnen und in ’nem Bett zu schlafen war eine ziemliche Strapaze für mich, aber bevor’s kalt wurde, verkrümelte ich mich manchmal in den Wald und schlief dort, und dabei ruhte ich mich dann aus. Die alte Art gefiel mir am besten, aber ich kam so weit, daß mir die neue auch ’n kleines bißchen gefiel. Die Witwe sagte, langsam aber sicher machte ich mich, und es ginge ganz gut vorwärts mit mir. Sie meinte, sie schämte sich nicht über mich.
Eines Morgens passierte mir’s, daß ich beim Frühstück das Salzfaß umwarf. Ich langte so schnell ich konnte nach einer Prise Salz, um sie mir über die linke Schulter zu werfen und das Pech abzuhalten; aber Miss Watson war schneller als ich und kam mir in die Quere. Sie sagte: »Nimm die Hände weg, Huckleberry – was für eine Unordnung du bloß immer machst.« Die Witwe legte ein gutes Wort für mich ein, aber es würde das Pech nicht abhalten – das wußte ich genau. Ich ging nach dem Frühstück los, fühlte mich ganz beklommen und zittrig und fragte mich, wo’s mir wohl passieren würde und was es sein würde. Manche Arten von Unglück kann man ja mit einigen Mitteln aufhalten, aber so eins war’s nicht, und so versuchte ich gar nicht, irgendwas zu unternehmen, sondern ich zog bloß niedergeschlagen und wachsam rum.
Ich ging durch den Garten und kletterte über den Zauntritt, der über den hohen Bretterzaun führt. Auf dem Boden lag ein Zoll Neuschnee, und ich sah die Fußspuren von jemand. Sie waren vom Steinbruch gekommen, hatten ein Weilchen bei dem Zauntritt gestanden und waren dann um den Gartenzaun rum weitergegangen. Komisch, daß sie nicht reingekommen waren, nachdem sie da so rumgestanden hatten. Ich konnte’s mir nicht erklären. Irgendwie war das merkwürdig. Ich wollte der Spur nachgehen, aber zuerst bückte ich mich, um sie mir mal anzusehen. Zunächst fiel mir nichts auf, aber dann schon. Unter dem linken Stiefelabsatz war ein Kreuz aus Nägeln, um den Teufel abzuhalten.
Im Nu schoß ich hoch und raste den Hügel runter. Ab und zu warf ich einen Blick über die Schulter zurück, aber ich sah niemand. So schnell ich nur konnte, lief ich zu Richter Thatcher.
Er sagte: »Nanu, mein Junge, du bist ja ganz außer Atem. Bist du gekommen, um deine Zinsen abzuholen?«
»Nein, Herr Richter«, antwortete ich, »sind denn welche für mich da?«
»O ja, gestern abend sind Zinsen für ein halbes Jahr eingetroffen. Über hundertfünfzig Dollar. Geradezu ein Vermögen für dich. Laß sie mich lieber zusammen mit deinen sechstausend für dich anlegen, denn wenn du sie nimmst, gibst du sie aus.«
»Nein, Herr Richter«, sagte ich, »ich will sie nicht ausgeben. Ich will sie überhaupt nicht haben – und die sechstausend auch nicht. Ich möchte, daß Sie sie nehmen, ich möchte sie Ihnen schenken – die sechstausend und alles.«
Er guckte erstaunt. Er schien’s nicht zu begreifen. Er sagte: »Wieso, was meinst du nur, mein Junge?«
Ich antwortete: »Bitte, stellen Sie mir keine Fragen drüber. Sie nehmen’s doch, oder nicht?«
Er meinte: »Nun, die Sache ist mir ein Rätsel. Ist irgend etwas geschehen?«
»Bitte, nehmen Sie’s«, sagte ich, »und fragen Sie mich nichts – dann brauch ich nicht zu lügen.«
Er dachte eine Weile nach und sagte dann: »Oho-o. Ich glaube, jetzt verstehe ich’s. Du willst mir dein ganzes Vermögen verkaufen – nicht schenken. So ist es richtig.«
Dann schrieb er was auf ein Blatt Papier, las es noch mal durch und sagte: »Siehst du, hier steht ›für ein Entgelt‹. Das heißt, ich habe es dir abgekauft und dich dafür bezahlt. Hier hast du einen Dollar. So, nun unterschreib.«
Ich unterschrieb also und ging.
Miss Watson ihr Nigger Jim hatte eine faustgroße Haarkugel, die aus dem vierten Magen von ’nem Ochsen rausgenommen worden war, und mit der zauberte er. Er sagte, da drin wäre ein Geist, und der wüßte alles. So ging ich also an diesem Abend zu ihm und erzählte ihm, daß Papa wieder da war, denn ich hatte seine Fußspuren im Schnee gefunden. Was ich nun wissen wollte, war, was er vorhatte und ob er dableiben würde? Jim holte seine Haarkugel raus und besprach sie und ließ sie auf den Fußboden fallen. Sie fiel ziemlich fest auf und rollte ungefähr ’nen Zoll weit. Jim versuchte es noch mal und dann noch mal, und’s war immer das gleiche. Jim ließ sich auf die Knie nieder, hielt sein Ohr an die Kugel und horchte. Es war aber zwecklos; er sagte, sie wollte nicht reden. Er erklärte, manchmal wollte sie ohne Geld nicht reden. Ich antwortete, ich hätte ’n altes, glattes, falsches Fünfundzwanzigcentstück, das nichts taugte, weil das Messing ein bißchen durch das Silber schimmerte und man’s nirgends loswerden könnte, auch nicht, wenn’s nicht durchscheinen würde, weil das Geldstück so glatt war, daß es sich fettig anfühlte, und dadurch würde es sich jedesmal verraten. (Ich dachte, ich wollte lieber nichts von dem Dollar sagen, den ich vom Richter bekommen hatte.) Ich meinte, es wäre ziemlich schlechtes Geld, aber vielleicht würde die Haarkugel es nehmen, weil sie’s vielleicht nicht merkte. Jim roch daran und biß darauf, rieb es und sagte, er wollte’s so einrichten, daß die Haarkugel glaubte, es wäre echt. Er meinte, er wollte ’ne rohe irische Kartoffel aufschlitzen, das Fünfundzwanzigcentstück reinstecken und es die ganze Nacht über drin lassen, und am nächsten Morgen würde man kein Messing mehr dran sehen und es würde sich auch nicht mehr fettig anfühlen, und jeder in der Stadt würde es sofort nehmen, um so mehr noch ’ne Haarkugel. Nun, ich wußte schon, daß eine Kartoffel so wirkt, ich hatte’s bloß vergessen.
Jim legte also das Fünfundzwanzigcentstück unter die Haarkugel, kniete sich wieder nieder und horchte. Jetzt sagte er, ’s wäre alles in Ordnung mit der Haarkugel. Er meinte, sie würde mein ganzes Schicksal voraussagen, wenn ich wollte. Ich sagte, mal los. So redete die Haarkugel also zu Jim, und Jim erzählte es mir.
Er sagte: »Dein alter Vater weiß noch nicht, was er machen will. Manchmal denkt er, er will fort, un’ dann denkt er wieder, er will bleiben. Am besten, du wartst ab un’ läßt den Alten machen. Zwei Engel schweben um ihn rum. Einer ist weiß un’ glänzt un’ der andere ist schwarz. Der weiße bringt ihn dazu, daß er ’ne Weile das Gute tut, un’ dann segelt der schwarze an un’ macht alles wieder kaputt. Es kann noch keiner nich sagen, welcher ihn zum Schluß kriegt. Aber bei dir is’ alles in Ordnung. Du wirst ’nen Haufen Sorgen im Leben haben un ’nen Haufen Freude. Manchmal kommst du zu Schaden, un’ manchmal wirst du krank, aber jedesmal geht’s dir nachher wieder gut. In deinem Leben fliegen zwei Mädchen um dich rum. Eine hat helles Haar un’ die andere dunkles. Eine is’ reich un’ die andere arm. Zuerst heiratst du die arme un’ dann schließlich die reiche. Vom Wasser mußt du wegbleiben, wo du nur kannst, un’ riskier nichts, denn’s steht geschrieben, daß du gehängt wirst.«
Als ich an dem Abend meine Kerze anzündete und auf mein Zimmer ging, saß da mein Papa in eigener Person!
FÜNFTES KAPITELPapa fängt ein neues Leben an
Ich hatte die Zimmertür geschlossen. Als ich mich umdrehte, saß er da. Immer hatte ich Angst vor ihm gehabt, weil er mich so oft verdrosch. Ich dachte, ich hätte jetzt auch Angst vor ihm, aber ich stellte gleich fest, daß ich mich irrte. Das heißt, nach dem ersten Schrecken, wo mir der Atem sozusagen steckenblieb – weil er so unerwartet da war; aber gleich darauf sah ich, daß meine Angst vor ihm überhaupt nicht der Rede wert war.
Er war an die Fünfzig und sah auch so aus. Sein Haar war lang und wirr und fettig und hing ihm runter, und man sah seine Augen durchscheinen, als wenn er hinter Kletterranken stände. Es war ganz schwarz und hatte noch kein Grau drin, und sein langer verhedderter Schnauzbart ebenfalls nicht. Sein Gesicht hatte überhaupt keine Farbe, da, wo man’s sehen konnte; es war weiß, aber seins war kein Weiß wie das bei anderen Leuten, sondern eins, von dem einem übel wurde, eins, von dem man ’ne Gänsehaut bekam – ein Baumkrötenweiß, ein Fischbauchweiß. Und seine Kleidung – die bestand bloß aus Lumpen, aus weiter nichts. Er hatte den Knöchel von einem Fuß auf das Knie von dem andern Bein gelegt; der Stiefel dadran war aufgeplatzt, zwei Zehen guckten raus, und die bewegte er ab und zu. Sein Hut lag auf dem Fußboden – ein alter schwarzer Schlapphut, bei dem der Kopf eingebeult war, wie bei ’nem Topfdeckel.
Ich stand da und glotzte ihn an; er saß da und glotzte mich an und kippte ’n bißchen mit dem Stuhl nach hinten. Ich stellte die Kerze ab. Ich merkte, daß das Fenster offenstand; er war also über den Schuppen reingeklettert. Er glotzte mich immer weiter von oben bis unten an. Schließlich sagte er:
»Nobler Aufzug – was? Du denkst wohl, du bist wer weiß was für ’n großer Herr, was?«
»Vielleicht bin ich einer, vielleicht auch nicht«, antwortete ich.
»Werd nicht frech zu mir«, sagte er. »Hast dir ja einige Flausen in den Kopf gesetzt, seit ich fort bin. Ich werd dir die Flügel schon stutzen, bevor ich mit dir fertig bin. Gebildet bist du auch, wird erzählt – kannst lesen und schreiben. Jetzt glaubst du wohl, du bist was Beßres als dein Vater, was, weil er’s nicht kann? Das werd ich dir schon austreiben. Wer hat dir denn erlaubt, dich mit solch hochtrabendem Blödsinn abzugeben, he? Wer hat dir denn das erlaubt?«
»Die Witwe. Die hat’s mir erlaubt.«
»Die Witwe, he? Und wer hat der Witwe erlaubt, ihre Nase in was reinzustecken, was sie überhaupt nichts angeht?«
»Das hat ihr gar keiner erlaubt.«
»Na, der werd ich’s schon lernen, sich einzumengen! Und paß mal auf – die Sache mit der Schule läßt du sein, verstanden? Ich werd’s den Leuten schon lernen, ’nen Jungen dazu zu erziehen, daß er vor seinem eigenen Vater eingebildet tut und glaubt, er wär’ was Besseres als er. Daß ich dich nicht wieder erwische, wenn du dich bei der Schule rumtreibst, verstanden? Deine Mutter hat nicht lesen können, und schreiben hat sie auch nicht können, bis zu ihrem Tode nicht. Keiner aus der Familie hat’s gekonnt, bis zu seinem Tode nicht. Ich kann’s auch nicht, und du stehst da und pustest dich so auf. Ich bin nicht der Mann, der sich das gefallen läßt, hörst du? Sag mal, lies mir mal was vor.«
Ich nahm ein Buch und fing irgendwas über General Washington und die Kriege an. Als ich ungefähr ’ne halbe Minute gelesen hatte, haute er mit der Hand auf das Buch und schmiß es quer durchs Zimmer. Er sagte: »Tatsächlich. Du kannst’s. Hab noch dran gezweifelt, als du’s mir erzählt hast. Also horch mal her: Hör du auf mit den Flausen. Ich erlaub’s nicht. Ich lauere dir auf, mein Klugscheißer, und erwisch ich dich bei dieser Schule, dann gerb ich dir gründlich das Fell. Eh du dich’s versiehst, wirste auch noch fromm. So was von ’nem Sohn hab ich noch nicht gesehen.«
Dann hob er ein kleines blaugelbes Bild auf, wo ’n paar Kühe und ein Junge drauf waren, und fragte: »Was ist denn das?«
»Das haben sie mir gegeben, weil ich meine Aufgaben gut gelernt habe.«
Er riß es entzwei und sagte: »Ich werd dir was Beßres geben: was mit dem Lederriemen.«
’ne Minute lang saß er knurrend und brummend da, und dann sagte er: »Was für ’n parfümierter Stutzer du doch bist! Ein Bett und Bettwäsche und ’n Spiegel und ’n Stück Teppich auf dem Boden – und dein eigener Vater muß bei den Schweinen in der Gerberei schlafen. So was von ’nem Sohn hab ich noch nicht gesehen. Aber ich werd dir schon ein paar von den Flausen austreiben, eh ich mit dir fertig bin! Du bildest dir ja sonstwas ein – es wird erzählt, du bist reich. He? Wie kommt denn das?«
»Sie lügen – daher kommt das.«
»Horch mal her – paß auf, wie du mit mir redst. Ich laß mir nur so viel gefallen, wie ich mir gefallen lasse, also keine Unverschämtheiten mehr. Ich bin seit zwei Tagen in der Stadt und hab weiter nichts gehört als bloß, daß du reich bist. Flußabwärts hab ich auch davon gehört. Deshalb bin ich hergekommen. Morgen besorgst du mir das Geld – ich brauch’s.«
»Ich hab’ kein Geld.«
»Du lügst. Richter Thatcher hat es. Du holst es. Ich brauch’s.«
»Ich sag dir doch, ich hab kein Geld. Frag Richter Thatcher, der wird dir dasselbe sagen.«
»Na gut, ich frag ihn, und ich werd schon dafür sorgen, daß er’s auspackt – das wär ja noch schöner. Sag mal, wieviel hast du in der Tasche? Ich brauch’s.«
»Ich habe bloß ’nen Dollar, und den brauch ich, um …«
»Ganz egal, für was du den brauchst – rück ihn raus.«
Er nahm ihn und biß drauf, um festzustellen, ob er echt wäre, und dann sagte er, er wollte in die Stadt runtergehen und ein bißchen Whisky holen; er erklärte, er hätte den ganzen Tag noch nichts zu trinken gehabt. Als er auf den Schuppen rausgeklettert war, steckte er den Kopf noch mal zum Fenster rein und beschimpfte mich, weil ich mir Flausen in den Kopf gesetzt hätte und was Beßres sein wollte als er, und als ich dachte, nun wär er weg, kam er wieder und steckte seinen Kopf noch mal zum Fenster rein und sagte, ich soll mich in acht nehmen wegen der Schule, denn er will mir auflauern und mich verprügeln, wenn ich nicht Schluß damit mache.
Am nächsten Tag war er besoffen, und er ging zu Richter Thatcher und verwünschte ihn und versuchte, ihn dazu zu bringen, daß er das Geld rausrückte – das gelang ihm aber nicht; da schwor er, er würde ihn schon noch gerichtlich dazu zwingen.
Der Richter und die Witwe gingen vor Gericht, damit es mich dem Alten wegnahm und einen von ihnen zu meinem Vormund machte; aber der Richter dort war ein neuer, der grade erst gekommen war und meinen Alten noch nicht kannte, darum sagte er, Gerichtshöfe dürften sich nicht einmischen und Familien auseinanderreißen, wenn’s zu umgehen wär; meinte, er wollte einem Vater lieber nicht sein Kind fortnehmen. So mußten Richter Thatcher und die Witwe die Sache aufstecken.
Das gefiel dem Alten so, daß er keine Ruhe mehr geben konnte. Er sagte, er wollte mich mit dem Riemen bearbeiten, bis ich grün und blau wäre, wenn ich ihm nicht Geld besorgte. Ich borgte drei Dollar von Richter Thatcher, und Papa nahm sie und besoff sich und trompetete rum und fluchte und jodelte und machte Krach; so trieb er’s in der ganzen Stadt und schlug auf einen Blechnapf, fast bis Mitternacht; dann lochten sie ihn ein, und am nächsten Tag stellten sie ihn vor Gericht und sperrten ihn noch mal ’ne Woche ins Gefängnis. Aber er sagte, er wäre zufrieden, sagte, über seinen Sohn bestimmte er, und er würde ihm schon einheizen.
Als er rauskam, erklärte der neue Richter, er wollte einen Menschen aus ihm machen. Er nahm ihn mit zu sich nach Hause, kleidete ihn schön sauber und ordentlich ein und ließ ihn Frühstück und Mittagessen und Abendbrot mit der Familie essen und war einfach Zucker zu ihm. Und nach dem Abendbrot redete er mit ihm über Enthaltsamkeit und so was, bis der Alte heulte und sagte, er wär ein Narr gewesen und hätte sein ganzes Leben wie ein Narr vertan, und jetzt würde er ’n neues Blatt aufschlagen und ein Mensch werden, über den sich niemand schämen brauchte, und er hoffte, der Richter würde ihm helfen und nicht auf ihn herabsehen. Der Richter antwortete, für die Worte könnte er ihn umarmen, und so heulte jetzt er, und seine Frau heulte auch; Papa sagte, er wäre ein Mensch, der bisher immer mißverstanden worden wäre, und der Richter antwortete, das glaubte er. Der Alte sagte, was ein Mann, der am Boden läge, brauchte, wäre Mitleid, und der Richter meinte, so wäre’s, und dann heulten sie wieder. Und als Schlafenszeit war, stand der Alte auf und streckte die Hand aus und sagte:
»Sehen Sie sie an, meine Herren und Damen, nehmen Sie sie, schütteln Sie sie. Das ist ’ne Hand, die die Hand von einem Schwein war, aber jetzt ist sie’s nicht mehr; jetzt ist’s die Hand von ’nem Menschen, der ein neues Leben angefangen hat und der lieber sterben will als ins alte zurückzufallen. Merken Sie sich diese Worte – vergessen Sie nicht, daß ich sie sprach. Eine saubere Hand ist das jetzt; schütteln Sie sie – haben Sie keine Bange.«
So schüttelten sie sie denn, allesamt, einer nach dem anderen, und heulten. Dem Richter seine Frau küßte sie. Dann unterschrieb der Alte ein Versprechen und setzte sein Zeichen drunter. Der Richter meinte, das wäre der heiligste Augenblick, an den er sich erinnern könnte, oder so was Ähnliches. Dann steckten sie den Alten in ein wunderschönes Zimmer, das Gästezimmer, und irgendwann in der Nacht bekam er mächtigen Durst und kletterte auf das Verandadach raus und rutschte am Pfosten runter und verscheuerte seinen neuen Rock gegen einen Krug Fusel, und dann kletterte er wieder zurück und feierte ordentlich; und gegen Morgengrauen kletterte er noch mal raus, stockbesoffen, rollte von der Veranda runter, brach sich den linken Arm an zwei Stellen und war schon fast erfroren, bis ihn jemand fand, als die Sonne aufgegangen war. Und als sie sich dann das Gästezimmer ansahen, mußten sie’s ausloten, bevor sie’s befahren konnten.
Der Richter war ziemlich verärgert. Er sagte, mit ’nem Schießgewehr könnte man, glaubte er, den Alten vielleicht bessern, aber einen andern Weg wüßte er nicht.
SECHSTES KAPITELPapa kämpft mit dem Todesengel
Na, der Alte war bald wieder auf und trieb sich rum, und dann verfolgte er Richter Thatcher gerichtlich, um ihn zu zwingen, das Geld rauszurücken, und mich verfolgte er auch, weil ich nicht aufhörte, zur Schule zu gehen. Zweimal erwischte er mich und verdrosch mich, aber ich ging trotzdem zur Schule, und meistens wich ich ihm aus oder rannte ihm davon. Vorher war ich nicht sehr gern zur Schule gegangen, aber jetzt dachte ich mir, ich gehe nun gerade hin, um Papa zu ärgern.
Der Prozeß war eine langwierige Angelegenheit; es sah aus, als ob sie überhaupt nicht damit anfangen würden; ich borgte mir also hin und wieder beim Richter zwei, drei Dollar für Paps, damit ich nicht eine Tracht mit dem Lederriemen bekam. Jedesmal, wenn er Geld kriegte, besoff er sich, und jedesmal, wenn er sich besoff, spektakelte er in der Stadt rum, und jedesmal, wenn er rumspektakelte, wurde er eingesperrt. Das gefiel ihm gut – so ’n Leben war genau das Richtige für ihn.
Mit der Zeit trieb er sich zuviel bei der Witwe ihrem Haus rum, und schließlich sagte sie zu ihm, wenn er nicht aufhörte, da rumzulungern, würde sie ihm Unannehmlichkeiten machen. Na, da war er vielleicht wütend! Er sagte, er würde ihr schon zeigen, wer über Huck Finn zu bestimmen hätte. So lauerte er mir denn eines Tages im Frühjahr auf, fing mich ein und nahm mich in ’nem Boot ungefähr drei Meilen weit flußabwärts mit, fuhr rüber zum Ufer von Illinois, wo es bewaldet war und kein Haus gab außer ’ner alten Blockhütte, an einer Stelle, die so dicht bewachsen war, daß man die Hütte nicht fand, wenn man nicht wußte, wo sie stand.
Er behielt mich die ganze Zeit über bei sich, und ich bekam überhaupt keine Gelegenheit auszurücken. Wir lebten in der alten Hütte, und nachts schloß er die Tür ab und legte sich den Schlüssel unter den Kopf. Er hatte ein Gewehr, das er, glaub ich, gestohlen hatte, und wir fischten und jagten, und davon lebten wir. Hin und wieder schloß er mich ein und ging zum Laden runter, drei Meilen bis zur Fähre, tauschte Fisch und Wild gegen Whisky ein und brachte den nach Haus und besoff sich, amüsierte sich großartig und verprügelte mich. Nach ’ner Weile machte die Witwe ausfindig, wo ich steckte, und schickte einen Mann rüber, der versuchen sollte, mich zu erwischen, aber Paps jagte ihn mit dem Gewehr davon, und es dauerte dann nicht mehr lange, bis ich mich dort an alles gewöhnt hatte und es mir gefiel – bloß die Sache mit dem Lederriemen nicht.
Das war ein faules und vergnügliches Leben, den ganzen Tag da so bequem rumzuliegen, zu rauchen und zu fischen, ohne Bücher und ohne lernen zu müssen. Zwei Monate oder noch mehr vergingen, und meine Kleidung bestand nur noch aus Lumpen und war ganz schmutzig, und ich verstand gar nicht mehr, wie’s mir je bei der Witwe hatte gefallen können, wo man sich waschen, von einem Teller essen, sich kämmen und regelmäßig zu Bett gehen und aufstehen, sich ewig über ’nem Buch den Kopf zerbrechen und sich dauernd von Miss Watson piesacken lassen mußte. Ich wollte jetzt nicht mehr zurück. Ich hatte aufgehört gehabt zu fluchen, weil es der Witwe nicht gefiel, aber jetzt gewöhnte ich’s mir wieder an, weil Paps nichts dagegen hatte. Alles in allem war es ganz schön da oben im Wald.
Aber mit der Zeit war Paps immer rascher mit dem Hickoryknüppel bei der Hand, und ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich hatte am ganzen Körper Striemen. Außerdem gewöhnte er sich auch an, sehr oft fortzugehen und mich einzuschließen. Einmal sperrte er mich ein und blieb drei Tage fort. Da war es schrecklich einsam. Ich dachte, er wär ersoffen und ich würde überhaupt nicht mehr rauskommen. Ich hatte Angst. Da beschloß ich, es irgendwie zu deichseln, daß ich von dort fort könnte. Ich hatte schon oft versucht, aus der Hütte rauszukommen, aber ich konnte keinen Weg finden. Ein Fenster, das auch nur groß genug gewesen wäre, um einen Hund durchzulassen, war nicht drin. Zum Schornstein konnte ich auch nicht raus, der war zu eng. Die Tür bestand aus dicken, massiven Eichenbohlen. Paps achtete recht sorgfältig drauf, daß er kein Messer oder so was in der Hütte ließ, wenn er fortging; ich schätze, ich hatte die Hütte bestimmt schon hundermal durchstöbert, denn damit war ich ja fast dauernd beschäftigt, weil’s so ziemlich das einzige war, womit ich mir die Zeit vertreiben konnte. Aber diesmal fand ich endlich was – ich fand eine alte rostige Säge ohne Griff. Sie lag zwischen ’nem Dachbalken und den Schindeln. Ich fettete sie ein und machte mich an die Arbeit. An der Rückwand von der Hütte, hinter dem Tisch, war vor die Balken eine alte Pferdedecke genagelt, damit der Wind nicht durch die Ritzen blies und die Kerze auspustete. Ich kroch unter den Tisch, hob die Decke hoch und machte mich dran, ein ordentliches Stück von dem dicken untersten Balken auszusägen, das groß genug war, um mich durchzulassen. Na, das war ’ne schön langwierige Arbeit, aber ich hatte nicht mehr lange zu tun, bis ich fertig war, als ich Paps Gewehr im Walde hörte. Ich beseitigte die Spuren von meiner Arbeit, ließ die Decke runter und versteckte meine Säge, und schon ziemlich bald dadrauf kam Paps rein.
Er war nicht gut gelaunt – und so war er also ganz in seiner normalen Verfassung. Er sagte, er wäre unten in der Stadt gewesen und alles ginge schief. Sein Anwalt hätte gesagt, er rechnete damit, daß er seinen Prozeß gewinnen und das Geld kriegen würde, wenn sie je damit anfingen, aber es gäb Wege, um ihn lange hinauszuschieben, und Richter Thatcher wüßte, wie das zu machen wäre. Und er sagte, die Leute wären der Ansicht, es würde noch ’nen zweiten Prozeß geben, um mich ihm wegzunehmen und der Witwe zu geben, die mein Vormund werden sollte, und sie glaubten, diesmal würde er gewonnen werden. Das gab mir ’nen mächtigen Schock, weil ich nicht mehr zur Witwe zurück und nicht mehr so eingezwängt sein und siwilisiert werden wollte, wie sie’s nannten. Dann fing der Alte an zu fluchen und verfluchte alles und jeden, der ihm nur einfiel, und dann verfluchte er sie alle noch mal, um sicher zu sein, daß er keinen übergangen hatte, und danach rundete er’s ab mit einer Art Sammelfluch, der ’nen beträchtlichen Haufen Leute einschloß, von denen er die Namen nicht wußte, und darum nannte er sie Wie-heißt-er-doch, wenn er bei ihnen angelangt war, und fluchte dann munter weiter.
Er sagte, er wollte ja mal sehen, ob die Witwe mich kriegte. Er meinte, er würde aufpassen, und wenn sie versuchen sollten, irgend so ’nen Dreh mit ihm zu machen, dann wüßte er einen Ort, sechs oder sieben Meilen weiter, wo er mich verstauen würde, und dann könnten sie nach mir suchen, bis sie umfielen, und würden mich doch nicht finden. Das beunruhigte mich ziemlich, aber bloß für ’nen Augenblick; ich dachte mir, ich würde nicht dableiben, bis er Gelegenheit dazu hätte.