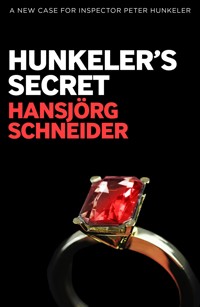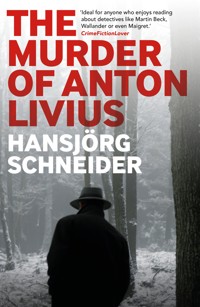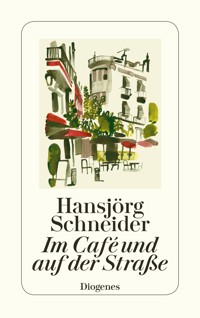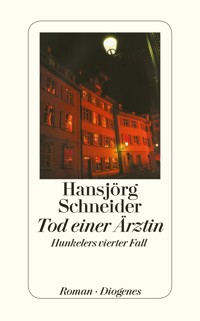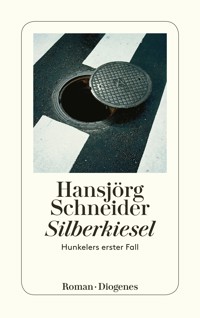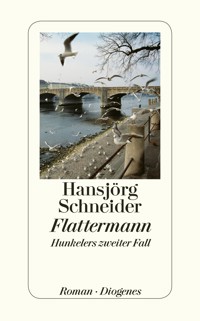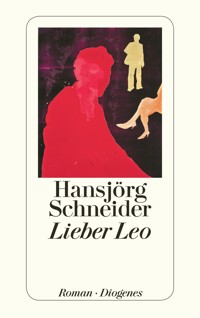8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissär Hunkeler
- Sprache: Deutsch
in havariertes Hausboot auf dem Rhein. Ein verschwundener Intendant. Ein handfester Theaterskandal. Eine unwahrscheinliche Liebe. Und ein paar alte Rechnungen. Peter Hunkeler vom Kriminalkommissariat Basel ermittelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hansjörg Schneider
Hunkelerund die Augendes Ödipus
Der achte Fall
Roman
Die Erstausgabe
erschien 2010 im Diogenes Verlag
Eine erste Ausgabe als
Diogenes Taschenbuch ist 2012 erschienen
Die beiden Texte ›Vom ertrunkenen Mädchen‹ und
›Kinderkreuzzug‹ (1Strophe) sind entnommen aus:
Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte
Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11, Band 12
Copyright © 1988 by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
Umschlagfoto von Christian Aeberhard (Ausschnitt)
Copyright © Christian Aeberhard/VISUM
Die Personen und die Handlung
des Romans sind frei erfunden, jede Ähnlichkeit
mit realen Personen oder Begebenheiten
ist rein zufällig
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24238 6 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60043 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Am Morgen des 24.April, es war ein Freitag, wurde Willy Dreier, Inhaber der Wirtschaft Stauwehr bei Märkt im deutschen Markgräflerland, von einem dumpfen, knirschenden Geräusch, welches das stete Rauschen des Wassers übertönte, geweckt. Er sah auf dem Wecker, dass es kurz vor sieben war. Punkt sieben hatte er aufstehen wollen, um den Keller zu reinigen und vorzubereiten für eine Lieferung Wein vom Tüllinger Hügel. Am Freitag, dem 1.Mai, wollte er sein Lokal für die kommende Sommersaison eröffnen.
Er fragte sich, ob er geträumt hatte, und blieb eine Weile liegen. Da das Geräusch nicht nachließ, sondern sich im Gegenteil steigerte, als ob Eisen gegen Eisen stieße, erhob er sich, schlüpfte in Hose und Hemd und trat vor die Tür.
Die Auenlandschaft lag in leichtem Nebel. Die Sonne war noch nicht zu sehen. Ein Chor von Vögeln besang das aufkommende Morgenlicht.
Das fremde Geräusch, das ihn geweckt hatte, war verstummt. Er überlegte, ob er zurückgehen sollte ins Haus, um zu frühstücken und mit der Arbeit zu beginnen. Da hörte er einen langgezogenen, schrillen, schleifenden Ton. Er erstarb. Es war nur noch das Wasser zu hören, das übers Wehr fiel.
Er ging die wenigen Meter durch das morgenfeuchte Gras zum Damm, kletterte hinauf und schaute über den Fluss, der breit wie ein See vor ihm lag. Dicht am Ufer schwammen ein paar hundert Reiherenten, die aus dem Norden hergeflogen waren, um hier zu überwintern. Drüben war das französische [6] Ufer. Er hörte die Kirche von Huningue sieben Uhr schlagen. Eine Schar Kormorane flog flussaufwärts Basel zu.
Der Rhein war hier gestaut. Auf französischer Seite floss das Wasser in den Kanal, auf dem die Schiffe hinunterfuhren zu den Schleusen von Kembs. Auf deutscher Seite lag der alte Flusslauf, der mit mehr oder weniger Wasser versorgt wurde, je nach Pegelstand. Die Betonkonstruktion des Wehrs ragte in den grauen Himmel, zuverlässig und beruhigend sicher.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Träger sah Willy Dreier etwas, was er noch nie gesehen hatte. Ein knapp acht Meter langes, älteres Schiff war auf die Stahlplatte, die das Wasser zurückhielt, aufgefahren. Sein Bug war eingedrückt. Er ragte über den Wasserspiegel, als ob er das Wehr hätte rammen und überspringen wollen.
Willy Dreier ging auf die Brücke zu der Insel, die Kanal und Altrhein trennte. Er schaute hinüber zum Schiff, das an der Stahlwand festsaß. Es war ein Hausboot und hieß Antigone, der Name stand in weißer Farbe auf dem Bug. Die Tür war offen, in der Stube brannte ein Licht. Willy Dreier rief mehrmals hinüber, so laut er konnte. Er bekam keine Antwort, es bewegte sich nichts.
Vierzig Minuten später fuhr ein Schlauchboot der deutschen Wasserschutzpolizei heran mit zwei Männern. Sie drosselten den Außenbordmotor, wendeten und legten an der Antigone an. Willy Dreier sah vom Ufer aus, wie sie sich unterhielten. Zu verstehen waren sie nicht, wegen des Wasserrauschens. Offenbar trauten sie sich nicht, das lecke Wohnboot zu betreten. Sie fuhren zurück zum Heck, und einer vertäute dort ein Seil. Der Motor wurde aufgedreht und zog an, [7] das Seil spannte sich. Langsam glitt die Antigone von der eisernen Wand, lag etwas schief im Wasser, war aber augenscheinlich noch flott genug, um abgeschleppt zu werden. Der Motor des Schlauchboots heulte auf und gewann an Fahrt flussaufwärts, Richtung Wirtschaft Auwald, vor der ein kleiner Hafen lag.
Am selben Morgen um elf verschickte Kommissar Christian Rotzinger von der Landespolizei Lörrach ein Rundschreiben, das unter anderem auch ans Kriminalkommissariat Basel und an die Gendarmerie St.Louis ging. Das Wohnboot Antigone, das im Rheinhafen Breisach angemeldet war und einem Bernhard Vetter gehörte, einem Mann von deutscher Nationalität mit Jahrgang 1937, wohnhaft in Basel am St.
[8] Peter Hunkeler, Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, früherer Familienvater, jetzt geschieden, erwachte, da er einen Hahn krähen hörte. Er fragte sich, was da los war, wo er sich befand. War er im Haus seiner Kindheit, das neben einem Bauernhof stand, auf dem er sich jede freie Minute herumtrieb? Im Kuh- oder Rossstall, auf dem Tenn, in der riesigen Küche, in der eine alte Frau Kartoffeln schälte? Davon hatte er wohl bloß geträumt, sehr undeutlich, wie ihm schien. Er konnte sich an kein konkretes Traumbild erinnern.
Nein, das Krähen, das regelmäßig ein- und wieder aussetzte, gehörte zur wirklichen Welt, in die er jetzt widerstrebend zurückfand. Als er die Augen öffnete, wusste er es. So erbärmlich krähte nur Hahn Fritz.
Er befand sich also in seinem Haus im Elsass. Neben ihm lag seine Freundin Hedwig. Er spürte ihren Atem am Hals, sah ihren weißen, schönen Rücken, den sie abgedeckt hatte, obschon eine frische Kühle durchs offene Fenster hereinkam.
Er schob Hedwigs Oberschenkel weg, den sie über sein linkes Bein gelegt hatte. Leise stand er auf, um ihren Morgenschlaf nicht zu stören, zog sich an und durchquerte Stube und Gang. Er öffnete die Küchentür und löffelte den beiden Katzen, die ihm mit aufgestelltem Schwanz gefolgt waren, den Napf mit Büchsenfleisch voll. Dann trat er vors Haus, sah zum Nachbarn hinüber, in dessen Stall Licht brannte, [9] und ging durch die Wiese zum Hühnerstall unter dem Scheunendach. Er schaute hinein in die Ecke, ob Eier dalagen. Es waren drei da. Gespannt sah er zu, wie die Hühner herauskamen. Sie gackerten zögernd, sie ließen sich Zeit, dann setzten sie Fuß vor Fuß. Zuletzt kam der Hahn, der wie gewohnt erst seine Weiber vorgeschickt hatte.
Hunkeler holte die Eier aus der Ecke, trug sie zum Tisch an der Hausmauer und setzte sich. Vom Kirchturm hörte er es sieben schlagen. Das Sonnenlicht fiel flach auf die Bäume, auf Pappel, auf Kirsch- und Birnbaum und die Trauerweide, die ihr erstes, helles Laub bis auf den Boden hängen ließ.
Heute war der 26.April, überlegte er. Ein Sonntagmorgen, ein friedlicher Feiertag. Hedwig hatte gestern Abend einen Butterzopf aus der Stadt mitgebracht. Den würden sie zum Frühstück aufschneiden, mit Honig bestreichen und gemächlich essen. Dann würden sie sich auf den Weg machen zum Sonntagsspaziergang durch den Wald. Nach der Messe, so gegen elf Uhr, wären sie zurück, und er würde die Motorsäge anwerfen, um Brennholz zu machen für den nächsten Winter. Der Sonntag war in diesem Dorf nicht nur ein Tag des Herrn, sondern auch ein Tag der Motorsense, der Motorhacke, der Motorheckenschere. Und Hunkelers Motorsäge würde mitheulen. Er hatte vor, aus seinem Anwesen ein Energiesparhaus zu machen. Nicht mit Isolierung und Wärmedämmung, sondern indem er die nachwachsende Energie, das Holz, verwertete.
Er stand sechs Wochen vor seiner Pensionierung. Wohlverdient, wie Staatsanwalt Suter bemerkt hatte. Er wolle ihn nicht gerade als Auslaufmodell bezeichnen, hatte er in seiner humorigen Art gemeint. Aber es sei Zeit, langsam ans [10] Aufhören zu denken und einen neuen Anlauf zu nehmen, einen Anlauf in die Freiheit des Alters.
Hunkeler grinste bitter. War vielleicht Hahn Fritz ein Auslaufmodell? Nein, der pickte geschäftig mit den Hennen im Gras herum, als ob es sein Leben gegolten hätte. Obschon am Abend leckere Körner auf ihn warteten. Der würde weiterhin picken und scharren, was das Zeug hielt, bis er von der Stange fiel. Aus dem einfachen Grund, weil Hunkeler es nicht übers Herz brachte, ihn totzuschlagen.
Die Freiheit des Alters, was war denn das? Die Freiheit, zu verblöden bis zur endgültigen Senilität? Er spürte ein Grauen in sich aufsteigen. Es war ihm, als sträubten sich seine Nackenhaare. Vorsichtig strich er über seinen Hinterkopf.
Gewiss, die Rente war ihm sicher. In diesem Punkt fühlte er sich solidarisch mit Hahn Fritz. Die Schweiz war eine direkte Demokratie. Hier wurde über wichtige Dinge wie zum Beispiel Rentenkürzungen abgestimmt. Bei Abstimmungen hatten die Senioren die Mehrheit. Die würden in geschlossenen Viererkolonnen zur Urne marschieren, wenn es um ihre Rente ging. Auch wenn niemand wusste, woher das Geld kommen sollte.
Wieder grinste Hunkeler, mit einiger Bitternis. Er mochte sein Land. Er fand die Volksherrschaft richtig, obwohl er das Volk manchmal stupide fand.
Er selbst war überzeugt, dass er noch gebraucht werden würde. Seine Erfahrung, seine Menschenkenntnis, fand er, waren unersetzlich. Im Allgemeinen hielt er sich für die Bescheidenheit in Person. Jetzt merkte er, dass er doch eine hohe Meinung von sich hatte. Aber dies war ja wohl die Meinung aller alten Knacker, die in Rente gingen.
[11] Immerhin würde er seinen letzten Fall in allem Anstand abschließen. Vor einer knappen Woche war auf dem Basler Dreispitz aus einem Möbellager ein Tresor entwendet worden. Offenbar waren es zwei Minderjährige aus einer fahrenden Familie, die bei Magstatt-le-Bas einen Standplatz hatte, gewesen. Zwei Jungen, die am frühen Morgen eine Menge Dynamit in die Luft gejagt hatten, um den Tresor loszusprengen. Paul Wirz von der Gendarmerie St.Louis, mit dem Hunkeler in diesem Fall zusammenarbeitete, vermutete, dass der Tresor irgendwo in der Nähe der Grenze versteckt war. Aufsprengen würden ihn die beiden Jungen wohl nicht können, dazu brauchte es mehr als Dynamit. Am Schluss des Verfahrens würden die Kinder zwar verurteilt, aber nicht eingesperrt werden, weil sie nach Strafrecht zu jung waren. Ein Bagatellfall also, der Hunkeler die Gelegenheit gab, sich gemächlich auf den Ruhestand vorzubereiten.
Eigenartig war bloß die Tatsache, dass auf dem Dreispitz zur Tatzeit ein weißer Kastenwagen mit Pariser Kennzeichen gesichtet worden war, von zwei Taxifahrern, die unabhängig voneinander behaupteten, darin hätten zwei junge Männer arabischen Aussehens gesessen. Auf die Frage, wie sie dies zu nächtlicher Stunde hätten feststellen können, hatten beide erklärt, sie hätten die Führerkabine mit dem Fernlicht gestreift. Der eine war der Meinung, es seien zwei Männer aus Marokko gewesen, der andere tippte auf Algerien.
Ein weißer Kastenwagen mit Pariser Kennzeichen war auch in Kappelen gesichtet worden, wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Wie Paul Wirz berichtete, gehörte er [12] zwei Tunesiern, die in den Dörfern des Sundgaus von Haus zu Haus gingen und kleine Teppiche feilboten. Was nichts Außergewöhnliches war, abgesehen davon, dass es sich bei diesen fliegenden Händlern meist um Schwarze handelte. Paul Wirz hatte sie als wahre Landplage zu bezeichnen beliebt. Was keineswegs politisch korrekt war, aber, so Wirz, seinem nationalen Denken entsprach.
Hunkeler hatte zwei Eier gekocht, Kaffee und Schwarztee aufgegossen, Tee für sich, Kaffee für Hedwig. Er hatte im Herd ein Feuer gemacht und die Kaminklappe so gestellt, dass der heiße Rauch durch die Ofenkunst in der Stube zog. Jetzt saß er am Küchentisch, auf dem Sims draußen die Katzen im Sonnenlicht, und aß. Erst ein Ei, dann ein Stück Zopf, das er mit Butter und Honig bestrichen hatte.
Die Tür ging auf, Hedwig kam herein, im blauen Morgenrock. Sie setzte sich und klopfte das Ei auf, das er ihr hingestellt hatte. Sie schaute ihn an.
»Ach so«, sagte sie, »du hältst es nicht aus.«
»Was halte ich nicht aus?«
Sie klaubte sorgfältig die Schale vom Ei, streute Salz und Pfeffer drauf.
»Das Nichtstun. Du solltest dich langsam gewöhnen daran.«
»Ich mache schon Fortschritte«, sagte er. »Ich hocke den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag im Büro, löse Kreuzworträtsel und lese im Internet Zeitung. Ich kenne mich bestens aus im aktuellen Zeitgeschehen. Ich bin schon gestern Mittag hierhergefahren, um Holz zu hacken. Aber weißt du was? Ich sterbe vor Langeweile.«
[13] Hedwig biss in ein Stück Zopf, goss Milch in den Kaffee und trank. Sie tat das mit langsamen, trägen Bewegungen.
»Mir graut«, sagte sie, »wenn ich an deine Pensionierung denke.«
»Verstehe ich gut, mir auch. Aber was soll ich tun?«
»Warum kannst du nicht loslassen?«
»Was soll ich loslassen?«, brüllte er. »Mein Leben? Oder dich?«
Er erhob sich so abrupt, dass die beiden Katzen auf den Rasen hinuntersprangen. Er schmiss die Küchentür hinter sich zu, ging in die Scheune und warf die Motorsäge an. Dafür war es zwar noch zu früh, er hätte bis nach der Messe warten sollen. Aber das war ihm egal. Die konnten ihn alle mal, und zwar kreuzweise, diese Heuchler vor dem Herrn, die in der Kirchenbank knieten und sangen. Kein Mensch im ganzen Dorf glaubte mehr an die Wiederauferstehung Christi, davon war er überzeugt. Kein einziger!
Er machte sich über den Stamm der Rottanne her, die der Sturm vor zehn Jahren umgeworfen hatte. Er sah das Sägeblatt durch den Stamm fahren, das Holzmehl wegstieben, er roch den Duft von Harz. Eine schöne, gute Arbeit. Er würde die ganze Scheune mit Holz füllen, kunstvoll aufgeschichtet. Vielleicht würde er draußen unter dem Nussbaum eine Beige in Igluform aufbauen, wie man es früher gemacht hatte. Und zwar so, dass alle Scheite leicht gegen außen abfielen und den Regen abtropfen ließen.
Als der Stamm der Tanne in handliche Stücke zersägt war, hatte er sich wieder beruhigt. Das fing ja gut an, dachte er, wenn er schon jetzt, wo er noch in Amt und Würden war, durchdrehte wie der letzte Choleriker.
[14] Er sah Hedwig hereinkommen. Sie hatte sein Handy bei sich. Er stellte die Motorsäge ab.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Es soll nicht mehr vorkommen.«
»Ich verstehe dich schon. Aber lass deine Wut am Holz aus, und nicht an mir. Es ist übrigens Lüdi.«
Sie gab ihm das Handy.
»Ja«, sagte er, »was gibt’s am heiligen Sonntag?«
Er hörte ein leises Kichern. Das war so bei Lüdi. Er merkte es selbst nicht, aber er kicherte andauernd.
»Was tust du?«
»Holz sägen. Für die kalten, einsamen Nächte, die auf mich warten. Was gibt’s?«
»Heute Nachmittag ist Rapport im Waaghof. Um 16Uhr. Du sollst auch kommen, hat Suter gemeint.«
»Warum? Sag ihm, ich sei ein Auslaufmodell, er könne mich mal.«
Aber Lüdi ließ sich nicht beirren.
»Du kennst doch das Hausboot Antigone«, sagte er, »du hast vor zwei Jahren damit zu tun gehabt.«
»Ja, es gehört Bernhard Vetter. Der wohnt darauf, obschon er eigentlich nicht dürfte. Jedenfalls nicht auf Schweizer Gebiet. Wir haben ein Auge zugedrückt, weil er in Basel gemeldet ist, am St.Alban-Rheinweg. Und weil er Theaterdirektor ist. Ein Theaterdirektor darf alles.«
»Das Boot ist am Freitagmorgen am Wehr bei Märkt gefunden worden, ziemlich havariert. In der Stube brannte noch Licht. Es war niemand drauf. Von Bernhard Vetter fehlt jede Spur. Das hat Christian Rotzinger gemeldet.«
Hunkeler stützte sich auf den Sägebock und überlegte.
[15] »Was soll das?«, fragte er. »Soviel ich weiß, hat Vetter in den letzten Jahrzehnten nur noch auf dem Wasser übernachtet, da er auf festem Boden nicht mehr einschlafen kann. Wegen eines Traumas, das er sich als Junge in den Bombennächten von Dortmund geholt hat.«
»Stimmt genau«, sagte Lüdi.
»Dann ist das Wasser doch sein Element. Der fällt nicht einfach hinein und ertrinkt.«
»Auch das stimmt.«
»Wo könnte er denn sein?«
»Er ist international ausgeschrieben. Bis jetzt hat sich niemand gemeldet.«
»Wer hat die Verfahrensleitung?«
»Madörin.«
»Warum nicht ich?«
»Das weißt du doch. Vielleicht dauert das Verfahren länger als sechs Wochen.«
Ach so, ja. Das hätte Hunkeler beinahe vergessen.
»Gut«, sagte er, »ich werde da sein.«
Er rollte über die Hohe Straße Basel zu. Die Fahrbahn war leer, die Elsässer saßen wohl alle beim Sonntagsbraten, an langen, schwerbeladenen Tischen, von der Grand-mère bis zum Petit-fils. Die Aprilsonne beschien die weite Landschaft, ein bisschen zu grell, wie Hunkeler dachte. Ein Zeichen dafür, dass das Wetter bald umschlagen würde.
Er fuhr den langgezogenen Hügel hinunter. An verkrüppelten Apfelbäumen vorbei, die bloß noch hier standen, weil die Besitzer zu faul waren, sie umzuhauen. Vorbei an riesigen Äckern, wo Mais angesät war. Die Milchwirtschaft war [16] längst nicht mehr profitabel, die Bauern produzierten für die chemische Industrie.
Links drüben erhoben sich die Vogesen, der Grand Ballon trug noch Schnee. Rechts der dunkle Jura. Gegenüber im Osten der Schwarzwald, auch der Belchen leuchtete weiß. Unten in der Ebene der EuroAirport. Daneben die Hochhäuser der Chemie, weiter rechts die alte Stadt Basel.
Kurz nach Mittag parkte er vor seiner Wohnung in der Mittleren Straße. Er ging die paar Meter zum Sommereck. Am Stammtisch saß Edi, vor sich ein Glas Tomatensaft.
»Warum sitzt du nicht draußen im Garten?«, fragte Hunkeler. »Die Sonne würde dich wärmen.«
»Nichts da, nicht im April. Erst im Mai.«
»Wo sind deine Gäste?«
»Was für Gäste? Du bist mein einziger Gast.«
»Was soll der Tomatensaft?«
»Der soll mich am Leben erhalten. Ich habe dem Arzt gesagt, dass ich nicht an meinem Übergewicht sterben werde, sondern an meinem Hunger.«
Edi brachte 140Kilo Lebendgewicht auf die Waage.
»Ich hätte da noch eine Wildsaupastete aus Ferrette«, sagte er, »mit Weißbrot und Essigzwiebeln eine Delikatesse.«
»Dann fahr auf.«
Edi verschwand in der Küche. Hunkeler blätterte in den beiden Sonntagszeitungen, die auf dem Tisch lagen. Beide berichteten groß über die havarierte Antigone, die Zürcher Boulevardzeitung sogar auf der ersten Seite. »Ich hörte es krachen«, so der Titel. Darunter war ein Mann am Wasser zu sehen, der Willy Dreier hieß und Wirt der Wirtschaft Stauwehr war.
[17] Der Artikel war vom dicken Hauser gezeichnet, der unweit von Hunkeler an der Colmarerstraße wohnte. Es war offensichtlich, dass er die Havarie der Antigone zur großen Geschichte ausbauen wollte. Hatte Vetter Feinde, fragte er, die ihm ans Leben wollten? Hatte seine unbarmherzig konsequente Arbeitsweise, mit der er die verkrusteten Strukturen des überlebten Bildungstheaters aufzubrechen, die von einem faschistoiden Polizeiapparat unterdrückten Widersprüche und Spannungen der durchökonomisierten Gesellschaft auf die Bühne zu stellen versuchte, zu seinem Verschwinden geführt? Und wer waren die Täter? Verbargen sie sich hinter den Masken der ach so kunstsinnigen Basler Milliardäre, die mit der chemischen Industrie die halbe Welt vergifteten, siehe Seveso und Schweizerhalle?
Diese Sätze verwunderten Hunkeler sehr. Er wusste zwar, dass Hauser aus dem Luzerner Hinterland nach Basel gekommen und hier nie recht heimisch geworden war. Aber warum hatte die Redaktion in Zürich diese hasserfüllten Tiraden abgesegnet? Es war noch keineswegs ausgemacht, dass Vetter umgekommen war. Oder wusste Hauser mehr?
Woher hatte er überhaupt diese Begriffe? Faschistoid und durchökonomisiert? Widersprüche und Spannungen? Hatte er die linken Soziologen gelesen? Das glaubte Hunkeler nicht. Vielleicht hatte er einen Einflüsterer, der sich im Theaterjargon auskannte.
Klar war, dass das Boulevardblatt Vetters Verschwinden zum heißen Thema machen wollte. Die Auflage der Zeitung war rückläufig. Da konnte es nicht schaden, wieder einmal auf die Schwesterstadt Basel einzuschlagen. Das hieß, dass [18] auf die Sonderkommission unter Leitung Madörins enormer Druck zukommen würde.
Hunkeler grinste. Zum Glück war er nicht der Verfahrensleiter. Er würde sich der Motorsäge und seinem Brennholz widmen.
Edi kam aus der Küche mit der Pastete, die in eine Tonschüssel eingelegt war, und mit einer Flasche Riesling im Eiskübel.
»Für mich bloß Wasser«, sagte Hunkeler, »sonst schlafe ich gleich ein.«
»Wieso? Du bist doch bald in Rente, da kannst du den ganzen Nachmittag schlafen.«
Edi holte eine Flasche Wasser.
»Hast du gelesen?«, sagte er. »Wenn du mich fragst, liegt er auf dem Grund des Rheins.« Er stieß seinen Löffel in die Pastete, brach ein Stück Weißbrot ab, dass es krachte.
»Warum?«, fragte Hunkeler. »Vielleicht hatte er einfach genug vom Theater und liegt jetzt in der Südsee am Palmenstrand.«
Die Pastete schien hervorragend zu schmecken. Niemand fraß so hemmungslos wie Edi. Auch Hunkeler schlug seinen Löffel hinein.
»Warum sollte er? Der verdient enorm viel Geld. Alles subventioniert. Von uns, den Steuerzahlern. Warum sollte er abhauen? Mir würde es auch gutgehen, wenn ich subventioniert würde.«
»Ich habe einmal gelesen«, sagte Hunkeler, »dass das Theater eine moralische Anstalt sei. Das bist du nicht.«
»Was bin ich nicht?«
»Eine moralische Anstalt.«
[19] »Willst du etwa behaupten, ich sei eine unmoralische Anstalt?« Edis Kinn glänzte fettig, die Schüssel war bereits halb leer. »Gut kochen ist auch moralisch. Es gibt nichts Moralischeres als ein gutes Essen. Ein gutes Essen hebt die Moral enorm. Warum soll der Staat diese Schwätzer subventionieren und nicht uns, die Köche? Warum stellt Basel diesen Theatertempel mitten in die Stadt und nicht einen Fresstempel? Da hätten die Leute bestimmt mehr davon.« Er schabte die letzten Reste der Wildsau aus der Schüssel. »Wann bist du zum letzten Mal im Theater gewesen?«
»Ich weiß nicht«, sagte Hunkeler. »Vor zehn Jahren vielleicht. Oder vor zwanzig Jahren.«
»Siehst du? Du bist doch ein gebildeter Mann. Wer soll denn ins Theater gehen, wenn nicht du?«
Beim Rapport im Waaghof war die übliche Mannschaft anwesend, Madörin, Haller, Lüdi und Hunkeler. Vom Technischen Dienst war de Ville da. Von der Landespolizei Lörrach Rotzinger, von der Gendarmerie St.Louis Wirz. Staatsanwalt Suter, in hellblauem Flanell mit grasgrüner Krawatte, leitete die Sitzung. Er wirkte überaus nervös. Er deutete auf die Zeitungen, die vor ihm auf dem Tisch lagen.
»Das hier, meine Herren«, sagte er, »sind Zeitungen aus Deutschland. Aus München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Von den Sonntagszeitungen aus Zürich ganz zu schweigen. Alle diese Blätter berichten groß über das Verschwinden unseres verehrten Theaterdirektors Bernhard Vetter. Und überall wird angedeutet, dass es sich dabei um ein gewaltsames Verschwinden handeln könnte. Als ob wir in unserer alten Humanistenstadt nichts Besseres zu tun hätten, als [20] unseren Intendanten umzubringen. Das ist ein Riesenskandal. Wir haben nichts dagegen, wenn Basel in die internationalen Schlagzeilen kommt. Aber bitte nicht mit üblen Verleumdungen, sondern mit kulturellen Höchstleistungen wie der Art Basel oder dem Beyeler-Museum. Der Imageschaden ist schon jetzt enorm. Es gilt, möglichst schnell Gegensteuer zu geben und Vetter ausfindig zu machen. Dies ist nicht ein gewöhnlicher Vermisstenfall, meine Herren. Diesmal geht es um die Ehre unserer Vaterstadt. Ich bitte Sie alle, mit Volldampf an die Arbeit zu gehen und nicht eher zu ruhen, bis wir dieses üble Missverständnis aus der Welt geschafft haben.«
Hier stockte seine Rede, er schien sehr traurig zu sein. Er war eben nicht nur ein Schönredner, er war auch überzeugter Basler Patriot.
Da nicht klar sei, fuhr er fort, von welchem Staatsgebiet Vetter verschwunden sei und in welchem Anrainerland er sich zurzeit aufhalte, ob in der Schweiz, in Deutschland oder in Frankreich, würden die Ermittlungen in trinationaler Zusammenarbeit geführt. Das Hausboot sei eindeutig auf deutschem Staatsgebiet aufgefunden worden. Deshalb begrüße er Kollege Rotzinger. Möglich sei indessen auch, dass sich Vetter nach Frankreich abgesetzt habe, deshalb sei auch Kollege Wirz anwesend. Klar sei, dass Vetter in Basel wohne, weshalb die Ermittlungsleitung beim Kriminalkommissariat Basel liege. Er wünsche gute Zusammenarbeit.
Anschließend ergriff Madörin das Wort. Er fasste zusammen, was bis jetzt bekannt war.
Am letzten Montag, dem 20.April, hatte die Premiere [21] von König Ödipus von Sophokles stattgefunden, im großen Saal des Stadttheaters. Dabei war es zu einem tumultähnlichen Publikumsprotest gekommen. Nicht wegen des Stücks, das ja bekanntlich zur Weltliteratur gehöre. Sondern der Regie wegen, die man, wie Madörin meinte, als Unterhosentheater bezeichnen könne. Es seien Zwischenrufe zu hören gewesen wie »Was soll der Blödsinn? Hört endlich auf mit dem Scheißdreck!« Nach anderthalb Stunden geduldigen Ausharrens habe sich die Mehrheit des Publikums entschlossen, das Theater unter Buhrufen und Pfiffen zu verlassen. Es sei ins benachbarte Restaurant Kunsthalle geströmt und habe dort darauf gewartet, dass der Regisseur erschien, wie es nach Premieren der Brauch sei. Als dieser, ein junger Mann namens Stephan Hulsch aus Berlin, aufgetaucht sei, sei aufs Neue Tumult ausgebrochen. Wie er von verlässlichen Augenzeugen gehört habe, hätten sich mehrere ältere Damen und Herren aus Basels Großbürgertum auf den jungen Regisseur gestürzt in der eindeutigen Absicht, ihm an den Kragen zu gehen. Eine besonders rabiate Dame namens Sarasin habe ihm mit ihrem Granatring zwei Zähne ausgeschlagen. Sie habe dann vom Kunsthallenwirt Peter Wyss, vom Darsteller des Ödipus Oswald Gemperle und von Bernhard Vetter, die mit Hulsch hereingekommen waren, mit vereinten Kräften zurückgehalten werden können, sonst wäre es zum Ringkampf gekommen. Der Regisseur sei geflüchtet. Bernhard Vetter habe einen kleineren Kollaps erlitten und dringend einen doppelten Cognac gebraucht.
So weit die Vorgeschichte, die ja gewiss allen bekannt sei, da dieser Theaterskandal weit herum für Aufsehen gesorgt habe.
[22] Drei Tage später, am 23.April, einem Donnerstag, habe Vetter auf der kleinen Bühne einen Vortrag gehalten zu Hölderlins Ödipus-Übersetzung, die der Aufführung zugrunde liege. Er habe die Geschichte dieser Übersetzung erläutert und daraus vorgelesen. Die Veranstaltung sei gut besucht gewesen und ruhig verlaufen. Vetter habe sich anschließend in die Kantine gesetzt und sei dann noch mit Freunden und Bekannten auf sein Boot gegangen, das am St.Alban-Rheinweg vertäut gewesen sei. Er sei guter Laune gewesen, da es ihm endlich wieder einmal gelungen sei, wie er sagte, das konservative Basler Premierenpublikum aus der Reserve zu locken und zu reizen bis zu Tätlichkeiten. Er sei leicht angetrunken gewesen, aber noch bei klarem Verstand. Um halb zwei hätten die Gäste das Boot verlassen. Einige hätten noch zugeschaut, wie es abgelegt habe und Richtung Mittlere Brücke verschwunden sei.
Das sei alles, meinte Madörin, was man bis jetzt an Informationen habe. Vieles sei möglich, es sei noch zu früh, bestimmte Vermutungen zu äußern. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe die Möglichkeit, dass Vetter von Basel endgültig die Nase voll gehabt und sich abgesetzt habe. Ein Gewaltverbrechen könne allerdings keineswegs ausgeschlossen werden. Er bitte jetzt Kollege Rotzinger, von seinen Ermittlungen zu berichten.
Rotzinger fasste sich kurz. Sie hätten das Wohnboot so genau untersucht, wie es in der kurzen Zeit möglich gewesen sei. Es sei beim Aufprall aufs Wehr gehörig durchgeschüttelt worden. Trotzdem hätten sie Spuren einer gesitteten Party vorgefunden, mit vermutlich neun Teilnehmern. Drei leere Flaschen Château Margaux, zwei leere Mineralwasserflaschen.
[23] Auffällig seien einige kleinere Blutflecken auf der linken Seite des Decks, die aber auch älteren Datums sein könnten. Ob Vetter in jener Nacht im Bett gelegen habe, könne nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Jedenfalls sei das Bett nicht gemacht gewesen.
In einer Ledermappe sei man auf den Vortrag über Hölderlins Übersetzung gestoßen. Ebenfalls auffällig sei, dass das Halteseil am Heck, das zur Vertäuung des Bootes diente, offenbar kürzlich durchgeschnitten worden sei.
Im Übrigen sei das Innere des Bootes ausgesprochen spartanisch. Der Besitzer müsse fast mönchisch gelebt haben. Ein PC sei nicht gefunden worden. Es gebe kaum persönliche Gegenstände an Bord, außer Büchern und einigen Fotos, die alle die gleiche Frau zeigten.
Er legte ein Foto auf den Tisch.
»Das ist Judith Keller«, sagte Hunkeler.
»Woher wissen Sie das?«, fragte Suter.
»Ich habe sie gekannt. Vor Jahren, als sie an Karters Komödie war. Sie hat die jugendliche Liebhaberin gespielt und dann in München unter Vetter Karriere gemacht. Soviel ich weiß, hat sie eine Tochter von ihm. Ich habe gehört, dass sie sich vom Theater zurückgezogen hat und im Elsass wohnt, in Helfrantzkirch.«
»Moment«, sagte Lüdi und beugte sich über seinen Computer. »Stimmt, Rue du Général de Gaulle 16.«
Suter kratzte sich umständlich am Hals.
»Kennen Sie sich aus im Theater?«, fragte er.
»Früher ja«, sagte Hunkeler, »jetzt nicht mehr. Seit Jahrzehnten nicht mehr.«
»Wenn ich mich richtig erinnere«, sagte Suter, »so steht in [24] Ihrem Curriculum, dass Sie in der Komödie gearbeitet haben.«
»Das war vor vierzig Jahren.«
»Wir müssen die Aufgaben verteilen. Wie wäre es, wenn Sie sich im Theater umsehen?«
Er schaute Madörin an, der den Blick auf die Tischplatte gesenkt hatte.
»Was meinen Sie dazu, Wachtmeister Madörin?«
»Ich leite die Ermittlungen«, sagte der, »und niemand anders. Kollege Hunkeler scheidet in sechs Wochen aus. Was dann?«
»Ich bitte Sie, meine Herren«, sagte Suter, »so lange können wir nicht warten. Ich erwarte stündlich Vetters Anruf. Wenn er sich nicht meldet, müssen wir ihn finden. Möglichst bald. Ich bitte Sie, im Interesse unserer Stadt persönliche Animositäten hintanzustellen.«
»Meinetwegen«, sagte Madörin. »Aber alle Informationen laufen über mich. Und ich verbitte mir Extratouren.«
Hunkeler ging durch die Steinenvorstadt Richtung Barfüßerplatz. Es war kurz nach sechs Uhr abends. Die Straßencafés waren voller junger Menschen. Viel nackte Haut, obschon es kühl war. Viel Piercings, in Nasenflügel und Augenbrauen geklemmt. Viel Langeweile in den Gesichtern, viel brennende Gier in den Blicken.
Es war Hunkeler nicht wohl in dieser Straße, er kannte sich hier nicht aus. Er kam sich als alter Mann vor, der sich selbst überlebt hatte. Und er wusste nicht, wohin mit seinem Blick.
Vor der ehemaligen Komödie blieb er stehen. Das Café [25] im Erdgeschoss gab es noch, aber es waren andere Gäste. Lauter junge Burschen südländischen Typs, aus dem Balkan wohl. Sie hatten den alten Mann, der draußen auf der Straße stand und hineinschaute, mit Sicherheit längst gesehen, sie waren sehr schnell mit den Augen. Aber keiner schaute auf.
Hunkeler spürte eine Spannung aus dem Lokal strömen, die seinen ganzen Körper ergriff. Er kannte das, er wusste, dass ihn die Burschen als Polizisten identifiziert hatten. Er wusste auch, dass sich diese Spannung bis um Mitternacht aufbauen würde, langsam und zäh. Bis sie sich eines Nachts entlud mit Faustschlägen ins Gesicht und Messerstichen. Dann würden nicht nur die Jugendstaatsanwälte Arbeit bekommen, sondern auch die Jugendpsychologen, die von gewaltfördernden Gettostrukturen reden würden.
Er betrat die Passage, die früher zur Theaterkasse geführt hatte. In den Vitrinen, die damals die Fotos der auftretenden Stars gezeigt hatten, wurden jetzt Jeans und bedruckte Shirts feilgeboten, mit Tigern drauf, mit Muskelmännern und mit Che Guevara. Dass der immer noch Mode war, dieser Kitschbruder mit Tarzanlook und Jesusblick, erstaunte Hunkeler. Die Jugend wollte wohl noch immer erlöst werden.
Hier in diesem Gebäude hatte er damals, als er sein Studium unterbrach, Fuß zu fassen versucht. Als Bühnenarbeiter, als Regieassistent, als Autor von Programmheften. Einige Male hatte er als Statist auf der Bühne gestanden. Es wurde hart gearbeitet in Karters Komödie. Niemand sprach von Mitbestimmung, dazu wäre keine Zeit gewesen. Geprobt wurde eine Woche, dann öffnete sich der Vorhang zur Premiere. Auf den Spielplan kam, was das Publikum zu interessieren versprach. Komödien der gehobenen Sorte, Klassiker [26] des Bildungstheaters. Gespielt wurde aber auch Brecht, und zwar zu einer Zeit, als dies noch verpönt war, wenn nicht verboten, da Brecht Kommunist war.
Karter versuchte, das Publikum ins Theater zu locken. Er tat das mit den Mitteln des Theaters, so wie das schon Shakespeare, Molière und Goldoni versucht hatten. Mit guten Autoren, mit Licht und Schatten, mit Puder und Schminke, mit schönen Frauen, mit Können und sehr viel Routine. Er erhielt kaum Subventionen, er war angewiesen auf ein volles Haus. Jeden Abend nach der Vorstellung rief er, von wo auch immer, bei der Kasse an und erkundigte sich nach dem Einspielergebnis. Er war ein großartiger Intendant gewesen. Er hatte sein Möglichstes geleistet, mit Intelligenz, Charme und List, die eine Theaterlist war.
Hunkeler hatte damals viel Brecht gelesen. Er hatte von ihm gelernt, dass Sinn und Zweck von Theater die Unterhaltung war. Erst die Unterhaltung, dann die Erkenntnis. Oder anders: Erkenntnis durch Unterhaltung. Denn nichts war unterhaltsamer als Erkenntnis.
Hunkeler betrat das Lokal und bestellte Kaffee. Es wurde still, als er hereinkam, das fiel ihm sogleich auf. Nur die Frauenstimme aus den Lautsprechern, die ein Lied mit türkischem Einschlag sang, war zu hören.
Hatte er tatsächlich das Gesicht eines Polizisten? Eines Ordnungshüters, der das staatliche Gewaltmonopol beanspruchte? Eines Beamten, der die Probleme der jungen Leute mit Handschellen lösen wollte?