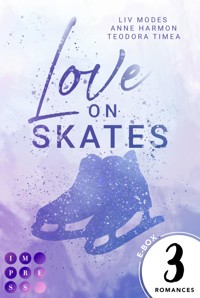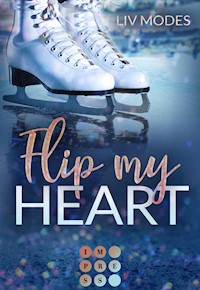Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Litur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sturm vor der Küste und ein Hurrikan im Herzen Bree lebt ihren Traum: Sie arbeitet bei der Coast Guard in Seattle und rettet Menschenleben. Doch dann kommt unter ihrer Leitung ein Mensch ums Leben und Bree wird zwangsversetzt – in ein Kaff auf die andere Seite des Landes. Dabei hasst sie Kleinstädte, aus gutem Grund: Prompt entpuppt sich ihr gedankenloser One-Night-Stand in der ersten Nacht als die Schwester ihres neuen Arbeitskollegen Jake Tanner. Und nicht nur deswegen ist Jake wenig begeistert von ihr. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist eine Städterin, die glaubt, alles besser zu wissen. Doch bald zeigt sich, dass die beiden einander mehr brauchen, als sie es je zugeben würden …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hurricane Heart
Die Autorin
Liv Modes (*1997) konvertierte 2015 vom Land- zum Hauptstadtleben. Nach einem Umweg über den Sozialversicherungsbereich begann sie 2021, Psychologie zu studieren. Bisher erschienen ihr Sciencefiction-Debüt »ANXO: Zwischen den Sphären« im Eisermann Verlag, der Romance-Kurzroman »Auf der anderen Seite der Sterne« im Selfpublishing, sowie der Young Adult-Roman »Flip my Heart« im Carlsen Verlag. Daneben veröffentlichte sie mehrere Kurzgeschichten, ist Mitgründerin des Autor*innen-Netzwerks #BerlinAuthors und absolvierte ein Fernstudium zur Social Media Managerin.
Das Buch
Bree lebt ihren Traum: Sie arbeitet bei der Coast Guard in Seattle und rettet Menschenleben. Doch dann kommt unter ihrer Leitung ein Mensch ums Leben und Bree wird zwangsversetzt – in ein Kaff auf die andere Seite des Landes. Dabei hasst sie Kleinstädte, aus gutem Grund: Prompt entpuppt sich ihr gedankenloser One-Night-Stand in der ersten Nacht als die Schwester ihres neuen Arbeitskollegen Jake Tanner. Und nicht nur deswegen ist Jake wenig begeistert von ihr. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist eine Städterin, die glaubt, alles besser zu wissen. Doch bald zeigt sich, dass die beiden einander mehr brauchen, als sie es je zugeben würden …
Liv Modes
Hurricane Heart
The storms we feel
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin August 2022 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorinnenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus
978-3-95818-677-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Epilog
Leseprobe: Lumberjack Love
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 1
Es gab eine Menge Dinge auf der Welt, die ich nicht leiden konnte. Wenn Leute mitten auf der Straße ohne Vorwarnung stehen blieben, zum Beispiel. Den Verkehr in Seattle. Sushi. Und Kleinstädte. Vor allem solche, die zu weit weg vom nächsten Flughafen waren, als dass man sie noch mit dem Shuttlebus-Service hätte erreichen können.
Letzteres wäre für sich genommen ein überschaubares Problem gewesen. Allerdings war erstens mein Toleranzlevel für jegliche Art von Unannehmlichkeiten gerade heute ausgesprochen niedrig und zweitens hatte ich die Rechnung ohne den Mitarbeiter der Mietwagenstation gemacht.
»Ich hatte extra reserviert«, wiederholte ich und hielt mein Handy mit der geöffneten Bestätigungsmail so an die Plexiglasscheibe, dass der Mann, der dahinter auf einem abgeschrabbelten Drehstuhl lümmelte, sie sehen konnte. Wenn er sie denn hätte sehen wollen. Gerade schien er viel interessierter an dem Baseballspiel, das auf einem Tablet lief.
»Hören Sie, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich keine Reservierung im System habe.« Der Mann – mittelalt, weiß, Kappe mit dem Logo irgendeiner Pizzakette – machte sich nicht einmal die Mühe, den Kopf zu heben und mich anzusehen.
»Könnten Sie noch mal nachschauen, bitte? Der Name ist Bree Genevieve Carter, der Zweitname schreibt sich Golf, Echo, November, Echo …«
»Wollen Sie mir unterstellen, ich könnte Ihren Namen nicht von Ihrem Führerschein ablesen?«, unterbrach mich der Mann. Jetzt schaute er mich doch an, mit einem Blick, als würde er jeden Moment den Sicherheitsdienst rufen und nur darauf warten, dass ich ihm einen Grund dafür gab.
Ich presste die Lippen aufeinander, zählte im Kopf bis zehn und unterdrückte den sehr Karen-haften Reflex, mich einfach auf den Boden zu werfen und zu schreien.
Normalerweise hatte ich kein Problem damit, mich mit frustrierten Männern auseinanderzusetzen, das war eins der ersten Dinge, die ich an der Coast Guard Academy gelernt hatte.
Aber nicht heute.
Heute fühlte sich jeder Schritt an, als hätte mir jemand Backsteine an die Knöchel gebunden.
Heute war nicht der Tag, um mich mit fragiler Männlichkeit auseinanderzusetzen.
Mit einem Seufzen gab ich nach. »Ist auch egal. Ich brauche einfach nur irgendein Auto, okay? Ich ziehe gerade um und würde wirklich, wirklich gern heute noch ankommen.«
Der Mann musterte mich einen Moment und halb erwartete ich einen Kommentar darüber, dass ich »irgendein« Auto gesagt hatte. Allerdings schien ihm inzwischen auch aufgegangen zu sein, dass er am schnellsten zurück zu seinem Baseballspiel kam, wenn er es dabei beruhen ließ.
An diesem Punkt hätte ich auch einer Pferdekutsche zugestimmt, wenn ich nur endlich aus diesem Flughafengebäude herauskam.
Nicht, dass ich mich auf den Ort freute, zu dem ich unterwegs war. Aber in Bewegung zu bleiben, half immerhin.
Fünfzehn Minuten später erwog ich, meine Einstellung noch einmal zu überdenken: Das Auto, zu dem der Mann mir den Schlüssel gegeben hatte, besaß die entzückende Farbe von Erbrochenem.
»Na, wenn das mal nicht zur Situation passt«, murmelte ich vor mich hin. Dann machte ich ein Foto von diesem Monster, schickte es Ari und Dexter und machte mich auf den Weg zu meinem neuen Zuhause.
Oder besser gesagt – ins Exil.
Ari hatte mir zwar verboten, es so zu nennen, aber ich war diejenige, die ans andere Ende des Kontinents verbannt worden war. Ich durfte es nennen, wie ich wollte.
Als ich das hübsche, blau-weiß bemalte Ortseingangsschild mit dem Schriftzug »Cape Charles, Virginia« passierte, fand ich die Bezeichnung passender als je zuvor. Es kam mir vor, als könnte ich die Scherben meines alten Lebens unter den Rädern meines hart erkämpften Kotzmobils knirschen hören. Das Einzige, das mich davon abhielt, einem Nervenzusammenbruch der Kategorie fünf zu erliegen, war die Tatsache, dass ich mich in einem fahrenden Auto mitten auf einer Hauptstraße befand und absolut keine Lust hatte, meine Verbannung mit einem Unfall zu beginnen.
Um mich abzulenken, wiederholte ich wie ein Mantra, was ich unzählige Male über diese Stadt gelesen hatte.
1009 Einwohner.
Zehn Quadratkilometer Fläche.
4767 Kilometer und drei Zeitzonen entfernt von Seattle.
Ich hatte einen ganzen Ordner auf meinem Desktop über die Stadt angelegt, aber es hatte nicht viel gegeben, das ich hätte eintragen können. Der Großteil der Berichte, die ich bei meiner Recherche gefunden hatte, waren Einträge auf Urlaubsbewertungswebsites gewesen und wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaute, verstand ich leider auch, warum.
Cape Charles war geradezu ekelhaft idyllisch – saubere, schnurgerade Straßen, gesäumt von blühenden Bäumen und Einfamilienhäusern im Kolonialstil, unwirklich grünen Rasenflächen und weiß gestrichenen Gartenzäunen. Man sah der Stadt an, dass sie, nachdem das Eisenbahnzeitalter nicht den versprochenen Boom gebracht hatte, auf Tourismus umgesattelt hatte. Während ich den Anweisungen des Navis folgte, kam ich mir vor, als würde ich durch eine Aneinanderreihung von Postkartenmotiven fahren. Für Familien mit Kleinkindern und Menschen über siebzig war das sicher super. In mir lösten die kleinen Straßen und leeren Fußwege ein seltsames Gefühl der Beklemmung aus, das erst besser wurde, als ich den Stadtkern hinter mir ließ.
Ich hatte das Haus gekauft, ohne es vorher gesehen zu haben, und das hatte dem Teil in mir, der immer wissen wollte, was auf ihn zukam (was ziemlich genau 93,7 Prozent von mir waren), in eine mittelschwere Krise gestürzt. Aber im Chaos der letzten Wochen hatte ich weder Zeit noch Nerven gehabt, durch das ganze Land zu fliegen, um Häuser zu besichtigen.
Es lag ein Stück außerhalb der Stadt am Ende einer kurzen Zufahrtsstraße mit dem klangvollen Namen »Blue Heaven Road«, was Ari, die vor ein paar Wochen eine überwältigende Obsession mit allem Spirituellen entwickelt hatte, sofort als Omen gedeutet hatte. Ihrer Deutung zufolge hieß das, dass ich entweder das Paradies finden oder draufgehen würde.
»Paradiesisch« war zwar weit übertrieben, aber als ich jetzt ausstieg und das Haus zum ersten Mal live und in Farbe sah, musste ich widerwillig zugeben, dass es wirklich hübsch aussah. Wie gefühlt jedes Haus in dieser Stadt war es von einem ordentlich getrimmten Rasen und einem kleinen Gartenzaun umgeben. Die weiße Fassade des Hauses wirkte frisch gestrichen und leuchtete so hell wie der Schnee, der hier quasi nie fiel (12,7 Zentimeter durchschnittlich pro Jahr, und damit 58,42 Zentimeter weniger als der US-Durchschnitt). Eine kleine Treppe führte zu einer Veranda hinauf, von der aus man angeblich ganz toll den Sonnenaufgang bewundern konnte. Hatte zumindest die Maklerin behauptet, und sie hatte dabei so enthusiastisch geklungen, dass ich es nicht übers Herz gebracht hatte, einen Kommentar darüber loszuwerden, dass ich nicht vorhatte, hier heimisch zu werden.
Gerade wollte ich mich daranmachen, mein Gepäck und die Lebensmittel, die ich unterwegs eingekauft hatte, auszupacken, da klingelte mein Handy.
Ich schloss die Augen und erwog für einen Moment, mich einfach totzustellen. Heute war wirklich nicht der Tag, an dem ich mich mit den Kalendersprüchen meiner Mutter oder dem trockenen Pragmatismus meiner Schwester auseinandersetzen wollte. Schließlich warf ich aber doch einen Blick auf das Display und atmete erleichtert auf, als ich das Profilbild meiner besten Freundin erkannte.
»Bist du schon angekommen?«, fragte Ari, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten.
»Nein. Ich bin unterwegs in ein Portal gefallen und kämpfe jetzt in einer Parallelwelt gegen Haie mit Kettensägen«, erwiderte ich trocken. »Musst du nicht arbeiten? Du hast doch die Spätschicht heute, oder?«
Kurze Stille. Dann: »Meine Pause ist erst seit zehn Minuten vorbei, alles ganz entspannt. Außerdem hat der Film mit den Haien und den Kettensägen nicht in einer Parallelwelt gespielt, du Banause. Ich wollte nur wissen, ob du zurechtkommst oder ob wir schon einen Code Ananas haben.«
Bei der Erwähnung des Safewords, das Ari und Dexter sich für mich ausgedacht hatten, musste ich widerwillig lachen. »Alles okay.«
»Wirklich? Auf einer Skala von eins bis zehn, wenn zehn das Schlimmste ist?«
Acht. Mindestens. Aber das würde ich ihr nicht sagen, sonst würde sie sich nur Sorgen machen und das half keiner von uns.
»Eine stabile 4,7.«
»Okay.« Ari klang erleichtert und ich entspannte mich ein wenig. »Dann kannst du mir noch kurz das Haus zeigen, bevor ich zurückmuss.«
»Du solltest wirklich deine Arbeitsmoral überdenken«, neckte ich sie, während ich auf Videocall umstellte.
»Und dieser Staat sollte seine Arbeitsbedingungen überdenken, aber das tut er auch nicht«, entgegnete sie unbeeindruckt, bevor sie beeindruckt durch die Zähne pfiff. »Schick!«
Ihr Bild war inzwischen ebenfalls auf meinem Display aufgetaucht und ich sah, wie ihre Augen aufleuchteten. »Du musst mich unbedingt herumführen!«
»Ich war selbst noch nicht drinnen.«
»Echt nicht? Laut Dexters Rechnung hättest du seit mindestens einer Stunde da sein müssen.« Ari runzelte die Stirn.
»Ich war zwischendurch einkaufen. Hätte ich gewusst, dass direkt Big Brother über mich herfällt, hätte ich das auf später verschoben.«
»Big Sister, wenn schon. Los, ich habe nicht viel Zeit, ich glaube, mein Boss kommt gleich von seiner Zigarettenpause wieder!«
Ich musste lachen. »Du bist unmöglich.«
Trotzdem rappelte ich mich auf und gab Ari die Tour, die sie sich gewünscht hatte. Als ich einmal ums Haus herumgegangen war, setzte ich mich auf die Stufen der Veranda. »Und, was sagen deine fachkundigen Augen?«
Ari musterte mich mit schiefgelegtem Kopf. »Ich weiß, wir hassen das Haus, wir hassen die Stadt, wir hassen alles, aber Bree … es ist unfassbar schön! Ich meine, du hast Bäume hinter deinem Gartenzaun. Keine nervigen Nachbarn, die nachts um drei Trompete üben, niemand, der dir den Parkplatz klaut, nur Ruhe und Einsamkeit und ein ganzer Ozean!« Sie atmete so enthusiastisch ein und aus, als könnte sie die Meeresluft praktisch selbst riechen.
»Darf ich dich erinnern, dass eine Bucht nicht dasselbe ist wie ein Ozean?«
»Pff, Meerwasser ist Meerwasser.«
Ich musste mich sehr zurückhalten, um darauf nicht mit einem halbstündigen Vortrag zu antworten, warum Meerwasser nicht gleich Meerwasser war und auf wie viele verschiedene Weisen sie diese Annahme in ernsthafte Gefahr bringen konnte, aber so viel Zeit hatten wir heute nicht. Also beließ ich es bei einem Kopfschütteln. »Man merkt, dass du ein Stadtkind bist.«
»Hey, ich war auch schonmal auf dem Land!«
»Ach ja?« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Wo denn? Die paar Tage beim Burning Man zählen nicht.«
»Aber das war wirklich sehr weit weg von vernünftiger Zivilisation.«
Ich stöhnte. »Wenn ich in einer Gegend hätte wohnen wollen, in der es mehr Kühe als Einwohner gibt, wäre ich bei meinen Eltern in Idaho geblieben.«
»Und wahrscheinlich noch mehr Bibeln als Kühe«, ergänzte Ari, was nicht dazu beitrug, dass ich den nächsten zwölf Monaten positiver entgegensah.
Als ob sie meine Gedanken gelesen hätte, wurde ihre Stimme plötzlich weicher. »Hey, wollen wir vielleicht zusammen reingehen? Also, nicht zusammen. Na ja, du weißt, was ich meine.«
Kurz zögerte ich, bevor ich nickte. »Das wäre …«
In diesem Moment wurde Aris Bild erschüttert und auf einmal wurde mein Display dunkelgrau.
»Ari? Was ist denn los?«
Statt einer Antwort erklang das Rascheln von Stoff, anscheinend hatte Ari ihr Handy in die Hosentasche gesteckt. Dann hörte ich eine harte Männerstimme, die ich nicht verstand. Musste ich auch nicht. Dass Aris Chef wenig begeistert von ihrer eher … flexiblen Einstellung zu festen Pausenzeiten war, wusste ich auch so. Er würde sie nicht feuern, dafür war sie zu gut in ihrem Job – außerdem gab es nicht viele Leute, die es mehr als drei Monate in einem Callcenter aushielten - aber das hielt ihn nicht davon ab, sich regelmäßig mit ihr zu streiten.
Dass Ari Spaß an diesen Auseinandersetzungen hatte und ihn regelmäßig auflaufen ließ, schien ihm bis heute nicht aufgefallen zu sein. Ich hörte noch, wie Ari etwas erwiderte, in dem die Worte »Spätkapitalismus« und »Work-Life-Balance« vorkamen, dann legte ich auf.
Diesen Kampf konnte sie ausfechten, ohne dass ich Kommentare vom Seitenrand einwarf. Gedankenverloren starrte ich auf das schwarze Display und versuchte, mich mental in den Zustand von vor zwanzig Minuten zurückzuversetzen, in dem es mir absolut machbar erschienen war, das Haus allein zu betreten.
Jetzt war ich mir da nicht mehr so sicher. Aber Dexter konnte ich nicht anrufen, im Gegensatz zu Ari nahm mein bester Freund seine Pausenzeiten sehr ernst, und meine Familie würde kaum verstehen, warum ich wegen so einer Kleinigkeit anrief.
Also atmete ich tief durch und ging meine Sachen holen.
Bei meinem letzten Umzug hatte ein riesiges »Herzlich Willkommen«-Banner an der Tür gehangen, das meine Mutter im nächstbesten Geschenkeladen aufgetrieben hatte. Heute empfing mich nur ein Meer aus Kisten und der stickige Geruch von Räumen, in denen lange niemand mehr regelmäßig gelüftet hatte.
Na, wenn das nicht der Inbegriff von »Home Sweet Home« war.
Ich ließ meine Sachen neben der Tür stehen und kletterte über das Kistengebirge, um mir den Rest des Hauses anzuschauen.
Das untere Geschoss wurde fast vollständig von einer Küche im Landhausstil und dem anschließenden Wohnbereich eingenommen und mein Herz machte einen kleinen Sprung, als ich unter einem der Fenster mein grünes Cordsofa entdeckte. Es sah ein bisschen verloren aus, dabei war es für meine alte Wohnung beinahe zu groß gewesen. Überhaupt wirkte alles leer und unpersönlich, obwohl ich fast alle meine Möbel mitgenommen hatte. Es half nur wenig, dass die Umzugsfirma wirklich gute Arbeit geleistet und alles dort aufgebaut hatte, wo ich es ihnen auf mindestens drei verschiedenen Plänen eingezeichnet hatte. Auch der Stapel von Kisten kam mir viel zu klein vor, um das ganze Haus zu füllen, dabei hatte ich beim Einpacken das Gefühl gehabt, als würde ich halb Seattle in Pappkartons verstauen.
Auch in der oberen Etage sah alles gut aus, doch das half nicht gegen das hohle Gefühl, das sich in meiner Magengegend auszubreiten begann. Neben dem Schlafzimmer und dem Bad gab es einen zweiten Raum, der bis auf ein paar weitere Kisten mit Klamotten und Nähsachen völlig leer war. Ich war mir nicht sicher, was ich mit dem Raum eigentlich anfangen sollte. Dexter hatte erst einen Fitnessraum, dann eine Bar vorgeschlagen, Ari ein Nähzimmer. Der Gedanke, mich mit meinen Nähsachen richtig ausbreiten zu können, hatte mir gefallen, doch als ich jetzt in dem leeren Raum stand, war ich mir nicht mehr so sicher. Laut der Maklerin hatte vor mir eine Familie hier gewohnt, vermutlich war es das Kinderzimmer gewesen und diese Vorstellung gab mir das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Als hätte ich nicht das Recht, diesen Ort zu meinem zu machen. Und eigentlich wollte ich das ja auch nicht.
Dass das Haus viel zu groß für mich war, hatte ich vorher gewusst. Aber es war ohnehin schon schwierig gewesen, so schnell etwas zu finden, wie ich es gebraucht hatte, und der Immobilienmarkt erlaubte es nicht, wählerisch zu sein. Innerlich hatte ich gehofft, dass es vielleicht ganz schön wäre, so viel Platz zu haben. Meine Wohnung in Seattle war dagegen ein Schuhkarton gewesen.
Als ich mich jetzt jedoch den vollen einhundertzwanzig Quadratmetern gegenübersah, verspürte ich alles andere als den »Zauber des Neuanfangs«, wie es auf den ganzen Pinterest-Boards so schön geheißen hatte. Stattdessen war ich einfach nur erschöpft und fühlte mich unendlich allein.
Dabei wusste ich seit Wochen, dass dieser Zeitpunkt kommen würde. Ich hatte unzählige Umzugsunternehmen und Speditionen verglichen und mit drei verschiedenen Maklerinnen telefoniert. Ich hatte Gespräche mit meiner alten Chefin, meiner neuen Chefin und während des Videochats auch kurz mit der Katze meiner neuen Chefin geführt – und hoffte bis heute, dass Chief Siobhan Roberts nicht mitbekommen hatte, wie ich besagte Katze anmiaut hatte, als sie kurz das Büro hatte verlassen müssen. Ich hatte Verständnis gezeigt, war ruhig geblieben, hatte von Chancen und Herausforderungen gesprochen und sehr viel öfter »Vielen Dank« gesagt, als ich es empfunden hatte. Alles in allem hatte ich mich wie die vernünftige Erwachsene verhalten, die man von mir mit achtundzwanzig Jahren erwartete zu sein.
Bis jetzt. Jetzt ging ich wieder nach unten und ließ mich auf die unterste Treppenstufe sinken wie eine Marionette, der man die Fäden durchgeschnitten hatte. Ich hatte keine verdammte Kraft mehr, vernünftig und erwachsen zu sein.
Meine Finger rieben so fest über meinen Handballen, dass es wehtat, und selbst diese winzige Bewegung kam mir anstrengender vor, als sie eigentlich war. Aber ich hätte auch nicht damit aufhören können, selbst wenn ich es gewollt hätte.
Müde starrte ich auf einen Karton mit der Aufschrift »Badutensilien, Textilien, Kosmetik, kleine Handtücher, Duschhandtücher«. Daneben hatte Ari einen Elefanten beim Duschen gemalt. In Dexters krakeliger Handschrift stand dazu: »Badkrams halt. Mach’s nicht so kompliziert.«
Obwohl Dexter sonst in allem, was er tat, eine beeindruckende Effizienz an den Tag legte, sah seine Handschrift aus wie die Fußspur einer betrunkenen Taube und ich bildete mir schwer etwas darauf ein, dass ich sie trotzdem lesen konnte. Jetzt allerdings fühlte sich der Anblick an, als ob die Taube auf einem lebenswichtigen Organ in meinem Körper gelandet war und ihre Krallen fest hineingrub.
Und es war so unfassbar leise.
Es kam mir vor, als würde sich die Stille zu riesigen, unüberwindbaren Mauern auftürmen und mich von allem um mich herum abschneiden, mich isolieren. Der Druck meiner Finger wurde fester. Es war mir nie so deutlich bewusst gewesen, aber die allgegenwärtige Geräuschkulisse in Seattle hatte mir immer zuverlässig versichert, dass da noch andere Menschen waren, selbst wenn ich allein in meiner Wohnung war.
Dagegen ließ mich die Stille, die mich hier umgab, daran zweifeln, ob ich mich überhaupt noch auf dem Planeten Erde befand.
Wäre ich jetzt zu Hause gewesen, wäre ich gerade von der Arbeit gekommen. Ich hätte die Uniform in die Ecke geschmissen (und sie fünf Minuten später schuldbewusst wieder aufgesammelt), hätte viel zu lang gebraucht, um zu entscheiden, nach welchem Klamotten- und Make-up-Stil mir heute zumute war und wäre am Ende trotzdem als Einzige pünktlich zum Treffen gekommen. Dexter würde bereits seit zehn Minuten warten, weil er die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens mit seiner Familie in Japan gelebt hatte und eine ausgemachte Zeit für ihn bedeutete, zu dieser Zeit startklar zu sein. Egal, ob es um ein Meeting oder nur entspanntes Cocktailtrinken ging. Ich hatte die Theorie, dass er selbst dann zu früh ankommen würde, wenn in ganz Washington die Erde beben und Piranhas vom Himmel regnen würden. Dagegen kam Ari fast immer zu spät, selbst wenn sie überpünktlich losging. Seit ihre Esoterik-Freundin darin einen Beweis für die Balance des Universums gesehen hatte, versuchte sie auch gar nicht mehr, auf die Zeit zu achten, und sprach stattdessen gerne von »Flow«.
Während wir auf sie warteten, würden Dexter und ich schonmal die ersten Cocktails bestellen - Maracuja-Daiquiri für Dexter, Tequila Sunrise für mich und den Cocktail der Woche für Ari. Wir hätten über Papierstrohhalmen und Limettenscheiben die Ereignisse der Woche ausgetauscht und wären später weitergezogen. In eine Ausstellung oder ins Theater, wenn uns danach zumute war, intellektuell zu tun, oder in einen Club, wenn wir uns jung fühlen wollten oder Ari irgendwo Gästelistenplätze organisiert hatte.
Wir hätten getanzt, geredet, die Zeit vergessen und mit wildfremden Menschen um vier Uhr morgens über die Existenz von Gott und Schicksal diskutiert.
So hatte ich meine Zwanziger verbringen wollen.
Stattdessen würde ich ein ganzes Jahr verpassen – in meiner Karriere, in meiner Stadt, in meinem Leben und dem meiner Freunde – und ich konnte nichts dagegen tun.
Meine Kehle schnürte sich zusammen und ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen.
Wow. Sehr pathetisch. Ich hatte den ersten Heulanfall nicht vor heute Abend eingeplant.
Ich wollte den Tränen freien Lauf lassen. Mich in dramatischer Geste über die Umzugskartons werfen und mir die Augen ausheulen, so richtig schön mit Rotznase und verschmierter Wimperntusche wie eine Vierzehnjährige, deren erster Crush ihr keinen Stift hatte leihen wollen.
Verlockende Vorstellung.
Trotzdem zwang ich die Tränen zurück. Nachzugeben fühlte sich an, als würde ich ihn damit gewinnen lassen und das würde ich nicht zulassen. Er hatte mir schon meinen Job und mein Image genommen, meinen Stolz bekam er nicht auch noch.
Mehr aus Trotz als aus Kraft rappelte ich mich auf und ließ meinen Blick über die geduldig wartenden Umzugskartons schweifen.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, sofort mit dem Auspacken anzufangen. Es gab für jeden Tag dieses Wochenendes eine eigene To-do-Liste. Aber wenn ich jetzt die Bilder und Abschiedsgeschenke meiner Kollegen und Freunde in die Hände bekam, würde ich womöglich doch noch anfangen zu heulen.
Mir blieben daher genau zwei Optionen – in einem leeren Haus in düsteren Gedanken versinken und online Kreuzworträtsel lösen, oder meinem Vorsatz, niemals allein zu trinken, eine Ausnahmeregelung hinzuzufügen und die nächstbeste Provinzkneipe ausfindig zu machen. Wenn ich Glück hatte, hatten sich die Barbesitzer an die Bedürfnisse der stadtflüchtigen Touristen angepasst und boten mehr an als nur Root Beer und Whiskey on the Rocks. Also räumte ich die Einkäufe aus dem Weg und schnappte mir meine Tasche. Kurz überlegte ich, der Badkrams-Kiste noch einen Besuch abzustatten, denn schon aus Gewohnheit fühlte es sich seltsam an, das Haus an einem Freitagabend ohne Make-up zu verlassen. Normalerweise liebte ich es, mich mit ein wenig Stoff und Farbe in jede Version meiner Selbst verwandeln zu können, die ich gerade sein wollte. Mein Job ließ schließlich nicht viel Spielraum für kreative Entfaltung. Dort war ich Petty Officer Carter, die für jede Situation einen Plan B in der Hinterhand hatte und die für ihre organisierte Arbeit geschätzt wurde, und ich war das gern. Aber genauso gern war ich Bree, die auch um fünf Uhr morgens einer fremden Person auf einer Clubtoilette den perfekten Eyeliner ziehen konnte und wusste, wie man sich selbst die Haare schnitt, ohne danach wie ein Wischmopp auszusehen.
Jetzt gerade war mir allerdings herzlich wenig danach zumute, auszuprobieren, wie ich möglichst viel Glitzer auf meine Augenlider auftragen konnte, ohne nach fünf Minuten auszusehen wie Rainbow Dash aus »My Little Pony«. Wenn überhaupt, dann war ich heute die »Ich bin eine Packung schwarze Haarfarbe vom nächsten Nervenzusammenbruch entfernt«-Version von mir selbst. Außerdem wollte ich nicht auffallen. Alles, was ich gerade wollte, war ein sehr starker Drink. Und dann noch einer. Und vielleicht noch einen dritten.
Der erste Laden, der aussah, als würde er Alkohol ausschenken, war ein Meeresfrüchte-Restaurant mit dem unglaublich einfallsreichen Namen »The Shanty«. Leider lag es direkt am Hafen und war damit nicht nur gesegnet von einem allgegenwärtigen Geruch nach Fisch, von dem mir übel wurde (was vielleicht daran lag, dass ich seit der Landung am Flughafen nichts mehr gegessen hatte), sondern auch mit einer Menge von Gästen, die mein aktuelles Level an tolerierbaren Menschen in meiner Umgebung weit überstieg.
Inzwischen zog die Dämmerung herauf und legte den ersten Schleier von Dunkelheit über die Straßen. Die Straßenlampen leuchteten bereits und verbreiteten zusammen mit der stetigen Brise und dem Geruch nach Meersalz sogar so etwas wie Urlaubsatmosphäre.
Beziehungsweise hätten sie das verbreitet.
Wenn ich nicht langsam angefangen hätte zu frieren. Die Aussicht auf Meer und die angenehmen dreiundzwanzig Grad, zu denen ich angekommen war, hatten mich vergessen lassen, dass trotz allem erst Mai war und es abends abkühlte. Deswegen beschloss ich, dass heute nicht der Tag fürs Wählerischsein war, und steuerte auf den nächstbesten Laden zu, den ich an der Strandpromenade entdeckte. Über der Tür hing ein Schild mit der Aufschrift »Kelly’s Gingernut Pub«. Die Fenster des hübschen Backsteingebäudes waren erleuchtet und aus der geöffneten Tür drangen Gelächter und typische Irish Pub-Musik. Laut einer an der Tür angebrachten Kreidetafel fand heute ein Dartturnier statt. Da ich wenig Lust auf betrunkene Männer mit spitzen Dingen in den Händen hatte, verabschiedete ich mich nun doch von der Aussicht auf Wärme und suchte mir draußen einen Platz. Aus Reflex tastete ich nach meinem Handy, nur um festzustellen, dass ich es bei meinem Fluchtreflex vorhin gar nicht mitgenommen hatte. Unwillkürlich breitete sich ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend aus. Dexter nannte das unseren Cop-Modus und er meinte das nicht als Witz, obwohl wir beide genau genommen gar nicht zur Polizei gehörten, sondern zu einer militärischen Einheit, die den Drogenschmuggel über den Seeweg überwachte. Es hatte in den letzten Jahren nicht nur einen Moment gegeben, in dem mein Leben wortwörtlich davon abgehangen hatte, schnell zur richtigen Zeit die richtigen Leute erreichen zu können. Von jeglicher Kommunikationsmöglichkeit abgeschnitten zu sein, sorgte dafür, dass ich mich unwohl fühlte (auch wenn meine Mutter felsenfest davon überzeugt war, das läge daran, dass meine ganze Generation smartphoneabhängig war).
Bitter erinnerte ich mich daran, dass mir das in dieser Stadt ohnehin egal sein konnte. Ich kannte niemanden, den ich im Notfall hätte anrufen können, und für meinen Job spielte es auch keine Rolle mehr. Denn hier war ich keine hochqualifizierte Drogenfahnderin mit einem eigenen Team, die jederzeit erreichbar sein musste.
Hier war ich das Coast Guard-Äquivalent einer Verkehrspolizistin.
»Hi, was kann ich dir denn bringen?«
Als die Stimme der Kellnerin neben mir ertönte, fuhr ich erschrocken zusammen. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich sie gar nicht bemerkt hatte. So viel zur hochqualifizierten Drogenfahnderin.
»Ehm, einen Tequila Sunr… nur einen Tequila, bitte.«
Die Kellnerin hob eine Augenbraue. »So schlimm, ja?«
Ihr Tonfall war spöttisch, doch ihre Augen funkelten belustigt.
»Bin heute erst hergezogen«, gab ich zu und überraschte mich damit selbst. Es war nicht mein Plan gewesen, der erstbesten Frau überhaupt irgendetwas über mein Leben zu erzählen. Doch als die Kellnerin – ihr Namensschild wies sie als Thea aus – zur Antwort mitfühlend lächelte, entspannte ich mich wieder ein wenig.
»Na dann, willkommen in Cape Charles!«
Thea hatte ein schönes Lächeln. Sie war allgemein verdammt hübsch, wie mir auf den zweiten Blick auffiel. Sie hatte einen Sidecut auf der einen und perfekt gewellte aschblonde Haare auf der anderen Seite ihres herzförmigen Gesichts, was ihr eine atemberaubende Ähnlichkeit mit Natalie Dormer in »Tribute von Panem« verlieh. Ihre wachen, leicht zusammengekniffenen Augen gaben ihr den Anschein einer Raubkatze, kurz bevor sie ihre Krallen in ihre Beute schlug. Trotz der Temperaturen trug sie kurze Jeansshorts, die den Blick auf lange Beine und kräftige Oberschenkel freigaben, dazu ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo des Pubs auf der Brust, dass ihre üppigen Rundungen betonte.
»Danke«, erwiderte ich, bevor ich auch nur einen Gedanken daran verschwendete, was ich hier tat. Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. »Ich habe bisher noch nicht viel von der Stadt gesehen. Gibt es denn etwas, dem ich besondere Aufmerksamkeit schenken sollte?«
Noch während ich redete, wurde ich nervös. Warum hatte ich überhaupt etwas gesagt? Der Plan war gewesen, Tequila zu inhalieren, bis sich die nagende Leere in meiner Brust füllte, nicht, mit attraktiven Kellnerinnen zu flirten. Wenn man das überhaupt flirten nennen konnte, so schlecht, wie der Spruch gewesen war. Ich rieb meine Finger über mein Handgelenk, um das Kribbeln zu vertreiben, das sich auf meiner Haut ausbreitete, als Thea mich mit schiefgelegtem Kopf musterte. Sie hielt noch immer Stift und Notizblock im Anschlag, aber jetzt sah es so aus, als wäre sie durchaus bereit, sich meine Telefonnummer statt des Tequilas zu notieren. Oder bildete ich mir das nur ein? Hatte mich der Sidecut in die Irre geführt? Nicht zum ersten Mal verfluchte ich die Tatsache, dass man die Sexualität anderer Menschen letztendlich immer nur raten konnte, wenn man nicht gerade in die jeweilige Flagge gewickelt über den Christopher Street Day spazierte. Die Chance falschzuliegen war hoch. Im besten Fall hatte man nur einen Zeh ins Fettnäpfchen getaucht, schlimmstenfalls durfte man sich mit Homofeindlichkeit auseinandersetzen.
Schöne neue Welt.
Doch in diesem Moment veränderte sich das Lächeln auf Theas Lippen. Wo vorher hauptsächlich Höflichkeit gewesen war, mischte sich jetzt ein Schmunzeln hinein.
»Du könntest mit diesem Pub hier anfangen. Und seinen Angestellten.«
Sie zwinkerte mir zu und verschwand dann ins Innere des Backsteingebäudes. Erleichtert blickte ich ihr nach. Gut zu wissen, dass mein Gaydar noch funktionierte. Auch wenn Dexter nicht müde wurde, mir zu erklären, dass es so etwas nicht gab.
Als Thea wenige Minuten später zurückkam, auf ihrem Tablett zwei Shotgläser mit Salz und Limettenvierteln am Rand, hatte ich mich so weit mit der Planänderung abgefunden, dass das nervöse Kribbeln verschwunden war und ich langsam begann, die Situation interessant zu finden.
Ich deutete auf das Tablett und hob neckend die Augenbrauen. »Zwei?«
Nun grinste Thea sehr eindeutig. »Meine Schicht endet gleich. Und ich meine mich zu erinnern, dass du mich einladen wolltest.«
Keine der sieben verschiedenen Versionen, die ich mir von meinem ersten Tag in Cape Charles ausgemalt hatte, hatte eine Kellnerin mit Natalie Dormer-Frisur und Katzenaugen enthalten.
Doch als ich ein paar Stunden später rückwärts in Theas Bett taumelte, unter meinen Händen nackte Haut und weiche, nach Tequila schmeckende Lippen auf meinen, beschloss ich, mich nicht weiter zu beschweren.
Kapitel 2
Ich hatte nicht geplant, bei Thea zu übernachten. Bei One-Night-Stands zu übernachten, widersprach meiner eisernsten Datingregel. Nicht, dass ich sie oft brauchen würde. Aber merkwürdige Morgen-Danach-Gespräche und »Frühstücken wir noch zusammen oder rufe ich mir ein Taxi?«-Geplänkel standen auf der Liste von Dingen, die ich nicht leiden konnte, direkt hinter dem Feierabendverkehr auf der Sixth Avenue. Eigentlich fand ich ja, dass man mit One-Night-Stands überhaupt nicht frühstücken sollte. Am Ende stellte man vielleicht fest, dass man sich gut unterhalten konnte, und ab da wurde es meistens kompliziert.
Was ich allerdings nicht bedacht hatte, als ich eine Kellnerin an ihrem Arbeitsort abgeschleppt hatte, war die Tatsache, dass sie immer wieder für flüssigen Nachschub sorgen konnte. Deshalb war es natürlich nicht beim ersten Shot geblieben. Wenn ich ehrlich war, hatte ich irgendwann den Überblick verloren – etwas, das mir seit meiner ersten Party in der Miller-Scheune nicht mehr passiert war. Überhaupt erinnerte ich mich an erschreckend wenig von dem, was passiert war, bevor Thea sich über den Tisch gebeugt und mit rauem Flüstern gefragt hatte, ob ich noch einen Shot trinken oder mit zu ihr kommen wollte.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das für die beste Idee der Welt gehalten.
Als ich jetzt allerdings erwachte, war ich mir dessen nicht mehr so sicher. Wegen der Sache mit den Shots, nicht wegen Thea. Sie war eine außerordentlich gute Idee gewesen. Meine Oberschenkel fühlten sich an, als hätte Dexter mich zu einem extra Leg Day verdonnert. Dafür brummte jetzt mein Schädel und mein Mund fühlte sich pelzig an. Ich rieb mir die schlafverklebten Augen und blinzelte gegen das Sonnenlicht. Noch leicht verwirrt sah ich mich um, um herauszufinden, wo genau ich mich eigentlich befand.
Immer noch in Theas Bett. So weit, so unangenehm.
Erleichtert stellte ich fest, dass Thea selbst gar nicht mehr da war. Was ich ziemlich mutig von ihr fand, in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns vor weniger als vierundzwanzig Stunden kennengelernt hatten. Ich hätte eine Kriminelle auf der Flucht vor dem Gesetz sein können. Oder Kleptomanin. Aber vielleicht war das diese »Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb«-Dorfmentalität.
Ich ließ meinen Blick durch Theas Schlafzimmer schweifen. Es war groß und unordentlich und erinnerte mich an mein Zimmer im Studierendenwohnheim, schien auf den ersten Blick jedoch nichts zu beinhalten, weshalb Thea sich Sorgen machen müsste, dass ich sie ausraubte. Das Wertvollste, das ich entdeckte, war eine riesige Sammlung alter »Vogue«-Ausgaben in einem Bücherregal neben dem Schreibtisch, das aussah, als würde es einzig und allein von Stickern zusammengehalten werden.
Unter einem Kleid aus waldgrünen Pailletten und einem Pullover, bei dem mir auf den zweiten Blick auffiel, dass er selbstgenäht sein musste, entdeckte ich schließlich auch meine eigenen Klamotten. Das war der Moment, in dem ich entdeckte, dass ich Theas T-Shirt mit dem Logo des Pubs trug.
Ups.
Mit einem Seufzen schwang ich die Beine aus dem Bett und stand auf. Zumindest wäre ich das gern. Allerdings protestierte mein Kopf sehr entschieden dagegen und ich ließ mich schnell wieder auf die Bettkante sinken. Dabei fiel mein Blick auf den Nachttisch, der aussah, als wäre er vom Sperrmüll gerettet und von einer talentierten Hand aufgemöbelt worden. Darauf stand ein Glas Wasser mit einer Kopfschmerztablette daneben. Und ein Zettel, mit einer hastig hingekritzelten Nachricht.
Ich hab’s nicht so mit Reden am Morgen. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Willkommen in Cape Charles.
Keine Telefonnummer.
Ich atmete erleichtert aus. Das hätte noch gefehlt, dass ich mich am ersten Tag mit falschen Erwartungen herumschlagen musste. Zum Glück ersparte mir Thea diesen Part. Diese Frau wurde mir immer sympathischer.
Gähnend kippte ich das Wasser inklusive Kopfschmerztablette herunter und schlüpfte in meine Sachen. Noch ein Vorteil, niemals bei spontanen One-Night-Stands zu übernachten – man konnte am nächsten Morgen frische Unterwäsche anziehen …
Nachdem ich wieder vollständig bekleidet war und mir notdürftig mit den Fingern durch die Haare gefahren war, fühlte ich mich wieder ansatzweise lebendig und der Herausforderung des Nach-Hause-Gehens gewachsen.
Ich war schon auf dem Weg zur Tür, als ich innehielt. Vielleicht war es mein Cop-Modus, vielleicht nur die Neugierde darauf, was eine Frau wie Thea wohl in ihrem Leben so machte. Sehr wahrscheinlich hatten wir gestern Abend darüber gesprochen. Leider erwies sich meine Erinnerung noch immer als sehr unzuverlässig. Möglicherweise könnte ich meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Darauf bedacht, nichts anzufassen und durcheinanderzubringen, streifte ich durch das Zimmer. Meine Schritte lenkten mich beinahe direkt zum Schreibtisch, auf dem eine Nähmaschine (Pluspunkt für Thea!) und einige bedrohlich hohe Papierstapel thronten. Hauptsächlich herausgezogene und nach dem Lesen zurück in ihre Umschläge gestopfte Briefe. Einer stammte vom hiesigen Stromanbieter, bei dem ich ebenfalls einen Vertrag abgeschlossen hatte. Langweilig. Mein Cop-Modus wollte schon Entwarnung geben, da entdeckte ich einen anderen Umschlag mit einem schicken Logo, der halb von einem achtlos hingeworfenen Kassenzettel überdeckt wurde (zwei Gläser eingelegte Gurken, eine Tafel Schokolade und eine Flasche Champagner, jemand hatte entweder einen ziemlich guten oder einen ziemlich beschissenen Tag gehabt). Ich hätte den Brief beinahe ignoriert, wenn mir das Logo nicht irgendwoher bekannt vorgekommen wäre. Ich zermarterte mir den noch immer brummenden Kopf, aber erst, als ich das Glas mit den Pinseln entdeckte, kam ich darauf, woher ich den Briefkopf kannte.
Es war das Emblem einer angesehenen Kunstakademie in Kalifornien. Ari war dort eingeschrieben gewesen, bevor sie einen Platz in Washington bekommen hatte und seitdem mal mehr, mal weniger intensiv … was auch immer studierte (ich hatte den Überblick über ihre Fächerwechsel irgendwo zwischen Bildhauerei und Modern Dance verloren).
Ob Thea genug hatte vom Kellnerinnenleben?
Nicht, dass ich es nicht verstehen könnte. Es hatte schließlich einen Grund gegeben, wieso ich nach dem Highschool-Abschluss die erstbeste Gelegenheit genutzt hatte, die Farm meiner Eltern zu verlassen. Diese Gelegenheit war ein Stipendium für Frauen in Naturwissenschaften gewesen, eher zufällig war ich dadurch in Seattle – und in einem Astrophysik-Studium - gelandet. Dort hatte ich schnell feststellen müssen, dass Astrophysik enttäuschend wenig mit Sternbildern zu tun hatte, dafür erschreckend viel mit Informatik und Elektromagnetismus. Zwischen meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst, dem Bedürfnis, als Frau in einer Naturwissenschaft nicht nur gut, sondern besser zu sein als alle anderen, und der Tatsache, dass mich Physik schlichtweg nicht interessierte, zerbrach ich beinahe. Und trotzdem hätte mich keine Rinderherde dazu bringen können, zurück zu meiner Familie aufs Land zu ziehen. Sie zogen mich bis heute damit auf, wie aus einem Mädchen, das den Kühen Schleifen um die Hörner band, eine waschechte Großstädterin hatte werden können. Mein Vater behauptete immer, ich wäre wortwörtlich geflohen und insgeheim stimmte ich ihm zu. Damals hatte ich es nicht benennen können, aber diese winzige Stadt in Idaho hatte mir die Luft abgeschnürt. Wie sehr, das war mir erst Jahre später richtig aufgegangen – Dexter und ich hatten gerade die Grundausbildung bei der Coast Guard abgeschlossen, und um zu feiern, hatte Ari uns auf diese abgefahrene Künstlerparty mitgenommen. Die Veranstaltung war topsecret gewesen, man kam nur auf persönliche Einladung rein, und dann waren wir auf einmal in irgendeinem Kellergewölbe gewesen, die Wände in Lichtspiele getaucht, überall Neonfarben, und dann stand plötzlich eine Person vor mir und fragte, ob sie mich küssen dürfte. Einfach so.
Die ganze Situation widersprach dem, wie ich einmal gedacht hatte, dass man leben müsste. Und ich liebte es. Ich hatte die Person geküsst und es hatte sich angefühlt wie der erste richtige Atemzug meines Lebens.
Und jetzt war ich zurück in einer winzigen Stadt und hatte das Gefühl, langsam zu ersticken.
Auf der Suche nach irgendetwas, mit dem ich mich von diesem Gefühl ablenken konnte, blieb mein Blick an Theas Pinnwand hängen. Nichts Besonderes, soweit ich das feststellen konnte: eine Teilnahmeurkunde von einem Buchstabierwettbewerb aus der Grundschule, was ich irgendwie süß fand (Thea war Zweite geworden), daneben vor allem Postkarten und Polaroids, auf denen auffallend oft der Pub im Hintergrund zu sehen war. Dabei tauchten vor allem zwei Gesichter immer wieder auf.
Das Eine gehörte einem schlanken Typen, dessen weiße Haut durch die schlechte Qualität der Polaroids einen so starken Kontrast zu seinen schwarzen Haaren bildete, dass er auf manchen Bildern wie ein Geist aussah. Je älter er auf den Bildern wurde, desto mehr Tattoos entdeckte ich auf seinen Armen. Der zweite Mann schien etwas älter zu sein als Thea und hatte auf den meisten Bildern seinen Arm um ihre Schulter gelegt. Bis er ungefähr zwanzig war, kringelten sich seine sandbraunen Haare zu kleinen Löckchen, dann wurden sie radikal von einem Buzzcut abgelöst, was ich ein bisschen schade fand. Dafür lächelte er seitdem mehr, ein verschmitztes Grinsen, das man trotz der miserablen Auflösung sehr gut erkennen konnte.
Das letzte Bild an der Wand war gestochen scharf und fiel nicht nur deswegen aus der Reihe – es war auch das einzige Kinderfoto von Thea. Sie war darauf viel jünger, vielleicht sieben oder acht, im Hintergrund war ein Freizeitpark erkennbar. Erst wollte ich dem keine weitere Beachtung schenken, ich war ohnehin schon viel zu lange hier, aber etwas an der Aufnahme irritierte mich: Niemand in diesem Bild sah glücklich aus.
Klein-Thea saß auf dem Boden und zog ein Gesicht, als hätte sie gerade herausgefunden, dass Micky Mouse gar nicht echt war. Hinter ihr standen zwei gestresst wirkende Erwachsene, vermutlich ihre Eltern, und am Bildrand lümmelte ein Teenager mit gelangweilt verschränkten Armen.
Ich legte den Kopf schief. Warum hatte Thea ausgerechnet dieses Bild aufgehängt? Es schien ja nicht unbedingt der beste Tag ihres Lebens gewesen zu sein. Überhaupt – wieso war das das einzige Familienfoto?
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, polterte etwas hinter mir. Ertappt fuhr ich herum und starrte auf die geschlossene Zimmertür.
Von draußen ertönte eine Männerstimme: »Thea? Bist du zu Hause?«
Oh, verdammt. Das war jetzt ungünstig.
Frage 1: Wer war der Typ?
Frage 2: Wusste er, dass ich wegen Thea hier war und nicht, weil ich hatte einbrechen wollen?
Frage 3: Wenn nicht – was sollte ich jetzt bitte tun?
Während ich versuchte, so leise wie möglich zu atmen, ging ich im Kopf meine Handlungsoptionen durch. Ich war mir ziemlich sicher, dass Thea und ich gestern Abend zu viele Treppenstufen nach oben gestiegen waren, um jetzt einfach aus dem Fenster klettern zu können. Ich könnte dem Typen natürlich auch einfach die Tür aufmachen und erklären, dass ich keine Einbrecherin war. Der Zettel, den Thea geschrieben hatte, sollte Beweis genug sein. Allerdings barg diese Option zwei Gefahren: Der Kerl könnte mir eine verpassen und die Polizei rufen, bevor ich mit meiner Erklärung fertig war, und mir war wirklich nicht danach zumute, meinen Samstagmorgen verkatert auf einer Polizeistation zu verbringen. Oder es handelte sich um ihren Freund und meine Anwesenheit löste einen handfesten Beziehungskonflikt aus. Männer hatten Frauen schon für weniger erschossen. Und ich wollte meine Sicherheit nicht auf den unwahrscheinlichen Fall setzen, dass Thea und ihr hypothetischer Freund eine polygame Beziehung führten und alles abgesprochen war. Bis zu meinem Outing hatte meine Familie über die LGBTQIA*-Community nicht viel mehr gewusst, als dass das irgendwas mit der Regenbogenflagge zu tun hatte. Ich bezweifelte, dass das Hinterland von Virginia in der Hinsicht fortschrittlicher war, auch wenn sie bei der letzten Präsidentschaftswahl auf die Seite der Demokraten gewechselt waren.
Mein Blick fiel auf Theas Kleiderschrank. Die Türen hingen leicht schief in den Angeln, was in mir den Drang auslöste, den nächstbesten Werkzeugkasten zu suchen. Trotzdem war der Schrank gerade meine beste Option. Angesichts der Ironie hätte ich beinahe gelacht.
»Thea? Schläfst du noch oder kann ich reinkommen?«
Ich war im Schrank, bevor der Kerl seinen Satz beendet hatte. So leise ich konnte, zog ich die Tür vor mir zu. Ein dämmriges Halbdunkel umgab mich und ich konnte förmlich spüren, wie mir Staub in die Nase kroch.
Oooh nein. Ich würde jetzt nicht niesen. Ich kam mir sowieso schon vor wie die Protagonistin einer wirklich miesen Komödie, da musste ich mich nicht auch noch durch ein schlecht getimtes »Hatschi« verraten.
Angespannt lauschte ich, ob ich mich doch verraten hatte, aber da niemand »Hallo, wer ist da?« rief, war ich wohl vorerst in Sicherheit. Vorsichtig versuchte ich, eine etwas bequemere Position zu finden. Ich stand etwas geduckt unter einer Kleiderstange, die mit einer schier unmöglichen Menge von Kleiderbügeln behängt war. Warum die Stange noch nicht in der Mitte durchgebrochen war, war mir ein Rätsel. Vorsichtig schob ich ein paar Kleider beiseite. Direkt vor meiner Nase baumelte eine schicke Lederjacke von einem meiner Lieblingsbrands. Ob es sehr auffallen würde, wenn ich sie später einfach mitnahm …?
In diesem Moment ging die Zimmertür auf und für den Bruchteil einer Sekunde war ich der festen Überzeugung, der Kerl hätte meine kriminelle Energie gespürt und wäre deshalb hereingekommen. In dem Fall hätte ich mich bei Ari dafür entschuldigen müssen, dass ich mich über ihre Eso-Obsession lustig gemacht hatte.
Der Geräuschkulisse nach zu urteilen, gab es allerdings keinen Grund, mich zu entschuldigen. Es klang, als ob der Typ etwas suchte. Während ich die Luft anhielt, beendete mein Gehirn die moralische Debatte zwischen meinem Berufsethos und einer potenziellen Karriere als Kleiderdiebin und wandte sich hilfreicheren Gedanken zu. Nämlich, wie zur Hölle ich hier wieder herauskommen sollte. Irgendwann fand der Typ sicher, was er suchte, aber wenn er hier wohnte, dann würde er die Wohnung möglicherweise nicht mehr so schnell verlassen, immerhin war Wochenende.
Zu allem Überfluss begann meine Nase jetzt wirklich auch noch zu kribbeln. Vorsichtig verlagerte ich mein Gewicht und lehnte mich ein Stück nach vorn, sodass ich durch den Spalt zwischen den Schranktüren hindurchsehen konnte. Augenblicklich fühlte ich mich nicht mehr wie in einer mittelmäßigen RomCom, sondern wie im Einsatz. Lage sondieren. Das verdächtige Subjekt observieren. Das konnte ich, darin war ich gut.
Durch die schiefhängende Tür konnte ich ein Stück der Fotowand sehen, ein bisschen Fenster – und den Rücken eines Mannes, der über einer der Schubladen des Schreibtisches gebeugt stand. Jetzt richtete er sich auf und mir rutschte der Magen in die Kniekehlen, als er sich umdrehte und scheinbar ernsthaft in Erwägung zog, seine Suche im Kleiderschrank fortzusetzen. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, welchen Gegenstand man entweder im Schreibtisch oder im Kleiderschrank aufbewahrte. So, wie er stand, konnte ich sein Gesicht nicht erkennen, aber eigentlich war es auch egal, wie er aussah.
Hauptsache, er ging wieder!
Aber natürlich ging er nicht. Stattdessen klingelte sein Handy.
Wenn man das, was da aus dem Handy des Typen erklang, überhaupt als Klingeln bezeichnen konnte. Es klang eher, als wäre gerade ein Frosch überfahren worden. Fantastisch.
»Seth, hi! Was gibt es?« Die Stimme des Mannes klang jetzt viel freundlicher. »Ich stehe gerade in Theas Zimmer und überlege, ob ich dieses schreckliche ›Tomb Raider‹-Poster endgültig verschwinden lasse.«
Ein Lachen, sanft wie eine Brise über dem Meer, folgte seinen Worten. Es hatte wie ein Running Gag geklungen, allerdings hatte ich keine Ahnung, um welches Poster es ging – ich hatte letzte Nacht Besseres zu tun gehabt, als mich mit Theas Wanddekoration zu beschäftigen. Dieser Seth, mit dem der Typ telefonierte, schien jedoch weniger zu Witzen aufgelegt zu sein. Stattdessen hörte ich ein eindringliches Murmeln und etwas in der Haltung des Typen änderte sich, je länger er zuhörte. Er wirkte jetzt aufrechter, wie in Habachtstellung, und als er wieder sprach, schwang etwas Alarmiertes darin mit.
»Alles klar. Ich bin grad erst reingekommen, ich habe gestern Abend auf Camilles Kinder aufgepasst und bin dann da eingeschlafen. Ich zieh mich nur kurz um und esse was, dann komme ich. Nein, kein Problem, wirklich.«
Während er Seths Antwort lauschte, setzte er sich wieder in Bewegung und verließ endlich den Raum. Das Attentat auf das Poster schien vergessen.
Wer auch immer Seth war – gerade war er meine Lieblingsperson.
Ich lauschte konzentriert auf die Schritte und die sich entfernende Stimme, bis ich beides nur noch dumpf hörte. Jetzt war meine beste Chance, ungesehen die Wohnung zu verlassen.
Vorsichtig drückte ich die Schranktür auf und kletterte mit einem letzten wehmütigen Blick auf die Lederjacke hinaus. Als ich mich wieder gerade aufrichtete, knackte ein Wirbel in meinem Rücken und ich sah vor meinem inneren Auge schon die Schlagzeile: »Beziehungstragödie – Mann erwischt One-Night-Stand seiner Freundin und wird verprügelt« vorbeiziehen, aber der Typ redete unbeirrt weiter.
Sehr gut. Ich hasste es, mich auf leeren Magen und außerhalb eines Boxrings mit Leuten prügeln zu müssen.
So leise ich konnte, schlich ich durch das Chaos in Theas Zimmer und warf dabei einen Blick auf besagtes Tomb Raider-Poster. Aus feministischer Perspektive konnte ich nachvollziehen, wieso der Kerl es hatte zerreißen wollen. Aus Sicht einer bisexuellen Frau verstand ich allerdings auch sehr gut, wieso Thea es aufgehängt hatte. Vorsichtig lugte ich nach draußen. Am Ende des Flures stand die Tür zur Küche offen und ich konnte sehen, wie der Typ mit zwischen Ohr und Schulter eingeklemmtem Handy den Kühlschrank öffnete.
Eine bessere Chance würde ich nicht bekommen. Ich schätzte kurz den Abstand zwischen mir und der Wohnungstür ein und schob mich langsam auf den Flur.
»Hey, warte!«
Ich erstarrte. Die Worte klangen wie das ferne Grollen des Donners, das von Sturm kündete, und jagten mir einen Schauer über den Rücken. Wie in Zeitlupe drehte ich mich zu der Stimme um.
Doch der Kerl stand noch immer mit abgewandtem Rücken vor dem Kühlschrank und schien mich nicht bemerkt zu haben. Stattdessen lachte er leise über irgendetwas. Eine Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen.
Das wäre der Augenblick gewesen, in dem ich die Flucht hätte ergreifen sollen. Aber irgendetwas daran, wie der Kerl lässig gegen die offene Tür des Kühlschranks lehnte, hielt mich davon ab. Selbst von hier aus konnte ich sehen, dass sein navyblaues Sweatshirt leicht über seinem Kreuz und den Oberarmen spannte. Er hatte schmale Hüften, die durch die schwarzen Cargo Pants, die er trug, noch betont wurden.
Ich konnte nicht aufhören, ihn anzustarren. Himmel, ich hatte einen Sweet Spot für alles, was auch nur ansatzweise nach Techwear aussah. Und scheiße, es stand ihm gut.
Okay, ich musste wirklich, wirklich hier raus. Bevor ich mich zu sehr von gutaussehenden Fremden ablenken ließ oder der Kerl beschloss, sich doch noch umzudrehen, schlüpfte ich aus der Wohnung und rannte praktisch über den Flur.
An dieser Stelle war ich Vergangenheits-Bree sehr dankbar dafür, Laufschuhe angezogen zu haben.
Wenige Augenblicke später stand ich wieder draußen auf der Straße und blinzelte in die frische Frühlingssonne. Die Luft war noch kühl und klar und unter anderen Umständen hätte ich das total super gefunden. Im Moment wurden dieser wunderschöne Morgen und meine Freude über die gelungene Flucht allerdings dadurch getrübt, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich war. Außerdem erinnerte sich mein Körper langsam daran, dass ich ihm gestern eine nicht unbeträchtliche Menge alkoholischer Getränke zugemutet hatte und er das absolut nicht witzig fand. Mein Magen grummelte unangenehm und als ich den Kopf in den Nacken legte und an dem Haus hinaufsah, das ich gerade verlassen hatte, schoss ein scharfer Schmerz durch meine Schläfen. Nichts an dem Gebäude kam mir bekannt vor, nichts gab mir einen Hinweis darauf, wo ich mich befand und wie ich von hier wieder nach Hause kam. Aus Reflex tastete ich nach meinem Handy, nur um augenblicklich daran erinnert zu werden, dass ich keins dabeihatte.
Fantastisch. Es gab doch nichts besseres, als an einem Samstagmorgen verkatert einen Orientierungslauf durch eine fremde Stadt zu machen.
Weil ich befürchtete, mich vor Theas Haus zu übergeben, wenn ich mich noch weiter suchend im Kreis drehte, ging ich einfach in irgendeine Richtung los. So viele Möglichkeiten gab es schließlich nicht.
Obwohl ich nicht in der besten Stimmung für Unterhaltungen war, war ich doch froh, als ich ein paar Straßenecken weiter auf eine Bäckerei stieß. Ein warmes, einladendes Licht drang durch die Fenster, über einer smaragdgrün gestrichenen Ladentür hing ein sorgfältig gemaltes Schild mit der Aufschrift »Alan’s Bakery« und zwei Kübel mit weiß und rosa blühenden Blumen flankierten den Eingang. Der Laden sah aus wie ein Motiv auf einer »Cape Charles – wir waren hier«-Postkarte aus dem Souvenirshop.