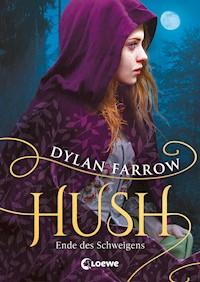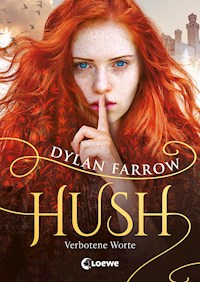
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hush
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bücher sind gefährlich. Tinte kann tödlich sein. Shae lebt in Montane, einem Land, in dem Sprache Macht bedeutet. Mit eiserner Hand regieren die Barden über das verarmte Volk. Denn nur sie können mit ihren Worten die Magie kontrollieren. Shae fürchtet sich umso mehr vor ihnen, weil sie ein Geheimnis hat: Alles, was sie stickt, wird lebendig. Aber dann passiert etwas, das ihr keine Wahl lässt, als Antworten bei den Barden zu suchen. Und schnell lernt Shae, wie mächtig Worte wirklich sein können … Das aufsehenerregende Jugendbuch-Debüt von Dylan Farrow ist der Auftakt einer starken Fantasy-Dilogie, die aufzeigt, wie mithilfe von Propaganda und Lügen die öffentliche Meinung beeinflusst und die Wahrheit totgeschwiegen wird. Spannend werden die Themen Fake News und politische Meinungsmache in eine originelle Fantasygeschichte mit feministischem Charakter eingeflochten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Aus dem Manifest des Hohen Hauses
Kapitel 1 – Schnipp. Schnipp-schnipp-schnipp. Ich …
Kapitel 2 – Die meisten Reisenden …
Kapitel 3 – Die Jubelschreie der …
Kapitel 4 – Ma sitzt mit …
Kapitel 5 – Ich kann nicht …
Kapitel 6 – Sterne blitzen am …
Kapitel 7 – Wieder werde ich …
Kapitel 8 – Als ich vor …
Kapitel 9 – Der Laden ist …
Kapitel 10 – Ich war noch …
Kapitel 11 – Man sagt, dass …
Kapitel 12 – »Aufhören! Lasst mich …
Kapitel 13 – Ravods Haltung, mit …
Kapitel 14 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 15 – Warmer Sonnenschein flutet …
Kapitel 16 – Ich ziehe mein …
Kapitel 17 – Er weiß es. …
Kapitel 18 – Die stille, blasse …
Kapitel 19 – »Du warst in …
Kapitel 20 – Die Welt hüllt …
Kapitel 21 – Mein Kopf ist …
Kapitel 22 – Es ist zwei …
Kapitel 23 – Ich warte, bis …
Kapitel 24 – Ich bin wieder …
Kapitel 25 – Zurück in meinem …
Kapitel 26 – Es war Kennan. …
Kapitel 27 – Ich hätte ein …
Kapitel 28 – Anfangs spüre ich …
Kapitel 29 – Es ist schwer …
Epilog
Danksagung
Anmerkung der Autorin
AUS DEM MANIFEST DES HOHEN HAUSES
Zuerst färben sich die Adern im Handgelenk blau, damit fängt es an. Jeder weiß das. Dann folgen Kurzatmigkeit, Husten, Fieber und Muskelschmerzen. Nach der Ansteckung können noch ein oder zwei Tage vergehen, ehe die blauen Adern am ganzen Körper sichtbar werden und in der Lederhaut der Augen Flecken und Trübungen auftreten. Die Blaufärbung breitet sich durch die Extremitäten bis in die Fingerspitzen und Zehen aus und im letzten Stadium werden die Adern extrem druckempfindlich. Sie pulsieren und schwellen an, als ob sie jeden Moment platzen würden.
Manchmal, in den ganz schlimmen Fällen, tun sie das auch.
Die Schmerzen werden schließlich unerträglich. Dazu gesellen sich die unterschiedlichsten Abstufungen von Delirium und Paranoia. Unvergessen ist diese Aussage eines Barden: »Sie haben sogar noch mehr Angst als wir.«
Unsere Epoche ist unwiderruflich von Tod und Chaos geprägt. Auf den Straßen, den Feldern und in den Häusern verweilt der faulige Verwesungsgestank der Krankheit. Über ganz Montane hängt eine Rauchwolke von den vielen Tausend Scheiterhaufen, auf denen die Toten verbrannt werden, und den Häusern, die wir den Flammen übergeben müssen, um eine Verbreitung der Krankheit zu verhindern.
Wenn wir diese Tragödie beenden wollen, müssen wir zu ihren Anfängen zurückkehren.
Es wird behauptet, dass die Krankheit, die gemeinhin als »der Blaue Tod« oder einfach »die Flecken« bezeichnet wird, als Erstes in einem ländlichen Anwesen im Südwesten auftrat. Und als ob sie sich durch bloße Erzählungen ausbreiten würde, tauchte sie überall dort auf, wo man kurz zuvor darüber berichtet hatte. Sie raste förmlich durch Montane, sodass nach nur wenigen Tagen aus allen Ecken des Landes Krankheitsfälle gemeldet wurden. Jeder, der die typischen Symptome aufwies, musste sich umgehend in Quarantäne begeben, aber auch das konnte die Flut des Todes nicht aufhalten. Es war die Hölle auf Erden. Wir waren ein Land, in dem Schmerz, Angst und Chaos regierten.
Es gibt immer noch Menschen, die sich an die düsteren Prozessionen der maskierten Ärzte erinnern können, die ganze Wagenladungen blauer Leichen zu den Scheiterhaufen brachten.
Und erst nach eingehender Untersuchung entdeckten die Barden des Hohen Hauses die wahre Natur des Feindes:
Tinte.
Wir hatten diesen Feind mit offenen Armen willkommen geheißen – in unseren Geschichten, Briefen und Nachrichten. Wir hatten ihn in unsere Häuser eingeladen, ihn mit unseren eigenen Händen weitergegeben und ihn sogar noch in unseren Warnschreiben verbreitet.
Aber gemeinsam werden wir uns aus der Asche unserer Gefallenen erheben und eine neue Ära des Friedens in Montane einläuten. Alle müssen sich auf die Seite des Hohen Hauses stellen, damit sich eine solche Tragödie niemals wiederholen kann. Die Tyrannei des Blauen Todes kann bezwungen werden.
Unsere Geschichte zeigt, dass Wachsamkeit und Vorsicht die Grundlagen für unser Überleben bilden. Verbannt Tinte von Papier. Wendet euch von verbotenen Wörtern ab, von giftigen Geschichten und tödlichen Symbolen. Reinigt das Land von diesem üblen Geschwür.
Schließt euch uns an.
Shae saß unter dem alten Baum vor dem Haus, in dem ihr Bruder im Sterben lag.
Bis hierher drangen nur die lautesten, schrillsten Klagelaute und sie wurden immer leiser, je schwächer er wurde. Er war noch nicht tot, aber es würde nicht mehr lange dauern.
Vor ihr stand ein Korb mit Lumpen. Sie griff mit beiden Händen hinein und riss den Stoff in lange Streifen. Der Kummer schnürte ihr die Kehle zu. Wenn Kierans Todesbänder erst am Baum hingen, würden alle wissen, dass die Flecken ihre Familie heimgesucht hatten.
Sie dachte an die blauen Adern, die unter der Haut ihres Bruders über seinen Körper krochen, und erschauerte. Die Erwachsenen hinderten sie daran, sich ihm zu nähern, aber sie hatte die Anzeichen der Krankheit durch den Spalt in der Schlafzimmertür gesehen. Und sie hörte die Geräusche, die er von sich gab – Schmerzensschreie und heftiges Husten.
Er war noch ein Kind, drei Jahre jünger als sie. Es war nicht gerecht.
Sie spürte ein unheilvolles Ziehen in ihrer Magengrube, als sie aufstand und auf den Baum klettern wollte. Ein weiterer Schmerzenslaut erklang vom Haus. Kierans geplagte Schreie und Mas besänftigende Stimme waren die einzigen Geräusche weit und breit, die der Wind über den grauen Berghang trug.
Shae stopfte die Bänder, die sie gerissen hatte, in ihre Rocktasche und stieg auf den Baum. Sie fand eine Stelle, wo sie sich hinsetzen konnte, und begann, die dunkelblauen Stoffstreifen an die Äste und Zweige zu binden. Die bleiche Wintersonne lugte durch die Wolken und warf den knorrigen Schatten der Baumkrone auf das Haus.
Shae erschauerte. Die Schatten sahen aus wie blaue Adern.
Aus ihrem Krähennest im Baum erkannte Shae drei Reiter in der Ferne. Schnell kamen sie näher. Sie hatte noch nie so herrliche Pferde gesehen, obwohl sie schon von solchen Tieren gehört hatte, die ganz anders waren als die Ackergäule im Dorf. Jeder in Montane kannte die Geschichte des Ersten Reiters: Vor langer Zeit, Jahrhunderte vor dem Auftreten des Blauen Todes, zähmte er ein Wildpferd, das aus der Sonne entstanden war. Auf seinem Rücken galoppierte er durch die leere Dunkelheit der ungeborenen Welt und erschuf Leben mit den Worten, die von seinen Lippen flossen. Wohin er auch kam, erblühte das Land.
Die Mähnen und Schweife der sich nähernden Pferde schwebten, als wären sie unter Wasser, und selbst im blassen Winterlicht glänzten sie. Diese wunderschönen Tiere konnten nur von einem Ort stammen: vom Hohen Haus.
Die Barden kamen, um ihr Haus zu verbrennen.
Obwohl ihre Gesichter von Kapuzen verhüllt waren, hätte Shae schwören können, dass sie sah, wie sich die Lippen der Barden unermüdlich bewegten. Der Wind frischte auf, als sie sich näherten, und die Schreie wurden lauter, als ob sie mit ihm wetteifern wollten. Der Ast unter ihr tat einen abrupten Ruck und Shae verlor das Gleichgewicht. Sie rutschte ab und ihre Hände suchten vergeblich nach Halt.
Alles, was sie im Fallen sehen konnte, war ein Gewirr aus blauen Bändern, die im Wind knatterten und flatterten.
KAPITEL 1
Schnipp. Schnipp-schnipp-schnipp. Ich reiße die Augen auf. Ich liege im Bett, auf der dünnen, harten Matratze. Derselbe Traum, genauso lebendig wie damals vor fünf Jahren, als es geschah.
Über mir steht eine dunkle Gestalt und schnippt mit den Fingern.
»Aufwachen, Schlafmütze!«
»Pst!«, flüstere ich. »Sei doch leise, sonst weckst du Ma auf.« Sie braucht ihren Schlaf viel mehr als ich.
Fiona schnaubt, tritt von meinem Bett zurück und in die graue Morgendämmerung, die durch das Fenster fällt. Bei Licht betrachtet, sieht sie viel weniger beängstigend aus. Groß gewachsen, schlank und blond, mit den höchsten Wangenknochen in ganz Montane, so steht sie da: wie Sonnenschein an einem verregneten Tag. Schön, aber auf eine Art, die sie selbst nicht erkennt. Meine Eltern waren beide braunhaarig, klein und gedrungen und mein Wunsch, so groß und blond zu werden wie Fiona, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber von wem ich die unzähligen Sommersprossen im Gesicht habe, weiß niemand, zumindest weder von meiner Ma noch von meinem Pa. Das scheint allein meine Bürde zu sein.
Meine Freundin zuckt mit den Schultern. »Das bezweifle ich, jedenfalls wenn sie einen so festen Schlaf hat wie du.«
Ich schaue zu meiner Mutter. Ihr zierlicher Körper liegt unter der Decke auf dem Bett an der anderen Wand und ihr Brustkorb hebt und senkt sich sanft mit jedem Atemzug. Fiona hat recht. Meine Mutter schläft wie eine Tote.
»Was machst du hier?« Ich ziehe die dünne Decke von meinen Beinen und massiere meine verspannte Schulter.
»Wir haben Sichelmond, schon vergessen?«
Fionas Vater verkauft die Wolle von unseren Schafen und als Gegenleistung bekommen wir Lebensmittel aus seinem Laden. Fionas Familie ist eine der wenigen, die sich noch mit uns abgibt, seit uns die Flecken befallen haben. Jeden Monat bei Viertelmond kommt Fiona vorbei und wir tauschen die armseligen Waren aus, die unseren Familien das Überleben sichern.
»Aber warum denn so früh?« Ich unterdrücke ein Gähnen. Meine Füße schmerzen, als ich sie auf den Boden stelle, und meine Beine zittern vor Erschöpfung. Obwohl ein langer Tag auf dem Feld hinter mir lag, konnte ich letzte Nacht schlecht schlafen. Dunkle Träume lauerten am Rand meines Bewusstseins, mit leise flüsternden Stimmen und Schatten. Und so saß ich stundenlang im blassen Licht der Mondsichel am Fenster und stickte, um mich abzulenken.
Fiona folgt mir zur anderen Seite des Raums, wo meine Kleider hängen. Eine einfache weiße Bluse, ein ausgeblichener grüner Rock, den ich mit Wollfäden bestickt habe. Der Saum ist schlammig und eingerissen. Dazu eine passende Weste, gefüttert mit weichem Kaninchenfell. Die Sachen sind das Gegenteil von elegant, doch etwas anderes besitze ich nicht. Eigentlich trage ich lieber Hosen; sie sind praktischer für die Arbeit im hohen Gras, aber nachdem ich immer wieder aus ihnen herausgewachsen bin, sobald ich den Saum herausgelassen hatte, beschloss ich, dass ein Rock einfacher ist. Ich raffe ihn hoch und knote ihn oberhalb meiner Knie zusammen, wenn es heiß ist oder ich mich in unwegsamem Gelände befinde.
Fiona dreht sich diskret um, als ich mich umziehe, wobei sie über meinen Wunsch nach Privatsphäre beim Kleiderwechsel die Augen verdreht. Als ich fertig bin, schiebe ich sie aus dem Schlafzimmer und ziehe die knarrende Tür so leise wie möglich hinter mir zu.
»Pa will, dass ich wieder im Laden bin, bevor wir aufmachen«, sagt Fiona und mustert meine vom Spinnen schwieligen und wunden Hände, mit denen ich nun die Garnknäuel für sie in den Korb lege. »Die Barden kommen heute.«
Die Barden. Plötzlich ist mir, als ob das ganze Haus mit Eis überzogen wurde. Die Dorfältesten sagen, dass in manchen Wörtern Macht liegt, dass bestimmte Ausdrücke die Welt ringsum verändern können. Das Gleiche hat man von der Farbe der Krankheit behauptet. Indigo wurde gemieden, als ob schon allein der Anblick oder der Klang des Wortes die Krankheit wieder aufflackern lassen könnte. Wenn man heute davon spricht, was nur selten geschieht, nennt man sie »die Verfluchte Farbe«.
Nur die Barden können Wörter gefahrlos verwenden mittels ihrer Beschwörungen. Jedes Kind in Montane weiß, dass ein Narr Unheil herbeirufen kann, nur indem er verbotene Worte äußert.
Manche behaupten, mein Bruder sei ein solcher Narr gewesen.
Man sagt, dass die Flecken mit dem geschriebenen Wort ihren Anfang nahmen. Die Zerstörung, die sie anrichteten, hat dazu geführt, dass man Wörter im Allgemeinen fürchtet, seien sie nun geschrieben oder gesprochen. Jede unbedachte Äußerung kann die Pandemie wieder aufflackern lassen.
Und das führte dazu, dass Ma seit Kierans Tod kein Wort mehr gesagt hat.
Ein vertrautes Gefühl der Furcht schlängelt sich durch meine Eingeweide.
Die Barden tauchen ein- oder zweimal im Jahr hier auf und meistens erfahren wir erst einen Tag vorher von ihrem Kommen durch einen Raben oder den Wachtmeister des Dorfs, der dann alle Leute zusammentreibt, um die Barden gebührend willkommen zu heißen. Man sammelt den Zehnten ein, der dem Hohen Haus übergeben wird. Sollten diese Abgaben Gnade vor den Augen der Barden finden, darf das Dorf auf eine Beschwörung hoffen, mit der Land und Leute gesegnet werden.
Aber die Barden sind nur selten gnädig. Die Gaben, die Aster anzubieten hat, sind dürftig: ein Arm voll Wolle, ein paar blässliche Weizenbüschel. Die Haut und das Geweih eines Hirschs, wenn wir Glück haben.
Seit ich geboren wurde, hat es in Aster keine Beschwörung mehr gegeben, aber der Dorfälteste, Großvater Quinn, erzählt oft von einer Beschwörung aus seiner Kindheit. Nachdem die Barden gegangen waren, brauchte seine Familie sechs Wochen, um die üppige Ernte einzufahren.
Ich bin den Barden das letzte Mal begegnet, als Kieran starb. Danach verbot mir Ma, sie zu sehen – es waren die letzten Worte, die sie zu mir sagte. Aber andererseits habe ich gar keine Zeit, um mich mit ihnen abzugeben. Die gnadenlose Sonne hat unser Land völlig vertrocknen lassen und oft muss ich unsere Herde meilenweit treiben, um überhaupt Futter für sie zu finden. Letzten Monat ist uns ein drei Wochen altes Lamm verhungert.
Jetzt verstehe ich, warum Fiona so früh gekommen ist. Wenn die kleinen Wollknäule, die wir zu bieten haben, den Zehnten des Dorfs auch nur ein bisschen aufwerten, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass die Barden die Dürre beenden. In Aster hat es seit fast neun Monaten nicht mehr geregnet.
»Alles in Ordnung?«, fragt Fiona leise.
Ich schrecke auf, das Garn noch in der Hand. In letzter Zeit verfolgen mich seltsame Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Träume, die mir eher wie schreckliche, unerklärliche Vorahnungen erscheinen. Und dann wache ich mit der immer stärker werdenden Angst auf, dass mit mir etwas nicht stimmt.
»Mir geht’s gut.« Die Worte dringen mir schwer aus dem Mund.
Fionas große grüne Augen werden ganz schmal. »Du lügst«, sagt sie unverblümt.
Ich atme tief durch, während eine verzweifelte, irrsinnige Idee in mir aufkeimt. Mit einem schnellen Blick zu der geschlossenen Schlafzimmertür packe ich den Wollkorb mit der einen Hand und Fionas Handgelenk mit der anderen und gehe mit schnellen Schritten aus dem Haus.
Die Sonne lugt gerade über den Horizont und die Luft ist immer noch kalt und trocken. Die Berge ringsum schneiden harte Zickzacklinien in den Himmel und Nebel überzieht das Tal mit einem Schleier, der allmählich höher steigt.
Schweigend gehe ich mit Fiona um das Haus herum. Trotz der kühlen Morgenluft fühlt sich meine Haut heiß an und juckt. In meinem Kopf wirbeln die Gedanken. Ich habe Angst, dass Fiona die Wahrheit in meinen Augen erkennt, wenn ich sie jetzt ansehe.
Und dann wäre ich in ernsten Schwierigkeiten – und sie auch, nur durch ihre Freundschaft zu mir.
Es fing vor etwa einem Jahr an, gleich nach meinem sechzehnten Geburtstag. Ich bestickte gerade eins von Mas Kopftüchern mit Amseln im Flug, und als ich zwischendurch den Kopf hob und nach draußen schaute, sah ich, wie ein Schwarm Amseln sich über dem Haus am Himmel sammelte. Nicht lange danach saß ich einmal auf der Wiese und stickte einen weißen Hasen auf einen Kopfkissenbezug, als einer der Nachbarshunde mit einem blutbesudelten weißen Hasen im Maul vorbeilief.
Und seitdem steigt mir jedes Mal, wenn ich die Nadel zur Hand nehme, ein warmes Kitzeln in die Finger. Nicht unangenehm, aber sonderbar.
Zahllose Nächte lag ich wach und starrte die dunklen Holzbalken an der Zimmerdecke an, während ich versuchte herauszufinden, ob ich verrückt oder verflucht bin – oder beides. Nur eins weiß ich mit Sicherheit: Der Schatten der Krankheit ist schon einmal auf uns gefallen. Wir wurden von den Flecken berührt. Es ist unmöglich vorauszusehen, welche sonstigen Katastrophen aus diesem Kontakt entstehen könnten. Und seit ich entdeckt habe, dass meine Stickereien in der wirklichen Welt widerhallen, fühlt sich Mas Schweigen geradezu ohrenbetäubend an. Die Luft ist schwer von all den unausgesprochenen Worten.
Verlust. Erschöpfung. Nagender Hunger, Tag für Tag.
Die morgendliche Kühle lässt mich erschauern und eine kalte Furcht setzt sich in meinen Eingeweiden fest. Erst als wir die Scheune erreichen, lasse ich Fiona los, trotzdem werfe ich erneut einen ängstlichen Blick über die Schulter. Das kleine graue Holzhaus liegt still und stumm im Dunst, so wie wir es verlassen haben.
»Was ist denn in dich gefahren, Shae?« Misstrauisch, aber gleichzeitig neugierig zieht sie eine Augenbraue hoch.
»Fiona«, sage ich und beiße mir dann auf die Lippe, weil ich nicht sicher bin, wie ich fortfahren soll. »Du musst mir einen Gefallen tun.« Das immerhin ist die Wahrheit.
Ihr Blick wird weich. »Natürlich, Shae. Jederzeit.«
Sofort will ich meine Worte ungesagt machen. Ich versuche mir vorzustellen, was passieren würde, wenn ich ihr einfach alles erkläre. Ich bin vielleicht von den Flecken befallen und deshalb will ich die Barden fragen, ob sie mich heilen können.
Im besten Fall verliere ich meine Freundin, die fürchten muss, dass ich sie mit meinem Fluch anstecke. Dann weiß das ganze Dorf innerhalb eines Tages Bescheid. Ihre Eltern werden den Handel mit Ma beenden, niemand wird unsere Wolle kaufen und Ma und ich werden verhungern.
So etwas nur laut auszusprechen ist verboten. Niemandem darf auch nur ein einziges Wort, das irgendeinen Schaden hervorrufen könnte, über die Lippen kommen. Solche Wörter tragen ihr ganz eigenes Übel mit sich, ihren eigenen Fluch, den sie sowohl auf demjenigen abladen, der sie ausspricht, als auch auf denen, die sie hören. Die Worte würden meine Vermutung wahr werden lassen, allein durch ihre Existenz.
Im schlimmsten Fall stecke ich tatsächlich meine beste und allerliebste Freundin mit der Krankheit an.
Dieses Risiko darf ich nicht eingehen.
Ich starre in Fionas liebes, erwartungsvolles Gesicht und weiß, ich kann es nicht. Ich kann nicht riskieren, sie auch noch zu verlieren.
»Darf ausnahmsweise ich die Wolle heute zu deinem Pa bringen?«, frage ich sie stattdessen. »Dann müsstest du die Herde hoch auf die Nordweide treiben und auf die Tiere aufpassen, bis ich wieder da bin. Sie dürften heute Morgen nicht allzu störrisch sein und ich würde dir genau erklären, was du tun musst. Außerdem hast du mir schon hundertmal dabei zugesehen.«
Fiona runzelt die Stirn. »Das ist alles? Klar mache ich das. Aber warum?«
Schwer hämmert mein Herz in der Brust. Ich hole tief Luft, lehne mich gegen die grob behauenen Holzlatten der Scheune, weil mir die Knie weich werden, und bemühe mich, das Chaos in meinen Gedanken zu ordnen. Es ist zum Verrücktwerden, wie schlecht ich lügen kann.
»Oh, jetzt weiß ich, was los ist!« Ein schelmisches Lächeln kräuselt Fionas Mundwinkel und mein Herz setzt plötzlich aus und hüpft mir dann vor die Füße. »Du triffst dich mit Mads, stimmt’s?«
»Ja!« Erleichtert atme ich auf. »Genau.« Niemand würde sich darüber wundern, wenn ich ins Dorf gehe, um Mads zu sehen. Oder wenn doch, würde man Verdächtigungen anstellen, die weit von dem entfernt sind, worüber ich mir Sorgen mache.
»Shae, das muss dir doch nicht peinlich sein«, lacht Fiona. »Ich verstehe das vollkommen.«
Ich zwinge mich zu einem dünnen, hoffentlich überzeugenden Lachen, obwohl es eher so klingt, als ob ich mich verschluckt hätte. »Danke. Du hast was gut bei mir.«
»Da fällt mir bestimmt was ein.« Sie beugt sich vor und umarmt mich. Unwillkürlich will ich zurückweichen, als würde allein schon meine Berührung eine Gefahr für sie darstellen. Aber stattdessen bade ich einen Augenblick lang in ihrem Duft aus frischem Dill und Brombeeren und klarem Wasser aus dem Fluss. Und diesen einen Augenblick lang fühle ich mich nicht verflucht, sondern gesegnet.
Fiona und ich sind als Freundinnen ein ungewöhnliches Paar. Ich bin klein, sie groß, ich dunkelhaarig, sie blond. Ich bin stämmig und muskulös, sie schlank und weich. Sie hat Verehrer, ich habe Schafe. Na ja, Schafe und Mads. Aber das geht schon in Ordnung. Fiona ist treu, mitfühlend und bereit, all meine Launen auszuhalten. Sie ist der Typ Mensch, der mir jederzeit seine Hilfe anbieten und keinerlei Gegenleistung erwarten würde. Sie verdient etwas Besseres als meine Lügen.
»Er vergöttert dich, meinst du nicht auch?«, sagt Fiona und löst sich aus der Umarmung. Aus ihrem wissenden Lächeln ist ein breites Grinsen geworden. »Ich hätte nie gedacht, dass du vor mir heiraten würdest.«
Jetzt kommt mein Lachen von Herzen. »So weit würde ich nun nicht gehen!«
Wenn Fiona eine Schwäche hat, dann ist es ihre Neigung zu Klatsch und Tratsch. Und über junge Männer zu tuscheln ist ihre absolute Lieblingsbeschäftigung. Vielleicht würde das auch auf mich zutreffen, wenn ich so wie sie im Mittelpunkt männlicher Aufmerksamkeit stünde. Aber Mads ist der Einzige in ganz Aster, der mich nicht links liegen lässt.
Er hat mich einmal geküsst, letztes Jahr, nach dem Erntedankfest, das einer enttäuschenden Ernte folgte. Am nächsten Tag verkündete der Wachtmeister, dass die Dürre zurückgekehrt sei, und Mads und sein Vater gingen daraufhin auf die Jagd und blieben drei Wochen fort. Über den Kuss haben wir nie gesprochen. Selbst jetzt weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Vielleicht ist der erste Kuss in Wahrheit für niemanden eine überwältigende Erfahrung und die Leute übertreiben, wenn sie darüber reden.
Aber Mads ist die geringste meiner Sorgen. Ich kann nur hoffen, dass ich diese kleine Scharade so lange aufrechterhalten kann, bis ich wieder zu Hause bin, ohne dass Fiona oder meine Mutter den wahren Grund meines Besuchs im Dorf erfahren – von den neugierigen Nachbarn ganz zu schweigen. In Aster wird man auf Schritt und Tritt beobachtet.
»Und du versprichst, dass du mir alles erzählst, wenn du wieder da bist?«, drängt mich Fiona und rammt mir das Messer noch tiefer ins Herz.
»Ich verspreche es.« Ich kann ihr nicht in die Augen sehen. »Komm, ich zeige dir, wie du die Herde treiben musst.«
Fiona folgt mir gehorsam um die verwitterte alte Scheune herum zum Tor. Wie das Haus ist auch die Fassade des Nebengebäudes grau vor Alter und das Reetdach marode. Es ist schon erstaunlich, dass die Scheune überhaupt noch steht, geschweige denn in der Lage ist, Raubtiere und Diebe abzuhalten.
Die Herde blökt fröhlich und trippelt, als ich den Riegel zurückschiebe und das Tor öffne. Ohne Umschweife trotten sie hinaus auf die Weide. Glücklicherweise scheinen sie heute brav und ruhig zu sein und bleiben auf dem Weg ins Tal beisammen. Nur Imogen fällt ein wenig zurück, was ich ihr nicht übel nehme. Sie wird noch diese Woche ihr Lamm gebären, ein Geschenk, das es wert ist, ein bisschen länger auf sie zu warten.
Wir bringen die Schafe auf den Hügel östlich des Tals, wo sie vom Haus aus nicht gesehen werden können. Dort drehe ich mich um und nehme Fionas Hände.
»Was ist?«, fragt sie mit einem verwirrten Blick.
»Das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe etwas für dich.« Ich hole meine jüngste Arbeit hervor, ein Taschentuch, das ich mit einer Mischung aus Roter Bete und Blütenblättern gefärbt und dann mit dunklen Blumen bestickt habe, die aussehen wie Augen. Auch einer meiner seltsamen Träume, obwohl dieser kaum wahr werden kann.
»Es ist wunderschön«, flüstert sie.
Fiona liebt alles, was ich nähe und sticke, selbst die merkwürdigen oder verstörenden Muster und Motive. Manchmal glaube ich, dass sie die Welt auf dieselbe Weise sieht wie ich. Dann wieder denke ich, dass ihr diese Dinge nur deshalb gefallen, weil sie die Welt völlig anders sieht.
Denn für sie ist alles ganz einfach. Für sie bedeutet die Sonne Licht, keine Geißel. Die Nacht ist ein Gewölbe aus Sternen, kein bedrückender Mantel aus Furcht und Stille. Und ich kann ihr nicht sagen – denn ich verstehe es ja selbst nicht –, dass ich manchmal Angst habe, dass mich die Dunkelheit verschluckt.
KAPITEL 2
Die meisten Reisenden müssen einen tückischen Pass überwinden, um in unser Dorf zu gelangen, aber von unserem Haus aus ist es nur ein Fußmarsch von etwa einer Stunde am Ufer eines Teichs entlang. Der Weg ist leicht zu bewältigen, wenn auch trostlos. Ohne den Regen wirkt die Landschaft braun und trüb, wie ausgewaschen. Der Teich ist schon lange ausgetrocknet. Übrig geblieben ist nur ein dunkler Krater mitten im Tal – eine Narbe in der Haut der Erde, die uns daran erinnert, wie es einmal gewesen ist.
Je näher ich dem Dorf komme, desto mehr ergreifen Übelkeit und Schwindelgefühl von mir Besitz. Vor meinen Augen tanzen Punkte, als hätte ich einen Sonnenstich. Die hohen Wachtürme ragen vor mir auf und werden mit jedem meiner Schritte größer. Bedrohlich. Reglos. In ihre Schatten zu treten verstärkt nur noch mein Unwohlsein.
Selbst wenn ich mit den Barden sprechen kann – es besteht das Risiko, dass sie mich für meine Unverschämtheit einfach hinrichten. Und was wenn sie in mir Spuren des Blauen Todes entdecken und mich und Ma verbannen? Und unser Zuhause ein zweites Mal verbrennen? Eine eisige Welle rollt über mich hinweg, als ich an die Strafen denke, die Barden gewöhnlich verhängen. Fionas Mutter hat einmal erlebt, wie ein Barde eine Frau mit Stummheit geschlagen hat, indem er ihr etwas ins Ohr flüsterte.
Um mein rasendes Herz zu beruhigen, versuche ich, mich an den Klang von Mas Stimme zu erinnern. Wenn ich mich konzentriere, kann ich noch immer ihr warmes Timbre hören: sanft wie der Sommerwind. Ehe das Schweigen kam, hat sie mir und Kieran Gutenachtgeschichten erzählt – Geschichten von einem Ort jenseits der wolkenverhangenen Berge, wo wir eines Tages alle in Ruhe und Frieden leben würden. Geschichten von Gondal, einem Land voller Magie und Schönheit, wo die Blumen doppelt so groß werden wie ein erwachsener Mann, wo Vögel sprechen und Spinnen summen und Bäume mit Stämmen so dick wie Häuser bis in den Himmel ragen.
Kieran und ich lagen in den Betten, die Pa für uns gemacht hatte, und lauschten gebannt. Die Betten waren vollkommen gleich, nur dass in mein Kopfteil ein kleines Herz geschnitzt war und in Kierans ein Stern. Ma saß auf einem Schemel zwischen uns, das Gesicht vom flackernden goldenen Licht einer Kerze beleuchtet, und erzählte uns von den Barden von Montane. Durch die Beschwörung können die Barden Glück erschaffen. Ihre geflüsterten Worte können ein schlagendes Herz zum Stillstand bringen und der Welt die tiefsten Geheimnisse offenbaren.
Es war eine glückliche Zeit, bevor die Legenden von Gondal als gefährlich und verdorben galten. Bevor die Barden die Dörfer und Städte auf den Kopf stellten und jede Geschichte, jedes Bild von Gondal aus den Häusern und Versammlungsstätten entfernten. Selbst das Wort »Gondal« wurde verboten.
Gondal ist nur ein Märchen, wenn auch ein unheilvolles. Als Kind habe ich das nicht verstanden, aber heute schon. Geschichten wie die über Gondal sind trügerisch und haben keinen Platz in unserer Wirklichkeit.
Sie hätte uns diese Geschichten nie erzählen sollen, denke ich wütend. Vielleicht wäre Kieran dann noch am Leben.
In meinen Fingern zuckt es und ich hätte zu gerne meine Stickerei hervorgeholt, um meine Nerven zu beruhigen. Doch stattdessen atme ich nur tief durch und vertreibe die giftigen Gedanken aus meinem Kopf. Aster taucht vor mir auf der anderen Seite des Passes auf.
Von allen Einwohnern leben Ma und ich am weitesten vom Dorf entfernt. Der Wachtmeister hat es so bestimmt, nach dem, was mit Kieran passiert ist. Ich weiß noch genau, wie es war, als Ma meine Hand nahm und mit mir den Weg in dieses Tal antrat, in dem wir seitdem wohnen. Und ich höre noch die Schläge des Hammers, mit dem der Wachtmeister das schwarze Mal über unserer Tür anbrachte – eine Totenmaske mit leerem Mund und leeren Augenhöhlen –, eine ständige Mahnung an das, was wir verloren haben. Die guten Leute von Aster müssen nicht befürchten, von unserem Unglück angesteckt zu werden, solange sie sich von uns fernhalten. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte. Ma war schon vorher, seit dem Tag, an dem Pas Herz versagte, nicht mehr dieselbe. Und seit Kierans Tod hat sie das Haus kaum noch verlassen, außer um das Land zu bestellen.
Vom Pass aus kann ich die Aneinanderreihung von Dächern unter mir auf der windgepeitschten Ebene sehen, wo Wildpferde frei herumlaufen und jeden angreifen, der dumm genug ist, sich ihnen zu nähern. Vor den Flecken war diese Ödnis das beste und fruchtbarste Land weit und breit. Jetzt erstreckt sich die trockene, staubige Erde meilenweit, hier und da gespickt mit abgestorbenen Bäumen. Im Westen zieht sich die Zickzacklinie eines wasserlosen Flussbetts wie eine offene Wunde durch das Land. Die Brücke, die den Fluss überspannt hat, wurde in einem besonders harten Winter abgerissen und zu Feuerholz verarbeitet. Zurückgeblieben ist nur ein Gerippe aus geborstenen Steinen und Mörtel.
Aster besteht aus ein paar dicht gedrängt stehenden, kleinen Häusern und scheint jedes Mal etwas mehr zu schrumpfen, wenn eine neue Horde Banditen den Weg hierher findet. Das Dorf liegt allein auf der staubigen Ebene, von hinten beschattet durch die unbarmherzigen Berggipfel. In früheren Zeiten hat man eine Mauer und Wachtürme errichtet, die über den Häusern aufragen. Die Investition hat sich gelohnt; heutzutage lebt es sich viel sicherer in Aster. Zumindest ist das Dorf keine leichte Beute mehr.
Die einfachen Häuser aus Holz und Stein wurden weiß getüncht, nachdem der Blaue Tod überstanden war, um dem Dorf den Anschein von Reinheit zu geben. Doch die Farbe ist ergraut und blättert allmählich ab. Zum Vorschein kommt das grobe Baumaterial darunter. Dennoch blitzen hier und da tapfer ein paar Farben auf: eine Reihe von Fensterläden, einstmals gestrichen in einem kräftigen Rot, jetzt aber rostig und verwittert; eine Mauer mit welkem Efeu und Blumenkästen mit vertrocknetem Unkraut. Man sieht noch, dass Aster einmal ein hübsches Dorf war, bevor Armut und Krankheit in wilder Jagd durch die engen Gassen zogen.
Vor hundert Jahren, als die Flecken das erste Mal in Montane wüteten, stapelten sich aufgedunsene blaue Leichen in den Straßen. Aber die Familie des Hohen Hauses heilte die schlimmsten Auswüchse und ein paar Jahrzehnte lang schien der Blaue Tod gänzlich ausgerottet. Doch die Menschen hielten sich nicht an die Regeln. Sie schmuggelten Tinte in die Städte und luden die Flecken in ihre Häuser ein. Und so kehrte die Krankheit in Wellen zurück.
Das könnte wieder geschehen, wenn wir nicht aufpassen.
Die Barden sorgen für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen. Trotz der harten Strafen verdanken wir ihnen unser Leben. Ihre Beschwörungen können einem Menschen, der Worte ausspricht, die den Blauen Tod herbeirufen könnten, die Luft aus der Lunge saugen. Aber sie können auch jenen das Leben wieder einhauchen, die am Rand des Todes stehen, sofern sie reinen Herzens sind.
Kieran hatte dieses Glück nicht und vielen anderen erging es ebenso. Es gibt Dinge, zu denen nicht einmal das Hohe Haus fähig ist. Aber das würde ich niemals laut aussprechen.
Der Randbereich des Dorfs ist verlassen. Als ich an den klapprigen Holzhäusern vorbeigehe, höre ich lediglich irgendwo in der Nähe eine Katze schreien. Vermutlich haben sich bereits alle Bewohner auf dem Marktplatz versammelt.
Musik dringt aus dem Dorfzentrum zu mir, aber die fröhlichen Klänge hallen geisterhaft in den leeren Straßen wider. Ich folge dem hohlen Echo und wickele den Schal um mein Gesicht, damit mich niemand erkennt. Bei dem Gedanken an starrende Augen und leise gemurmelte Flüche verkrampft sich mein Kiefer. Trotzdem gehe ich weiter in Richtung Markt.
Als ich an der verlassenen Schmiede um die Ecke biege, sehe ich die ersten Anzeichen dafür, dass sich die Menschen auf das Kommen der Barden vorbereiten – in Wahrheit ist es eine Inspektion, obwohl niemand es so nennt. Großvater Quinn spielt auf seiner rostigen Flöte und seine Frau dirigiert den Chor aus Kindern, die zu der Musik singen. Über die Melodie hinweg werden einer Gruppe junger Männer, die bunte Banner aus den Fenstern hängen, Anweisungen zugerufen. Die Farben sind mit den Jahren verblasst und der Stoff ist fadenscheinig geworden. Die Banner sehen so aus, als würden sie von der ersten steifen Brise in Fetzen gerissen.
Darunter haben die wohlhabendsten Familien von Aster ihre Stände aufgebaut, um die besten Waren auszustellen, die das Dorf zu bieten hat. Fionas Vater steht ebenfalls dort, groß gewachsen und blond wie seine Tochter. Mit hastigen Handgriffen errichtet er einen fleckigen Baldachin über einer Ansammlung mittelprächtiger Feldfrüchte, die auf umgedrehten Körben aufgeschichtet wurden, um ihnen den Anschein von Fülle zu geben. Mein Herz verkrampft sich vor Mitleid – und Angst. Selbst Fionas Vater, der unter uns am meisten vom Glück gesegnet ist, muss kämpfen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht lange und die mageren Früchte unserer Arbeit werden auf einen Karren geladen und zum Hohen Haus verfrachtet.
Es sei denn, die Barden sind unzufrieden mit uns.
Auf der anderen Straßenseite eilen Mädchen in meinem Alter in ihren besten Kleidern in Richtung Markt, in den Händen Teller mit Früchten und Krüge mit kostbarem Wasser. Meine Kehle sehnt sich nach einem Tropfen Flüssigkeit. Ich erkenne einige von ihnen, aber ich hoffe, sie erkennen mich nicht. Die Ältesten eskortieren sie, zupfen an ihren Haaren und Kleidern und kläffen: »Steht gerade!« und »Ihr müsst lächeln!«. Die Hübschesten werden nach vorne geschickt, wo sie die Blicke der Barden auf sich ziehen sollen. Einer der Ältesten beklagt sich lautstark über Fionas Abwesenheit. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken.
Die Erregung, die über dem Dorf liegt, verschleiert kaum die alles durchdringende Verzweiflung. Das Ganze ist nur eine Maskerade, um nicht zu offensichtlich werden zu lassen, dass wir dem Hohen Haus aufgrund der Dürre kaum etwas zu bieten haben. Ich frage mich, ob sich die Barden davon täuschen lassen.
Mit meinen Ellbogen schiebe ich mich durch die Menge näher an den Marktplatz heran. Ich senke den Kopf und ziehe den Schal fester um mein Gesicht, aber die meisten Leute sind sowieso viel zu sehr mit dem beschäftigt, was gleich passieren wird, um auf mich zu achten.
Die Spannung ist spürbar und die Mienen der Menschen sind starr unter ihrem erzwungenen Lächeln. Aster hatte schon vor der gegenwärtigen Dürre keinen leichten Stand, aber Wachtmeister Dunne hat uns versichert, dass die Lage in diesem Jahr besser aussehe. Fiona behauptet, er glaube, dass wir diesmal mit einer Beschwörung gesegnet werden. Dann hätte unsere Not ein Ende. Niemand müsste mehr hungern.
Ich riskiere einen Blick in die Runde. Viele Dörfler gehen in Lumpen, die Gesichter so hager und ausgezehrt wie mein eigenes. Der Knoten in meinen Eingeweiden zieht sich noch enger zusammen. Am Rand des Dorfzentrums stehen die Leute so dicht an dicht, dass ich nicht einmal bis zum Marktplatz sehen kann.
Ich runzele die Stirn und dränge mich weiter vor. Aber es ist schwierig, die Leute zum Ausweichen zu bewegen. Ich stecke fest, viel weiter weg, als ich es mir wünsche. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, kann aber trotzdem über die Schultern des Mannes vor mir kaum etwas von der Szene auf dem Markt erkennen.
Wachtmeister Dunne steht einsam und allein am Fuß der Treppe zum Rathaus, sein hagerer Körper steif vor Sorge. Dem einstmals prächtigen Gebäude fehlen mittlerweile etliche Dachschindeln und ein Teil der Eichenholzverkleidung. Dunnes Blick ist auf den Platz gerichtet. Solange ich denken kann, ist er Asters Ortsvorsteher. Er ist groß und kräftig für einen Mann seines Alters, aber in seinen Augen liegt Müdigkeit, während er nach den Barden Ausschau hält. Nach ein paar Minuten strafft er unvermittelt die Schultern, streicht seinen abgetragenen Mantel glatt und hebt die Hand.
Die Musik wird lauter und die versammelten Menschen verstummen. Auf einer Seite des Platzes teilt sich die Menge.
Die Barden sind da.
Mein Herz macht einen Satz und es dauert einen Moment, bis ich ein Wort für das Gefühl finde, das sich in meiner Brust ausbreitet. Hoffnung.
Drei imposante Gestalten treten vor, während sich Stille über die Menschen senkt. Die langen schwarzen Mäntel sind goldverbrämt – Schwarz und Gold, die Farben des Hohen Hauses – und so passgenau geschnitten, dass sie die scharfen Linien und die makellose Haltung der Barden noch unterstreichen. Auf dem rechten Oberarm eines jeden prangt das Wappen des Hohen Hauses, ein Schild mit drei Schwertern. Die Pracht ihrer Uniformen steht in einem krassen Gegensatz zu der Ärmlichkeit unseres Dorfes. Soweit ich es erkennen kann, sind ihre Mienen unter den dunklen Kapuzen reglos und starr.
Wachtmeister Dunne begrüßt sie mit einer tiefen, ehrfürchtigen Verbeugung, die von den Barden gänzlich ignoriert wird. Ungeschickt richtet er sich wieder auf und gibt mit der Hand ein Signal, das diesmal den Mädchen gilt, die mit ihren Körben und Tellern vortreten.
Die Musik nimmt Fahrt auf, zunächst unsicher, doch dann immer munterer. Es ist eine leichte, fröhliche Melodie, die über den Marktplatz schallt, während die Prozession sich den Barden nähert. Die jungen Frauen tanzen und werfen gefärbte Stoffstücke in die Luft, die Blütenblätter imitieren sollen. Sie lächeln die Barden gepresst an und verteilen sich dann, wobei jede eine Position bezieht, wo sie mit ihrer hübschen Gestalt von etwas ablenken kann, das nicht ganz so hübsch ist. Eine stellt ihren Fuß über einen dunklen Fleck auf dem Boden. Blut, so erinnere ich mich erschauernd, das beim letzten Besuch der Barden vergossen wurde. Mein Magen dreht sich um.
Als Nächstes schieben die Kaufleute und Händler ihre sorgfältig ausgelegten Waren auf den Platz. Sie stellen sich in einer Reihe auf und verbeugen sich vor den Barden, ehe sie wieder zurücktreten. Die drei schwarz gekleideten Gestalten wechseln einen Blick, bevor sie mit langsamen Schritten an den Karren vorbeigehen und die Gaben des Dorfs in Augenschein nehmen. Alles scheint den Atem anzuhalten, während die Barden einen Karren nach dem anderen hinter sich lassen.
Nach einer gefühlten halben Ewigkeit wenden sie sich Wachtmeister Dunne zu, wobei die Menge zuschaut und nicht hören kann, was gesagt wird. Dunnes Kiefer verkrampft sich. Seine breite Stirn legt sich in Runzeln und Schweißtropfen bilden sich darauf.
Leises Murmeln erhebt sich aus der Menge, das sich von den ersten Reihen nach hinten bewegt wie Wind, der durch das Gras fährt.
»Hast du irgendwas verstanden?«
»Vielleicht zeigen sie Gnade …«
»… die magersten Gaben in der ganzen Region«, höre ich eine Frau neben mir zu ihrem alten Vater sagen. »Die Barden werden uns wieder ihren Segen verweigern.«
Eine andere Frau schluchzt auf und presst ein Taschentuch gegen ihren Mund. »Wir sind nicht würdig.«
Der Wachtmeister redet beschwörend auf die Barden ein, aber sie scheinen ihn gar nicht zu beachten. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, wächst die Verzweiflung. Es kommt mir seltsam vor, dass der hochgeschätzte Wachtmeister Dunne, der gewöhnlich ein so gemessener und würdevoller Mann ist, eine derart unterwürfige Haltung einnimmt.
Wenn die Barden dem wichtigsten Mann des Dorfes keine Aufmerksamkeit schenken, welche Chance habe dann ich, von ihnen angehört zu werden?
Noch während ich fieberhaft nachdenke, tritt einer der Barden, ein großer Mann mit noch breiteren Schultern als Wachtmeister Dunne, nach vorne und hebt die Hand. Er fordert Ruhe ein und die Menge gehorcht umgehend.
»Ihr guten Leute von Aster«, wendet er sich an uns. Obwohl er nicht laut spricht, kann ich ihn klar und deutlich verstehen, als würde er direkt neben mir stehen. Seine Stimme ist tief und volltönend, gefärbt mit einem schwachen, elegant klingenden Akzent, den ich noch nie gehört habe. »Wie immer neigt das Hohe Haus demütig das Haupt vor eurer Großherzigkeit. Es schmerzt uns sehr, dass eure Gaben nicht mit der Begeisterung mithalten können, mit der sie gegeben werden.«
Mein Inneres verkrampft sich. Wieder erhebt sich Gemurmel aus der Menge, das mit einer weiteren Handbewegung des Barden abgeschnitten wird. Seine Augen verengen sich vor Ärger. »Unglücklicherweise muss auch dieser Besuch in Aster als Enttäuschung verbucht werden. Durch die Gnade von Lord Cathal kann euch das Hohe Haus nur so viel anbieten, wie ihr selbst zu geben in der Lage seid.«
Er geht zu dem Karren, auf dem Fionas Vater seine Waren präsentiert, und nimmt eine verschrumpelte Rübe in die Hand. Dabei gerät das sorgfältig aufgeschichtete Gemüse ins Rutschen und man sieht die umgedrehten Körbe darunter, auf denen die Waren drapiert waren. Ein anderer Barde greift nach einem Apfel und dreht ihn um, wobei eine braune Stelle darauf sichtbar wird. Der Barde schnalzt mit der Zunge und schüttelt den Kopf. Fionas Vater steht wie erstarrt da. Sein Gesicht ist aschfahl.
»Während andere Dörfer jenseits der Ebene eine üppige Ernte vorweisen können, ist die Ausbeute hier mager.« Der Barde legt die Rübe behutsam wieder auf den Karren. »Wir möchten euch helfen. Wirklich. Aber es ist offensichtlich, dass hier etwas nicht stimmt. Aster wird selbst von einer Beschwörung kaum profitieren.«
Wachtmeister Dunne räuspert sich. »Es liegt an der Dürre. Nichts will mehr …«
»Bitte habt Erbarmen! Wir können ohne eine Beschwörung nicht überleben!« Die Frau neben mir heult auf und übertönt die Worte des Wachtmeisters. Tränen laufen ihr über das Gesicht.
Der Barde verlangt abermals nach Ruhe und die Menge gehorcht. Ihr unausgesprochenes Flehen hängt wie eine dicke Wolke in der Luft.
»Wie ich bereits sagte.« Die Stimme des Barden ist fest. »Es gibt einen Grund, warum nur Aster ein solches Unglück befallen hat. Jemand trägt dafür die Verantwortung.« Er verstummt und betrachtet die Umstehenden. Ich bin mir sicher, dass seine Augen unter der Kapuze auch meinen Blick festhalten, und ich atme rasselnd aus, als sie weiterwandern. »Ich möchte jeden ermutigen vorzutreten, der Informationen diesbezüglich hat. Hat jemand ein verbotenes Wort ausgesprochen? Benutzt oder hortet jemand Tinte? Oder versteckt verfluchte Gegenstände?«
Die Frau neben mir zieht scharf die Luft ein.
Wachtmeister Dunne blickt in die Menge und nickt schwach. »Es ist Zeit, euer Wissen preiszugeben. Das Schicksal von Aster hängt davon ab.«
Die Menschen auf dem Marktplatz hüllen sich in Schweigen – doch dabei schauen sie nicht die Barden an. Sie mustern sich gegenseitig. Ihre Augen sind groß und ängstlich. Grausam. Ich muss es wissen; es waren solche Blicke, mit denen man mich und meine Mutter vertrieben hat. Suchen sie nach jemandem, den ich kenne?
Ein eisiger Gedanke zieht mir durch die Adern. Suchen sie vielleicht sogar nach mir?
Ein kleiner Junge kommt nach vorne und geht schweigend auf den Barden zu. Ich erkenne seinen zotteligen dunklen Haarschopf. Es ist Großvater Quinns jüngster Enkel.
Der groß gewachsene Barde beugt sich nach unten, damit das Kind ihm ins Ohr flüstern kann. Ein rasender Sturm bemächtigt sich meiner Gedanken.
Flüstert er meinen Namen?
Mein Herzschlag hallt in meinen Ohren wider, lauter und lauter, als der Barde sich wieder aufrichtet. Mit einem sanften Klaps auf die Schulter schickt er den Jungen wieder weg.
»Der Dorfälteste, allgemein als Quinn bekannt, wird beschuldigt, Geschichten über Gondal zu verbreiten«, sagt der Barde und verschränkt die Hände hinter dem Rücken. »Tritt vor.«
Meine Fäuste lösen sich. Ein Schlurfen erklingt aus den hinteren Reihen, begleitet von einem jammervollen Flehen, als die Dorfbewohner Großvater Quinn packen und grob nach vorne zerren. Sie stoßen ihn dem Barden vor die Füße, wo er schlaff zu Boden sinkt. Sein alter Körper zittert wie Espenlaub. Galle steigt mir die Kehle hoch, aber ich kann den Blick nicht abwenden. Ich glaube dem Jungen und trotzdem ist es ein Schock. Sein Verrat. Dass er so dumm war. Dass er uns alle in Gefahr gebracht hat.
»Bitte, gütige Barden …«
»Still!« Die Stimme des Barden klingt zornig.
»Tu, was er sagt.« Ohne dass ich es wollte, habe ich die Worte leise ausgesprochen. Glücklicherweise schweigt der alte Mann.
»Als Strafe für dein Vergehen, verbotene Sprache zu benutzen, wirst du fortan schweigen. Deine Zunge soll die Schuld gegenüber dem Hohen Haus begleichen.«
Mit unergründlicher Miene nickt Dunne den Leuten zu, die Quinn aus der Menge gezerrt haben. Sie zögern und wechseln Blicke, ehe der kräftigste von ihnen Quinn packt. Die Bewegung erinnert mich an eine Katze, die ihre Krallen in eine Maus schlägt. Quinn schenkt seinem Enkel über die Schulter hinweg ein wässriges Lächeln und lässt sich ohne ein weiteres Wort in das baufällige Rathaus schleppen.
Erst nachdem er in den Schatten des Gebäudes verschwunden ist, gellt sein schriller Schrei durch die Stille.
Wachtmeister Dunne beeilt sich, die Tür zuzuschlagen. Mit einem lauten Knall trennt er Quinn von den anderen Dorfbewohnern, wie ein scharfes Messer Fleisch von einem Knochen abschneidet.
Schließlich wendet er sich den Barden zu, die Handflächen fest gegeneinandergepresst. »Edle Barden, der Schandfleck ist entfernt. Dies ist doch gewiss eine ausreichende Maßnahme, um Aster von all dem Übel zu erlösen, nicht wahr? Ist es so – stehen wir wieder in der Gunst des Hohen Hauses?«
Der Barde betrachtet Dunne mit einem gleichmütigen Ausdruck. »Aster hat heute dem Hohen Haus eindrucksvoll seine Loyalität bewiesen«, erwidert er. »Es kostet viel Mut, dass jemand, der so jung an Jahren ist wie dieses Kind, vortritt und die Wahrheit spricht. Diese Tat werden wir mit einer Beschwörung belohnen.«
Diese Neuigkeit reicht aus, um die Anspannung in der Luft mit einem Schlag aufzulösen. Jubel erhebt sich aus der Menge und sofort ist die Rede von überquellenden Erntekörben und atemberaubenden Festen – und eifrigen Schwüren, alle Verräter auszumerzen. Die Barden bezeugen mit einem knappen Nicken ihre Anerkennung und treten dann zurück, um die Beschwörung vorzubereiten.
Tief sauge ich die Luft in meine Lunge und recke mich, um etwas sehen zu können – und um zu verhindern, dass ich in dem Gedränge ohnmächtig werde.
Ich beobachte die Barden und spüre gleichzeitig, wie sich eine Art Energie über Aster ansammelt. Die drei schwarzgoldenen Gestalten haben die Gesichter einander zugewandt. Ihre Fingerspitzen berühren sich, sodass ihre Hände jeweils vor ihren Oberkörpern eine Art Zelt bilden. Sie stehen so still wie Steinfiguren. Aber ihre Lippen bewegen sich wortlos im Gleichklang und zwischen ihnen pulsiert diese Energie, die ich gefühlt habe, wird angelockt von ihrem stummen Zauberspruch. Der Wind frischt auf. Es fühlt sich an, als ob mit jeder Sekunde der Stoff, aus dem die Welt gemacht ist, sich verdichtet, enger zusammengezogen wird. Die Lippen der Barden bewegen sich schneller und schneller.
Ein Donnerschlag hallt durch den Himmel. Hunderte ehrfürchtige Gesichter wenden sich nach oben, die Münder weit aufgerissen vor Staunen über eine dunkle Wolke, die eben noch nicht da war.
Und dann fällt ein kostbarer Wassertropfen, so glitzernd wie ein Juwel, herab. Nach einem Atemzug folgt ein weiterer Tropfen, dann noch einer und noch einer und noch einer.
Regen.
KAPITEL 3
Die Jubelschreie der Menschen hallen von den Hauswänden wider. Wir starren in den Himmel und lassen den gesegneten Regen über unsere Gesichter laufen. Es fühlt sich an, als würde ich weinen – vielleicht tue ich es ja. Mein ganzes Leben lang schon wusste ich über die großartigen Kräfte der Barden Bescheid, aber so wie heute habe ich sie noch nie erlebt. So rein, so Leben spendend.
Die Dorfbewohner fangen an zu tanzen. Ihre Haut glänzt vor Nässe. Ich atme ehrfürchtig aus, während die Hoffnung mich durchflutet. Wenn alle anderen vor Regen ganz freudetrunken sind, habe ich vielleicht eine Chance, mit den Barden zu sprechen, wenn die Beschwörung vollendet ist.
Plötzlich reißt mir eine Hand den Schal vom Gesicht. »Du!«
Wie ein Feuer rast die Angst, erkannt worden zu sein, durch mich hindurch.
Mein früherer Nachbar – ein freundlicher Mann, der mir einmal einen Korb Erdbeeren geschenkt hat – blickt mich böse an. Köpfe wenden sich zu uns, Münder werden aufgerissen, als die Dörfler sehen, wer da in ihrer Mitte steht: das Mädchen, das von den Flecken berührt wurde. »Wie kannst du es wagen, dich hier blicken zu lassen? Ausgerechnet dann, wenn wir uns endlich eine Beschwörung verdient haben?«
Ein jüngerer Mann setzt giftig hinzu: »Man hätte dich zusammen mit Großvater Quinn wegschleppen sollen!«
»Unglücksweib!«, faucht eine Frau.
Jemand stößt mich, sodass ich mit den Knien im Schlamm lande. Jemand anderes spuckt mich an. Ehe ich mich richtig aufrappeln kann, treibt mich ein Sturm aus Hieben, Knüffen und Flüchen zurück, weg von den Barden. Ich krieche und stolpere durch die Gasse und versuche, dem Mob zu entfliehen.
Obwohl ich am ganzen Leib zittere, komme ich schließlich wieder auf die Füße, ziehe den Schal über meinen Kopf und laufe weg, wobei ich an mich halten muss, um nicht in Tränen auszubrechen.
Am liebsten wäre ich nach Hause gerannt, hätte mich neben meiner Mutter zusammengerollt und mir vorgestellt, dass sie mir ein Schlaflied singen würde. Vielleicht hätte ich dann auch von Gondal geträumt, von dieser wunderschönen, verdorbenen Lüge. Von der Legende, für die ich und mein Bruder gelebt haben und die ihn womöglich getötet hat …
Die Großvater Quinn zu ewigem Schweigen verdammt hat.
Aber ich kann nicht zurück – nicht, wenn dort die Dunkelheit auf mich wartet, die wachsende Gewissheit, dass ich von etwas verschlungen werde: von dem Fluch, den Flecken, von irgendetwas, das mich – oder andere – verdammt.
Als ich aus der Menge heraus bin, bleibe ich keuchend stehen. In dem ganzen Durcheinander ist mir niemand nachgekommen. Alle sind zu sehr mit dem Regen beschäftigt. Ich knirsche mit den Zähnen und wische mir den Schlamm von den Kleidern. Mein Herz hämmert und der Kloß in meiner Kehle droht mich zu ersticken.
Atme.Atme, befehle ich mir. Es muss etwas geben, womit ich die Aufmerksamkeit der Barden erregen kann.
Ich schaue zu der Wand aus Menschen, die immer noch jubeln und tanzen und mich glücklicherweise nicht mehr beachten.
Ein Lichtblitz am Ende einer schmalen Gasse zwischen zwei Häusern lenkt meinen Blick auf sich. Da – wieder einer! Ich schaue genauer hin und jetzt sehe ich es: ein prächtiges Pferd, das den Kopf hochwirft, sodass sich das Licht auf seinem goldenen Zaumzeug spiegelt.
Mir stockt der Atem. Plötzlich bin ich wieder elf Jahre alt, sitze im Baum und knüpfe Kierans Todesbänder an die Äste.
Die Pferde der Barden scharren ungeduldig mit den Hufen, als ob sie geradewegs aus meiner Erinnerung getreten wären.
Eilig husche ich weiter, bis ich den Rand des Marktplatzes erreicht habe. Von da aus nähere ich mich im Schatten der Häuser den Pferden. Irgendwann werden die Reiter wieder hierherkommen müssen.
Die drei eleganten Rösser sind nicht einmal festgebunden. Sie warten einfach dort, wo man sie zurückgelassen hat, auf ihre Herren. Es sind allesamt schwarze Stuten, fast beängstigend schön und ganz und gar nicht mit den alten Ackergäulen zu vergleichen, die ich aus dem Dorf oder von den Bauernhöfen her kenne. Ihre dunklen klugen Augen beobachten mich, als ich auf sie zugehe, fast so, als würden sie mich abschätzen.
Die Stute, die mir am nächsten steht, senkt neugierig den Kopf.
»Hallo, du«, flüstere ich und das Pferd wippt leicht mit dem Kopf auf und ab, als ob es mich begrüßen würde. Eine merkwürdige Ruhe legt sich über mich und zum ersten Mal, seit ich die Schafweide verlassen habe – seit ich Fiona angelogen habe –, kann ich aufatmen. Bei der Bewegung rutscht die Stirnlocke der Stute zur Seite und darunter kommt ein kleiner weißer Stern zum Vorschein.
Ich stelle den Korb mit der Wolle, den ich die ganze Zeit umklammert gehalten habe, vor meine Füße und strecke langsam die Hand aus. Nach einem neugierigen Schnüffeln lässt sich die Stute von mir über die Stirnzeichnung streicheln, über das schwarze Gesicht, bis hinunter zu ihren weichen Nüstern. Sie wiehert und senkt den Kopf noch weiter, damit ich sie hinter den Ohren kraulen kann.
Aus der Nähe betrachtet, raubt mir die Pracht ihres im Regen glänzenden Zaumzeugs schier den Atem. Der goldene Stirnriemen und das Nasenband sind mit zierlichen Figuren und Motiven geschmückt, die ich nicht kenne, und mit kleinen weißen Edelsteinen besetzt. Ich muss den Namen dieser Juwelen nicht kennen, um zu wissen, dass nur ein einziger dieser funkelnden Steine doppelt so viel wert ist wie ganz Aster. Mit der freien Hand fahre ich über die Verzierungen und die Juwelen, aber ganz vorsichtig, als ob sie sich unter meiner Berührung in Luft auflösen könnten.
Plötzlich schließt sich eine feste, behandschuhte Hand um mein Handgelenk und zieht mich zurück. Im Umdrehen stockt mir der Atem, als eine schwarz-goldene Gestalt in mein Blickfeld kommt. Zitternd sehe ich mich von Angesicht zu Angesicht einem Barden des Hohen Hauses gegenüber.
Sein Gesicht ist nicht länger gleichmütig – Feuer scheint in seinen dunklen Augen zu tanzen, sodass sie im Schatten seiner Kapuze aufblitzen. Seine flüsternde Stimme ist grollend und gefährlich. »Hände weg, Dieb!«
Das Erste, was ich spüre, als nach dem anfänglichen Schreck das Gefühl in meine Glieder zurückkehrt, ist ein dumpfer Schmerz in meinem Handgelenk, wo der Barde mich gepackt hält. Nicht fest genug, dass eine Quetschung zurückbleiben würde, aber fest genug, um mir klarzumachen, dass es noch schlimmer werden könnte, wenn ich irgendetwas Dummes anstelle. Instinktiv senke ich den Blick auf die nassen Pflastersteine.
Er lässt mich los. »Nun? Hast du nichts zu deiner Verteidigung zu sagen?«
Seine Stimme versetzt die Luft zwischen uns in eine Art Schwingung. Sie ist tief und volltönend und besitzt gleichzeitig einen unterschwelligen, irgendwie überirdischen Nachklang, eine eigene Note, die sich um seine Worte schlingt und mir durch Mark und Bein dringt, sodass ich wie angewurzelt stehen bleibe. Ich weiß noch, wie ich mich an den Rock meiner Mutter geklammert habe, als Claire, die Bäckerin, in der Abenddämmerung auf dem Marktplatz sang, begleitet von ihrem Mann, der auf einem Saiteninstrument spielte, von dem ich nie den Namen erfuhr. Im Augenblick ist mir, als würde die Stimme des Barden gleichzeitig ihre eigene musikalische Begleitung hervorbringen. Mit jedem Wort fühle ich eine prickelnde Hitze auf meinem Gesicht und meinem Hals und die Luft zwischen uns verdichtet sich und wird schwer wie bei einem aufziehenden Sturm.
Das Gefühl verschwindet, sobald er aufhört zu reden, und mir wird kalt. Ich will mehr davon.
Ich bemühe mich um Fassung, als mein Blick von seinen prächtigen, spiegelblank polierten Lederstiefeln nach oben wandert. Die goldene Bordüre an seiner Uniform zieht sich über eine elegante Hose unter dem schwarzen Umhang hinauf zu einer tadellos sitzenden Jacke von derselben Farbe, die mit zwei Reihen Goldknöpfen besetzt ist, rechts und links auf seiner Brust. Er verharrt unnatürlich still und blickt mir, ohne zu blinzeln, in die Augen, obwohl ihm der Regen ins Gesicht geweht wird. Von Nahem wirkt er noch Ehrfurcht gebietender, noch außergewöhnlicher – und viel gefährlicher, als ich es mir vorgestellt habe.
»Ich …« Jetzt, da ein wahrhaftiger Barde vor mir steht, ist mein Kopf vollkommen leer. Ich schlucke und versuche es noch einmal. »S…Sir …« Ist er ein Sir? Sir Barde? Oder muss ich Lord sagen? Bei all meinen Überlegungen habe ich nie darüber nachgedacht, wie man einen Barden anspricht. Die Scham überkommt mich.
Der Barde gibt ein Geräusch von sich, halb Stöhnen, halb genervtes Seufzen. Er zieht mich mit einer mühelosen Bewegung wie einen Vorhang beiseite und wendet sich seiner Stute zu.
»Was habe ich dir gesagt über Fremde, die sich dir nähern?« Er streichelt dem Tier den Hals. »Du bist viel zu vertrauensselig.« Seine strenge Stimme wird weich.
Ich merke, wie mir die Röte ins Gesicht steigt, während ich mit den unterschiedlichsten Emotionen kämpfen muss – zunächst einmal Verlegenheit über meine Unbeholfenheit, dann Unglauben darüber, dass er ein Tier über die Nöte eines Menschen stellt, und schließlich Zorn auf mich selbst, weil mir die Worte fehlen, um ihm zu sagen, was ich sagen will.
Der Barde schlägt seinen Umhang zurück und macht Anstalten, sich in den Sattel zu schwingen. Er schaut nicht einmal zu mir hin.
Das Chaos in meinem Inneren verwandelt sich in Entschlossenheit. Die Gelegenheit droht mir durch die Finger zu gleiten.