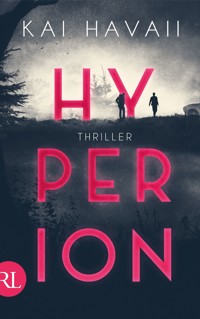
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ein Undercover-Agent ist ein Schauspieler, der um sein Leben spielt.«
Felix Brosch, ehemaliger Elitesoldat und Geheimdienstagent, hat nach dem Unfalltod seines kleinen Sohnes den Halt verloren. Er führt ein zurückgezogenes Leben auf einer Berghütte in den Alpen. Bis eines Tages eine alte Bekannte vom BND bei ihm auftaucht. Eine neue, rechte Terrororganisation treibt auf der ganzen Welt ihr Unwesen. Ihr unbekannter Anführer verbirgt sich hinter dem Namen Hyperion – der Lichtbringer. BND und Mossad vermuten, dass er einen Mitstreiter hat: Broschs englischen Cousin Simon, den er seit seinen Teenagertagen nicht mehr gesehen hat. Das Ansinnen, sich seinem Cousin zu nähern, lehnt Brosch zuerst entschieden ab. Dann aber wird bei einem Anschlag in den USA ein Junge getötet, der ihn an seinen Sohn erinnert, und er weiß, dass er handeln muss. Mit Hilfe der Mossad-Agentin Yael lässt er sich in die Organisation einschleusen und begegnet Hyperion ...
Hochspannend und aktuell – ein Blick in die Welt der Undercover-Agenten. Der neue Thriller vom Frontmann der Band »Extrabreit«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Felix Brosch, ehemaliger Elitesoldat und Agent des Militärischen Abschirmdienstes MAD, hat nach dem Unfalltod seines kleinen Sohnes den Halt verloren. Als Koch arbeitet er in einer Berghütte in den bayrischen Alpen. Eines Tages erscheint dort seine alte Freundin Magdalena Knoop, eine höhere Beamtin des Bundesnachrichtendienstes. Sie berichtet ihm, dass der israelische Geheimdienst Mossad den BND um Mithilfe bei der Zerschlagung einer global agierenden, rechtsextremen Terrororganisation gebeten habe, deren Führer sich Hyperion – der Lichtbringer – nenne. Offenbar hat Hyperion einen wichtigen Mitstreiter: Simon Jenkins, Felix‘ englischer Cousin, mit dem er als Teenager oft die Sommerferien verbracht hat. Um an Hyperion heranzukommen, sei Felix daher der ideale Mann.
Felix lehnt den Auftrag zuerst entscheiden ab. Auf keinen Fall will er sein früheres Leben wieder aufnehmen. Doch nachdem Hyperions Organisation in den USA einen Anschlag verübt hat, bei dem neben vielen anderen Opfern ein kleiner Junge getötet wurde, der ihn an seinen Sohn erinnert, sieht er sich in der Pflicht. Der Mossad stellt ihm eine junge, ehrgeizige Agentin zur Seite: Yael Rubin. Sie soll Felix auf die gefährliche Mission vorbereiten. Tatsächlich gelingt es ihm, seinen Cousin in Berlin zu treffen und dessen Vertrauen zu gewinnen. Doch das ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu Hyperion – ins Herz der Finsternis. In einem Ausbildungscamp der Terroristen glaubt Felix sich am Ziel, und dann scheint doch alles schiefzugehen.
Über Kai Havaii
Kai Havaii, geboren 1957 in Hagen, wurde nach kurzem Germanistikstudium und Jobs als Taxifahrer und Cartoonist 1979 Sänger von EXTRABREIT, einer der bekanntesten deutschen Rockbands. Kai Havaii arbeitete auch als freier TV-Autor, u. a. für ZDF und ARTE. Wenn er nicht mit der Band auf Tour ist, lebt er in Hamburg. „Hyperion“ ist nach „Rubicon“ sein zweiter Thriller.
„Rubicon“ ist als Aufbau Taschenbuch und in einer Audioversion, eingelesen vom Autor, lieferbar.
„Hyperion“ liegt ebenfalls in einer Audioversion vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kai Havaii
Hyperion
Thriller
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2 — Fünf Monate zuvor. In der Nähe von Schliersee, Bayern.
Kapitel 3
Kapitel 4 — Silvester 1999. Brighton, England.
Fünf Monate zuvor.
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8 — Zwei Wochen später. Tulsa, Oklahoma, U. S. A.
14 Stunden später. Miami Beach, Florida.
Zwei Stunden zuvor.
16:15.
Kapitel 9 — Zwölf Stunden später.
Kapitel 10
Kapitel 11 — Am Nachmittag des nächsten Tages. Berlin.
Kapitel 12
Kapitel 13 — Eine Woche später. Berlin-Schöneberg.
Kapitel 14 — Fünf Jahre zuvor. Hamburg-Niendorf.
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21 — Vier Wochen später.
Kapitel 22 — Zwei Tage später.
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27 — Einen Tag später.
Kapitel 28 — Vier Tage später.
Kapitel 29 — Drei Tage später.
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32 — Eine Woche später.
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36 — Fünf Tage später.
Kapitel 37
Kapitel 38 — Drei Wochen später.
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45 — Zwei Tage später.
Kapitel 46
Kapitel 47 — 24 Stunden zuvor.
Kapitel 48
Kapitel 49 — Zwei Tage später.
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54 — Vier Tage zuvor.
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60 — Vier Tage später. Tel Aviv, Israel.
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65 — Fünf Tage später.
Kapitel 66 — Einen Tag später.
Kapitel 67 — Teheran. Islamische Republik Iran.
Kapitel 68 — Zwei Tag später. Antalya, Türkei.
Kapitel 69 — Am Morgen darauf. Teheran. Islamische Republik Iran.
Kapitel 70 — Am Abend desselben Tages. Antalya, Türkei.
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73 — Beirut, Libanon.
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79 — Drei Tage später.
Kapitel 80
Kapitel 81 — Einen Tag später.
Kapitel 82
Kapitel 83 — Newark, New Jersey, USA.
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86 — Vier Wochen später.
Kapitel 87
Kapitel 88 — Drei Tage später.
Kapitel 89 — Zur selben Zeit, in der Nähe von Teheran, Iran.
Kapitel 90 — Vierzehn Tage später.
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95 — Zwei Tage später.
Kapitel 96
Kapitel 97 — Zehn Tage später. Minsk, Belarus.
Kapitel 98
Kapitel 99 — Einen Tag später. Tel Aviv, Israel.
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102 — Drei Tage später. Berlin, Deutschland.
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105 — Drei Tage später. Hamburg, Deutschland.
Kapitel 106
Kapitel 107 — Einen Tag später. Teheran.
Kapitel 108
Kapitel 109 — Zwei Monate später.
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
»Ein Undercover-Agent ist ein Schauspieler, der um sein Leben spielt.«
1
In langen Spiralen, durch Schichten von Nebel und Dunkelheit, windet sich sein Bewusstsein an die Oberfläche. Minutenlang liegt er bewegungslos, während seine verschwommenen Sinne um Schärfe ringen und er seinen Körper zu spüren beginnt. Sein Kopf schmerzt und dröhnt, als befinde er sich in einer vibrierenden Schraubzwinge. Die geschwollene, staubtrockene Zunge haftet schmerzhaft am Gaumen.
Er öffnet mühsam seine verklebten Augen.
Vollkommene Schwärze.
Instinktiv zwinkert er ein paarmal mit den Augenlidern, aber die Dunkelheit bleibt.
Er bewegt die Finger seiner Hände, aus denen nur langsam die Taubheit weicht. Dann hebt er unter großer Anstrengung seine Arme ein wenig an, die sich so kraftlos anfühlen, als seien sie aus Gummi. Als er sie zur Seite spreizen will, stoßen sie sofort gegen etwas Hartes. Er ertastet zwei Wände, direkt neben seinem Körper. Als er die Arme nach oben hebt, stoßen sie erneut sofort auf Widerstand. Dort, nur zwanzig Zentimeter über seinem Gesicht befindet sich eine weitere Wand.
Ein eisiger Schreck durchfährt ihn, als ihm klar wird, dass er in einer engen Kiste liegt.
Ein … ein Sarg!
Würgende Angst steigt in ihm auf. Für einen Moment fürchtet er, lebendig begraben zu sein.
Aber dann nimmt er das Geräusch wahr. Ein fernes, mechanisches Stampfen, wie von einer Maschine. Ein paar Augenblicke später wird ihm bewusst, dass sich sein Körper in einer lang gezogenen, rhythmischen Bewegung der Länge nach sanft hebt und wieder senkt. Hebt und senkt.
Ein Schiff! Ich bin auf einem Schiff!
Nun kommt auch die Erinnerung wieder.
Ich war in Antalya. In der Türkei.
Er sieht die Szene verschwommen vor sich: Er ist draußen auf der Straße, es ist dunkel. Plötzlich sind da diese Männer. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Er wird in ein Auto gestoßen, offenbar einen Kleinbus. Spürt viele kräftige Hände, die ihn mit eisernem Griff niederhalten. Und dann einen kleinen, spitzen Schmerz in der Beuge seines Arms.
Danach nichts mehr.
Betäubt. Ich bin betäubt worden.
Der Durst ist so quälend, dass es ihm fast wieder die Sinne raubt.
Wie viel Zeit mag vergangen sein, seit sie mich geschnappt haben?
Unvermittelt wird das leise, monotone Stampfen des Schiffsmotors von einem anderen Geräusch übertönt. Ein metallisches Rumpeln, ziemlich nah, gefolgt von einem Quietschen, so als würde eine schwere, lange nicht geschmierte Stahltür geöffnet. Im nächsten Moment erscheint vor seinen Augen ein Quadrat aus kleinen Lichtpunkten. Elektrisches Licht, das durch die Atemöffnungen dringt, mit denen die Kiste versehen ist.
Er hört Stimmen. Nur undeutlich, aber sie reden in einer Sprache, die er nicht versteht.
Kurz darauf klacken Scharniere, und der Deckel seines Gefängnisses wird angehoben. Gleißende Helligkeit blendet ihn, und es dauert eine Weile, bis er das Gesicht eines Mannes erkennt, der auf ihn herabblickt. Ein bärtiger Mann mit einer dicken, spiegelnden Brille.
Dahinter nimmt er undeutlich einen weiteren Mann wahr, in einem gelben Jogging-Anzug und mit einer Pistole in der Hand.
Der mit der Brille dreht sich um und sagt etwas zu dem Kerl mit der Waffe.
Dann wendet er sich wieder ihm zu, hebt seinen Kopf ein wenig an und führt einen Trinkhalm an seine Lippen. Er beginnt, begierig zu saugen.
Wasser! Wasser!
Als er genug getrunken hat, hat er den Impuls, etwas zu tun – irgendetwas zu sagen, aber er ist immer noch viel zu kraftlos. Sein Kopf sinkt matt auf das dünne Kissen zurück, das zum Inventar seines Gefängnisses gehört.
Dann spürt er plötzlich einen Einstich in seinem Arm. Er verkrampft sich, doch er ist viel zu schwach, um sich zu wehren.
Wieder taumelt sein Bewusstsein in tiefe Schwärze hinab.
Dass kurz darauf ein paar Meter entfernt der Deckel einer weiteren Kiste geöffnet wird, hört er schon nicht mehr.
2
Fünf Monate zuvor. In der Nähe von Schliersee, Bayern.
Es wird Frühling in den Alpen. In diesem Jahr kommt er besonders zeitig, denn es ist erst Anfang Mai, aber weil es seit Tagen ungewöhnlich warm und sonnig ist, ist die Schneeschmelze bereits in vollem Gange. Das Farbenspiel der Landschaft wirkt in der klaren Luft so gestochen scharf, als sei es mit Photoshop bearbeitet.
Ein wolkenloser, tiefblauer Himmel, blendend weiße Schneefelder, die im Sonnenlicht bläulich glitzern, dazwischen Flächen mit dem ausgelaugten, fahlgelben Gras vom Vorjahr. An vielen Stellen ballen sich bunte Pulks von Alpenkrokussen, und zwischen den verwitterten, hellgrauen Granitfelsen, die die Hänge sprenkeln, leuchten knallgelb die Blüten von Küchenschellen. Im Hintergrund wächst die schwarze, zerklüftete Felsmasse des Riesensteins empor, hier und da weiß gefleckt von ewigem Schnee.
Unterhalb des Gebirgsmassivs öffnet sich ein weites Hochtal, eingerahmt von steilen, baumlosen Hängen, in das sich der Eiserbach im Laufe der Jahrtausende tief eingegraben hat. Was die meiste Zeit des Jahres ein gemütlich plätschernder, kleiner Bergbach ist, ist seit Tagen ein meterbreiter, gelb schäumender Fluss, dessen Rauschen eine stetige Geräuschkulisse bildet.
Gut fünfzig Meter oberhalb des Gebirgsbachs unterbricht ein fast ebenes Plateau den östlichen Hang, nicht sehr groß, aber groß genug für das zweistöckige Haus mit dem Seitenflügel, das dort steht und neben einer weitläufigen Terrasse auch über einen größeren Vorplatz verfügt.
Auf diesem Vorplatz steht, einen Arm auf den Stiel einer Schneeschaufel gestützt, ein langhaariger, bärtiger Mann und beobachtet am Himmel zwei Kolkraben, die plötzlich mit angewinkelten Flügeln in einen Sturzflug in Richtung Boden übergehen, wo sie irgendetwas Interessantes erspäht haben. Eine Maus vielleicht oder den vom Schnee freigegebenen Kadaver einer Gämse, die den Winter nicht überlebt hat.
Der Name des Mannes, der so interessiert den Flug der Vögel verfolgt, ist Felix Gerhard Brosch. Er ist neununddreißig Jahre alt, mittelgroß und athletisch gebaut, mit schmalen, hellgrauen Augen, einem klar konturierten, recht gut geschnittenen Gesicht und kräftigen Händen. Das dunkelblonde, ungebändigte Haar fällt ihm bis auf die Schultern, und der wild wuchernde, an ein paar Stellen schon grau melierte Bart verdeckt nur zum Teil die dünne, glänzende Narbe, die sich vom rechten Wangenknochen bis zum Mundwinkel zieht.
Die vielen Fältchen um seine Augenwinkel lassen ihn ein wenig älter erscheinen, als er ist, und erahnen, dass er trotz seiner relativ jungen Jahre bereits ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich hat.
Felix beobachtet die Raben noch eine Weile, dann macht er sich wieder daran, den Vorplatz, auf dem bald Sonnenschirme und Biertische stehen werden, von den letzten Schneeresten und dem Unrat zu säubern, der sich darunter angesammelt hat. Weil die Vorhersage weiter warmes Wetter, geradezu einen Bilderbuchfrühling verheißt, hat Melly, Felix’ Chefin und Pächterin des Hauses, beschlossen, es schon in zwei Tagen für den Gastronomiebetrieb zu öffnen. Am Nachmittag wird der Helikopter aus Rosenheim das erste Mal mit dem Lastennetz kommen, um dann im mehrmaligen Pendelflug vom Tal aus die knapp sechzehn Tonnen Brennholz und Lebensmittel heraufzuschaffen, die in der Sommersaison benötigt werden.
Als Felix seine Arbeit beendet hat, bringt er Schneeschaufel und Besen wieder in die kleine Garage, in der auch das einsitzige Raupen-Fahrzeug mit der Schneewalze steht, mit dem er während des Winters den Weg bis zur Station der Riesensteinbahn frei gehalten hat. Allerdings ist die Seilbahn im Winter nur in Ausnahmefällen in Betrieb und verkehrt erst in ein paar Tagen wieder regelmäßig.
Felix geht wieder hinaus auf den sonnenbeschienenen Vorplatz und zieht vorsichtig eine kleine Marihuana-Zigarette aus der Brusttasche seines grün karierten Lumberjackets. Er lässt sein Zippo klicken und inhaliert tief die Mischung aus Tabak, Gras und der kühlen, klaren Luft. Sekunden später dockt das THC an die Rezeptoren seiner Großhhirnrinde an, und er genießt den sanften, ganz leicht halluzinogenen Kick der Droge.
Als er seinen Blick über die Hänge schweifen lässt, nimmt er in der Ferne eine winzige Bewegung wahr. Er geht ins Haus, um sein Fernglas zu holen, und kurz darauf hat er einen exklusiven Blick auf eine Murmeltiersippe, die sich, eins nach dem anderen, aus der Schneedecke über ihrem Höhlenausgang herausarbeitet.
Es ist ein Anblick, der Felix fasziniert und berührt. Als er hierher in die Berge kam und diese letzten Mohikaner der großen Eiszeit das erste Mal beobachtete, hat er sich über sie ein bisschen schlau gemacht. Er weiß, dass die Tiere ganze sieben Monate praktisch reglos und dicht aneinandergedrängt in ihrem unterirdischen Labyrinth im Kälteschlaf verbracht haben – ohne Nahrung zu sich zu nehmen oder zu trinken. Um das überhaupt zu ermöglichen, verfügen sie über die unter Säugetieren einmalige Fähigkeit, ihre Körpertemperatur auf sechs Grad zu senken und ihren Herzrhythmus auf zwei bis drei Schläge pro Minute herunterzudimmen. Zwischen ihren einzelnen Atemzügen liegen dann Minuten.
Felix schwenkt das Fernglas ganz sacht über die Gruppe, die aus fast zwanzig Tieren besteht, und beobachtet die Jungtiere vom letzten Jahr, die – ganz gewiss im Gegensatz zu ein paar anderen – den kräftezehrenden Winterschlaf überlebt haben. Sie tollen in der Sonne und im Schnee herum wie unter Strom gesetzt, ihr Übermut und ihre Freude über die Neugeburt ist mit Händen zu greifen. Die älteren, größeren Tiere machen sich unterdessen sofort über die Krokusse her, die auf den schneefreien Flächen sprießen.
Plötzlich nimmt Felix auf dem Schneefeld, auf dem die Jungen herumspringen, einen großen Schatten wahr. Einen Wimpernschlag später vergraben sich zwei wuchtige, gelbe Klauen im Körper eines der hüpfenden Fellbündel. Das junge Murmeltier stößt einen letzten, schrillen Schrei aus, der bis zu Felix zu hören ist. Dann hebt es auch schon vom Boden ab, und Felix folgt mit dem Fernglas dem Flug des Steinadlers, der, seine baumelnde, erschlaffte Beute umklammernd, dem verschatteten Felsmassiv zustrebt.
Felix stockt der Atem.
O nein! Das war’s für dich, Kleiner! Den Winter hast du überlebt und jetzt …
Er setzt das Fernglas ab und seufzt leise. Dann wendet er sich um und geht ins Haus.
Das Riesensteinhaus ist eine Berghütte des Bayerischen Alpenvereins, in gut eintausendsechshundert Meter Höhe gelegen, nicht allzuweit vom Spitzingsee und nah an der österreichischen Grenze. In längst versunkenen Zeiten waren hier oben Schmuggler unterwegs, die ihre Ware von einem Land ins andere brachten. Heute sind es nur noch Touristen, die es hierherzieht, und das auch nur während der Saison, die im Spätherbst sowie von März bis Mitte Mai, zur Zeit der Schneeschmelze, ruht. Vor allem im Sommer ist das Riesensteinhaus ein beliebtes Ausflugsziel, was auch an seiner urigen, nostalgischen Ausstrahlung liegt.
Das zweistöckige Gebäude mit dem großen Vorbau und dem kleinen Seitenflügel wurde 1935 erbaut, und seitdem hat sich daran nicht allzu viel verändert.
Noch immer bilden verwitterte Holzschindeln die Fassade, und die niedrige Gaststube mit den kleinen Fenstern, dem jahrzehntealten Mobiliar und den rot-weiß karierten Tischdecken gäbe immer noch eine perfekte Kulisse für einen Ufa-Film ab. Die uralten Holzdielen auf dem verwinkelten Gang zu den kleinen Gästekammern lamentieren bei jedem Schritt, und neben dem Fuß der ausgetretenen Treppe hängt ein vergilbtes Schild, das in Fraktur-Schrift dazu ermahnt, das obere Stockwerk »nicht mit Schi-Schuhen« zu betreten.
Abgesehen von einigen Erzeugnissen der Neuzeit wie dem allen Standards genügenden Sanitärbereich, der Stromversorgung und der Satellitenantenne wirkt das Haus wie aus der Zeit gefallen.
Das gilt auch für die Küche, die von einem noch aus den 1930ern stammenden, gusseisernen Herd mit vier Feuerstellen beherrscht wird. Er wird mit Holz betrieben und ist Felix’ eigentlicher Arbeitsplatz. Seit vier Jahren arbeitet er als Koch im Riesensteinhaus.
Der Job ist hart. Während der Saison hat er Zwölf- bis Dreizehn-Stunden-Schichten, aber dafür verdient er ziemlich gut und hat in den knapp vier Monaten im Jahr, in denen die Hütte geschlossen ist, voll bezahlten Urlaub. Diese freie Zeit hat er allerdings, abgesehen von ein paar Trips in seine Heimatstadt Hamburg, oft allein hier oben in den Bergen verbracht. Auch in diesem Winter hat Felix sich bereit erklärt, einige Reparaturen im Haus machen, den Weg zur Seilbahnstation frei zu halten und jeden Morgen die auf der Windseite gelegene Vorderfront und die Eingangstür von den brusthohen Schneewehen freizuschaufeln. Um überhaupt nach draußen zu gelangen, musste er aus dem Fenster seiner winzigen Kammer auf der Rückseite des Hauses steigen.
Es waren Wochen der fast völligen Einsamkeit. Ganze zwei Mal ist er auf Skiern runter ins Tal, von wo er mit Bus und Bahn eineinhalb Stunden nach München gefahren ist, um sich mit neuen Socken und Unterhosen einzudecken, frisches Obst für sich zu kaufen und in einem vietnamesischen Restaurant Glasnudeln mit Garnelen zu essen.
Dazwischen war nur menschenleere Zeit, das völlige Auf-sich-selbst-gestellt-Sein inmitten der gleichgültigen Natur. Da war das stetige Wispern, Pfeifen oder Brüllen des Windes, der das alte Haus in allen Fugen erzittern ließ. Die windstillen Nächte, die nur vom Rascheln und Trappeln der zahllosen Mäuse erfüllt waren, die das Haus bewohnten. Die langen Schatten der Giebel und Schornsteine, die der Vollmond in klaren Nächten auf die Schneedecke malte und die sich auf unheimliche Weise stets zu verändern schienen. Die hellen Schreie der Füchse, die das Haus nachts umschlichen, ein geisterhafter Sound, wie von Wesen aus einer anderen Sphäre.
Felix geht in die Küche und öffnet die Tür zu dem sich anschließenden, geräumigen Lagerraum, in dem sich ein zur Neige gehender Brennholzstapel, vier Tiefkühltruhen und wandfüllende Regale befinden, die im Moment fast leer sind. Im Lauf des Nachmittags werden sie sich mit Mehltüten, Konserven und haltbarer Milch füllen. Auch die Tiefkühltruhen sind beinahe leer, aber bald werden auch sie bis zum Rand gefüllt sein.
Felix weiß, dass ihm ein schweißtreibender Sommer bevorsteht, in dem er, in der Gluthitze des von der Sonne aufgeheizten Hauses und des Ofens, an manchen Tagen dreihundert Mahlzeiten raushauen muss – nur unterstützt von seinem slowenischen Küchenhelfer Milan. Aber weil er gut organisiert ist und der Menüplan sich auf eine Handvoll einfache Gerichte beschränkt – Suppe, Fleischpflanzerl, Kasspätzle, Leberkäs oder Kaiserschmarren –, kommt er gut klar.
Felix räumt eine Weile im Lagerraum herum, und weil er sonst nichts mehr zu tun hat, macht er sich ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade und begibt sich damit hinter das Haus, wo sich auf einem flachen, grasbewachsenen Stück das Minigehege seiner Griechischen Landschildkröte »Franzi« befindet.
Felix besitzt das urzeitliche Reptil bereits seit seiner Kindheit. Nach einem Todesfall und einer Haushaltsauflösung in der Nachbarschaft war das Tier, das, wie es hieß, damals um die zehn Jahre alt war und das niemand haben wollte, samt einem gut ausgestatteten Terrarium zu ihm gelangt. Weil es in der Haltung billig und anspruchslos war, hatte seine Mutter ihm erlaubt, es zu behalten.
Er hatte die Schildkröte, ein Weibchen, damals Franziska getauft, weil ihm der Name aus irgendeinem Grund gefiel, und daraus war im Lauf der Zeit »Franzi« geworden. In seinen ziemlich einsamen Kinderjahren war sie Felix’ zuverlässigste Freundin, sie war immer da und hörte ihm zu, wenn es sonst niemand tat. Sie kannte all seine Geheimnisse, Sorgen und Sehnsüchte, und die innige Zuneigung zu ihr verging auch nicht, als er älter wurde. Inzwischen begleitet ihn Franzi, eine immer noch recht junge Dame im besten Schildkrötenalter, schon seit über dreißig Jahren. Tatsächlich ist sie eins der sehr wenigen Dinge, die ihm von seiner früheren Existenz überhaupt geblieben sind.
Bedächtig sein Sandwich kauend, hockt Felix im Schneidersitz neben dem mit einem niedrigen Drahtzaun gesicherten Gehege und beobachtet Franzi, die auf ihren Säulenbeinchen langsam ihr kleines Revier durchstreift, das aus einer Grasfläche, einem mit Kies bestreuen Bereich, einem winzigen, flachen Wasserbassin und einem kleinen Busch besteht, der als Versteck und Schattenplatz fungiert.
Felix beugt sich vor und streicht mit seiner freien Hand sanft über Franzis anthrazifarbenen, in kräftigen Gelbtönen gemusterten Panzer, der im Gegensatz zur landläufigen Meinung für Berührungen durchaus sensibel ist. Sofort hält das Tier in seiner Bewegung inne und verharrt regungslos, während sich seine großen Lider in schläfrigem Wohlbehagen über die schwarz glänzenden, schon immer uralt wirkenden Augen schieben. Felix lächelt voller Zuneigung. Wie eh und je liebt er dieses archaische Tier, in dessen rätselhaftem, so weise wirkendem Blick er manchmal ein jahrmillionenaltes, tiefes Wissen um alles Werden und Vergehen zu erkennen glaubt.
Wie alt magst du jetzt wohl sein? So langsam müsstest du auf die vierzig zugehen.
Felix schluckt den letzten Bissen von seinem Sandwich herunter und beginnt, Franzi mit seinem Zeigefinger zärtlich unter dem Kinn zu kraulen, was das Tier willig geschehen lässt. Der faltige Hals wird sogar noch ein bisschen länger, um ihm das Köpfchen so weit wie möglich entgegenzustrecken.
Felix ist froh, Franzi so gesund und aktiv zu sehen, nachdem sie, in diesem Punkt den Murmeltieren ähnlich, den gesamten Winter in einer Kältestarre verbracht hat. Allerdings nicht in einer Höhle tief unter der Erde, sondern in einer mit feuchtem Laub ausgekleideten Kiste in einem der Kühlschränke im Lagerraum. Felix hat regelmäßig nach ihr gesehen, sie gewogen und sich auf den Tag im März gefreut, an dem es Zeit war, sie langsam aufwachen zu lassen.
Wie eh und je pflegt Felix seine Schildkröte mit größter Hingabe. Er ist entzückt, wenn sie mit sichtbarem Genuss die Blaubeeren verzehrt, die er extra im Tal besorgt, weil Franzi sie so liebt. Er leidet mit ihr, wenn sie erkältet ist oder Verstopfung hat, und kein Weg ist ihm je zu weit und keine Tierarztrechnung zu hoch, wenn es um seine gepanzerte, kleine Freundin geht.
Schon immer konnten viele Leute in seiner Umgebung – einschließlich der stets robusten, unsentimentalen Melly – ihre Verwunderung darüber kaum verhehlen, dass er sein Herz dermaßen an ein scheinbar so langweiliges, unkommunikatives Tier gehängt hat, aber das prallt vollkommen von ihm ab.
Die wissen es eben nicht besser.
Nachdem Felix seine obligatorische halbe Stunde mit Franzi verbracht hat, geht er wieder zur Vorderseite des Riesensteinhauses und lässt sich auf der grau verwitterten Holzbank neben der Eingangstür nieder. Er setzt seine Kopfhörer ein und aktiviert auf dem Smartphone den Titeltrack der Serie Westworld. Ein paar Minuten verbringt er so in der Sonne, den Rücken an die Wand des Hauses gelehnt und mit geschlossenen Augen in die seltsam entrückte Musik versunken.
Als er die Augen wieder öffnet und in Richtung des Weges schaut, der leicht bergan zur Seilbahnstation führt, nimmt er, noch weit entfernt, eine winzige Gestalt wahr, die sich auf das Haus zubewegt.
Felix seufzt.
Wieder ein versprengter Wanderer, der nicht weiß, dass wir noch geschlossen haben. Jedenfalls mach ich heute nicht die Küche auf.
Hin und wieder macht er auch Ausnahmen, so wie vorgestern bei dem rüstigen Rentner-Ehepaar mit ihrer leicht behinderten Tochter. Denen hat er Leberkäs, Kartoffelsalat sowie drei der letzten Biere serviert.
Mit zusammengekniffenen Augen beobachtet er die Gestalt, die ganz langsam größer wird. Es sieht jetzt, dass es eine kräftig gebaute Frau ist, offenbar älter, die ein Kopftuch und eine Sonnenbrille trägt und eine glänzende Umhängetasche, die das Licht reflektiert. Mit kleinen, vorsichtigen Schritten bewegt sie sich auf dem von der Schneeschmelze rutschigen Pfad.
Die Frau nähert sich weiter, aber erst, als sie nur noch zehn Meter entfernt ist, erkennt Felix sie. Mit einer ruckartigen Bewegung nimmt er die Kopfhörer aus den Ohren und richtet sich auf.
»Magdalena!«, ruft er verblüfft.
»Felix!«, antwortet eine wohlvertraute, mit einem etwas knarzigen Timbre versehene Stimme.
3
Nachdem die beiden sich umarmt haben, bittet Felix die Besucherin in die Gaststube, wo er ihr mit der Maschine hinter dem Tresen einen Kaffee braut, den sie schwarz trinkt. Für sich selbst holt er eine Flasche Spezi aus dem Kühlfach. Die beiden setzen sich an einen Tisch am Fenster und betrachten sich eingehend, so wie es zwei Menschen tun, die sich einige Jahre nicht gesehen haben.
»Du siehst richtig schön verfilzt aus«, meint Magdalena. »Wie The Big Lebowski.«
Felix grinst. »Findest du?«
»Ja. Bist du jetzt so ne Art Hippie geworden?«, fragt Magdalena mit einem feinen, ironischen Lächeln.
Felix lächelt zurück und sagt gleichmütig: »Ja, vielleicht so was in der Art. Warum nicht?«
»Jedenfalls siehst du richtig gut aus. Gesund.«
»Kommt von der frischen Luft hier.«
»Wirklich. Kein Vergleich mit dem Felix Brosch von vor ein paar Jahren.«
Felix nickt. »Ja, ich komme klar. Tut mir gut, hier oben zu sein.«
»Das freut mich«, sagt Magdalena mit einem warmen Ton in der Stimme.
Felix lächelt und sagt: »Aber du siehst auch gut aus. Wie aus dem Ei gepellt.«
Das Kompliment ist absolut ehrlich gemeint, aber Felix entgeht auch nicht der etwas müde Zug um die Augen seiner Besucherin.
Magdalena. Müsste jetzt langsam auf die sechzig zugehen.
Magdalena Knoop ist in der Tat achtundfünfzig Jahre alt. Sie ist eine etwas füllige, sehr gepflegte Erscheinung, die sich trotz ihres Alters mehr als nur einen Hauch von ihrer jugendlichen Attraktivität bewahrt hat. Ihr tizianrot gefärbtes, als halblanger Bob frisiertes Haar ist immer noch kräftig, und die manikürten Hände mit den perlmuttfarben lackierten Fingernägeln zeigen nur wenige Altersfältchen. Im Moment trägt sie lässige Outdoor-Sachen, aber im Office zeigt sie sich meist in dreiteiligen, schicken Hosenanzügen. Während sie Felix betrachtet, haben ihre schmalen, kastanienbraunen Augen einen weichen, nachgiebigen Ausdruck, doch daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. In Magdalena Knoop stecken ein kristallklarer, kühl-analytischer Verstand und eine sehr große Portion Durchsetzungsvermögen.
Magdalena nimmt einen Schluck aus ihrer Tasse und fragt: »Wie lange ist das her, dass wir zuletzt telefoniert haben? Drei Jahre?«
»Kommt hin«, sagt Felix. Ihm ist ein wenig unbehaglich bei dem Gedanken daran, dass er sich irgendwann gar nicht mehr bei ihr gemeldet hat – schließlich war sie eine der zwei Personen, die ihm damals in seiner schwersten Krise beizustehen versucht haben.
Aber sie hat ja irgendwann auch nichts mehr von sich hören lassen. Umso überraschender, dass sie plötzlich hier auftaucht – noch dazu ohne Ankündigung.
Felix fragt: »Wie kommt es, dass du nicht angerufen hast?«
Magdalena lächelt. »Ich wollte dein überraschtes Gesicht sehen.«
»Hm«, macht Felix, ein wenig verwundert. »Und woher wusstest du, dass ich im Moment hier oben bin?«
»Ich habe über den Bayerischen Alpenverein die Nummer deiner Chefin bekommen. Und die hat mir gesagt, dass du hier bist.«
Felix nickt. »Verstehe.« Dann denkt er daran, dass es von Berlin aus, wo Magdalena lebt, ziemlich weit ist bis in die Alpen und fragt: »Hattest du in München zu tun?«
»Nein«, sagt Magdalena lächelnd. »Ich bin deinetwegen hier. Es ist schön, dich wiederzusehen.«
Felix sieht, dass das ehrlich gemeint ist, und lächelt zurück. »Ich freue mich auch, dich zu sehen!«
Die Besucherin nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee, bevor sie Felix über den Rand ihrer Tasse fixiert und fragt: »Trinkst du noch?«
»So gut wie gar nicht.«
»Und die Tabletten?«
»Null.«
»Das ist gut.«
Magdalena betrachtet wohlwollend Felix’ von der alpinen Wintersonne gebräuntes Gesicht, die trainierten Arme und den muskulösen Oberkörper, der sich unter dem verwaschenen, grauen T-Shirt abzeichnet. »Du siehst auch extrem fit aus. Machst du viel Sport hier oben?«
»Ja. Im Winter Skitouren, im Sommer renne ich die Berge rauf. Und unterm Dach habe ich mir so ein kleines Gym eingerichtet mit ein paar Gewichten.« Er grinst und ergänzt: »Außerdem muss ich hier viel Holz hacken.«
»Und sonst? Ich meine, wenn du nicht arbeitest und keinen Sport machst?«
Felix schürzt die Lippen. »Na ja, ich lese viel, mehr als je zuvor. Ich schaue Serien und höre Musik.«
Magdalenas Augen funkeln ein wenig ironisch. »Immer noch Gangsta Rap?«
Felix lächelt milde. »Ja, manchmal, beim Holzhacken. Aber ich habe hier für mich auch ganz andere Musik entdeckt. Wenn die Sonne untergeht, höre ich Blues. Und nachts Beethoven.«
Magdalena zieht die sorgfältig gezupften Brauen hoch. »Beethoven! Das ist interessant. Was empfindest du dabei?«
»Ewigkeit.«
Magdalena sieht ihn nachdenklich an und nickt langsam. »Ewigkeit. Wie treffend.«
Es entsteht eine kurze Pause, dann fragt Magdalena: »Aber … ist dir das denn nicht zu einsam hier, so abgeschieden. Nicht zu … gleichförmig?«
Felix schüttelt den Kopf. »Absolut nicht. Ich arbeite wieder in meinem alten Beruf – und es gefällt mir hier! Sieh dich doch bloß um! Ein wunderschöner Ort!«
Magdalena ignoriert die Bemerkung und fragt stattdessen: »Gibt es keine Frau?«
Felix muss grinsen.
Die alte Magdalena. Immer ganz direkt.
»Nicht wirklich«, antwortet er.
Was er damit meint, ist, dass er manchmal das Bett mit seiner Chefin Melly, einer attraktiven Mittvierzigerin, teilt, aber das ist lediglich eine verstohlene, kleine Mesalliance, weil Melly in München verheiratet ist, und das, wie sie sagt »gar nicht mal so unglücklich«. Felix ist das recht, weil auf diese Art die Natur und das Bedürfnis nach menschlicher Nähe hin und wieder zum Zug kommen, ohne dass er mit Haut und Haaren in einer richtigen Beziehung steckt. Er mag Melly sehr gern, sie sind Freunde, aber Liebe ist es nicht.
Magdalena lächelt über die vage Auskunft und nimmt wieder einen Schluck von ihrem Kaffee.
»Aber mal zu dir«, sagt Felix. »Wie geht es Robert?« Er hat Magdalenas Mann, einen leicht verschrobenen, mit feinem Humor ausgestatteten Mathematikprofessor, einen US-Amerikaner, zweimal getroffen und ihn sehr sympathisch gefunden.
Magdalenas Augen bekommen einen trüben Schimmer.
»Robert ist vor zwei Jahren gestorben. Ein Gehirntumor. Es ging ganz schnell.«
Felix erschrickt.
»O nein! Das tut mir unendlich leid. Wenn ich das gewusst hätte …« Er macht eine hilflose Geste.
Magdalena lächelt flüchtig. »Ach nein, lass. Es war eine beschissene Zeit, aber ich konnte das nur allein bewältigen. Inzwischen geht es. Viel Arbeit hilft dabei. Aber klar, an manchen Abenden …«
Felix nickt voller Verständnis. Dann fragt er: »Wie alt war er?
»Fünfundsechzig.«
Felix schüttelt den Kopf. »Viel zu früh.«
Magdalena hebt die Schultern. »Weißt du, was Bob immer gesagt hat? ›When time is up, time is up.‹ Er hat das ganz gelassen hingenommen. Ein Stoiker. Das war dann irgendwie tröstlich für mich, dass er das so gesehen hat.«
Felix betrachtet sie eine Weile nachdenklich. Dann muss er plötzlich an Magdalenas und Roberts Sohn denken, den er nie kennengelernt hat, weil er in Bayern auf einem Internat zur Schule ging. Er fragt: »Und wie geht es Fynn? Was macht er?«
Bei der Erwähnung ihres Sohnes hellt sich Magdalenas nachdenkliche Miene auf. »Es geht ihm gut«, sagt sie. Und, mit einem Anflug von Stolz: »Er hat sein Studium mit Auszeichnung beendet und eine Karriere beim Auswärtigen Amt begonnen.«
Felix schürzt anerkennend die Lippen. »Das hört sich gut an.«
Es tritt eine Gesprächspause ein, während sich Magdalena scheinbar interessiert in der Gaststube umsieht. Dann wendet sie sich wieder Felix zu und sagt: »Also, das ist ja wirklich ganz schön hier. Wie in nem Heimatfilm.« Sie lächelt ein wenig ironisch. »Aber vermisst du denn deinen alten Job überhaupt nicht?«
Felix setzt ein mildes Lächeln auf und sagt ruhig: »Nein. Kein bisschen.«
Magdalena legt den Kopf ein wenig schief und fixiert ihn direkt. »Ich meine, das war doch etwas anderes als hier oben Leberkäse zu braten, oder?«
Ihr Tonfall verrät, dass sie findet, dass Felix »alter Job« nicht nur etwas anderes, sondern auch etwas »Besseres« gewesen sei, aber das ist Ansichtssache. In jedem Fall lässt die Art und Weise, in der Magdalena das Thema aufbringt, in Felix plötzlich den Verdacht aufkeimen, dass ihr überraschender Besuch doch nicht nur privater Natur ist. Wie sich bald herausstellen wird, liegt er damit vollkommen richtig.
Felix Brosch und Magdalena Knoop haben sich vor zehn Jahren kennengelernt, als Berufskollegen, so wie es Millionen anderen auch ergeht. Im Gegensatz zu diesen arbeiteten sie allerdings in einer ziemlich exklusiven und ambivalent schillernden Branche: in der Welt der Geheimdienste.
Felix war damals ein junger Mitarbeiter des MAD, des Militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, und Magdalena eine bereits ziemlich weit oben auf der Karriereleiter stehende Beamtin beim Bundesnachrichtendienst, kurz BND, dem Auslandsgeheimdienst Deutschlands.
Obwohl Spionageschichten und Agentenfilme Felix schon als Kind fasziniert hatten, war er, als er mit Ende zwanzig MAD-Agent wurde, nicht so naiv, anzunehmen, dass der Alltag eines Nachrichtendienstlers aus actionreichen Heldentaten bestand. Aber das besondere Flair, das die Geheimdienstbranche umwehte, jenes Schattenreich, in dem man in höherem, staatlichem Auftrag und gleichzeitig im Verborgenen agierte, übte eine große Anziehungskraft auf ihn aus. Es schien eine ganz eigene Sphäre zu sein, in der man schlau und trickreich sein musste und Mittel und Befugnisse hatte, die dem Normalbürger nicht zur Verfügung standen. Und was die Aufgaben des MAD betraf – die Abwehr militärischer Spionage, die Aufklärung von Sabotage und nicht zuletzt die Enttarnung politischer oder religiöser Extremisten innerhalb der Armee und ihre Entfernung aus der Truppe –, all das waren Dinge, mit denen Felix sich absolut identifizieren konnte.
Felix Brosch war noch keine zwei Jahre beim Militärischen Abschirmdienst, als er Magdalena Knoop kennenlernte. Er hatte mit der BND-Agentin in einem besonderen Fall zusammengearbeitet, und weil sowohl die professionelle als auch die persönliche Chemie zwischen ihnen stimmte, hatten sie sich – trotz des großen Altersunterschiedes und ihres unterschiedlichen beruflichen Standings – angefreundet. Magdalena, die in der BND-Zentrale in der Chausseestraße in Berlin residierte, war wie Felix Hamburgerin und nutzte jede Gelegenheit, ihrer Heimatstadt, in der Felix stationiert war, einen Besuch abzustatten. Dann tranken sie ein, zwei Bier am Hafen oder aßen Kuchen in dem mondänen, bei der Hamburger High Society beliebten Café des Hotels »Vier Jahreszeiten« an der Binnenalster. Magdalena liebte solche Orte, wie auch hippe, von bekannten Künstlern und ihrer In-Crowd besuchte Restaurants, in die sie Felix, der sich solchen Luxus kaum leisten konnte, gern einlud. Dann redeten sie über alles Mögliche: Filme, Fußball, für den Magdalena ein echtes Faible hatte, aber auch über Privates. Und oft genug über seinen Job, wobei Felix den Rat seiner erfahrenen Kollegin sehr schätzte.
Magdalena kramt in ihrer Umhängetasche aus schwarzem Lackleder und nimmt ein mit violett gefärbtem Krokoleder bezogenes Zigarettenetui heraus. Dann stutzt sie und fragt: »Ist doch okay, wenn ich hier rauche?«
Felix lächelt.
»Schon okay. Ist ja keiner hier. Meine Leute kommen erst so in zwei Stunden.«
Er meint damit Melly sowie zwei Helfer, die ihm beim Entladen der Helifracht und dem Verstauen der Vorräte helfen werden.
Magdalena nickt. »Gut.« Sie öffnet das Etui und nimmt eine Zigarette heraus.
»Warte.« Felix fingert sein Zippo aus der Brusttasche und gibt ihr Feuer. Dann erhebt er sich, um einen der weißblauen Aschenbecher von der Anrichte zu holen, die dort, sauber und gespült, auf die ersten Gäste der Saison warten.
Als Felix wieder am Tisch Platz genommen hat, fragt er: »Wie bist du überhaupt hier raufgekommen? Etwa zu Fuß? Die Seilbahn fährt doch noch gar nicht.«
Magdalena lächelt. »Für mich schon. Ich habe das über die Polizei in Schliersee geregelt. Weil ich in einem dienstlichen Auftrag unterwegs bin.«
Felix nickt zu sich selbst.
Also doch! Ich hatte den richtigen Riecher. Aber was um alles in der Welt kann sie von mir wollen?
Die BND-Agentin sieht auf ihre Hände und streicht sich mit den Fingerkuppen der Rechten über die perlmuttfarben schimmernden Nägel der Linken. Es ist ein kleiner Manierismus, der Felix gut vertraut ist. Er signalisiert erhöhte Konzentration.
»Hör zu …«, beginnt Magdalena, »ich bin aus einem bestimmten Grund gekommen. Ich werde dir das sofort erklären. Aber ich bitte dich, bevor du etwas dazu sagst: Hör mir bitte erst zu Ende zu. Okay?«
Felix starrt sie stumm an und nickt dann unmerklich.
Magdalena sagt: »Zuerst eine Frage: Erinnerst du dich an den Terroranschlag auf die jüdische Synagoge in Bergamo in Italien vor einem halben Jahr? Wo neben zweiunddreißig Gemeindemitgliedern, darunter acht Kinder, auch der Attentäter ums Leben kam?«
Felix nickt. Obwohl er versucht, sich hier oben so weit wie möglich von all dem Unglück und dem Entsetzen dieser Welt fernzuhalten und seinen Nachrichtenkonsum drastisch eingeschränkt hat, hat er diese üble Geschichte natürlich mitbekommen.
»Sicher«, sagt er.
»Nach dem Attentat«, fährt Magdalena Knoop fort, »gab es im Internet eine Erklärung einer ›Symbiotic Liberation Force‹, einer angeblich global vernetzten, rechtsextremen Terrororganisation, die sich dem weltweiten Kampf gegen das Judentum verschrieben hat und den Anschlag von Bergamo für sich reklamierte.«
Felix nickt.
»Man ging damals davon aus, dass es sich bei dieser ›Symbiotic Liberation Force‹ um Fake News handelte, um Trittbrettfahrer, und der Attentäter von Bergamo ein Einzelgänger war, der sich – wie bei solchen Leuten ja meist üblich – über entsprechende Plattformen im Internet radikalisiert und sich seine eigene Wahnwelt geschaffen hat. Es schien keinen Beweis zu geben, dass diese Organisation wirklich existiert. Deshalb verschwand das auch bald wieder aus den Medien.«
Magdalena bläst kurz Rauch zur Decke und fährt fort: »Vor zwei Wochen sind die Israelis an mich herangetreten. Der Mossad. Sie haben über ihre IT-Spezialisten herausgefunden, dass es tatsächlich eine auffällige, extrem gut verschlüsselte Kommunikation zwischen Leuten in verschiedenen Ländern gibt, die sich offenbar dieser SLF zurechnen. Das zentrale Glaubensbekenntnis ist ein achthundertseitiges Pamphlet mit dem Titel ›Time Has Come‹, verfasst von einem gewissen ›Hyperion‹.
Die Israelis gehen davon aus, dass dieser Hyperion als Person tatsächlich existiert und dass bei ihm die Fäden zusammenlaufen. Dass er solche Anschläge tatsächlich orchestriert.«
Felix schaut ungläubig.
»Du meinst so eine Art al-Qaida von Rechtsextremen? Mit diesem Hyperion als Nazi-Version von Osama bin Laden?«
Magdalena lächelt dünn.
»Ich weiß, das klingt ein wenig nach Fiction, wie in einem Filmplot. Aber, wie die Amis sagen: ›Ich habe auch schon mal einen Iren getroffen, der nur Milch trank.‹«
Sie nimmt einen Zug von ihrer Zigarette und sagt: »Tatsache ist jedenfalls, dass die Israelis äußerst alarmiert sind. In einer Online-Erklärung von Hyperion ist von ›seven devastating strikes‹ – sieben vernichtenden Schlägen- die Rede, mit der die weltweite jüdische Community getroffen werden soll. Der erste war der in Italien im Januar. Der Mossad hat die Verhinderung weiterer Anschläge ganz oben auf der To-do-Liste.«
»Auch in Israel?«
»Das nicht unbedingt, aber das spielt für den Mossad keine Rolle.«
Felix denkt daran, was er in seiner MAD-Ausbildung über fremde Nachrichtendienste gelernt hat.
Der Mossad ist der einzige Geheimdienst der Welt, dessen Auftrag nicht nur der Schutz der Bürger des eigenen Landes ist – sondern der aller Juden weltweit.
»Es liegt eben an der besonderen, ideologischen Ausrichtung der SLF, dass der Mossad sie als seine ureigenste Sache begreift«, sagt Magdalena. »Weil Hyperion diese Leute ausschließlich auf den Kampf gegen die Juden einschwört. Die Muslime zum Beispiel sind für ihn nicht der Hauptfeind, auch nicht die Migranten. All diese seien auch nur Spielball der jüdischen Weltverschwörung. Es sei gerade deren Ziel, dass sich Arier und Muslime gegenseitig vernichten, damit Zion die endgültige Weltherrschaft antreten kann.«
Felix betrachtet Magdalena nachdenklich.
Der jüdische Weltherrschaftsplan. Die Mutter aller Verschwörungstheorien. Und in unserer Zeit wieder ein großer Hit. Fatal. Aber was hat all das mit mir zu tun?
Magdalena schnippt mit einer eleganten Fingerbewegung die Asche von ihrer Zigarette und fährt fort: »Jedenfalls sind die Israelis fest davon überzeugt, dass diese SLF und Hyperion tatsächlich existieren, und sie stecken eine Menge Kapazitäten in die Jagd nach diesen Leuten. Sie sagen, es gibt in Berlin einen Mann, von dem sie vermuten, dass er in engerem Kontakt zur SLF und zu Hyperion steht. Ein auch dem Verfassungsschutz bekannter Nazi. Die Israelis haben gefragt, ob wir jemanden kennen, der sich ihm als Undercover-Agent nähern könnte. Und dabei dachte ich an dich.«
Felix richtet sich langsam auf, bis er kerzengerade auf seinem Stuhl sitzt. Er starrt Magdalena eine Weile wortlos an, dann sagt er ruhig: »Magdalena … was soll das? Du weißt, ich bin raus aus all dem, das ist für mich kein Thema mehr! Und undercover – was ich noch nie gemacht habe? Was für eine absurde Idee!« Er schüttelt ungläubig den Kopf. »Wie um alles in der Welt kommst du bloß auf mich?«
Magdalena schaut ihm ruhig in die Augen.
»Weil ich glaube, dass du diesen Mann kennst.«
»Was?«
Magdalena drückt ihre Zigarette langsam in dem weiß-blauen Aschenbecher aus. Dann sagt sie, jede Silbe betonend: »Sein Name ist Simon Trevor Jenkins. Aufgewachsen in Brighton, England.«
Felix traut seinen Ohren nicht.
Simon? Unmöglich!
4
Silvester 1999. Brighton, England.
Check It Out Now
The Funk Soul Brother!
»Felix!«, brüllt Simon und reißt beide Arme hoch. »Ain’t that fuckin’ great?«
Seine Stimme ist in dem Soundgewitter aus knallenden Bässen, dem frenetischen Chor des Publikums und der Stimme von Fatboy Slim, die leicht verzerrt aus den Speakern dringt, kaum zu vernehmen. Aber Felix weiß auch so, was er meint.
Während der berühmte britische DJ auf der Bühne, die eine Hand an seinem Mischpult, die andere hoch erhoben, seinen Superhit The Rockafeller Skank zelebriert, scheint der mit sechshundert Menschen vollgepackte Club förmlich abzuheben. Die Menge wogt auf und ab wie ein einziger, großer Organismus, ein Leviathan der Feierwut, befeuert von Ecstasy, MDMA, Marihuana und dem guten alten Alkohol, und das zuckende Stroboskoplicht, das den Bewegungen der Tänzer einen Zeitlupeneffekt verleiht, tut das Seine, um allen das Gefühl zu vermitteln, sich auf einem ganz eigenen Planeten zu befinden. Dem der ganz und gar selbstvergessenen und sich selbst rechtfertigenden Ekstase. Eine Feier des Lebens, wild und absichtslos, nur geleitet von der Gier nach Entgrenzung und dem elektrisierenden Gefühl des Aufgehens in einer euphorischen, dicht gepackten Menge.
Auch Felix ist davon gezündet. Er hüpft mit den anderen auf und ab und versucht dabei, seinen Pappbecher mit Ale, der noch halb gefüllt ist, so ausbalancieren, dass nichts verschüttet wird.
Simon und er befinden sich bei der Opening Night des Concorde 2, einem Raveclub, der am Madeira Drive direkt gegenüber der Uferpromenade des südenglischen Seebads Brighton liegt. Es ist Silvester 1999, und das altehrwürdige, viktorianische Gebäude mit der üppigen, ornamentstrotzenden Fassade vibriert förmlich in der Erwartung des neuen Jahrtausends.
Dass Simon und Felix überhaupt Tickets bekommen haben, ist den Beziehungen von Simons Vater zu verdanken, der mit dem neuen Betreiber des Clubs bekannt ist. Der hat dann auch anderweitig ein Auge zugedrückt. Mit ihren fünfzehn Jahren dürften sie eigentlich gar nicht hier sein, geschweige denn Alkohol trinken.
Die englischen Jugendschutzgesetze sind äußerst rigide und werden sonst scharf kontrolliert, aber heute hat die Polizei andere Sorgen: Alkoholleichen, häusliche Gewalt, Brände, Schlägereien, Staus, Unfälle. Das ganze Programm. An diesem feuchtkalten, durchgedrehten Milleniumsabend steht Brighton unter Hochspannung.
Nach der Show stehen Felix und Simon in ihren Windbreaker-Jacken und Cargohosen auf der Meerseite des Madeira Drive an dem grün oxydierten alten Geländer, von wo aus man auf die Uferstraße und den Strand hinabsieht. Zur Rechten liegt, lang in die schwarze See gestreckt, das von einer hellen Lichtaura überwölbte Brighton Palace Pier, eine riesige Seebrücke mit großen, viktorianischen Holzbauten und Fahrgeschäften, ein ganzer Vergnügungspark. Am Fuß der Brücke dreht sich ein gigantisches Riesenrad, so unwirklich hell blinkend wie ein Ufo aus einem Steven-Spielberg-Film. Der ins Halbdunkle getauchte Strand, auf den sie hinabblicken, wimmelt vor Menschen, von denen viele mit farbigen Leuchtstäben wedeln. Es wirkt, als würden dort Hunderte von Glühwürmchen einen wirren Tanz aufführen.
»Das war cool, das Konzert«, sagt Felix und schiebt sich ein fettiges, weiches Kartoffelstück in den Mund. Er und Simon haben sich gerade bei einer der verschnörkelten Imbissbuden eine Portion Fish & Chips besorgt, mit Salz und Malzessig veredelt.
»Yeah«, sagt Simon, aber er wirkt plötzlich nicht mehr sehr enthusiastisch. Wie jäh ernüchtert, starrt er mit abwesendem Ausdruck auf seine unberührte Fish-&-Chips-Tüte aus Zeitungspapier, bei der das Frittierfett die Druckerschwärze der Buchstaben verschwimmen lässt. Felix betrachtet ihn besorgt.
Irgendetwas ist mit ihm. Bei dem Konzert gerade schien er noch gut drauf zu sein, aber jetzt ist er komisch. Still. Eigentlich ist er das schon, seit ich vorgestern angekommen bin.
»Sag mal«, fragt Felix, »hast du was? Gibt es ein Problem?«
Simon druckst eine Weile herum, man merkt, dass es ihm schwerfällt, mit seinen Sorgen herauszurücken, aber dann stößt er einen tiefen Seufzer aus und sagt leise:
»Meine Eltern lassen sich scheiden. Mein Vater hat eine andere Frau, in Glasgow, in Schottland. Er wird dorthin ziehen. Ich muss bei meiner Mutter bleiben, aber nicht hier in Brighton. Man hat ihr einen Job in Cincinnati, USA, angeboten. An der Uni. Da ziehen wir hin.«
Felix lässt das Kartoffelstück, das er gerade in der Hand hält, wieder in die Tüte fallen.
»Was? Echt jetzt? Ich fass es nicht! Seit wann weißt du das?«
Simon schnaubt durch die Nase. »Erst seit ein paar Tagen. Seit Weihnachten. Meine Eltern haben mich getrennt informiert. Jeder für sich.«
Felix ist verstört, auch weil die Sache eine Familienangelegenheit ist. Simons Mutter ist seine Tante, die Schwester seiner Mutter und Simon somit sein Cousin. Aber sie sind mehr als das: Sie sind dicke Kumpels, weil Felix schon seit fünf Jahren in den Sommerferien immer für vier Wochen nach Brighton kommt, wo er bei Simons Familie wohnt. Für Felix war und ist es die so ziemlich beste Zeit des Jahres, weil er dann der Tristesse und der Enge seines eigenen Zuhauses entkommen kann. Dafür trennt er sich sogar für eine Weile von seiner geliebten Schildkröte Franzi, die in dieser Zeit in der Obhut seiner Mutter bleibt, auch wenn ihm dabei nicht immer ganz wohl ist. Obwohl seine Reisen nach Brighton nur einen geringen Teil seines Lebens ausmachen, sind es ungeheuer intensive, innige Tage, in denen es Felix scheint, als habe er in Simon den Bruder gefunden, den er nicht hat und sich insgeheim ersehnt.
Das Zuhause seines Cousins ist für Felix’ Maßstäbe ein richtiger Palast, ein gepflegtes, großes Einfamilienhaus mit Garten, Doppelgarage und viel Platz im Inneren. Tante Marion hat es besser getroffen als ihre Schwester Heike. Marion Brosch hat in Edinburgh studiert und ihren Magister in Sozialökonomie gemacht, bevor sie Simons Vater, einen smarten, hochgewachsenen Engländer, kennenlernte, der gerade dabei war, in der Versicherungsbranche Karriere zu machen. Von ihm hat Simon das dicke, sandfarbene Haar, die hellblauen Augen und die schlanken, drahtigen Gliedmaßen.
Weil Felix die Neuigkeit erst einmal verdauen muss, bleibt er eine Weile stumm und blickt aufs Meer hinaus, wo der schwarze Horizont des Meeres mit dem Himmel verschmilzt. Unten am Strand tanzen die menschlichen Glühwürmchen, und zur Rechten nähert sich ein Pulk von Feiernden auf der Uferpromenade.
Junge Männer und Frauen in bunten Metallic-Perücken und mit Luftballons in den Händen. Zwei tragen überdimensionale Fun-Brillen, die in Form der Zahl 2000 gestaltet sind, darüber steht in Glitzerschrift das Wort Welcome. Aus einem Ghettoblaster knallen Techno-Bässe.
Felix wartet, bis die lärmende Gruppe vorbeigezogen ist, und wendet sich wieder Simon zu: »Und wie findest du das mit Amerika?«
Simon verzieht das Gesicht zu einer Grimasse.
»Fuck, I hate it! But I can’t do anything about it!«, stößt er hervor. Weil er es von seiner Mutter gelernt hat, spricht er normalerweise Deutsch mit Felix, der kaum Englisch kann, aber wenn er erregt ist, wechselt er automatisch ins Englische.
In diesem Fall versteht Felix ihn gut. Er fragt: »Du würdest lieber bei deinem Vater bleiben, stimmt’s?«
Simons Gesicht bekommt einen gequälten Ausdruck. Bitterkeit und eine tiefe Verletztheit spiegeln sich darin.
»Ja! Aber mein Vater will das nicht. Oder seine neue Frau«, sagt er.
Felix sieht Simon bestürzt an.
Ich weiß, wie viel ihm sein Vater bedeutet. Und der schiebt ihn jetzt ab!
Der Schmerz seines Freundes ist für Felix regelrecht körperlich spürbar. Er legt Simon den Arm um die Schultern und sagt: »O Mann, das tut mir leid! Das tut mir echt leid!«
So stehen sie eine Weile schweigend beisammen, bis Felix sagt: »Hey, Mann! Es wird sich alles finden! Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht in Amerika!«
Es ist ein ziemlich schwacher Versuch, seinen Freund aufzumuntern, denn ihm ist selbst wehmütig zumute. Mit einem Mal wird Felix nun klar, warum er von Simons Mutter, ganz anders als sonst, in diesem Jahr auch zum Jahreswechsel für ein paar Tage nach Brighton eingeladen worden ist.
Vielleicht soll das ja so eine Art Abschiedsbesuch sein. Wer weiß, ob Simon und ich uns je wiedersehen. Cincinatti – wo ist das überhaupt? Nach Brighton ist es von Hamburg nur ein Katzensprung, aber nach Amerika?
Doch es ist nicht nur die Entfernung, die das Problem ist. Bisher hat Simons Vater stets Felix’ Flugtickets nach England finanziert, weil seine Mutter mit ihrem Sozialhilfebudget dazu schlicht nicht in der Lage war. Er hat Felix auch immer mit etwas Taschengeld ausgestattet, was – zusammen mit ein paar Scheinen aus Felix’ illegalen Einkünften als Mitglied einer jugendlichen Straßengang in Hamburg – für vier Wochen gut ausreichte.
Simon und er haben diese Sommertage stets bis zur Neige ausgekostet. Wenn es warm und sonnig war, hingen sie am Strand ab und glotzten den Touristenmädchen hinterher, an die sie sich, wenn es dunkel wurde, beim Booster-Karussell auf dem Brighton Pier heranmachten. Letzten Sommer sogar mit Erfolg, als sie zwei Bräute aus London überreden konnten, am nächtlichen Strand mit ihnen rumzumachen. An regnerischen Tagen spielten sie in Simons geräumigem Zimmer Videogames, bei denen Simon so gut wie immer gewann, oder sie besorgten sich über ein paar Umwege heimlich Bier und hörten Musik, bevorzugt amerikanischen Gangsta Rap wie Tupac, Notorious Big und Snoop Dog. Und wenn ihre überschüssige, jugendliche Energie ein Ventil suchte, hauten sie sich beim Badminton die Federbälle um die Ohren.
Es waren Zeiten, in denen keine Sekunde Langeweile aufkam, auch wenn Felix die scheinbar so perfekte Welt seines Cousins, der im Gegensatz zu ihm auch in der Schule ein Ass war, hin und wieder einschüchterte und auch ein wenig neidisch machte.
Denn Felix Gerhard Broschs Start ins Leben war gewiss nicht das, was sein erster Vorname »Der Glückliche« verhieß. Seit seiner Geburt besteht seine Welt aus einer nach Zigaretten, Alkohol und Depressionen riechenden Wohnwabe in der Hochhaussiedlung Kirchdorf-Süd, in der er allein mit seiner Mutter lebt.
Kirchdorf-Süd ist ein mit sechstausend Menschen vollgestopfter Betonmoloch im äußersten Süden des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg und ein soziales Ghetto par excellence, mit einem exorbitant hohen Anteil von ebenso kinderreichen wie armen Migrantenfamilien. Hier war man materiell und kulturell Lichtjahre entfernt von den poshen Gegenden rund um den von weißen Segeln gesprenkelten Alstersee im Herzen der Stadt. Der »goldene Löffel«, mit denen die Kids dort ihren Babybrei verabreicht bekamen, war bei Felix ein von den Flammen des Gasherds versehrtes, dunkelblaues Plastikteil und der vertrauteste Anblick seiner Kindheit der seiner hageren, früh verblühten Mutter, die, violette Schatten unter den immer noch schönen, grauen Augen, rauchend am Küchentisch saß, Fantasyromane las oder mit dem Kugelschreiber Kreuze auf den Anzeigenseiten des Wochenblatts machte. Im Hintergrund lief dazu stets der Fernseher in dem kleinen Wohnzimmer neben der Küche, in dem Felix’ schmales Ikea-Bett stand, aber auch ein zweiter Kühlschrank, an dessen Inhalt – Discountbier und Billigwodka – sich seine Mutter regelmäßig bediente. Das leise Quietschen der sich öffnenden Kühlschranktür und das anschließende Klirren der Flaschen war für den kleinen Felix eine stets wiederkehrende Wahrnehmung, so vertraut wie das verblichene, gelbgrüne Karomuster der Bettwäsche, in der er jahrelang schlief.
Felix starrt unschlüssig in seine Zeitungstüte mit dem Imbiss und sagt: »Weißt du, es klingt vielleicht blöd, aber ich weiß ja nicht mal, wer mein Vater ist. Und ich komme ganz gut klar.«
Ein Blick in Simons verschlossene Miene zeigt ihm, dass das eine wenig hilfreiche Bemerkung war.
Tatsächlich hat Felix seinen Vater nie kennengelernt, weil der, eine Zufallsbekanntschaft seiner Mutter, drei Tage mit ihr versackt war und sich dann aus dem Staub gemacht hatte. Er weiß von seiner Mutter nur, dass er »Werner« hieß und »irgendwas mit Textilien« gemacht habe.
Felix beobachtet seinen Cousin, der jetzt, die Fish-&-Chips-Tüte in der Linken, mit der rechten Hand eine Packung Benson & Hedges und ein Zippo aus seiner Windjacke zieht.
Es gibt wirklich große Unterschiede zwischen uns. Verglichen mit mir ist er reich. Aber er hat mich das nie spüren lassen. Er respektiert mich. Das hat er immer getan. Und er hat auch nie ein böses Wort über meine Mutter verloren.
Wie Simon und Felix beide wissen, hat Heike Brosch einen rasanten sozialen Abstieg hinter sich. Aus einem biederen, soliden Haus stammend, war sie, obwohl recht intelligent und nicht unattraktiv, von Natur aus labil und unsicher in ihren Entscheidungen. Durch missglückte Männergeschichten, einen frühen Hang zur Flasche und ständige Jobwechsel in ihrem Beruf als Steuerfachangestellte war sie in einen Sog geraten, der sie unweigerlich abwärts zog bis hinab in die permanente Arbeitslosigkeit und die endgültige Kapitulation vor König Alkohol. Als Heike Brosch mit Felix schwanger wurde, lebte sie bereits von der Stütze, und kurz darauf kam sie in Kirchdorf-Süd an. Trotz der Vermittlungsversuche ihrer Schwester Marion hatten sich ihre Eltern längst von ihr abgewandt und wollten auch mit ihrem Enkel Felix, jenem Zufallsprodukt, nichts zu tun haben. Seitdem ist Tante Marion, Simons Mutter, die Einzige aus der Familie, die noch den Kontakt zu ihr hält und ihre Schwester hin und wieder mit Geldzuwendungen unterstützt.
Während Simon an seiner Zigarette saugt und schweigend vor sich hin starrt, muss Felix voller Zuneigung an eine Sache denken, die sich im vergangen Sommer ereignet hat und bei der sich gezeigt hat, dass sie auch in extremen Situationen füreinander einstehen – ohne Rücksicht aus Verluste.
Fünf Monate zuvor.
In einer warmen, vom nahenden Vollmond erhellten Julinacht stehlen sie sich heimlich aus dem Haus von Simons Eltern, um noch ein wenig am Strand herumzulaufen und Gras zu rauchen. Das Haus von Simons Eltern liegt am Princes Crest in Hove, dem »besseren«, westlichen Teil der Stadt, und von dort sind es nur ein paar Minuten bis zum Meer.
Felix und Simon überqueren den Kingsway, eine vierspurige Uferstraße, und betreten die Western Lawns, einen breiten, parallel zum Meer verlaufenden Grünzug mit Tennisplätzen und quadratischen, gepflegten Rasenflächen, auf denen die gut situierten Einwohner Hoves tagsüber Boccia und Federball spielen. Sie durchqueren die Lawns, passieren einen gepflasterten Weg mit weißen Umkleidehäuschen und betreten den mit Sand und kleinen Kieseln bedeckten Strand, der einsam und still daliegt. Sie laufen zur Wasserlinie und schlendern in östlicher Richtung daran entlang. Simon nimmt den vorbereiteten Joint aus der Brusttasche seines Poloshirts und feuert ihn an. Felix nimmt ebenfalls einen Zug und reicht die Marihuana-Tüte gerade an Simon zurück, als sie merken, dass sie nicht allein sind.
Aus dem Schatten der Reihe mit den Umkleidehäuschen lösen sich drei Gestalten und steuern direkt auf Felix und Simon zu. Als sie näher kommen, sehen sie, dass es drei dunkelhaarige Jungs mit orientalischen Zügen sind, alle offenbar etwas älter als Simon und Felix. Zwei von ihnen, ein stämmiger, schwerer Kerl und ein kleiner Typ, tragen stonewashed Jeans und dunkle T-Shirts, der größte und offenbar älteste ist ein gut aussehender, athletischer Junge mit einem knallroten Jogginganzug. Um seinen Hals baumelt eine massive Stahlkette.
Simon raunt Felix zu: »Keine Ahnung, was die nach Hove verschlagen hat. Die sehen aus, als kämen sie aus Moulscoomb. Das gibt bestimmt Ärger!«
Felix’ Cousin spricht von einem berüchtigten nordöstlichen Vorort Brightons, in dem sich arme, britischstämmige Menschen mit einer wachsenden Zahl von ebenso armen, vor allem arabischen Migranten mischen. Im offiziellen Sprachgebrauch gilt Moulscoomb als deprived area – als »benachteiligtes Stadtgebiet« –, aber das trifft den Sachverhalt nur unzureichend. Weniger zarte Gemüter bezeichnen Moulscoomb als pure shithole. Tatsächlich ist das Viertel eine der ärmsten, deklassiertesten Gegenden in ganz Großbritannien – geprägt von Kriminalität, Drogen, Perspektivlosigkeit.
Ein paar Augenblicke später stehen die fremden, offensichtlich arabischen Kids vor Simon und Felix und nehmen eine lässig-überlegene Haltung ein. Der Typ im roten Jogginganzug schnüffelt demonstrativ in der Luft herum, wo sich der typische Grasgeruch ausgebreitet hat, und deutet auf den Joint in Simons Hand. »Hey«, sagt er mit drohender Miene. »Gimme dat!«
Felix hat zwar von seinem Zuhause her einige Erfahrung mit solchen Situationen, aber die fremde Umgebung und das arabisch gefärbte Slum-Englisch verunsichern ihn. Er sieht zu Simon, der ein trotziges Gesicht macht und offenbar nicht die geringste Neigung hat, ihren kostbaren Joint auszuliefern. Dann geht Felix’ Blick zu dem fremden Jungen, dessen Gesicht er im Mondlicht gut erkennen kann. Die dunklen Augen unter den zusammengewachsenen Brauen sprühen vor Aggressivität.
Simon nimmt sichtbar all seinen Mut zusammen und sagt laut: »No!«
Der andere durchbohrt ihn mit stechendem Blick. Dann greift er in die Tasche seiner Jacke und holt ein Springmesser hervor. Mit einem scharfen, metallischen Klacken fährt die lange Klinge aus. Felix sieht sie im Mondlicht blitzen. Seine Nackenhaare sträuben sich.
Der Typ im Jogginganzug bewegt sich, das Messer in Brusthöhe vor sich gestreckt, einen Schritt auf Simon zu, der wie hypnotisiert auf die tödliche Waffe starrt und sich nicht rührt.
»Gimme dat, piece o’ shit! And cell phone!«, sagt der Araber zu Simon und macht einen weiteren Schritt nach vorn. Simon steht bloß da, vor Schreck wie gelähmt.
In Felix’ Gehirn explodiert die Amygdala, der Alarmschalter in seinem lymbischen System, und augenblicklich überspült eine mächtige Woge von Adrenalin und Testosteron seine Großhirnrinde. Seit er zwölf ist, ist er ein Streetfighter, und jetzt, mit fünfzehn, ist er ein kräftiger und gewandter Kerl, ein bei den Feinden seiner Hamburger Gang gefürchteter Gegner.
In einer blitzschnellen Bewegung macht Felix einen Satz auf den Typen mit dem Messer zu, und als er, leicht seitlich versetzt, etwa einen Meter vor ihm ist, holt er mit dem rechten Bein aus, knickt seinen Oberkörper nach links ab und tritt seinem Gegner in einer weit ausholenden Bewegung unter dem Messerarm hindurch in den Unterleib.
Es ist ein Volltreffer. Mit einem pfeifenden Geräusch entweicht die Luft aus der Lunge seines Gegners. Sekundenbruchteile wirkt er wie erstarrt, dann lässt er das Messer fallen und sinkt in die Knie. In dem sinnlosen Reflex, den bewusstseinssprengenden Schmerz zu lindern, hält er seine Weichteile, während seine Augen schier aus den Höhlen treten. Sein Mund gibt nur noch ein ersticktes Gurgeln von sich gibt.
Sofort kommt Bewegung in die beiden anderen. Sie stürzen sich auf Felix und Simon, der aus seiner Erstarrung erwacht ist. Faustschläge und Tritte hageln auf beiden Seiten, es ist ein verbissener Kampf am nächtlichen Strand von Hove. Dann hat Felix’ Gegner, der stämmige, massige Kerl, ihn rücklings zu Fall gebracht und sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn geworfen. Mit der rechten Hand versucht er, Felix Sand in den Mund und in die Nasenlöcher zu stopfen. Der wehrt sich so gut es geht, als er hinter sich einen Ausruf in einer fremden Sprache hört. Der Stämmige hört auf, Felix zu traktieren, sondern beschränkt sich nun darauf, ihn mit Knien und Armen auf dem Boden zu fixieren. Felix dreht mühsam seinen Kopf nach hinten und sieht den Typen im roten Jogginganzug, den er vorhin von den Beinen geholt hat, mit schwerem, breitbeinigem Schritt auf sich zukommen. Er hält jetzt wieder das Messer in der rechten Hand. Felix kämpft verzweifelt, um zu entkommen, aber der Bullige hält ihn mit eisernem Griff am Boden festgenagelt. Einen Augenblick später ist der Typ mit dem Messer bei ihm, sein wutverzerrtes Gesicht schwebt, auf den Kopf gestellt, dicht über seinem. Überdimensional groß kommt das Messer in Felix’ Blickfeld.
Die Klinge nähert sich seinem Gesicht.
Whomp! Ein dumpfes, hartes Geräusch, und das über Felix schwebende Gesicht und das Messer fliegen plötzlich aus dem Bild. Der Bullige, der ihn am Boden festhält, glotzt wie versteinert auf etwas außerhalb von Felix’ Blickfeld. Sein Griff lockert sich, weshalb Felix einen Arm freibekommt. Als er gerade zu einem Fausthieb in das Gesicht des Gegners ausholen will, geht ein weiterer, dumpfer Schlag nieder, und der Bullige sinkt zur Seite. Felix kommt frei.
Er blickt nach oben und starrt ungläubig auf Simon, der, schwer atmend und mit den Händen ein großes Stück Treibholz umklammernd, dasteht, das Gesicht eine Grimasse der Wut und der Entschlossenheit.





























