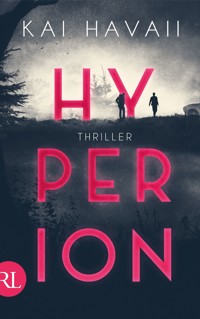8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wenn du zu weit gehst – und eine Umkehr tödlich wäre.
In Afghanistan war Carl Overbeck der beste Scharfschütze seiner Einheit, doch zurück in Deutschland kommt er mit seinem Leben nicht mehr zurecht. Da macht ihm ein alter Jugendfreund ein besonderes Angebot: Er soll in Italien einen Mafioso erschießen, der sich der Polizei als Kronzeuge angedient hat. Carl übernimmt diesen Job und wird damit zum Auftragskiller, der still und heimlich seine Aufträge versieht. Bis er sich in die falsche Frau verliebt ...
Spannend, aktuell und hochemotional, ein Ereignis. Der erste Roman von Kai Havaii, dem Sänger der Band Extrabreit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 940
Sammlungen
Ähnliche
Über Kai Havaii
Kai Havaii, geboren 1957 in Hagen, wurde nach sehr kurzem Germanistikstudium und Jobs als Taxifahrer und Cartoonist 1979 Sänger von EXTRABREIT, bis heute eine der bekanntesten deutschen Rockbands. Kai Havaii arbeitet auch als freier TV-Autor, u. a. für ZDF und ARTE. Wenn er nicht mit der Band auf Tour ist, lebt er in Hamburg.
Informationen zum Buch
Wenn du zu weit gehst – und eine Umkehr tödlich wäre.
In Afghanistan war Carl Overbeck der beste Scharfschütze seiner Einheit, doch zurück in Deutschland kommt er mit seinem Leben nicht mehr zurecht. Da macht ihm ein alter Jugendfreund ein besonderes Angebot: Er soll in Italien einen Mafioso erschießen, der sich der Polizei als Kronzeuge angedient hat. Carl übernimmt den Job und wird damit zum Auftragskiller, der still und heimlich seine Aufträge versieht. Bis er sich in die falsche Frau verliebt.
Spannend, aktuell und hochemotional – ein Ereignis. Der erste Roman von Kai Havaii, dem Sänger der Band Extrabreit.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kai Havaii
Rubicon
Thriller
Inhaltsübersicht
Über Kai Havaii
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Epilog
Impressum
1
Rom, Italien. September 2018.
Weg. Irgendwie wegkommen.
Der Alfa schlingert und bockt auf der von Schlaglöchern übersäten, ungepflasterten Piste. Carls Puls hämmert schmerzhaft in seinen Ohren, und sein T-Shirt ist nassgeschwitzt. Im Rückspiegel sieht er, wie ein schwarzer SUV aus der Toreinfahrt schießt, aus der er selbst gerade gekommen ist. Das Teil hat die Ausmaße eines kleinen Schützenpanzers.
Drei, vier Schüsse, die ihm gelten. Aber sie sind ein ganzes Stück hinter ihm, und weil auch das Geländefahrzeug heftig mit der zerkraterten Piste kämpft, verfehlen sie ihn. Links und rechts Werkstätten und Fabrikhallen, viele verrottet. Carl beschleunigt noch mal. Der Alfa macht einen Satz nach vorn und erreicht bald die Einmündung in eine asphaltierte Hauptstraße.
Carl sieht die Straße nur kurz ein, dann zieht er mit vollem Risiko raus und reißt das Steuer nach links. Das Heck des Alfa bricht wild zur Seite aus, bevor er beschleunigen kann und der Wagen wieder in die Spur kommt. Ein von rechts kommender Motorrollerfahrer muss scharf bremsen und stürzt beinahe. Hinter ihm folgt ein LKW, der ebenfalls hart bremsen muss. Gellendes Gehupe. Carl sieht im Rückspiegel, wie sich seine Verfolger hinter dem Truck einreihen müssen. In einem Moment kurzer Erleichterung stößt er Atemluft aus.
Phew.
Im Gegenverkehr tut sich eine Lücke auf. Er tritt das Gaspedal durch und überholt einen Fiat und einen kleinen Van mit knallig bunter Mozzarella-Werbung. Der Fahrtwind zerrt heftig am linken Ärmel seiner Jacke, weil die ganze Fahrertür bei seiner Flucht aus der Lagerhalle abgerissen ist. An ihrer Stelle klafft ein großes Loch. Weil dabei auch der linke Seitenspiegel draufgegangen ist, hat er nur den Rückspiegel, um seine Verfolger im Auge zu behalten.
Der Gegenverkehr wird jetzt zu dicht zum Überholen. Rückspiegel. Der schwarze SUV bleibt dran und hängt vier Fahrzeuge hinter ihm.
Ins Zentrum. Dahin, wo viel los ist. Aus der Karre raus, in einer Menschenmenge untertauchen.
Carl fährt nach Gefühl, er glaubt, dass er aus dieser Richtung gekommen ist. Dann sieht er auch ein Schild.
Centro
Plötzlich nimmt er wahr, dass aus den entgegenkommenden Fahrzeugen entsetzte Gesichter zu ihm herüberstarren. Was aber offensichtlich nicht an der fehlenden Fahrertür liegt.
Er fasst sich ins Gesicht und spürt klebrige Nässe.
Das ist kein Schweiß.
Er starrt auf seine rotverschmierte Hand und dreht den Rückspiegel in seine Richtung: Die linke Gesichtshälfte ist komplett mit Blut besudelt.
Es ist das Blut des Mannes, den er eben erschossen hat. Auf dem Beifahrersitz liegt die Waffe, eine zwölfschüssige Beretta 92. Allerdings ist sie jetzt nutzlos, denn das Magazin ist leer.
Carl öffnet das Handschuhfach und tastet darin herum. Ein paar halbzerknüllte, offenbar gebrauchte Papiertaschentücher.
Wahrscheinlich haben sie sich im Auto noch einen runtergeholt, bevor sie mich abgeholt haben.
Aber weil er in seiner Lage nicht wählerisch sein kann, nimmt er ein paar der Tücher und wischt das Blut ab, was einigermaßen funktioniert.
Ein paar Kilometer hat er schon zurückgelegt, immer mit dem schwarzen SUV-Panzer drei, vier Reihen hinter ihm.
Der Alfa beschleunigt mit einem aggressiven Grollen, als Carl ein Reisemobil überholt. Er streckt kurz den Kopf durch das Loch auf der Fahrerseite und sieht zurück. Der schwarze SUV driftet ein Stück nach links, um ebenfalls eine Lücke zum Überholen zu finden und wieder näher zu ihm aufzuschließen. Der Fahrer ist einer der braunhäutigen Männer mit Latinozügen, die er vorhin in der Lagerhalle gesehen hat – so kurz die Begegnung auch war.
Plötzlich beginnt es zu regnen. Erst klatschen ein paar dicke Tropfen auf die Windschutzscheibe, dann prasselt es wie Gewehrfeuer. Dunkle, tiefhängende Wolken schlucken das letzte Nachmittagslicht, und das Rauschen und Trommeln des Wassers übertönt alle anderen Geräusche. Ein Stück voraus zuckt ein Blitz über den Himmel, gefolgt von der dumpfen Explosion fernen Donners. Carl findet nach etwas Fummelei die Schalter für Licht und Scheibenwischer und starrt angestrengt durch die Windschutzscheibe, auf der die beiden Wischer trotz maximaler Schlagzahl mit dem Sturzbach kämpfen. Hinter einem Vorhang aus Regen ziehen hohe Mietskasernen vorbei, mit abblätternden, terrakottafarbenen Fassaden und kleinen Balkonen, auf denen römische Matronen versuchen, die zum Trocknen aufgehängte Wäsche in Sicherheit zu bringen. Auf den Gehsteigen hasten Menschen im Slalom an Haufen aus zum Teil aufgeplatzten Müllsäcken vorbei.
Die Gegend wird nun immer belebter, die Häuser sind älter und ehrwürdiger, aber ebenso narbig. Auf den Fassaden wuchern halbverwitterte Graffiti. Trattorien und Bars wechseln sich ab mit Tabacchi-Läden und kleinen Supermärkten. Motorroller kurven wie nassgeregnete Hummeln durch den zähen Strom der Autos. Ein großer Krähenschwarm steuert die Platanen am Straßenrand an, um ein halbwegs trockenes Plätzchen zu finden. Vor Carls Augen wabern die Rücklichter und Scheinwerfer. Nur mit Mühe entziffert er den grünen Wegweiser über der Fahrbahn.
Termini stazione
Jetzt!
In einem brutalen Manöver zieht er den Alfa nach links auf die Abbiegerspur. Bremsen kreischen, Hupen blöken, aber er schafft es, links abzubiegen, ohne dass es zu einem Unfall kommt.
Gut, dass die Italiener so gute Autofahrer sind. Das Chaos liegt ihnen im Blut.
Wieder ein Blick nach hinten, mit dem Kopf im Regen.
Scheiße.
Er wird den verdammten Riesen-SUV, den er inzwischen als Cadillac Escalade erkannt hat, nicht los. Der Fahrer hat es tatsächlich auch geschafft, rechtzeitig auf die Abbiegerspur zu kommen.
Aber es ist nun nicht mehr weit bis zu seinem Ziel. Er fährt die Via Nomentana hinunter, eine vierspurige Straße mit einem Mittelstreifen, während er mit der linken Hand Regenwasser auffängt und damit die letzten Blutreste aus seinem Gesicht wäscht. Zwischen dem zähfließenden Verkehr überqueren Menschen mit Schirmen und übergezogenen Kapuzen eilig die nasse Fahrbahn. Carl hört nicht zu ortende Sirenen und hofft, dass ihm nicht noch Polizei begegnet und ihn wegen der fehlenden Fahrertür festnagelt. Die italienischen Cops kann er genauso wenig brauchen wie die Typen in dem schwarzen Caddy hinter ihm.
Eine rote Ampel bringt die Kolonne zum Stehen. Carl streckt wieder den Kopf nach draußen, um nach hinten zu sehen – und zieht ihn sofort wieder ein. Durch den Regenschleier hat er gesehen, dass sich ein Mann an den stehenden Autos entlang in geduckter Haltung in seine Richtung bewegt – die Hand in der Tasche seiner Bomberjacke. Dann sieht er im rechten Seitenspiegel einen zweiten Mann, der sich auf der anderen Seite nähert. Ihre vorsichtigen Bewegungen zeigen ihm, dass sie damit rechnen, dass er noch munitioniert ist.
Logisch. Sie werden vorhin in der Lagerhalle kaum mitgezählt haben, wie oft ich geschossen habe.
Aber er will nicht warten, bis sie herausfinden, dass er leergeschossen ist, und bereitet sich darauf vor, nach links aus dem Alfa zu hechten und zu versuchen, zwischen den stehenden Autos zu entkommen. In diesem Moment jedoch springt die Ampel auf Grün, und die Kolonne setzt sich wieder in Bewegung. Im Rückspiegel erkennt Carl gerade noch, wie die beiden zu dem Geländewagen zurückhasten und wieder einsteigen.
Es geht ein Stück die Via Venti Septembre hinunter, dann biegt Carl scharf links ab und erreicht kurz darauf die Piazza della Repubblica mit ihren halbkreisförmigen, weißen Monumentalbauten und dem großen Brunnen in der Mitte. Von hier sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Bahnhof Termini, Roms Hauptbahnhof und Carls Ziel.
Die Straßen rund um den Bahnhof sind ziemlich belebt. Pulks von Touristen hasten mit Rucksäcken oder Trolleys durch den Regen, der jetzt etwas nachlässt. Einen Moment geht es nur im Schritttempo voran, und Carl fürchtet, dass seine Verfolger noch mal versuchen, sich an ihn heranzuarbeiten. Er kann den schwarzen Caddy nicht mehr hinter sich sehen, doch er spürt instinktiv, dass sie immer noch da sind.
Dann, nach fast einer halben Stunde Fahrt, ist es so weit. Kurz nachdem er in die Via Marsala eingebogen ist, eine schmale Einbahnstraße, taucht das nördliche Ende der langen Sandsteinfassade des Bahnhofs auf, die mit ihren zwei übereinanderliegenden Reihen von Fensterbögen an einen antiken Monumentalbau erinnert. Über einem verglasten Seiteneingang steht in fetten, weißen Lettern ROMA TERMINI. Wegen einer Baustelle wird die ohnehin schon schmale Straße hier besonders eng.
Carl löst den Gurt, stopft die leergeschossene Beretta in die Tasche seiner Windjacke und kuppelt in den Leerlauf. Er sieht kurz in den Rückspiegel und tritt die Bremse durch. Eine Sekunde später knallt es, und Carl, der die Arme auf dem Lenkrad abstützt, wird kurz durchgeschüttelt. Der hinter ihm fahrende Fiat ist auf ihn draufgerauscht. Carl sieht im Rückspiegel das entsetzte Gesicht der jungen Signorina hinter dem Lenkrad.
Er zieht den Schlüssel ab, springt aus dem demolierten Alfa und sprintet zum Bahnhofseingang, wobei er nur knapp einer Kollision mit einem der jungen Afrikaner entgeht, die billige Regenschirme und Kunststoffponchos anbieten.
Als er das Portal erreicht, verlangsamt er das Tempo und wirft einen Blick zurück. Da – nur vierzig Meter entfernt steht in dem von ihm erzeugten Stau der Wagen seiner Verfolger, dessen Türen jetzt auffliegen und drei Männer ausspucken. Zwei Latinos und der hellhäutige Typ mit dem grauen Basecap, der Carl vorhin in der Lagerhalle angesprochen hat und offenbar Amerikaner ist. Sie setzen ihm nach.
Carl rennt ein Stück in die hell erleuchtete Halle hinein, wobei er fast zwei junge Frauen in weißer Ordenstracht zu Fall bringt. Er wendet sich nach rechts, um zwischen eine Gruppe von osteuropäisch aussehenden Touristen zu kommen, die sich vor einer McDonald’s-Filiale stauen. Während er sich einen Weg durch die Leute bahnt, streift er seine durchnässte Windjacke ab und stopft sie im Vorbeigehen mitsamt der nutzlos gewordenen Pistole in einen großen Mülleimer. Er trägt jetzt nur noch ein helles T-Shirt. Wenn das Auge seiner Verfolger – wie seine Erfahrung ihm sagt – besonders auf seine schwarze Jacke fokussiert ist, ist das schon mal von Vorteil.
Pulks von Reisenden umkurvend oder sich einfach hindurchdrängend, bewegt Carl sich schnell ins Innere der langgestreckten Halle, die in der Mitte von einer Ladenzeile mit Mode- und Schuhgeschäften geteilt wird. Links reihen sich die Gleise des Kopfbahnhofs.
Er überlegt kurz, ob er versuchen soll, in einem der Züge zu entkommen, die am Gleis stehen, aber ein Blick auf die Anzeigetafel zeigt ihm, dass die nächste Abfahrt erst in zwanzig Minuten angezeigt ist. Zu lange, um in einem stehenden Zug festzustecken.
Wenn sie die Gleise ablaufen und die Wagen checken…
Vorsichtig schaut er sich kurz um und erkennt ziemlich weit hinten in der bewegten Menge den Amerikaner mit dem grauen Basecap, der sich, den Kopf wie ein Roboter mechanisch hin und her drehend, langsam in seine Richtung bewegt. Die beiden anderen sind nicht zu sehen.
Wahrscheinlich haben sie sich aufgefächert, um die Gleise und den Hauptausgang im Auge zu haben.
Sein Blick fällt auf die Rolltreppen in der Mitte der Halle, die zur Metro hinunterführen.
Die U-Bahn. Okay.
Er läuft los und ist bald darauf auf dem Weg in die Tiefe, wobei er versucht, sich – so gut es geht – an den vor ihm stehenden Passagieren der langen Rolltreppe vorbeizudrängeln, was ihm ein paar giftige Blicke und genervte Kommentare einbringt.
Kurz bevor er unter der Überdachung der U-Bahn-Etage verschwindet, dreht er sich um und sieht nach oben.
Dort, an der Balustrade neben dem Zugang zu den Rolltreppen, steht der Typ mit dem grauen Basecap und starrt ihm direkt ins Gesicht.
Der Adrenalinstoß schießt Carl bis in die Fingerspitzen. Aber er hat nicht viel Zeit, den Schreck wirken zu lassen, denn er ist schon mit dem nächsten Problem konfrontiert. Vor ihm liegen die Sperren, die den Zugang zum Bahnsteig der U-Bahn blockieren und nur mit einem gültigen Ticket passiert werden können.
Weil er nicht mal mehr zehn Cent in der Tasche hat, hat er daran gedacht, in einem unbeobachteten Moment die hüfthohen Sperren einfach zu überklettern und dann schnell im Strom der Reisenden unterzutauchen.
Doch da stehen überall Polizisten, auch Carabinieri in Kampfanzügen und mit Maschinenpistolen. An viel frequentierten Orten wie diesen versucht Rom, sich gegen die Terrorgefahr zu wappnen.
Scheiße. Aber ich muss es versuchen. Zurück kann ich nicht. Das Gute daran ist bloß, dass die anderen hier im Bahnhof nicht einfach rumballern können. Sie werden nicht die Kamikaze-Nummer machen.
Er dreht sich um und sieht zu der Rolltreppe, mit der er ins Untergeschoss gefahren ist und auf der seine Verfolger jeden Moment auftauchen müssen. Dann scannt er fieberhaft die Leute, die sich langsam durch die automatischen Sperren bewegen. Dort eine zu lange Schlange. Da ein paar kräftige Typen. Dann sieht er zwei junge Mädchen, offenbar chinesische Touristinnen, die sich einer der Sperren nähern. Beide halten ihr Ticket in der Hand.
Mit ein paar schnellen Schritten ist Carl bei ihnen.
»Scusi!«, sagt er, drängt sich an den beiden Chinesinnen vorbei und pflückt der vorderen das Ticket aus der kleinen Hand. Dann drückt er den Fahrschein auf den elektronischen Scanner. Der Metallbügel fährt zurück und gibt den Weg frei.
»Ouuuuuuh!«, hört er hinter sich und ein paar schnell gesprochene Worte in einer unverständlichen Sprache. Dann etwas, das wie das englische »Asshole!« klingt.
Er dreht sich im Gehen kurz um und sieht, dass die Uniformierten noch nicht aufmerksam geworden sind. Weiter hinten jedoch taucht der Ami auf. Jetzt ist auch einer der Latinos bei ihm.
Carl schwimmt mit dem Strom der Reisenden durch die langen, gefliesten Katakomben, die zu den Bahnsteigen führen. Er ignoriert die Abzweigung zur Linea B und erreicht den Bahnsteig, auf dem die Züge der Linea A in Richtung Battistina abfahren. Es ist ein Sonntag und früher Abend, und der Bahnsteig ist nicht besonders voll. Auf der Anzeigetafel über den Köpfen der Wartenden leuchtet die Zeit bis zur Ankunft des nächsten Zuges:
1 Minuto
Eine Minute! Genug Zeit, um sich ein Ticket zu besorgen und hier am Bahnsteig aufzutauchen.
Carls Zeitgefühl dehnt sich, es ist eine der längsten Minuten seines Lebens.
Dann fährt der Zug endlich ein, und er betritt ihn zusammen mit anderen Passagieren. Die durchgehende, moderne Bahn ist höchstens zur Hälfte gefüllt.
Die Abfahrt verzögert sich, weil noch ein alter, ärmlich gekleideter Mann mit einem Rollator zusteigt.
Fahr los. Fahr jetzt los.
Die Türen schließen sich. Der Zug fährt an.
Carl atmet durch und sieht sich um.
Es fühlt sich so kalt an wie eine Injektion mit flüssigem Stickstoff.
Nur ein paar Meter entfernt, an einer der benachbarten Türen, steht der bullige Latino, der gerade mit dem Mützentypen hinter ihm her war, und starrt zu ihm herüber.
Gottverdammt.
Carl sucht mit den Augen hektisch den Zug ab, aber er kann weder den Typen mit dem Basecap noch einen der anderen aus der Meute entdecken.
Scheint allein zu sein. Die anderen werden es auf den anderen Bahnsteigen versucht haben.
Sein Verfolger, ein kräftiger, untersetzter Typ von etwa dreißig Jahren, fixiert ihn mit unbewegtem Gesicht, allerdings einem triumphalen Glitzern in den ölschwarzen Augen. Die rechte Hand steckt in der Tasche seiner Bomberjacke, wo er ohne Zweifel eine Waffe hat. Mit gespreizten Beinen balanciert er das leichte Schlingern des Zuges aus, während er mit seiner freien Hand ein Smartphone aus der Tasche zieht. Er blickt kurz auf den Haltestellenplan über der Tür und spricht leise in das Handy, ohne Carl dabei aus den Augen zu lassen.
Er erzählt seinen Kumpels, was Sache ist. Sicher auch, dass er sieht, dass ich unbewaffnet bin. Immerhin scheint er nicht vorzuhaben, mich hier drin abzuknallen. Wäre auch hirnrissig mit all den Leuten hier und der Polizei oben. Er käme nicht weit.
Schon nach zwei Minuten erreicht der Zug die nächste Station. Vor den großen Scheiben tauchen Schilder auf.
Repubblica
Der Zug hält.
Fahrgäste steigen ein und aus.
Der Bullige lauert, immer bereit, Carl nachzusetzen, falls er Anstalten macht abzuhauen.
Wenn ich ihn nicht loswerde, habe ich bald wieder die ganze Meute auf dem Hals.
Der Zug verlässt den Bahnhof und nimmt wieder Fahrt auf.
Sein Verfolger telefoniert wieder, ohne den Blick von Carl zu wenden. Jetzt liegt der Hauch eines spöttischen Lächelns auf seinem breiten, pockennarbigen Gesicht.
Carls Augen wandern durch den Zug und zu den Fahrgästen in seiner Nähe. Ein älteres Paar mit zwei kleinen Kindern. Offenbar Großeltern und Enkel. Zwei korpulente Frauen in grellen Klamotten, die sich angeregt unterhalten. Einkaufstaschen, billige Regenschirme. Ein blasser Rucksacktourist mit Sommersprossen und rötlichem Fusselbart.
Er sucht etwas, ohne zu wissen, was.
Etwas, das ihn auf eine Idee bringt.
Irgendetwas.
Und dann sieht er es.
»Barberini!«, sagt die samtige Frauenstimme der automatischen Ansage.
Die Bahn hält.
Die Türen öffnen sich.
In einer schnellen Bewegung greift sich Carl den Rollator des alten Mannes, der mit ihm in Termini zugestiegen ist und die Gehhilfe neben seinem Sitzplatz in Carls Nähe abgestellt hat. Er ist eingedöst und bemerkt gar nicht, wie Carl mit dem Ding aussteigt.
Der Bullige glotzt verblüfft, reagiert aber schnell. Mit zwei Sätzen ist er ebenfalls auf dem Bahnsteig.
Carl benutzt den Rollator in der dafür vorgesehenen Art. »Scusi« rufend schiebt er das Ding, so zügig es geht, über den Bahnsteig, umkurvt Pulks von Reisenden und bewegt sich in Richtung eines der Schilder, die zu den Ausgängen weisen.
Uscita
Sein Verfolger, der sich absolut keinen Reim darauf machen kann, was die Scheiße mit dem Ding soll, Carl aber auf keinen Fall aus den Augen lassen will, folgt ihm mit ein paar Metern Abstand.
Die letzten Reisenden besteigen die wartende Bahn. Der Zug setzt sich in Bewegung.
Der lange Bahnsteig leert sich.
Er verfügt über zwei Ausgänge, zwischen denen ein größerer Abstand liegt. Carl, der vom hinteren Ende des Zuges kommt, lässt den ersten links liegen und läuft weiter in Richtung des zweiten Ausgangs, der fast vierzig Meter entfernt ist. Bis dahin ist der Weg jetzt fast vollkommen frei.
Der Bullige bleibt hinter ihm.
Plötzlich beginnt Carl zu rennen. Wie von der Tarantel gestochen, rast er dem hinteren Ausgang zu. Die kleinen Räder des Gehwagens rattern über den gefliesten Boden.
Sein Verfolger geht das Tempo mit. Carl hört das Geräusch seiner Schritte nicht weit hinter sich.
Als beide knapp dreißig Meter zurückgelegt haben und der hintere Ausgang immer näher kommt, geht alles sehr schnell.
Carl wirft einen schnellen Blick über die Schulter und bremst abrupt.
Er dreht sich um die eigene Achse und reißt dabei den Rollator herum. Dann stößt er ihn, durch das eigene Tempo rückwärts taumelnd, mit beiden Armen seinem Verfolger entgegen, der immer noch seine volle Geschwindigkeit draufhat.
Das Teil rollt, gar nicht mal so schnell, auf den Mann zu, aber der Abstand ist zu gering, als dass er ausweichen könnte.
Er versucht es zwar noch, kracht dann aber mit dem Knie voran in das sperrige Ding. Er hebt ab, fliegt kopfüber über das Hindernis und schlägt, mit dem Gesicht voran, auf dem Steinboden auf.
Carl, der bei dem Manöver selbst das Gleichgewicht verloren hat und fast gestürzt ist, rappelt sich auf.
Der Lärm hat ein paar Reisende, die ein ganzes Stück entfernt stehen, aufgescheucht. In der Absicht zu helfen, bewegen sie sich auf den am Boden liegenden Mann zu, der offenbar über seine Gehhilfe gestolpert ist. Carl wird kaum beachtet.
Der Bullige, der mit verdrehten Gliedern noch halb über dem Rollator hängt, hebt stöhnend den blutverschmierten Kopf und lässt ihn gleich wieder sinken.
Der linke Unterarm ist auf unnatürliche Art abgeknickt.
Der Kerl ist erst mal satt.
Carl verliert keine Zeit. Er verlässt den Bahnsteig und läuft in schnellem, aber nicht auffälligem Tempo durch die Eingeweide des hell erleuchteten, chrom- und kunststoffglänzenden U-Bahnhofs. An einer Stelle passiert er zwei müde aussehende Soldaten mit roten Barretts und MPs, bevor er an der Piazza de Barberini wieder an die Oberfläche kommt.
Ihm ist kalt, weil das Gewitter die Luft jäh abgekühlt hat und sein T-Shirt feucht ist, vom Regen und von dem Schweiß der Verfolgungsjagd.
Obwohl er sicher ist, dass der Typ aus der U-Bahn erst mal ausgeschaltet ist und es auch nicht so aussah, als ob er schon bald wieder telefonieren könnte, entfernt sich Carl so schnell wie möglich. Er überquert die belebte Piazza mit dem großen beleuchteten Brunnen, um den sich Autoscheinwerfer wie auf einem Karussell drehen, und läuft aufs Geratewohl in enge, kopfsteingepflasterte Gassen hinein. Er biegt mal hier und mal da ab und blickt sich gelegentlich über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass er nicht mehr verfolgt wird.
Dann, nach einer halben Stunde, ist er sicher, dass er im Straßengewirr der Metropole verschwunden ist.
Er atmet durch.
Ich bin sie tatsächlich los. Aber sicher nicht für immer.
Ihn überkommt das brennende Verlangen nach einem Drink. Nachdem er noch einmal ein paar Minuten gegangen ist, sieht er am Rande einer kleinen Piazza neben einem Zeitungskiosk eine schmale, hell erleuchtete Bar, vor der zwei Tischchen mit billigen Plastikstühlen stehen. An einem sitzt ein weißhaariger, alter Herr mit hellem Strohhut und nippt an einer Flasche Nastro Azurro.
Carl betritt das Lokal, in dem jetzt, am frühen Abend, nur zwei junge Typen in Shorts und Flipflops am Tresen rumhängen, offenbar Bekannte des Barkeepers, eines langhaarigen, dünnen Jungen, der Carl mit unbewegter Miene mustert. Aus dem Bluetooth-Speaker, der im Regal hinter ihm steht, puckert voluminös Learn To Fly von den Foo Fighters, wie Carl, nur halbbewusst, registriert.
Er grüßt mit »Buona sera!« und bestellt auf Englisch einen doppelten Brandy. Bezahlen kann er ihn nicht, aber das ist ein Problem, mit dem er sich später beschäftigen kann.
Dann sitzt er am hintersten Tisch des leeren Ladens, kippt den Inhalt seines Glases in einem Zug runter und ordert gleich das nächste.
Plötzlich bricht ihm der Schweiß aus und tränkt sein feuchtes Shirt noch mehr. Es ist die Angst, die ihn überfällt. Jetzt erst, nachdem alles vorbei ist. Schwindelnde Benommenheit überwältigt ihn, sein Herz galoppiert wie ein durchgehendes Pferd, und es fühlt sich an, als würde sein Gehirn versuchen, aus seinem Kopf zu kriechen.
Er konzentriert sich auf seinen Atem und versucht, die Luft gleichmäßig ein- und ausströmen zu lassen. Aber es dauert endlose Minuten, bis die Symptome endlich abklingen. Die Bilder in seinem Kopf laufen weiter.
All das, was er in den letzten zwei Stunden erlebt hat.
Die Lagerhalle.
Der gynäkologische Stuhl mit den Fesseln.
Die chirurgischen Instrumente.
Die Videokamera, mit der sie alles aufgezeichnet hatten.
Er kann nicht fassen, dass er noch am Leben ist.
2
Acht Jahre zuvor. September 2010. Afghanistan, Provinz Kunduz.
Gott, dieses staubige, elende Land.
Carl hockt zwischen fünf anderen eingezwängt im Mannschaftsraum eines Dingo-Radpanzers und starrt melancholisch durch das gepanzerte Seitenfenster. Zum tiefen Brummen des Motors zieht eine leere, völlig ebene Landschaft vorbei, in der der Staub und der Dunst die Farben schlucken. Eine Wüstenfläche, von Sand und Schotter bedeckt. Dann tauchen plötzlich grüne, von schmalen Kanälen bewässerte Felder auf, auf denen Menschen mit primitiv geschnitzten Holzhacken arbeiten. Auf einem der Feldwege treibt ein Mann in einem langen, weißen Gewand eine magere Kuh. Ein ausgefranster, winddürrer Hund folgt ihm in einigem Abstand. Ab und an ein kleines, ummauertes Gehöft aus fahlbraunem Lehm, mit schmalen, oft scheibenlosen Fensterlöchern.
Eigentlich wie vor zweitausend Jahren. Wenn da nicht die ganzen Schrottkarren wären.
Der Dingo überholt ein paar alte Toyota-Pick-ups und einen klapprigen LKW, der hoch mit knallgrünen Plastikkanistern beladen ist. Im oberen Ausschnitt des kleinen Fensters sieht Carl noch ein Stück des gnadenlos blauen Himmels, in dessen Zentrum eine Sonne brennt, die so nah scheint, dass man meint, die Erde müsse gleich Feuer fangen. Praktisch neun Monate im Jahr glüht sie unerbittlich, ohne Pause, jeden Tag, jede Minute. Kein Tropfen Regen netzt dann die lechzende, ausgedörrte Vegetation.
Carl verlagert etwas seine Position, was der Richtschütze des Dingos, der links neben ihm hockt, mit einem unfreundlichen Grunzen quittiert. Aber Carl fühlt sich unwohl, er fährt ohnehin nicht gern im Panzer, da muss er immer gegen seine Raumangst ankämpfen. Und bei dem Geschaukel wird ihm auch leicht übel. Der Dingo mit seinem hohen Radstand steigt und fällt bei jeder Bodenwelle wie ein Boot in der Dünung. Normalerweise sind er und Ebby mit den anderen Scharfschützen in einem Fuchs-Transportpanzer unterwegs, der etwas ruhiger läuft, aber wegen anstehender Reparaturen gab es einen Engpass an Fahrzeugen. Sie haben sich aufgeteilt, und Carl und Ebby mussten sich zu einer anderen Gruppe von Fallschirmjägern gesellen.
Die Dingo-Crew befindet sich mitten in einem langen Konvoi aus vierundzwanzig meist gepanzerten Fahrzeugen – Dingos, Füchse, Marder und Wölfe – der gerade vom Bundeswehr-Feldlager beim Flughafen von Kunduz in Afghanistan aufgebrochen ist. Eine ganze Kompanie Fallschirmjäger, gut hundertzwanzig Mann. Über die Airport Road rollen sie nach Norden in Richtung der südlichen Vororte der Stadt Kunduz. Da wird man nach Westen abbiegen, um zum Polizeihauptquartier der Provinz Chahar Darreh zu gelangen, dem Ziel ihrer Fahrt. Dort unterhält die deutsche Armee seit einiger Zeit einen Außenposten. Mitten im Feindesland.
Zwei Wochen werden die Soldaten im Polizeihauptquartier verbringen, und während dieser Zeit werden sie fast täglich rausgehen ins »Indianerland«, wie sie das von den radikalislamischen Taliban durchsetzte Gebiet nennen. Sie werden Minenräumkommandos sichern, die sich in stundenlanger Arbeit und zentimeterweise auf den Verbindungsstraßen vorarbeiten, um Sprengfallen zu finden und zu beseitigen. Sie werden zwei befestigte, strategische Höhen bemannen, und sie werden Patrouillen machen in die umliegenden Dörfer, mit den Dorfältesten sprechen, »Präsenz zeigen« und versuchen, Informationen über Bewegungen von Insurgents – Aufständischen – zu bekommen.
Carl studiert die zumeist unheimlich jungen, in sich gekehrten Gesichter der anderen. Diese Jungs hier sind »Tapsies«, wie die Neuankömmlinge wegen ihrer anfänglichen Unbeholfenheit genannt werden. Von Afghanistan kennen sie bis jetzt nur das relativ sichere Feldlager, eine hochbefestigte, kleine Containerstadt mit fünftausend Soldaten. Dagegen sind er und Ebby alte Hasen, beide sind jetzt zum dritten Mal hier.
Wieder erklimmt der Radpanzer eine Bodenwelle und kippt dann nach unten. Carls Magen macht einen Satz ins Leere, und der Richtschütze, der durch eine Art Periskop auf dem Dach die Umgebung beobachtet und von innen das oben montierte Maschinengewehr bedienen kann, zieht reflexartig den Kopf vom Okular zurück, um ein blaues Auge zu vermeiden. Da nützt auch die Polsterung nichts.
Seitdem sie das Feldlager verlassen haben, ist es ziemlich ruhig geworden im Panzer. Um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, packt Ebby ein paar seiner Afghanen-Witze aus.
»Was ist ein Esel mit ner roten Taschenlampe auffem Kopp?«, fragt er in seinem gedehnten norddeutschen Tonfall.
Interessiertes Schweigen.
»Der afghanische Knight Rider!«
Kollektives Gelächter. Den kannten sie noch nicht. Ebby lacht mit, sein typisches helles, hüstelndes Kichern. Und feuert gleich den nächsten ab:
»Und woran erkennt man eine afghanische Domina?«
Schweigen.
»An der Lederburka!«
Brüllendes Gelächter.
Carl grinst.
Sind alle froh, wenn einer ein paar Jokes macht.
Die Taliban wissen genau, wann sie kommen, und die deutsche Armee weiß, dass sie ihr nur allzu gern direkt vor der eigenen Haustür ein Ei unter den Hintern legen würden. Trotz intensiver Beobachtung durch Flugzeuge und die Luna-Drohnen, die fast unablässig über dem Gebiet um Kunduz kreisen, gelingt es ihnen immer wieder, selbsthergestellte Sprengfallen auf den Haupt- und Verbindungstraßen zu platzieren. Für ein paar Dollar geben sich auch einfache Bauern aus der Umgebung dafür her, die IEDs – Improvised Explosive Devices – wie die Dinger im NATO-Sprech heißen – zu legen. Manche Streckenabschnitte im südlichen Kunduztal sind geradezu gespickt damit – im Schnitt gibt dort es alle sechzig Meter ein verstecktes IED.
Früher wurden sie meist per Handy gezündet, aber seitdem die Bundeswehr neue Fahrzeuge einsetzt, sogenannte Störpanzer oder Jammer, die das Handynetz unterbrechen, greifen die Taliban auch wieder auf den guten alten Zünddraht zurück, der sich leicht hundertfünfzig Meter bis zum Triggerman, der in einem Feld verborgen ist, erstrecken kann. Weit genug, um unerkannt zu verschwinden. Oder sie schießen mit Panzerfäusten aus den Feldern entlang der Straße. Oder sie schicken einen Suicider, einen Selbstmordattentäter, jemand, der absichtlich einen »Unfall« mit einem der Konvoi-Fahrzeuge verursacht, mit den Soldaten aussteigt und dann den Sprengstoffgürtel zündet, den er unter seinem weiten, afghanischen Gewand versteckt hat. Besonders wirksam sind natürlich mit Sprengstoff vollgestopfte Autos, die entweder von einem Suicider direkt in den Konvoi gesteuert oder aber am Straßenrand geparkt und ferngezündet werden.
»Elbe! Offen!«, knarzt es aus dem Funkgerät vorne im Fahrerraum. Es ist eine Meldung aus dem Fahrzeug des Kompaniechefs an die Gefechtszentrale im Feldlager. Sie besagt, dass sie den ersten Kontrollpunkt ohne Zwischenfall passiert haben. Drei weitere Checkpoints folgen noch.
Der Konvoi fährt befehlsgemäß in der Mitte der Straße, alle anderen Fahrzeuge müssen ausweichen oder anhalten, es herrscht strikte Anweisung, kein anderes Fahrzeug in die Kolonne zu lassen. Der Chef hat bei der Vorbesprechung am Morgen von einer Suicider-Warnung für diesen Konvoi gesprochen. Ein Informant aus der Bevölkerung hat von einem Selbstmordattentäter in einem weißen Toyota gehört. Das fanden alle, na ja, beinahe lustig – weil gefühlt neunzig Prozent aller Autos in Afghanistan weiße Toyotas sind.
Weißer Toyota. Das ist etwa so wie: Der Attentäter trägt einen Bart. Den haben die hier auch alle.
Man kennt inzwischen gewisse Zeichen: Wenn plötzlich niemand mehr auf den Feldern zu sehen ist, kann das Gefahr bedeuten. Die Bevölkerung wird von den Taliban manchmal – keineswegs immer – vorgewarnt, wenn ein Angriff auf die Truppe bevorsteht.
Ein verlassener PKW am Straßenrand ist natürlich ein Alarmzeichen. In diesem Fall schwenken die Fahrer gern zur anderen Straßenseite aus, um dem möglichen Bombenfahrzeug auszuweichen. Aber auch das haben die Taliban – die möglichst jeden Hinterhalt filmen – längst geschnallt und platzieren die Sprengladung deshalb manchmal gerade nicht in dem verdächtigen Auto, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Wie Carl von einem der Minenräumer weiß, sind die Talibs, die »Koranschüler«, auch ziemlich kreativ bei der Herstellung der Höllenteile. Die IEDs werden meist aus Dieselbenzin, Autolack und Dünger hergestellt, der auf Harnstoff basiert. Und da Dünger manchmal knapp ist, kochen die Taliban stattdessen den Urin von Eseln so lange ein, bis die Harnstoffkonzentration stimmt.
Sie durchqueren jetzt die südlichen Vororte von Kunduz. Wegen des dichten Verkehrs verlangsamt sich die Fahrt auf Schritttempo, und Carl beobachtet durch die Panzerglasscheibe die Menschen am Straßenrand. In blaue Burkas gehüllte, vollverschleierte Frauen, deren Blicke man hinter dem Augengitter nicht mal erahnen kann. Verschlossene Männergesichter, von Bärten fast schwarzer oder grauweißer Schattierung umrahmt. Manchmal feindselig, öfter aber unlesbar, was den Afghanen nicht schwerfällt.
Nur ein paar Kinder hüpfen manchmal lachend neben dem Panzer her und winken. Der junge Soldat, der Carl gegenübersitzt, hebt einen Arm und winkt zurück. In diesem Moment kommt der Konvoi zum Stehen, und Carl bemerkt zwei vielleicht neunjährige Jungs, die am Straßenrand stehen und dem winkenden Soldaten direkt ins Gesicht blicken. Mit übertrieben aufgerissenen Augen und wie vor Schreck aufgesperrten Mündern machen sie Zeichen: Einer hält die rechte Hand hoch und simuliert mit dem angewinkelten Daumen ein paarmal das Auslösen einer Sprengladung. Der andere macht mit der flachen Hand die Geste des Halsabschneidens. Der Soldat, der eben noch gewinkt hat, lässt die Hand sinken und glotzt entsetzt.
An so was wirst du dich gewöhnen müssen. Alles etwas anders hier. Auch die Kinder.
Carl muss an eine Sache denken, die er im letzten Jahr erlebt hat. Er war auf Fußpatrouille in einem entlegenen Dorf und von Kindern umringt, die sie anbettelten. Weil sie nur noch Gummibärchen hatten, die laut höherer Anweisung ein No Go waren, weil sie für Muslime verbotenes Schweineblut enthielten, hatten sie ein paar Buntstifte mitgenommen. Die kleinen Afghanen betrachteten und befingerten die Stifte und gaben sie dann enttäuscht zurück, weil sie nicht wussten, was das war und was sie damit anfangen sollten. Carl denkt an seine Tochter Lilly, die jetzt acht ist und die in einer so behüteten, im Überfluss schwelgenden Welt aufwächst.
Lilly.
Er macht seine linke Hand frei, was der Richtschütze neben ihm wieder mit einem unwilligen Grunzen kommentiert, und tastet an seiner Brusttasche nach einem kleinen, harten Gegenstand. Es ist ein getrockneter Seestern, den Lil, wie er sie nennt, bei einem Wochenendtrip an die Nordsee gefunden hat und ihm vor dreieinhalb Jahren vor seinem ersten Einsatz in Afghanistan als Glücksbringer mit auf den Weg gegeben hat.
»Ich habe auch so einen zu Hause, und die passen beide aufeinander auf«, hat sie gesagt.
Der Seestern ist wie immer an Ort und Stelle, auch wenn die Ecken längst abgebröselt sind. Und Carl kommt wieder ein Bild vor Augen, das ihn seit seinem zweiten Afghanistantrip verfolgt. Es gelingt ihm jedoch, es beiseitezuwischen.
Bald darauf biegt der Konvoi scharf nach links ab und verlässt die Stadt Kunduz. Hier endet die asphaltierte Straße und geht in eine staubige Sandpiste über. Der Staub, der immer und überall in Afghanistan ist, das in Äonen erodierte, vom Wind fein gemahlene Gestein der Gebirge, der Sand der stets nahen Wüste, die abgetragene obere Schicht der hartgebrannten Erde. Im Nu ist der Dingo in eine dichte, gelbliche Wolke gehüllt. Carl kann nur noch schemenhaft die Außenwelt erkennen. Und weil sie sich hier zwischen offenen, hoch bewachsenen Weizen- und Baumwollfeldern bewegen, die gute Verstecke bieten, ist dies der gefährlichste Abschnitt der Fahrt. Es heißt, fünfzig US-Dollar bekomme ein Bauer von den Taliban, wenn er eine Panzerfaust auf einen Bundeswehr-Konvoi abfeuert. Die Kopfprämie für getötete Deutsche soll sich nach dem militärischen Rang richten: hundert Dollar für einen einfachen Soldaten, dreihundert Dollar für einen Unteroffizier und fünfhundert Dollar für einen Offizier. Viel Geld in einem Land, das das sechstärmste der Welt ist und in dem der durchschnittliche Jahresverdienst bei dreihundertvierzig Dollar liegt.
Der Dingo schaukelt weiter über die wellige Piste. Carls Magen schaukelt mit, und um sich abzulenken, fixiert er einen der in textilfrischem Grün leuchtenden, runden Aufnäher, den die Neuen auf den Ärmeln tragen. ISAF steht da in weißen Buchstaben, die Abkürzung für International Security Assistance Force, und darunter in geschwungener, paschtunischer Schrift die Worte »Hilfe und Kooperation«.
Klingt gut. Aber dazu müsste man erst mal diesen verfickten Krieg gewinnen.
Tatsächlich befindet sich die ISAF in einem seit neun Jahren andauernden Zermürbungskampf – gegen einen Gegner, der schon besiegt schien.
Langsam wird es unangenehm heiß im Panzer. Wegen der ständigen Gefahr eines Angriffs hocken sie da alle in voller Kampfmontur, mit fünfzehn Kilo schwerer Splitterschutzweste, Helm, Gepäck, Handfeuerwaffen und dem G-36-Gewehr zwischen den Knien – bei Carl und Ebby sind es gleich drei Gewehre, ein G 3, ein G 22 und ein G 82. In den Ohren tragen sie einen Gehörschutz gegen die Druckwelle bei Explosionen und vor den Augen eine splitterfeste, getönte Schutzbrille aus einem Spezialkunststoff, der sogar Pumpgun-Munition standhalten soll. Was keiner von ihnen wirklich glaubt. Auf dem Boden stauen sich die Rucksäcke, und über ihren Köpfen baumeln zwei Panzerfäuste in schwarzen Netzen.
Es ist Anfang September, und die Temperatur überschreitet am Mittag immer noch locker die Vierzig-Grad-Marke. Sie sind erst ein paar Minuten unterwegs, aber der Geruch nach Schweiß und zusammengepferchten Männerkörpern hängt schon dick und schwer in der Luft. Die Klimaanlage des Dingos ist hoffnungslos überfordert.
O bitte. Lasst mich aus dieser Scheißbüchse raus.
Im Panzer herrscht – abgesehen vom gedämpften, tiefen Brummen des Motors – eine Weile Stille. Dann bewegt Ebby seinen hageren Einmeterneunzigkörper und fummelt etwas aus seiner umgeschnallten Beintasche: eine halbe XL-Tafel supersüße, amerikanische Hershey’s-Schokolade, schön restverpackt in glänzender, dunkelbrauner und silberner Folie.
»Bevor die jetzt total weich wird …«, sagt Ebby und bricht sich eine freigelegte Ecke der schon elastisch werdenden, braunen Masse ab. »Wer will?«
Alle lehnen dankend ab, auch Carl.
Wenn ich da jetzt was von esse, kotze ich die ganze Kiste hier voll.
Nur ein kleiner, drahtiger Kerl mit blitzenden, blauen Augen greift zu.
»Herrr-scheijss!«, sagt er begeistert. Dann schiebt er sich genießerisch ein großes Stück zwischen die Zähne und produziert trotz vollen Munds ein versonnenes Lächeln.
»Die hat mein Onkel immer mitgebracht«, sagt er kauend, und man sieht förmlich, wie ihm der Geschmack seiner Kindheit auf die Zunge steigt.
»Woher?«, fragt Ebby.
»Aus Ramm-steiijn!«, sagt der kleine Typ fröhlich, und die Art, wie er das herausbringt – mit einem harten »R« und dem gedehnten, e-lastigen »stein« –, verrät endgültig seine osteuropäische Herkunft. Carl tippt auf einen Russlanddeutschen. Davon gibt es bei der Truppe viele. Gute Jungs meist, gute Kameraden, findet Carl. Nicht wenige von denen haben Väter, die in den achtziger Jahren mit der Roten Armee in Afghanistan gekämpft haben. Unter ganz anderen Vorzeichen, aber eigentlich gegen denselben Gegner.
Nein, der Junge, den Carl so auf zweiundzwanzig schätzt, kommt aus Polen, denn jetzt sagt er: »Mein Onkel hat da bei den Amis gearbeitet, bei der Err Forss … als Fahrer. Und er hat auf der Basis immer diese Herr-Scheijss gekauft und uns bei seinen Besuchen in Polen mitgebracht.«
Ebby nickt gutmütig und nimmt den Rest der Tafel wieder in Empfang, den er dann in zwei großen Happen vernichtet. Mit vollen Backen kauend, fummelt er eine kleine Wasserflasche aus seinem Rucksack und spült damit den Rest der Schokolade runter.
»Woher hast du die Herr-Scheiijss?«, fragt ihn der kleine Deutschpole.
»Eingetauscht bei den Amis.«
Im Feldlager in Kunduz sind seit ein paar Monaten außer Deutschen, Belgiern und ein paar Armeniern auch die Besatzungen von vier amerikanischen Black-Hawk-Kampfhubschraubern stationiert.
»Gegen was?«
»Drei Giant Bars gegen eine Kuckucksuhr.«
Die Soldaten glotzen Ebby an. Der legt eine kleine Kunstpause ein und schiebt dann nach: »Gibt so kleine Kunststoffdinger« – er zeigt mit Daumen und Zeigefinger etwa zehn Zentimeter an –, »aber funktionieren einwandfrei, mit Kuckuck, der rauskommt und Sound und allem. Die kriege ich bei so nem Versand für kleines Geld, fünf fünfundachtzig das Stück. Und weil die Amis doch so scharf auf deutsche Sachen sind – wie die Bundeswehr-T-Shirts –, habe ich mir gedacht, dass die auch auf Kuckucksuhren stehen. Und hab mal fünfzehn Stück mitgebracht. Und? Bingo!«
Der Gruppenführer der neuen Fallschirmjäger, der vorn auf dem Beifahrersitz hockt und bis jetzt keinen Ton gesagt hat, dreht sich nach hinten.
»Ohne Scheiß?«, fragt er und sieht Ebby an wie eine Meerjungfrau in der afghanischen Wüste.
Ebby hüstelt sein hohes Lachen. »Scheißen Bären in den Wald? Weißt du, was eine Hershey’s Giant Bar kostet? Drei Dollar siebenundsiebzig. Drei davon für eine Kuckucksuhr! Jetzt rechne mal! Ich hab auch ein paar mit, im PHQ sind ja jetzt immer ein paar Amis. Ich sag euch, die lieben diese Teile. Und dafür gibt’s immer was Interessantes. Die haben immer geile Sachen.«
Man staunt allgemein, aber weniger über Ebbys Schläue als über seine Verschrobenheit. Wie man schon gehört hat, laufen die Tauschgeschäfte mit den Amis normalerweise in anderer Währung ab. Die GIs sind immer scharf auf Alkohol; für eine Flasche Jägermeister bekommt man von ihnen so gut wie alles – zum Beispiel eins der coolen, mattschwarz beschichteten US-Kampfmesser, die so scharf sind, dass man sich tatsächlich damit rasieren kann. Carl besitzt auch eins.
»Und wie viele von den Kuckucksdingern bist du bis jetzt losgeworden?«, will der Gruppenführer wissen.
»Eine«, sagt Ebby.
Alle grinsen, der kleine Deutschpole bis zu beiden Ohren.
»Vielleicht Glicks-Schuss!«, sagt er vergnügt, und seine blauen Augen strahlen.
Carl grinst in sich hinein, während er und zwei andere unter vielen Verrenkungen ihre Wasserflaschen hervorholen.
Der gute, alte Ebby.
Sieben Jahre kennen sie sich jetzt schon, fast seit dem Beginn ihrer Ausbildung in der Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf, rund vierzig Kilometer südwestlich von Hamburg. Ebby ist Carl gleich aufgefallen. Er ist einfach eine besondere Erscheinung mit seinen eins zweiundneunzig und einem Körper, der knochig wirkt, mit zu langen Gliedmaßen. Er erscheint irgendwie unbeholfen, ist aber alles andere als das. Sein rotes Haar, die hellen Wimpern und die Sommersprossen weisen ihn als »keltischen« Typen aus, er ist extrem hellhäutig und dementsprechend sonnenempfindlich. Niemals exponiert er seinen Oberkörper in der afghanischen Sonne – so wie Carl und die meisten anderen, die nach ein paar Wochen hier unten tiefgebräunt sind. Im Einsatz sind Ebbys Gesicht und seine Hände stets dick mit Sonnenschutz beschichtet beziehungsweise mit Handschuhen geschützt.
Solange Carl Ebby kennt, ist er ein spezieller Vogel. Total verfressen, ohne je ein Gramm zuzulegen, nie um einen Spruch verlegen, ein guter Kamerad und im Allgemeinen ein gutmütiger Kerl. Allerdings durfte man es auch nicht übertreiben.
Zu Beginn ihrer Ausbildung kam ein Witzbold aus ihrem Zug auf die Idee, ihn wegen seiner roten Haare und seiner Sommersprossen »Pippi Langstrumpf« zu nennen, und war trotz wiederholter Aufforderung Ebbys, das zu unterlassen, nicht davon abzubringen. Es hat dann ein paar Drähte gebraucht, um seinen Kiefer wieder in Fasson zu bringen. Ebby bekam dafür einen strengen Verweis und zwei Tage Bau, der andere Typ, der immerhin auf eine Zivilklage verzichtete, wurde in einen anderen Zug gesteckt.
Passend zu Ebbys besonderer Erscheinung sind auch die seltsame Exzentrik, die er pflegt, seine Pfennigfuchserei, die kruden, kleinen Geschäftsideen, sein besonderes, schon unheimliches Verständnis von Waffen aller Art ebenso wie seine Neigung zu schweren Motorrädern der Marke Harley-Davidson.
Carl ist ein ganzes Stück kleiner als Ebby, drahtige ein Meter sechsundsiebzig und auch sonst ein eher gegensätzlicher Typ. Mit seinen dunklen Haaren und den braunen Augen wirkt er fast ein wenig südländisch. Man könnte ihn nicht direkt als hübsch bezeichnen – die ein bisschen zu groß geratene Nase steht dem im Wege, aber gerade deshalb macht er einen sympathischen Eindruck. »Ganz attraktiv, aber wirklich nicht schön«, wie seine Frau Danni es in ihrer unnachahmlich direkten Art ausdrückt.
Carl ist in einer Kleinstadt zwischen Duisburg und Düsseldorf aufgewachsen, hat aber mehr von der schnörkellosen, trockenen Art des Reviers als von rheinischem Frohsinn und launiger Unverbindlichkeit. Er ist überhaupt ein etwas zurückhaltender Typ, gemocht und respektiert von seinen Kameraden, doch keinesfalls so eine Stimmungskanone wie Ebby, eher nachdenklich und ein wenig introvertiert. Allerdings kennt seine zurückhaltende Art auch Grenzen – dann, wenn ihm jemand wirklich dumm kommt oder wenn es um sein Metier als militärischer Spezialist geht. Dann kommt es auch schon mal zu einem kleinen, verbalen Showdown mit seinem Vorgesetzten, dem Zugführer der Scharfschützen, einem etwas humorlosen und steifen Schwaben, den sie wegen seiner vorstehenden Zähne intern »Hacki« nennen.
Carl rückt den Helm auf seinem verschwitzten Kopf zurecht und betrachtet die Kampfhelme der Neuen. Zwei haben mit Filzstift das uralte Fallschirmjäger-Motto EGAL WO – EGAL WANN! draufgeschrieben, ein anderer drückt sich globalisierter aus: COMING TO KICK ASS. Alle haben hier Full Metal Jacket, Black Hawk Down und Apocalypse Now gesehen, all die Kriegerballaden Hollywoods. Und daraus die amerikanische Sitte übernommen, sich kriegerische Slogans auf die Kampfhelme zu malen. Das wird bei der Führung zwar nicht gern gesehen, aber bei den Truppen, die in »Raumverantwortung« gehen, toleriert – solange die Sprüche nicht offen islamfeindlich sind. Die Helmbotschaften sind so martialisch gemeint, wie sie klingen, aber auch ein wenig wie das berühmte Pfeifen im Walde.
Die haben natürlich darüber geredet, wie geil es wäre, den Fusselbärten mal selbst in den Arsch zu treten. Und jetzt sind sie wie vom Donner gerührt, weil es wirklich passieren kann.
Seit zwei Jahren ist hier in der Gegend kaum eine Woche vergangen, in der es keine Attacke auf deutsche Soldaten gegeben hat. Die Feindkontakte, im englischen NATO-Jargon TICs -Troops In Contact genannt, häufen sich – von Scharmützeln bis zu stundenlangen Gefechten, bei denen nicht nur viele Aufständische, sondern auch einige Bundeswehr-Soldaten getötet und etliche andere verwundet wurden.
Sehr frisch ist die Erinnerung an »die Scheiße in Isa Khel«. Vor ein paar Monaten – am Karfreitag 2010 – sind in dem nahe gelegenen Dorf Isa Khel fünfundzwanzig deutsche Fallschirmjäger – ein Zug aus ihrer Schwesterkompanie aus Seedorf – in einen Hinterhalt von über hundert Taliban geraten. Am Ende des stundenlangen Gefechts waren drei deutsche Soldaten tot und acht andere zum Teil schwer verwundet – fast die Hälfte des gesamten Zugs. Die Taliban haben ihren Triumph voll ausgekostet. In einem YouTube-Video posieren sie mit einem zerbombten Dingo, einer großen Blutlache und einem deutschen Kampfhelm.
Ja, Isa Khel wühlt tief in den Soldaten – in doppelter Hinsicht: Da sind die Angriffslust und der Wunsch nach Vergeltung für die toten und verwundeten, zum Teil verkrüppelten Kameraden. Und gleichzeitig das stets schwelende Bewusstsein, dass für jeden von ihnen der Weg nach da draußen auch sein letzter sein kann.
Ein Mittel gegen diese Furcht ist ihr Selbstvertrauen als Soldaten. Sie sind schließlich Fallschirmjäger, Elitetruppen, ausgebildet für den Kampfeinsatz an vorderster Front. Eigentlich ist ihr Name, der von ihrer besonderen Befähigung herrührt, mit sechzig Kilogramm Ausrüstung aus nur vierhundert Meter Höhe hinter den feindlichen Linien per Fallschirm abzuspringen, ein Anachronismus, denn diese Einsatztaktik wird in den modernen Kriegen so gut wie nicht mehr angewandt. Die Zeit der klaren Frontverläufe ist vorbei und hier in Afghanistan sowieso. Umso mehr gefragt ist hier aber ihre vielseitige Ausbildung, die sie befähigen soll, in kleineren Gruppen in einer von feindlichen Kräften durchsetzten Umgebung zu operieren, den Gegner »aufzuklären« – zu finden – und zu bekämpfen, auch im Häuserkampf. Sie sind darin geschult, gegen »irreguläre« feindliche Kräfte vorzugehen, Experten im Guerillakrieg. All diese Fähigkeiten sind natürlich nutzlos, wenn man Opfer eines IEDs oder eines Suiciders wird. Dem Tod, der aus dem Nichts kommt, ist nicht zu begegnen. Carl könnte den Jungs dazu eine Story erzählen, aber das lässt er natürlich. Sie wissen das ohnehin.
Die meisten der Neuen stammen aus eher kleinen Verhältnissen, oft aus den östlichen Bundesländern. Viele haben handwerkliche Berufe gelernt, sind Maurer, Elektriker, Installateure. Zeitsoldat bei der Bundeswehr zu werden und in den Auslandseinsatz zu gehen ist für sie ein Abenteuer, ein Ausbruch aus der Enge der provinziellen Verhältnisse, aus denen sie kommen. Sie sind sehr junge Männer, Anfang zwanzig, voller Testosteron, von denen der eine oder andere als Teenager auch schon mal Ärger mit dem Gesetz hatte. Aber das waren Kleinigkeiten, nichts Ernstes, vielleicht mal eine Spritztour in einem »geliehenen« PKW oder auch eine Anzeige nach einer Prügelei auf dem Schützenfest.
Dann wurden sie Soldaten, Fallschirmjäger sogar und haben nun das Gefühl, etwas Wichtiges und Ernsthaftes zu tun. Und etwas Gefährliches – was eine seltsame, elektrisierende Wirkung auf sie hat. Und die meisten von ihnen hätten nichts dagegen, auch im Kampf zu zeigen, was sie gelernt haben – unter dem Gütesiegel eines Einsatzes für das unzweifelhaft Gute: Menschenrechte, Demokratie, Freiheit. Und, klar, die hundertzehn Euro Auslandszulage, die jeder pro Tag zu seinem normalen Sold erhält, sind für die jungen Männer nicht gerade Peanuts.
In jedem Fall: Dass sie hier die Guten sind, daran zweifelt keiner von ihnen. Ihre Feinde, die Taliban, sind schließlich grausame Fanatiker, Steinzeitleute im Grunde, die Hände abhacken, Frauen steinigen und Mädchen nicht zur Schule gehen lassen. Seit sie zurück sind hier im Norden, haben im Distrikt Chahar Darreh einige Mädchenschulen bereits »freiwillig« geschlossen, aus Angst vor dem Zorn der Islamisten. Andere sind mit Raketen zerstört worden, und Eltern wurden exekutiert, die es gewagt hatten, ihre Töchter dort unterrichten zu lassen. Und dafür ist die Bundeswehr hier, so sagen sie, wenn sie zu Hause gefragt werden, was sie da eigentlich machen. Straßenverbindungen sichern, Schulen sichern, die Bevölkerung vor dem Terror der Taliban schützen.
Carl rückt das lange G-82-Gewehr, das er zwischen den Knien hält, ein wenig zurecht und tauscht mit Ebby ein paar private Bemerkungen aus. Innerhalb der First-Class-Truppe der Fallschirmjäger gehören die beiden noch einmal einer ganz besonderen Spezies an. Sie sind Scharfschützen, Spezialisten im Tarnen, Beobachten und Töten auf größere Distanz.
Carl und Ebby sind Partner, denn in den modernen Armeen operieren militärische Scharfschützen – abgesehen von den US Marines – fast immer als Zweierteam – sowohl in enger Anbindung an eigene Truppen, manchmal aber auch auf sich gestellt im feindlichen Umfeld. Aus getarnten, rückwärtigen Stellungen heraus sollen sie Operationen eigener Truppen sichern, indem sie das Einsatzgebiet beobachten und im Falle eines Gefechts feindliche Kämpfer mit Distanzschüssen von bis zu zwei Kilometern ausschalten oder – je nach verwendeter Waffe und Munition – auch technisches Gerät wie Autos oder Maschinenwaffen. Die eigenen Infanteristen, die das Ziel des feindlichen Feuers sind, wissen das zu schätzen. Es heißt, dass ein guter Scharfschütze die Kampfkraft eines ganzen Zuges verdoppelt. Denn erfolgreiche Sniper verbreiten Unsicherheit in den Reihen des Gegners. Zumindest, solange sie nicht entdeckt werden. Denn dann wird aus dem Jäger schnell der Gejagte.
Innerhalb eines Zweierteams, bei der Bundeswehr Scharfschützentrupp genannt, fungiert ein Soldat als Beobachter, als Spotter, der mit Fernglas und Spektiv entfernte Ziele ausmacht und dem Sniper, dem Schützen, angibt. Dann liefert er ihm anhand von Berechnungen zur Flugbahn des Projektils Informationen zur Einstellung seines Zielfernrohrs und erfasst nach erfolgtem Schuss, ob die Kugel im Ziel saß. Dabei sind beide Soldaten Allrounder – sowohl als Beobachter als auch als Schützen ausgebildet und trainiert –, denn die Rollen müssen auch jederzeit getauscht werden können. Seit die Briten im Ersten Weltkrieg diese flexible Zweiertaktik eingeführt haben, ist sie in den meisten Armeen Standard.
Carl und Ebby sind exzellente Scharfschützen, und Carl, der in ihrem Zweierteam der Truppführer, der befehlshabende Soldat ist, ist sogar der beste Schütze in ihrem Zug. Eine Eigenschaft, die ihm unter seinen Kollegen nicht nur Sympathien einbringt, denn wie überall herrscht auch unter diesen Spezialisten Rivalität.
Mit Ebby jedenfalls ergänzt er sich perfekt. Sie sind nun schon seit fünfeinhalb Jahren ein Team und das dritte Mal zusammen in Afghanistan. In all dieser Zeit, in der sie so oft zusammen auf Tuchfühlung in ihrer Beobachtungsstellung lagen oder mit auf Patrouille gingen, haben sie sich besser kennengelernt als manches Ehepaar. Sie respektieren sich beide als Soldaten und mögen sich als Typen. Carl liebt Ebbys kruden Humor, seine Unverwüstlichkeit und Unerschrockenheit, und Ebby schätzt Carls analytischen Verstand, seine trockene Art und seine Courage.
»Donau! Offen!«, sagt das Funkgerät im Fahrerraum. Sie haben den zweiten Kontrollpunkt ohne Zwischenfall passiert. Der Motor des Dingos röhrt hohl, weil der Fahrer sich verschaltet hat.
Nervös, der Junge. Das legt sich irgendwann. In ein paar Wochen ist der genauso abgestumpft wie wir.
Carl nimmt einen Schluck aus seiner Wasserflasche und beobachtet den jungen, bärenhaften Typen, der ihm links gegenübersitzt. Über dem Kragen seiner Kampfjacke ist der obere Teil eines großen Halstattoos zu erkennen – ein Eisernes Kreuz, das traditionelle Symbol der deutschen Armee. Er hat die dünne Stahlkugelkette mit der ovalen Erkennungsmarke aus dem Kragen gezogen und spielt scheinbar geistesabwesend damit herum. Oder denkt er dabei an den Sinn dieses kleinen Messingplättchens und damit an die eigene Sterblichkeit? Denn darauf sind in feiner, industrieller Stanzung ein paar Informationen vermerkt, die nur für den Fall von Bedeutung sind, dass der Träger selbst sie nicht mehr liefern kann: DEU für die Staatsangehörigkeit, auf Wunsch die Religionszugehörigkeit, die Blutgruppe, der Anfangsbuchstabe des Nachnamens und die persönliche Kennnummer. Und natürlich: die des zuständigen Kreiswehrersatzamts.
Der Konvoi rollt auf die stählerne Brücke über den Kunduz-Fluss, ein schlammig-braunes Gewässer, das sich in engen Mäandern träge durch das grüne Tal wälzt. Die Konstruktion wirkt marode, und die Brücke vibriert stark, als die schweren Fahrzeuge sie überqueren. Carls Magen macht sich zunehmend selbständig.
Bloß nichts anmerken lassen. An irgendwas anderes denken. Aber was? Tee. Hagebuttentee? Scheiße… nein! Anderer Tee…
Der Konvoi rollt von der Brücke, und das jähe Aufwallen der Übelkeit lässt etwas nach.
Sie passieren auch die Kontrollpunkte »Rhein« und »Weser« ohne Zwischenfall und erreichen ihr Ziel, das Polizeihauptquartier des Distrikts Chahar Darreh. Ein großer Komplex, umgeben von einer hohen, aus gelbgrauen, unverputzten Betonquadern bestehenden Mauer, die von Sandsäcken und Wolken aus NATO-Draht gekrönt ist. Carl kennt das »Pi-Äitsch-Kju«, wie es von den Soldaten in der NATO-Sprache Englisch abgekürzt wird, schon von früheren Einsätzen.
Das Provinz-Hauptquartier der ANP – der Afghan National Police – ist eine bizarre Mischung aus gerade entstehenden und bereits wieder verfallenden Neubauten. Im Grunde eine ewige Baustelle – wie ganz Afghanistan. Wie ein vorgeschobenes Fort liegt der Komplex in einer weiten Ebene, inmitten von Weizen- und Baumwollfeldern, aus denen nur vereinzelt ein Gehöft oder die Ruine eines solchen hervorsticht. Ein Außenposten mitten in einem Gebiet, das zum großen Teil von den Taliban kontrolliert wird. Seit einiger Zeit ist er ständig von einer Infanteriekompanie der Bundeswehr besetzt, die von dort aus Operationen in der Umgebung durchführt. Von hier aus ist auch der Zug der Fallschirmjäger gestartet, der nur wenige Kilometer entfernt in den tödlichen Hinterhalt geriet und so bitter geblutet hat. Isa Khel ist hier ganz nah.
3
Vierundzwanzig Rad- und Kettenpanzer, Sanitätsfahrzeuge und ein Jammer-Störpanzer rumpeln durch das stählerne, blaue Rolltor in den großen Innenhof, der mit hellem Kies bedeckt ist. Als die hundertzwanzig Mann alle mehr oder weniger gleichzeitig absitzen, bricht das »verdichtete Chaos« aus, wie Carl das nennt. Während die Neuankömmlinge losrennen, um in einer der großen Baracken, die rings um den Innenhof stehen, einen »guten« Schlafplatz zu finden, lungert die Kompanie Panzergrenadiere, die sie ablösen, abmarschbereit und mit abgerockten, aber gutgelaunten Gesichtern bei ihren Fahrzeugen und wartet darauf, dass sich der Hof lichtet und sie die Rückfahrt ins Feldlager antreten kann. Viele tragen verwegen wuchernde Bärte, was nicht nur am Coolnessfaktor, sondern auch an den spärlichen sanitären Einrichtungen im PHQ liegt. Aber es macht auch anderweitig Sinn: Männer ohne Bärte werden von den meisten Afghanen nicht wirklich ernst genommen.
Carl ist heilfroh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, und atmet tief durch. Die Szene ist ihm vertraut: die Kameraden, die wie sandfarbene Michelin-Männchen den Baracken zustapfen, der Müll überall. Auch der Geruch nach Scheiße, der über allem hängt. Der ist allerdings dieses Mal besonders krass. Wie Carl von einem der abziehenden Panzergrenadiere erfährt, sind die fünfzehn himmelblauen Dixieklos, die einzigen Aborte des ganzen Komplexes, die in der Nähe der Außenmauer stehen, seit Tagen nicht geleert worden. Der Unternehmer, der sonst die Fäkaliencontainer abtransportiert hat, hat von den Taliban wegen Unterstützung des Feindes eine Kugel in den Kopf bekommen. Und nun hat die afghanische Polizei, die den Komplex hier betreibt, Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der den Job übernimmt.
»Auch ’ne Art von Kriegsführung«, sagt Carl und grinst. »Sie wollen, dass wir an unserer eigenen Scheiße ersticken.«
Der Hof leert sich, und Carl erkennt neben ein paar verrosteten Containern ihre eigentlichen Gastgeber: eine Gruppe von afghanischen Polizisten in ihren blassblauen Uniformen, die auf Campingstühlen im Schatten sitzen und das Treiben mit müden Gesichtern verfolgen. Einer döst mit geschlossenen Augen, ein anderer reicht gerade einen Joint an seinen Kollegen weiter. Etwa zwei Dutzend Angehörige der ANP sind hier ständig stationiert, und zwei oder drei sind auch stets dabei, wenn die Deutschen rausgehen in die Dörfer – auch um die enge Zusammenarbeit zwischen den ISAF-Truppen und den einheimischen Behörden zu demonstrieren. Schon in drei Jahren – 2013 – soll die ANP zusammen mit der afghanischen Armee in der Lage sein, die Aufständischen allein unter Kontrolle zu halten. Aber das, so ahnt Carl seitlängerem, wird wohl ein Problem werden.
Er weiß, dass diese blauen Jungs – oft halbe oder komplette Analphabeten – chronisch unterbezahlt sind, schlecht ausgebildet und noch schlechter ausgerüstet. Dass sie oft frustriert sind und anfällig dafür, die Seite zu wechseln. Und dass es passieren kann, dass sich unter ihnen ein eingeschleuster Fanatiker befindet, der plötzlich sein Magazin auf ein paar ISAF-Soldaten leert. Es gab da im letzten Jahr eine Sache, die ihnen allen unter die Haut gegangen ist: der Tod eines neunzehnjährigen deutschen Panzergrenadiers, der in einem Stützpunkt bei Mazar-e-Sharif gerade sein Fahrzeug wartete, als er von einem vorübergehenden ANP-Mann hinterrücks eine Kugel in den Kopf bekam.
Carl beobachtet, wie sich einer der Afghanen erhebt und auf die Reihe der überquellenden Dixie-Klos zuschlurft, sich dann aber offenbar eines Besseren besinnt und hinter dem Müllcontainer verschwindet, um sich zu erleichtern.
Schon krass, dass man hier vor den eigenen Verbündeten auf der Hut sein muss.
Während die abgelöste Kompanie Panzergrenadiere durch das blaue Tor rumpelt, latschen Carl und Ebby gemächlichen Schritts zu den Baracken, wo den Scharfschützen immer ein eigener Raum zugeteilt ist. In den unverputzten und teils von Schimmel befallenen Räumen hausen zwanzig bis dreißig Mann, deren Privatsphäre aus den eineinhalb Quadratmetern besteht, die ihr Feldbett einnimmt.
Dann stellt sich plötzlich heraus, dass der Raum, der für die fünfzehn Scharfschützen vorgesehen war, durch einen Wasserrohrbruch unbewohnbar ist, weshalb Carl und Ebby sich zumindest für zwei, drei Tage ein Quartier mit zwanzig Fallschirmjägern aus der Kompanie der Neuen teilen müssen. Das nervt, denn es gehört eigentlich zu den Privilegien der Sniper, dass sie einen eigenen Bereich für sich und ihre Waffen haben. Carl und Ebby haben sich jedoch längst daran gewöhnt, dass hier draußen ständig improvisiert werden muss, und fügen sich leise fluchend in ihr Schicksal.
»Ätzende Scheiße!«, brüllt einer der Soldaten in den Raum, den Carl und Ebby gerade betreten. Dann tritt er wuchtig in einen Haufen aus leeren Konserven- und Getränkedosen in einer Ecke. Die Dosen fliegen mit großem Geschepper durch den Raum. Ein bulliger Typ mit rasiertem Schädel wird am Bein getroffen und nimmt eine drohende Haltung ein.
»Ey, geht’s noch?«
Der Treter murmelt etwas, das sich wie eine Entschuldigung anhört, und flucht dann weiter auf die »beschissenen Panzeraffen, die ihren ganzen Müll liegen lassen!«.
Als ob das bei euch in zwei Wochen anders wäre. Immerhin gibt’s hier Klimaanlage und nen Kühlschrank, das ist der reinste Luxus!
Über den Boden verlaufen Kunststoffrohre, die durch die nur mit Plastikplanen verhüllten Fenster in den Hof führen. Dort spotzt und knattert ein Notstromaggregat vor sich hin.
In dem Barackenraum hängt noch der Mief ihrer Vorgänger: schmutzige Socken, durchgeschwitzte Uniformen, angetrocknetes Sperma. Hier hat zwar keiner Privatsphäre, aber im Dunkeln geräuschlos zu wichsen, haben viele gelernt.
»Seht mal! Der Scheff und seine Ische!«, ruft einer der Soldaten, ein großer Typ mit martialischem Rauschebart, und hält eine zerknitterte, etwas ältere Ausgabe der BILD am Sonntag hoch. Ein großformatiges Farbfoto zeigt den zähnebleckenden Verteidigungsminister und seine blonde Gattin auf einem Gala-Empfang. Die Headline prahlt: »DEUTSCHLANDS POWER-PAAR«.
»Voll porno«, sagt einer, was normalerweise bedeutet, dass etwas besonders cool ist, hier aber eher sarkastisch gemeint ist.
Genau. Unser oberster Dienstherr wird zu Hause als Glamourboy gefeiert, und von der Scheiße, die hier unten abgeht, will keiner was wissen.
»Ich find den gut!«, sagt einer. »Der tut was für die Truppe.«
»Klaro«, sagt Ebby. »Er schickt uns so Gasgranaten, wo die Taliban ganz kirre von werden und in BHs zu Kylie Minogue absteppen.«