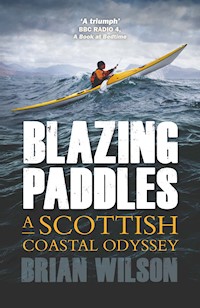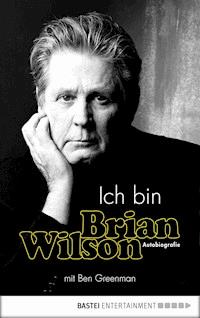
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Brian Wilson ist genialer Musiker, der uns unzählige Welthits wie "Surfin USA" oder "Good Vibrations" und das Jahrhundertalbum "Pet Sounds" geschenkt hat. Der amerikanische Rolling Stone hat ihn unter die 20 wichtigsten Künstler aller Zeiten gewählt. Brian Wilson ist auch ein labiler Mensch, der sich mit Tabletten, Drogen und Alkohol immer wieder in Zonen bewegt hat, aus der man ohne fremde Hilfe nicht heil herauskommt. Viele Jahre verschwand Brian Wilson entmündigt in Kliniken, bis seine zweite Frau ihn sprichwörtlich rettete: Für die Bühne, für neue Musik, für das Vermächtnis des einzigen Überlebenden der Beach Boys. In diesem Buch erzählt er von seinen dunkelsten Stunden, vom Glück einer großen Liebe und warum er noch lange nicht genug hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungOuvertüre1. KAPITEL2. KAPITEL3. KAPITEL4. KAPITEL5. KAPITEL6. KAPITEL7. KAPITEL8. KAPITEL9. KAPITEL10. KAPITELDISKOGRAFIEDANKÜber dieses Buch
Brian Wilson ist genialer Musiker, der uns unzählige Welthits wie »Surfin USA« oder »Good Vibrations« und das Jahrhundertalbum »Pet Sounds« geschenkt hat. Der amerikanische Rolling Stone hat ihn unter die 20 wichtigsten Künstler aller Zeiten gewählt. Brian Wilson ist auch ein labiler Mensch, der sich mit Tabletten, Drogen und Alkohol immer wieder in Zonen bewegt hat, aus der man ohne fremde Hilfe nicht heil herauskommt. Viele Jahre verschwand Brian Wilson entmündigt in Kliniken, bis seine zweite Frau ihn sprichwörtlich rettete: Für die Bühne, für neue Musik, für das Vermächtnis des einzigen Überlebenden der Beach Boys. In diesem Buch erzählt er von seinen dunkelsten Stunden, vom Glück einer großen Liebe und warum er noch lange nicht genug hat.
Über den Autor
Brian Wilson, geboren 1962 in Kalifornien, ist Mitbegründer der Beach Boys und hat die meisten ihrer großen Hits, darunter Klassiker wie »Surfin USA«, »Good Vibration« oder »Surfer Girl«. geschrieben. 1965 zog er sich von der Bühne zurück, um fortan vor allem als Komponist und Produzent für die Beach Boys zu wirken. Das 1966 veröffentlichte Album »Pet Sounds« gilt ob seiner ungewöhnlichen Harmonik und instrumentalen Finesse als eines der ambitioniertesten und einflussreichsten Pop-Alben der Geschichte, das 1967 verschollene, sprich: nie veröffentlichte Album »Smile« als einer der größten Mythen. Nach langen Phasen physischer Krankheit ist der in dritter Ehe verheiratete Wilson seit Ende der 90er Jahre wieder verstärkt musikalisch aktiv und gilt als einer der großen Legenden der Popmusik, die in Würde gealtert sind, ohne ihre musikalischen Ideale zu verraten.
Ich bin
Brian
Wilson
Autobiografie
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Harriet Fricke
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»I am Brian Wilson«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Brian Wilson c/o The Agency Group, New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Theml, Wiesbaden
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer
Einband-/Umschlagmotiv: © Guy Webster | über ARCHIVES | INTERTOPICS
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3954-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für MelindaGod only knows what I’d be without you
Ouvertüre
Royal Festival Hall, London, 2004
Es war schwer, und es war leicht. Meistens war es beides zugleich. Mein Freund Danny Hutton hat mit seiner Band Three Dog Night den Song »Easy to be Hard« gecovert, den ich manchmal in Gedanken singe. Darin heißt es: »It’s easy to be hard, it’s easy to be cold.« Jetzt ist es kalt. London im Winter 2004, ich sitze in der Royal Festival Hall und bereite mich auf den Auftritt vor. Einige Songs, die ich singen werde, handeln von Sonne und Strand. Im Augenblick sucht man beides vergeblich. Immerhin gibt es Wasser – die Royal Festival Hall liegt direkt am Fluss –, und in einigen Songs geht es auch darum.
Nach meiner Ankunft bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, und jemand hat mir erzählt, dass die Konzerthalle 1949 errichtet und im Herbst 1964 umgebaut wurde. 1964 war ein wichtiges Jahr. In diesem Jahr passierte alles. Die Beach Boys waren auf Welttournee. Im Januar waren wir mit Roy Orbison in Australien, im Juli in allen großen Städten der Vereinigten Staaten. Summer Safari – so hieß die Tournee, und wir traten mit Leuten wie Freddy Cannon oder den Kingsmen auf. Wenn wir nicht auf der Bühne standen, nahmen wir Songs auf: »Fun, Fun, Fun« und »The Warmth of the Sun« am Anfang des Jahres, »Kiss Me, Baby« gegen Ende des Jahres, und dazwischen unzählige andere. Wir veröffentlichten vier Platten – drei Studio-Alben (darunter das Christmas Album) und einen Live-Mitschnitt. Und das alles, nachdem wir schon 1963 rund um die Uhr beschäftigt gewesen waren: drei Album-Veröffentlichungen und das ganze Jahr über auf Tournee.
Heute höre ich mir die alten Sachen nur noch selten an. Aber ich denke oft über sie nach und versuche mir vorzustellen, was mir damals durch den Kopf ging. Das Bild ist nicht immer scharf. Manchmal ist es nur bruchstückhaft. Sich in sein früheres Ich hineinzuversetzen, ist gar nicht so leicht. Im Lauf der Jahre habe ich neue Sachen gespielt, und ich habe alte Sachen gespielt. In der Royal Festival Hall habe ich beides gespielt: 2002 war ich mit meiner Band hier und habe das gesamte Pet Sounds-Album aufgeführt. Den Leuten hat’s gefallen. Es war Sommer. Aber heute Abend ist es anders. Seit Monaten habe ich Angst vor diesem Abend, seit Jahren habe ich ihn mir vorgestellt. Heute Abend werden wir in der zweiten Konzerthälfte SMiLE aufführen, das Beach-Boys-Album, das es nie gab. Welcher Teufel hat mich bloß geritten? Wieso habe ich das jemals für eine gute Idee gehalten? SMiLE sollte Mitte der 1960er als Nachfolgealbum von Pet Sounds herauskommen. Aber aus verschiedenen Gründen wurde nichts daraus. Aus allen erdenklichen Gründen wurde nichts daraus. Einige Songs, die auf SMiLE erscheinen sollten, wurden im Lauf der Jahre auf anderen Platten veröffentlicht, aber das eigentliche Album ging unter und tauchte erst Jahrzehnte später wieder auf. Irgendwann habe ich es mir noch mal vorgenommen und fertiggestellt. Mit über sechzig habe ich geschafft, was ich mit zwanzig nicht hinbekommen konnte. Und das hat mich nun nach London geführt.
Ich sitze in der Konzerthalle. Alle sind mit letzten Vorbereitungen beschäftigt. Was hat mich nach London geführt? Es fällt mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Hier laufen so viele Menschen, so viele Musiker herum. Ich höre, wie sie ihre Instrumente stimmen und Licks austauschen, aber ich höre sie auch reden, die Musiker hier und die Musiker aus der Vergangenheit. Ich höre Chuck Berry, der als einer der Ersten aus Boogie-Woogie Rock’n’Roll entwickelte. Was hätte Chuck von den vielen Streichern und Bläsern gehalten? Vermutlich hätte er eine x-beliebige Band engagiert, wäre mit ihr auf die Bühne marschiert und hätte die Streicher und Bläser ignoriert. Ich höre Phil Spector, der in den 1950er und frühen 1960er Jahren hinter jeder großartigen Platte stand. Phils Stimme macht mir Angst, immer fordert sie mich heraus, immer erinnert sie mich daran, dass er zuerst da war. »Wilson«, höre ich ihn in meinem Kopf sagen, »du wirst ›You’ve Lost That Lovin’ Feeling‹ oder ›Be My Baby‹ niemals toppen, also versuch’s gar nicht erst.« Aber vielleicht will er, dass ich es wenigstens versuche. Mit ihm ist es nie ganz einfach, schon gar nicht, wenn er in meinem Kopf herumspukt. Einfachheit war nie sein Ding. Einige behaupten, wir hätten Pet Sounds ihm zu Ehren so benannt: Sehen Sie sich mal die Anfangsbuchstaben an.
In meinem Kopf höre ich auch meinen Vater. Seine Stimme ist lauter als die anderen: »Was ist mit dir los, Junge? Hast du keinen Mumm? Warum so viele Musiker? Für Rock’n’Roll braucht man zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Alles andere ist nur fürs Ego.«
Sobald ich die Stimmen höre, versuche ich, sie auszublenden. Ich versuche, ein Gefühl für den Raum zu entwickeln und mir vorzustellen, wie die Songs darin lebendig werden könnten. Außerdem versuche ich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ich hineinpasse. Mit den Beach Boys bin ich nie gern auf die Bühne gegangen. Die Leute haben geschrieben, ich würde steif wirken. Sie schrieben, ich hätte Lampenfieber. Ein merkwürdiger Ausdruck. Ich hatte schließlich kein Fieber. Ich hatte Angst vor den vielen Augen, die mich beobachteten, hatte Angst vor den Lichtern, hatte Angst, alle zu enttäuschen. Im Studio konnte ich viele Erwartungen erfüllen, aber auf der Bühne erwarten die Leute etwas anderes. Wenn das Publikum mitgeht, ist es wie eine Welle, auf der man reitet. Ein fantastisches Gefühl. Aber manchmal erlebt man das Publikum auch als eine Welle, die einen unter sich begräbt.
Neben Chuck Berry, Phil Spector und meinem Vater höre ich noch andere Stimmen. Die sind wesentlich schlimmer. Sie sagen schreckliche Sachen über meine Musik. Deine Musik taugt rein gar nichts, Brian. An die Arbeit, Brian. Du bist auf dem absteigenden Ast, Brian. Manchmal lassen sie meine Musik außen vor und greifen mich direkt an. Jetzt bist du dran, Brian. Du bist erledigt, Brian. Wir werden dich töten, Brian. Die Stimmen klingen wie niemand, den ich kenne, aber sie sind mir dennoch vertraut. Mit Anfang zwanzig habe ich sie zum ersten Mal gehört. Ich habe sie oft gehört, und wenn sie einmal ausblieben, hatte ich Angst, sie würden bald wiederkommen.
Mein ganzes Leben habe ich nach einem Weg gesucht, mit ihnen fertigzuwerden. Ich habe versucht, sie zu ignorieren. Das hat nicht funktioniert. Ich habe versucht, sie mit Alkohol und Drogen zu vertreiben. Das hat nicht funktioniert. Man hat mir alle möglichen Medikamente gegeben, und wenn es, wie so oft, die falschen waren, hat es ebenfalls nicht funktioniert. Ich habe alle möglichen Therapien ausprobiert. Einige waren furchtbar und hätten mich beinahe erledigt. Andere waren gut und haben mich stärker gemacht. Letzten Endes musste ich lernen, mit der Krankheit zu leben. Wissen Sie, wie das ist, wenn man jeden Tag seines Lebens dagegen ankämpfen muss? Ich hoffe, nicht. Aber viele Leute wissen, wie das ist, oder kennen einen, der es weiß. Jeder, der mich kennt, kennt einen. Unzählige Menschen auf diesem Planeten müssen mit einer psychischen Krankheit fertigwerden. Das ist mir im Lauf der Jahre klar geworden, und dadurch fühle ich mich nicht mehr so allein. Es ist ein Teil meines Lebens. Kein Weg führt daran vorbei. Meine Geschichte handelt von Musik, Familie und Liebe, aber auch von psychischer Krankheit.
London ist ein Teil der Geschichte. Die Stadt ist meine spirituelle Heimat. Das Londoner Publikum weiß meine Musik besonders zu schätzen. Auch das SMiLE-Konzert spielt in der Geschichte eine Rolle. Dadurch konnte ich etwas in die Gegenwart holen, das sonst für immer der Vergangenheit angehört hätte. Zur Beruhigung meditiere ich, bis ich in der Musik drin bin. Musik ist der Schlüssel. Musik trägt das, was in mir ist, in die Welt hinaus. Sie ist mein Mittel, den Leuten das zu zeigen, was ich ihnen sonst nicht zeigen kann. Music is in my soul – das habe ich vor langer Zeit mal geschrieben. Es ist einer meiner besten Texte.
Mir fällt wieder ein, woran ich gerade gedacht habe: an die Vergangenheit. SMiLE aus der Versenkung zu holen, betrifft die Vergangenheit und die Gegenwart. Weil wir das Album damals nicht fertiggestellt haben, blieb auch ein Teil von mir unvollendet. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, sein Meisterwerk vierzig Jahre lang in einer Schublade wegzuschließen? Die Schublade hat sich nur langsam geöffnet. Sie hat sich ein bisschen geöffnet, als ich auf einer Weihnachtsfeier bei Scott Bennett »Heroes and Villains« am Klavier spielte, und ein bisschen weiter, als David Leaf mich gebeten hat, das Stück beim Tribute-Konzert in der Radio City Music Hall zu spielen. Darian Sahanaja hat sie schließlich fast ganz aufgezogen. Darian ist Sänger und Songwriter, genau wie ich, nur viel jünger. Er steht auf die Musik, die wir früher gemacht haben, und hat einen frischen Blick darauf. Er spielt Keyboard in meiner Band und ist für mich so etwas wie ein Musikminister. Beim Konzert in der Radio City Music Hall, ein paar Monate nach der Weihnachtsfeier, interpretierten andere Sänger wie Paul Simon, Billy Joel, Vince Gill und Elton John meine Songs. Die großen Hits waren darunter, aber auch zwei Stücke, die wir für SMiLE aufgenommen hatten und die nun so dargeboten wurden, wie wir es uns damals vorgestellt hatten. Vince Gill, Jimmy Webb und David Cosby spielten »Surf’s Up«, und das Publikum spendete ihnen – und dem Song – ein paar Minuten lang stehenden Beifall. Ich konnte es kaum fassen. Ich saß am Seitenrand der Bühne, und David Cosby sagte im Vorbeigehen zu mir: »Brian, wie bist du bloß auf diese Wahnsinnsakkorde gekommen? Die sind einfach fantastisch.« Ich schüttelte den Kopf. »Weißt du«, sagte ich, »von dem Song hab ich mich schon vor langer Zeit verabschiedet.« Dann ging ich raus und spielte »Heroes and Villains« seit über vierzig Jahren wieder live. Das hatte ich bei der Weihnachtsfeier versprochen. Der Beifall war überwältigend. Der große George Martin sagte ein paar einführende Worte, bevor Heart auf die Bühne kamen und »Good Vibrations« spielten. Was er über mich sagte, haute mich um: »Wenn es unter allen lebenden Musikern in der Popmusik ein Genie gibt, dann ist es für mich Brian Wilson … Ohne Pet Sounds wäre Sgt. Pepper nicht möglich gewesen. … Pepper war ein Versuch, an Pet Sounds heranzukommen.« Das hat der Produzent der Beatles über mich gesagt – unfassbar. Ich fühlte mich wahnsinnig geehrt.
Kurz darauf wurde ich zum ersten Mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das ganze Album aufzuführen. Ich sagte Ja. Ich habe mich darauf gefreut, aber es gibt Zeiten, wie heute, da kommen mir doch meine Zweifel.
Jetzt sitze ich hier und versuche zu meditieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich nehme die Leute wahr, die geschäftig hin und her laufen. Einige bleiben stehen und wollen mich noch einmal an den Ablauf des Konzerts erinnern. Mir kommt es vor, als wäre ich den Ablauf schon hundert Mal durchgegangen. Ich kenne ihn in- und auswendig. Wir fangen mit einem Akustikset an, dann spielen wir ein paar Stücke von meinen Soloalben, ein paar frühe Beach-Boys-Hits und danach ein paar Songs von Pet Sounds. Es folgt eine Pause, dann kommt der Moment, auf den alle gewartet haben – SMiLE. Endlich.
Jemand bleibt vor mir stehen und räuspert sich. Ich schaue hoch. Es ist Jerry Weiss, der mich seit vielen Jahren als Tour-Assistent begleitet. »Hey, Brian«, sagt er. »Sie lassen die Leute jetzt rein. Gehen wir besser in die Garderobe.«
»Danke«, sage ich. »Wo ist Melinda?« Melinda ist meine Frau.
»Sie wartet in der Garderobe. Komm.« Aber ich möchte lieber in die Garderobe der Musiker. Das wird vor einem Konzert von dir erwartet, spätestens, nachdem du die Atmosphäre der Konzerthalle in dich aufgenommen hast. Du solltest bei den Musikern sein und ihnen noch mal sagen, was du beim Auftritt vorhast. Ich frage Jerry, wo ihre Garderobe ist. Eine Sekunde lang wirkt er enttäuscht, aber er führt mich trotzdem hin.
Darian sehe ich als Erstes. »Hi«, sage ich. »Was dagegen, wenn ich mich kurz zu euch setze?«
»Natürlich nicht«, sagt Darian. »Wie geht’s dir? Bist du bereit?«
»Ich bin bereit«, sage ich. Aber weil er gefragt hat, sage ich ihm die Wahrheit. »Ich hab ein bisschen Angst, bin nervös. Glaubst du, den Leuten wird’s gefallen?«
»Es wird ihnen nicht nur gefallen. Sie werden begeistert sein. Du wirst schon sehen. Und dann …«
Darian ist zur anderen Seite des Zimmers gegangen, und ich kann ihn kaum noch verstehen. Auf dem rechten Ohr bin ich so gut wie taub. Seit meiner Kindheit. Ein Profimusiker, der auf einer Seite nichts mehr hört? Ein Witz, und doch alles andere als witzig. Im Lauf der Jahre habe ich es gelernt, im Studio damit umzugehen, aber auf der Bühne ist es eine Herausforderung, denn dort muss man genau wissen, was um einen herum passiert. Es ist schwierig, den Ton zu halten, wenn man nicht jede Note hört, die auf der Bühne gespielt wird. Der Sound da oben kann einen umhauen, und ich habe nur eine Monitorbox, links neben mir. Sie muss perfekt ausgerichtet sein, sonst höre ich nur Rauschen. Und natürlich sind da noch die Stimmen in meinem Kopf. Manchmal kommen sie mit auf die Bühne. Manchmal werden sie mitten in einem Song lauter, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Jedes Mal schaffe ich es trotzdem, ihn zu Ende zu spielen. Aber beim nächsten Mal bin ich mir dann nicht mehr sicher, ob es mir wieder gelingen wird.
In zehn Minuten müssen wir auf die Bühne. Jerry sagt, im Publikum würden etliche Leute sitzen, die ich kenne. Ich frage, wo sie sitzen. Ich möchte sie von der Bühne aus sehen. Zu wissen, dass das Publikum nicht nur eine einzige große Welle ist, sondern aus bekannten Gesichtern besteht, hilft mir, die Nervosität zu bekämpfen. Melinda sitzt in der Mitte, direkt vor mir. Wenn ich geradeaus schaue, werde ich sie sehen und spüren, dass sie bei mir ist. Meine Managerin Jean Sievers sitzt gleich neben ihr; auch ihr habe ich es zu verdanken, dass ich heute hier bin. Van Dyke Parks, der mit mir an SMiLE gearbeitet und die Texte geschrieben hat, sitzt mit seiner Frau Sally ebenfalls in der ersten Reihe. Roger Daltrey war vorhin schon da und hat mich backstage begrüßt. Wix und Abe aus der Band von Paul McCartney sind ebenfalls hier. George Martin auch. Ich stelle mir ihre Gesichter vor, damit das Lampenfieber nicht überhandnimmt. Einen Augenblick lang steigt es, dann legt es sich wieder. Wenn ich mich an den Rhythmus gewöhne, kann ich damit umgehen. Rechts von mir sagt jemand etwas, das ich nicht verstehe, und ich drehe den Kopf, damit mein funktionierendes Ohr es auffängt. »Es wird Zeit«, sagt die Stimme. »Es wird Zeit.« Die Lichter gehen aus, und ich höre das Publikum lauter werden.
1. KAPITEL
Angst
There’s a world where I can go and tell my secrets to
In my room, in my room
In this world I lock out all my worries and my fears
In my room, in my room
– »In My Room«
Kein Morgen beginnt zu einer festen Zeit. Im Sommer wache ich ziemlich früh auf, manchmal schon um sieben. Im Winter wird es später, sind die Tage kürzer, schlafe ich länger. Manchmal stehe ich erst um elf auf. Vielleicht geht das allen so. Früher war es schlimmer. Da fiel mir das Aufstehen im Winter richtig schwer, mitunter blieb ich stundenlang im Bett liegen. Den Tag zu beginnen, fällt mir heute wesentlich leichter – egal zu welcher Jahreszeit.
Wenn ich heute in meinem Haus in Beverly Hills aufwache, gehe ich die Treppe runter, in mein Zimmer. Dort stehen der Fernseher und mein Sessel. Der Sessel hat einen marineblauen Bezug und steht schon immer dort. Früher war der Bezug rot. Er musste etliche Male erneuert werden, weil ich die Angewohnheit habe, Löcher in die Polsterung zu bohren. Wenn ich aus dem Schlafzimmer komme, ist der Sessel meine erste Anlaufstelle. Er ist meine Kommandozentrale. Dort sitze ich und sehe fern, obwohl das Gerät eher ungünstig steht. Am liebsten sehe ich Eyewitness News. Die Sendung ist vielleicht nicht die beste, aber die Nachrichtensprecher haben eine sympathische Ausstrahlung. Und den Wetterbericht gibt es dort auch. Gameshows mag ich ebenfalls, obwohl mir Jeopardy! langsam auf die Nerven geht. Jeden Tag der gleiche Mist. Glücksrad gefällt mir besser. Auch Sportsendungen schaue ich mir gern an, meistens Baseball, aber auch Basketball und Football. Sobald die Playoffs anstehen, wird es interessanter.
Aber der Fernseher ist nicht das Einzige, was ich von meinem Sessel aus sehe. Ich kann bis in die Küche schauen und auch sonst fast alles sehen. Wenn ich den Kopf drehe und aus dem Fenster schaue, ist dort der Garten, mit Blick auf den Benedict Canyon. Wenn man zum Ende des Gartens geht, breitet sich die ganze Stadt vor einem aus. Gleich neben meinem Sessel steht ein Telefon, ich kann jeden anrufen, den ich will. Handys benutze ich nicht. Ich hatte zwar schon einige, aber ich telefoniere nicht gern damit. Am liebsten sitze ich in meinem Sessel. Wenn ich in L.A. bin, verbringe ich dort hundert Prozent meiner Zeit. Manchmal komme ich ins Zimmer, und in meinem Sessel sitzt schon jemand. Dann stelle ich mich in die Nähe und warte, bis er frei wird. Auf Tournee habe ich einen anderen Stuhl dabei, einen Liegestuhl aus schwarzem Leder, damit ich mich wie zu Hause fühlen kann. Ich lasse ihn seitlich von der Bühne aufstellen und warte lieber dort als in der Garderobe.
Viele Leute brauchen morgens als Erstes einen Kaffee. Ich nicht. Ich mag keinen Kaffee. Das heißt nicht, dass ich von alleine munter werde. Wegen der Medikamente für die Nacht fühle ich mich schlaftrunken, und mir fällt es schwer, in die Gänge zu kommen. Von den Tabletten habe ich einen leichten Kater. Bin ich erst mal im Sessel gelandet, bleibe ich dort eine halbe Stunde lang sitzen. Dann gehe ich ins Deli und bestelle Frühstück. Im Lauf der Jahre haben sich meine Frühstücksgewohnheiten geändert. Als ich noch nicht auf mein Gewicht geachtet habe, waren es schon mal ein, zwei Schüsseln Cornflakes, Eier und eine Geflügelfrikadelle. Heute esse ich einen Gemüsebratling, Obstsalat oder eine Schale Blaubeeren. Meistens kommt Melinda morgens in mein Zimmer. Ein Blick und sie weiß, in welcher Gemütsverfassung ich bin. Sie kennt mich lange genug, um zu wissen, wann es mir gut geht oder auch nicht so gut.
Meistens spricht sie mich morgens nicht an. Sie lässt mich in meinem Sessel sitzen. Wenn sich meine Stimmung am Nachmittag noch nicht aufgehellt hat, erkundigt sie sich bei mir. »Was bedrückt dich?«, fragt sie dann. Meistens fehlen mir meine Brüder. Beide sind tot – Carl seit fast zwanzig Jahren, Dennis seit über dreißig. Manchmal denke ich zu lange darüber nach. Ich frage mich, warum sie gehen mussten und wohin sie gegangen sind. Ich mache mir Gedanken, weil die großen Themen Leben und Tod so schwer zu begreifen sind. Am schlimmsten ist es in der Weihnachtszeit. Dann kann es passieren, dass ich mich in Gedanken verliere. Wenn es richtig schlimm wird, setzt Melinda sich neben mich und holt mich in die Realität zurück. Sie erinnert mich daran, dass Carl schon lange tot ist und wir, als er noch lebte, nicht besonders viel Zeit miteinander verbracht haben. Gegen Ende seines Lebens haben wir uns vielleicht ein, zwei Mal im Jahr gesehen. »Natürlich fehlen dir deine Brüder«, sagt sie dann. »Aber du willst doch nicht so lange an sie denken, bis du wieder in ein Loch fällst, oder?« Sie hat recht. Das will ich wirklich nicht.
Manchmal bedrückt mich auch etwas anderes. Die Stimmen in meinem Kopf etwa. Vielleicht ist es einer dieser Tage, an denen sie mir verstörende Sachen sagen. Auch an solchen Tagen holt Melinda mich in die Realität zurück. »Die Stimmen sagen dir schon seit Jahren, dass sie dich töten wollen«, sagt sie dann. »Aber dir ist nichts passiert. Die Stimmen sind nicht echt, auch wenn du das glaubst.« Auch damit hat sie recht. An den Tagen, an denen Melinda nicht da ist, versuche ich mir vorzustellen, was sie zu mir sagen würde. Dann fällt mir ein, dass ich einen Spaziergang machen muss. Das pustet mir den Kopf frei. Ein Spaziergang hat auf mich immer eine beruhigende Wirkung.
Heute fühle ich mich in meinem Sessel bestens aufgehoben. Das Leben kommt mir nicht so schwer vor, nichts zieht mich runter. In ein paar Tagen findet ein besonderes Ereignis statt. Eine Filmvorführung. Der Film heißt Love & Mercy und handelt von meinem Leben. Nicht von meinem ganzen Leben, weder mein Sessel noch dieses Buch kommen darin vor. Es ist ein Film über mein Leben, meine Musik, meinen Kampf gegen die psychische Krankheit, er spielt in den 1960ern, aber auch ein paar Jahre später. Tausende Tage aus meinem Leben werden darin abgedeckt. Manche Tage waren gut. Einige fantastisch. Und aus schlechten wurden wieder gute. Darum geht es in dem Film und in meinem Leben – vor allem aber um die Liebesgeschichte zwischen Melinda und mir und wie sie es geschafft hat, mich aus der Hölle zu befreien, in die mich Dr. Landy geschickt hatte. Melinda und ich haben, mit Unterbrechungen, über Jahre an dem Film gearbeitet. Wir wollten die Geschichte möglichst wahrheitsgetreu erzählen. Das hat fast zwanzig Jahre gedauert. Kaum zu glauben, oder?
Die Filmvorführung findet nicht heute statt. Aber bald. Heute ist ein Tag wie jeder andere. Ich werde mich waschen, mir die Haare kämmen und frühstücken gehen. Auf dem Weg zum Deli muss ich über eine Ampel, die ewig rot anzeigt, fast neun Minuten lang. Später schaue ich meinem Sohn Dylan vielleicht beim Basketball zu. Er ist elf und spielt ziemlich gut. Früher war ich häufiger bei seinen Spielen, aber seit meiner Rücken-OP ist das schwieriger geworden. Dylan spielt außerdem ein bisschen Schlagzeug. Das hilft ihm, seine innere Anspannung loszuwerden. Vielleicht wäre es eine gute Idee, ihm Klavierspielen beizubringen.
Wenn ich 2015 in meinem Haus aufwache, fühle ich mich dort sehr wohl. Als ich vor über zwanzig Jahren in meinem Haus aufwachte, wusste ich nicht, wie ich mich fühlte. Der Arzt war gerade zur Tür raus. Der Arzt war Eugene Landy. Der Patient war ich. »Ich gehe, weil ich meine Zulassung verloren habe«, sagte er. »Bye, Brian.«
Ich habe nichts erwidert. Ich war froh, dass er endlich ging. Sein Rücken, der sich von mir wegbewegte, erinnerte mich an die ablaufende Flut. Als Dr. Landy weg war, war ich endlich wieder frei. Es gibt viele Geschichten von Tyrannen, die ganze Länder beherrschen. Dr. Landy war ein Tyrann, der nur einen Menschen beherrschte. Mich. Er kontrollierte, was ich tat, wo ich hinging, wen ich traf, was ich aß. Er spionierte mir nach. Und er ließ mich von anderen beobachten. Er schrie mich an und stopfte mich mit Medikamenten voll, die mich durcheinanderbrachten. Was ist das für ein Arzt, der Leute kurieren will, indem er ihre Persönlichkeit auslöscht? Ich habe keine Ahnung, aber diese Therapie hat er bei mir angewendet.
Manchmal kommen Erinnerungen hoch, wenn ich am wenigsten damit rechne. Vielleicht muss das so sein, wenn man das Leben geführt hat, das ich geführt habe: Mit meinen Brüdern, meinem Cousin und einem Highschool-Freund eine Band gründen, die von meinem Vater gemanagt wird; miterleben, wie mein Vater immer schwieriger und schließlich unausstehlich wird; miterleben, wie ich selbst immer schwieriger und schließlich unausstehlich werde; miterleben, wie Frauen, die ich liebe, kommen und gehen; miterleben, wie Kinder geboren werden und heranwachsen; miterleben, wie meine Brüder älter werden; miterleben, wie sie aus der Welt scheiden. Einige dieser Erlebnisse haben mich geprägt. Andere haben mir Angst gemacht. Manchmal war es ein und dasselbe. Wenn ich erleben musste, wie mein Vater wütend wurde und mit der Hand nach mir ausholte, hat mich das dann eher geprägt oder hat es mir Angst gemacht? Wenn ich die Stimmen in meinem Kopf hörte und mir klar wurde, dass sie nicht so bald verschwinden würden, hat mich das dann eher geprägt oder hat es mir Angst gemacht?
Wenn ich in meinem Sessel sitze, versuche ich, alles um mich herum genau zu beobachten. Das habe ich schon immer gemacht. Ich versuche auch, genau hinzuhören. Schon immer habe ich mir die Sounds im Studio und in der Welt, die Stimmen in meiner Band und in meinem Kopf genau angehört. Ich konnte nicht aufhören, alles in mich aufzunehmen, aber nicht immer war ich in der Lage, alles auch zu verarbeiten. Das war einer der Gründe, warum ich mit der Musik angefangen habe. Musik ist etwas Wunderbares. Songs helfen mir, gegen den Schmerz anzukämpfen, und sie ziehen in die Welt hinaus und helfen anderen, was mir ebenfalls hilft. Keine Ahnung, ob das die ganze Geschichte ist, aber es ist zumindest ein Teil davon. Die Kämpfe – mit meinem Vater, mit der Band und nicht zuletzt mit den psychischen Problemen, die mich, solange ich denken kann, schon quälen – habe ich auf meine Art zu bewältigen versucht. Bin ich immer stark gewesen? Ich bilde es mir ein. Aber eins weiß ich ganz sicher: Ich bin immer noch da.
Ich denke an ein Bild. Eigentlich ist es ein Bild von einem Bild: Anfang der 1970er, ich liege im Bett und schaue mir das Cover des Beach-Boys-Albums Sunflower an, das 1970 erschienen war. Auf dem Cover ist ein Foto der Band: ich, meine Brüder Dennis und Carl, mein Cousin Mike Love, Al Jardine und Bruce Johnston. Die ganze Band, aber da sind noch andere. Meine Tochter Wendy. Mikes Kinder Hayleigh und Christian. Carls Sohn Jonah. Und Matt, der Sohn von Al.
Das Foto entstand auf Dean Martins Hidden Valley Ranch, in der Nähe von Thousand Oaks. Wir waren auf dem Golfplatz und alberten herum. Ricci Martin, Deans Sohn, war der Fotograf. Er war ein cooler Typ und gut mit meinem Bruder Carl befreundet. Ein paar Jahre später produzierte Carl Riccis Album Beached. Eine gute Platte. Dennis spielt darauf Schlagzeug. Und sie enthält einen wunderschönen Song, den Carl geschrieben hat, »Everybody Knows My Name«.
Auf dem Cover von Sunflower tragen wir überwiegend rote, weiße und blaue Sachen, über dem Foto ist ein Banner mit dem Bandnamen und darüber ein Regenbogen mit dem Albumtitel. Ich bin ganz in Weiß gekleidet: weißes Hemd, weiße Hose, weiße Schuhe. Ich blicke nach unten, weil Wendy, in Rosa, auf meinem Schoß sitzt. Damals war ich in ziemlich guter Verfassung. Ich wog nicht zu viel und wirke entspannt. Vielleicht nicht unbedingt glücklich, aber ich bin doch im Zentrum des Geschehens. Sunflower war das erste Beach-Boys-Album, das auf Brother/Reprise Records erschien, nachdem wir zehn Jahre bei Capitol Records gewesen waren.
Fotos können täuschen. Wie das Coverfoto von Sunflower. Ich sitze im Zentrum der Band, aber als das Album herauskam, stand ich nicht mehr im Zentrum. Einige behaupten, ich hätte mich freiwillig zurückgezogen. Andere behaupten, ich wäre hinausgedrängt worden. Vielleicht war es eine Mischung aus beidem. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass jeder aus der Band andere Vorstellungen hatte, welche Art von Musik wir veröffentlichen, wie wir unsere Songs auf der Bühne präsentieren und wann wir uns wiederholen oder etwas Neues ausprobieren sollten. Weil Sunflower unser erstes Album bei Reprise war, wollte ich etwas von Grund auf Neues machen. Ich wollte sogar die Band in The Beach umbenennen, schließlich waren wir keine Boys mehr. Als ich den anderen davon erzählte, hielten sie es für keine gute Idee. Sie glaubten, es würde die Plattenkäufer verwirren. Wir mussten auf unsere Karriere achten, sprich: auf die Verkaufszahlen.
Ich hatte nicht nur über die Band die Kontrolle verloren, sondern auch über mich selbst. Woran merkt man, dass die Dinge aus dem Ruder laufen? Fing es 1964 an Bord eines Flugzeugs nach Houston an, als ich die Nerven verlor und entschied, nicht länger mit der Band auf Tour gehen zu können? Fing es bereits in den 1940ern an, als ich Prügel von meinem Vater bekam, weil er meine Art nicht mochte? Fing es in den 1970ern mit den Drogen an oder lange davor, bei den ersten Anzeichen der psychischen Krankheit, mit der niemand umzugehen wusste? Spielt es eine Rolle, wann genau es anfing? Wichtig ist nur, dass es eine Zeit lang nicht mehr aufhörte. Als wir Sunflower veröffentlichten, litt ich unter Angstzuständen. Ich hatte den Eindruck, die Band würde mir entgleiten. Ich hatte den Eindruck, mir selbst zu entgleiten. Die Zeit, in der ich voller Selbstvertrauen ins Studio gegangen war und dort alles unter Kontrolle gehabt hatte, war vorbei, und ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ich wusste nicht, woher ich das Selbstvertrauen nehmen, wie ich die Kontrolle wiedererlangen sollte. Ich habe das mal den »Tod des Ego« genannt. Damals hatte ich keine Ahnung, ob ich mein Leben jemals wieder ins Lot bringen würde.
Dass ich fast fünfzig Jahre später einen relativ stabilen Zustand erreicht haben würde, ahnte ich damals natürlich noch nicht. Ich habe inzwischen gelernt, mit den Ängsten besser umzugehen. Aber damals ahnte ich nicht, dass sich mein Zustand erst noch verschlechtern sollte. Ein paar Jahre nach Sunflower war ich auf dem Tiefpunkt angekommen. Ich war bis obenhin voll mit Drogen und Alkohol, mein Kopf war bis obenhin voll mit negativen Gedanken. Die negativen Gedanken kamen von den Drogen und vom Alkohol, und sie führten dazu, dass ich mir noch mehr reinpfiff. Wie ich schon sagte, ging man mit psychischen Krankheiten damals nicht offen um. Die meisten hätten nicht mal zugegeben, dass es sie gab. Betroffene schämten sich, darüber zu reden, und die anderen hatten merkwürdige Vorstellungen, wie man mit ihnen umgehen sollte. Ich blieb die meiste Zeit über zu Hause und bewegte mich so gut wie gar nicht mehr. Wegen meiner Depressionen fühlte ich mich wie gelähmt. Ich nahm zu, und das verstärkte das Gefühl der Lähmung. Am Ende wog ich fast hundertfünfzig Kilo. In diesem Zustand wollte ich nicht mehr mit der Band auf die Bühne gehen. Ich konnte zwar noch Stücke schreiben, tat es aber immer seltener. Ich brauchte unbedingt Hilfe, und die Menschen in meiner Nähe suchten verzweifelt danach.
So kam Dr. Landy ins Spiel. Meine damalige Frau Marilyn holte ihn. Das war in dem Jahr der Zweihundertjahrfeier, 1976, und überall sah man nur Rot, Weiß und Blau – wie auf dem Sunflower-Cover. Als wäre das ganze Jahr über Unabhängigkeitstag. Doch Dr. Landy glaubte nicht an Unabhängigkeit. Er wollte, dass ich abnehme und gesünder lebe. Erreichen wollte er das, indem er sich selbst in den Mittelpunkt meines Lebens stellte. Vierundzwanzig-Stunden-Therapie nannte er das. Mehr Stunden hat ein Tag ja auch nicht. Freunde, die mich besuchen wollten, mussten sich erst von Dr. Landy ausfragen lassen. Bestanden sie den Test, durfte ich sie nicht allein empfangen. Dr. Landy schickte immer jemanden, der mich überwachte, manchmal gleich mehrere Leute. Er wollte sichergehen, dass mein Besuch mir keine Drogen oder sonst etwas Gesundheitsschädliches mitbrachte.
Zu behaupten, er hätte mit seiner Methode keinen Erfolg gehabt, wäre eine Lüge. Er brachte mein Gewicht von fast hundertfünfzig auf knapp fünfundneunzig Kilo runter, mein Idealgewicht. Als Quarterback im Footballteam der Highschool hatte ich so viel gewogen. Zehn Jahre lang hatte ich nicht mehr mit der Band auf der Bühne gestanden. Es gab nur wenige Ausnahmen: 1967 war ich bei zwei Konzerten auf Hawaii dabei, 1970 bei einem im Whisky A Go Go in L.A. und etwas später bei zwei weiteren in Seattle. Aber meistens schaffte ich es nicht auf die Bühne. Nach ein paar Monaten unter Dr. Landys Aufsicht konnte ich 1976 in Oakland für ein paar Stücke mit auf die Bühne gehen, in Anaheim, Kalifornien, hielt ich sogar ein ganzes Konzert durch, das fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde. Allerdings sang ich nur beim Song »Back Home« die Leadstimme. Er erschien wenig später auf unserem Album 15 Big Ones. Back home – das war die Message an unsere Fans: Ich war zurück.
Noch im selben Jahr verschwand Dr. Landy wieder aus meinem Leben. Nach den Anfangserfolgen ging er zu weit. Er mischte sich zu sehr in mein Leben ein. Ich fand heraus, was er mir für die Behandlung berechnete, und stellte ihn zur Rede. Ich war stinksauer. Wir hielten uns nicht lange mit Worten auf. Ich verpasste ihm eine Ohrfeige, er schlug zurück, damit war die Sache erledigt. Fürs Erste wenigstens.
Nachdem er weg war, ging es erst einmal bergauf. Wir brachten zwei ziemlich gute Alben raus, auf 15 Big Ones folgte 1977 Love You. Leider liefen die nächsten Jahre nicht so gut. 1978 war wohl eins der schlimmsten meines Lebens. Ich ließ mich in San Diego in eine psychiatrische Klinik einweisen, dann rief ich Marilyn an und bat sie um die Scheidung. Ich hatte weder meine Gedanken noch meinen Körper unter Kontrolle. Es war zwar nicht das erste Mal, aber durch die Art, wie ich damit umging, verschlechterte sich mein Zustand. Ich trank Bali-Hai-Wein, nahm Kokain und rauchte Kette. Mein Gewicht stieg und stieg, irgendwann zeigte die Waage hundertfünfundfünfzig Kilo an.
Der Preis war hoch. Die Musik litt darunter. Plattenfirmen fragten uns immer wieder nach neuen Alben. »Fragen« ist nicht das richtige Wort, es klingt zu höflich. Sie forderten sie von uns und ließen als Antwort kein Nein gelten. Wir nahmen weiter Alben auf, die in Wahrheit nur zeigten, in wie viele verschiedene Richtungen sich die Band entwickelte: M.I.U. von 1978, L.A. (Light Album) von 1979 und Keepin’ the Summer Alive von 1980. Die meisten Fans mögen die Alben nicht. Einige haben noch nicht mal von ihnen gehört. Mir gefallen ein paar Stücke, wie »Good Timin’« und »Goin’ On«, aber die meisten anderen Sachen muss man sich nicht zweimal anhören. Ich habe zu den Platten so gut wie nichts beigetragen. Dazu war ich nicht in der Lage. Ähnlich war es bei unseren Konzerten. Im März 1979, ein, zwei Tage, nachdem ich die psychiatrische Klinik verlassen hatte, flog ich für ein Konzert in der Radio City Music Hall nach New York. Ich schaffte den Song »California Girls«, dann verzog ich mich an den Seitenrand der Bühne. Bei einer Tournee spielte ich Bass und hockte fast die ganze Zeit über im hinteren Teil der Bühne auf einem Verstärker. Mein Gesangsbeitrag schrumpfte immer weiter, bis ich fast nur noch die Mittel-Bridge in »Surfer Girl« (»We could ride the surf together«) und die erste Strophe von »Sloop John B« sang.
Ein Konzert von 1982 ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Es fand im Westbury Music Theatre in New York statt, und wir standen auf einer Drehbühne. Mitten im Song »Do It Again« bekam ich einen Lachanfall. Ich konnte nicht mehr aufhören. Auf meinem Klavier lag eine Schachtel Zigaretten, und ich schaffte es, mir eine anzustecken. Wir beschlossen, die Pause vorzuziehen, aber als wir zurückkamen, hockte ich mich einfach an den Bühnenrand, ließ mich mitdrehen und rauchte ununterbrochen. Obwohl es absolut nicht komisch war, musste ich die ganze Zeit lachen. Dann musste ich husten und japste nach Luft. Ein paar Wochen später bekam ich einen Brief, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich pleite und aus der Band geflogen war. Der erste Teil stimmte zum Glück nicht. Der zweite in gewisser Weise schon. Die anderen hatten die Geduld mit den Drogen, dem Gelache und den Zigaretten verloren.
Dieses Mal waren es die Beach Boys, die Dr. Landy holten. Bis auf Dennis hatten alle dafür gestimmt. Sie wussten sich vermutlich nicht mehr anders zu helfen. Landy brachte mich als Erstes nach Hawaii. Dort verordnete er mir strikte Diät. Keine Drogen, nichts. Der Entzug dauerte eine Woche, aber ich schaffte es, auch wenn es mir verdammt schwerfiel. Ich wälzte mich im Bett herum. Ich schrie wie am Spieß, klammerte mich an die Decke. So dreckig ging es mir nie wieder.
Auch beim zweiten Anlauf setzte Dr. Landy auf die alte Therapie: Er betrachtete alle Menschen in meiner Nähe als Teil des Problems und schickte jeden weg. Sogar meine damalige Freundin Carolyn, dabei hatte sie nichts falsch gemacht. Das war traurig. Aber die Medikamente, mit denen Dr. Landy mich vollstopfte, sorgten dafür, dass die Erinnerungen an sie bald verblassten.
Beim ersten Mal hatte Dr. Landy mit seiner Methode Erfolg gehabt. Sie war bestimmt nicht optimal gewesen, aber ich hatte mich immerhin besser gefühlt. Beim zweiten Mal ging es mir kein bisschen besser. Sonst hätte ich mich frei gefühlt, aber Dr. Landy glaubte nun mal nicht an Freiheit. Er gab mir immer mehr Tabletten, angeblich Vitaminpräparate. Er schickte Mädchen, die mir Gesellschaft leisten sollten. Er spielte seltsame Spielchen, legte eine Hand auf mein Bein, um zu sehen, ob ich für eine von ihnen etwas empfand. Er veranstaltete Grillpartys bei mir zu Hause, lud aber nicht etwa meine Freunde und Familie ein, sondern seine Familie und befreundete Ärzte. Er schmiedete große Pläne, wollte mit mir nach Hawaii und nach London fliegen, und verwarf die Pläne ohne irgendeine Begründung wieder. Ab und an erlaubte er mir eine Margarita. Und er schrie mich so laut an, dass mir die Tränen kamen.
Manchmal nahm ich meinen Mut zusammen und bot Dr. Landy ein kleines bisschen die Stirn. »Gene?«, fragte ich dann. »Warum bist du eigentlich hier?« Keine Antwort. Stattdessen stellte er eine Gegenfrage: »Hast du zur falschen Zeit gegessen?« Oder: »Warum bist du so schmutzig?« Ich hatte keine Ahnung. An meinen Sachen klebten Essensreste. Ich vergaß, mir die Nägel zu schneiden, und auch niemand sonst kümmerte sich darum. Wegen der Medikamente konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich wollte es auch gar nicht, weil ich Angst hatte und mich schämte. Meistens wartete ich von morgens bis abends nur auf das Ende des Tages. Wenn ich mit alten Freunden oder meiner Familie redete, dachten sie vermutlich, ich wäre nicht mehr ich selbst. Sie hatten recht.
Gene duldete keine anderen Menschen in meiner Nähe. Er wollte mich in völliger Abhängigkeit halten. Seine Methoden waren oft brutal. Manchmal erinnerte er mich an meinen Vater. Das kam mir falsch vor. Wieso spielte er sich wie ein Vater auf, wo er doch noch viel wütender und ungerechter war. Ich wusste nicht, ob er mir außer Wut so etwas wie Liebe entgegenbrachte. Mit echten Vätern kämpft man um Unabhängigkeit. Man versucht, sie ein Stück weit aus seinem Leben zu drängen, und stößt nicht selten auf Widerstand. Gene schien nicht zulassen zu wollen, dass ich ihn aus meinem Leben drängte. Er stellte eine Frau ein, die mir das Essen zubereitete. Sie hieß Gloria Ramos. Bevor sie in mein Haus kam, erzählte mir Gene von ihr. Er sagte, sie würde für ihn arbeiten. Er sagte, sie würde Essen machen und Einkäufe erledigen. Vorher hatte das eine Frau namens Deirdre gemacht, aber sie war nicht lange geblieben.
Zuerst wusste ich nicht, was ich von Gloria halten sollte. Immerhin arbeitete sie für Gene. Das machte mir Angst. Aber ich beobachtete sie und kam zu dem Schluss, dass sie nicht so war wie seine anderen Leute.
Gloria sprach nur gebrochen Englisch, aber ich konnte ein paar Brocken Spanisch. Es gibt den Song »¿Quando Calienta el Sol?«, was »Wie heiß ist die Sonne?« bedeutet. Den sang ich ihr vor oder ich spielte für sie auf dem Klavier. Eine Zeit lang war sie mein einziger Freund. Ich aß gern Frozen Yogurt, aber Gene erlaubte das nicht, daher bestellte Gloria sich eine Portion und teilte sie mit mir. Manchmal sahen wir zusammen fern, manchmal war mir nicht einmal danach, und ich bat sie, die Vorhänge zuzuziehen und mich im Dunkeln sitzen zu lassen. Sie weigerte sich. Sie sagte, die Tür müsse offen bleiben. Aus verschiedenen Gründen wollte ich, dass die Tür zublieb. Ich sagte, Moskitos könnten reinfliegen und Krankheiten übertragen. Dagegen gebe es Medizin, erwiderte sie. Aber ich war mir nicht sicher, ob die wirklich helfen würde.
Manchmal versuchte ich, ihr den großen Zusammenhang zu erklären, um ihn mir selbst vor Augen zu führen. Ich erzählte ihr, dass ich wegen der Beach Boys berühmt war und Musik gemacht hatte, die vielen Menschen gefiel, nun aber Angst hatte, dazu niemals wieder in der Lage zu sein. Sie sagte, das wäre den Leuten egal. Es war nicht böse gemeint. Sie wollte damit nicht sagen, dass ihnen meine Musik egal war. Sie glaubte, dass es ihnen egal war, weil sie mich ja nicht kannten, und dass es genauso wichtig war, gesund zu werden. Daraufhin musste ich weinen. Sie fragte, was sie für mich tun könnte, aber ich wusste keine Antwort. Ich wollte sie in meiner Nähe haben, weil ich mich bei ihr sicher fühlte.
Irgendwann verschwand Gene aus meinem Leben. Dafür gab es mehrere Gründe. Aber entscheidend war Melinda: Nachdem wir uns kennengelernt hatten und sie sich ein Bild von meiner Situation gemacht hatte, wurde ihr klar, dass Gene nicht gut für mich war. Vielleicht hatte er mir früher mal geholfen, aber nun schadete er mir nur noch. Zum Glück rief Melinda meine Mutter und meinen Bruder an und half, Beweismaterial gegen ihn zu sammeln. Carl beriet sich mit seinem Anwalt, wie man mich aus meiner Lage befreien konnte, und bald fasste ich wieder Mut. Dennoch blieb Dr. Landy noch eine Weile bei mir. Er mischte sich in meine Musik ein. Einmal hatten wir einen richtigen Streit. Ich hatte herausgefunden, dass er mir für seine Behandlung inzwischen fast fünfundzwanzigtausend Dollar im Monat berechnete. An die genaue Summe erinnere ich mich nicht. Hinzu kamen alle möglichen Extrakosten. Er wohnte in meinem Haus in Pacific Palisades und baute es mit meinem Geld um. Dann flog er mit seiner ganzen Familie für einen Monat nach Hawaii und schickte mir die Rechnung. Sein monatliches Honorar stieg immer weiter. Ende der 1980er schaute ich mir mal eine Rechnung an: dreißigtausend Dollar. Anfang der 1990er waren es schon fünfunddreißigtausend. Ich konnte nicht länger den Mund halten. »Was ist das für eine Rechnung?«, fragte ich. Er sah mich an, als würde er die Frage nicht verstehen. »Ich dachte, ich berechne mal ein bisschen mehr«, erklärte er schließlich. Daraufhin verlor ich die Geduld mit ihm. Und ich wusste, dass seine Tage gezählt waren.
Nachdem Gene endgültig weg war, musste ich wieder auf die Beine kommen. In mancher Hinsicht fühlte ich mich überglücklich. Als wäre mir eine Zentnerlast von den Schultern genommen worden. Selbst meine Schritte waren unbeschwerter. Dennoch war ich an manchen Tagen so deprimiert, dass ich das Haus nicht verlassen konnte. Ich schaffte es nicht mal, ins Restaurant oder ins Kino zu gehen. Wütend zu werden, machte die Situation erträglicher, aber ich hätte nicht sagen können, warum ich eigentlich wütend war. Ich warf mit Sachen um mich, trat nach Dosen, aber das löste das Problem natürlich auch nicht. Langsam wurde ich wieder ich selbst, auch wenn es eine Weile dauerte. Immerhin hatte ich neun furchtbare Jahre erlebt.
Oder waren es dreißig Jahre? Ich habe keine Ahnung, wie weit ich zurückgehen muss, um die Linie zu ziehen, die zu Landy führte. Aber ich kann mich an einen Punkt erinnern, durch den sie führen muss. Es war 1964, um die Weihnachtszeit. Ich flog mit der Band nach Houston, wo wir ein Konzert in der Music Hall geben sollten. Einige Tage zuvor waren wir nach einem Gig in der neuen Konzerthalle von Tulsa nach Los Angeles zurückgekehrt. Im Flughafen hatte ich plötzlich das Gefühl, den Halt zu verlieren. Zuerst dachte ich, meine Ehe wäre der Grund. Marilyn und ich hatten erst vor wenigen Wochen geheiratet. Wir waren noch jung, ich war zweiundzwanzig, Marilyn gerade mal sechzehn. Ich war glücklich, dass wir verheiratet waren, hatte aber auch Angst. Ich machte mir viele Gedanken über die Liebe. Woher weiß man, ob man für den anderen wirklich der oder die Richtige ist? Ein paar Monate vorher hatten Marilyn und ich uns mit den Jungs aus der Band getroffen, und mir war aufgefallen, dass sie sich mit meinem Cousin Mike Love ein bisschen zu nett unterhalten hatte. Nachts musste ich immer noch daran denken.
»Magst du ihn?«, fragte ich sie.
»Klar«, sagte sie. »Er ist echt nett.«
»Nein. Ich meine, gefällt er dir?«
»Das ist doch albern.«
»Ach, ja? Sag die Wahrheit.«
Marilyn hatte mich zwar beruhigen können, aber am Flughafen fiel mir die Geschichte wieder ein.
Aber das war nur ein Teil in einem Puzzle, das schneller auseinanderfiel, als ich es zusammensetzen konnte. Die Band feierte Riesenerfolge. Wir waren mehr als berühmt. Als wir 1962 mit »Surfin’ Safari« in Schweden auf Platz eins gelandet waren, hatten wir darüber gelacht. Platz eins in Schweden. Aber »Surfin’ Safari« stieg auch in den USA in die Top Twenty, und plötzlich produzierten wir nur noch Top-Ten-Hits: »Surfin’ USA«, »Surfer Girl«, »Be True to Your School«, »Fun, Fun, Fun«. Wegen den Beatles war es nahezu unmöglich, noch höher zu steigen. Im Februar 1964 traten sie in der Ed Sullivan Show auf, im April belegten ihre Singles die Plätze eins bis fünf der Billboard-Charts. In derselben Woche standen wir mit »Fun, Fun, Fun« auf Platz dreizehn. Im Mai veröffentlichten wir »I Get Around«, und die Single stieg in die Top Twenty, als die Spitzenpositionen von Künstlern wie den Dixie Cups (»Chapel of Love«), Mary Wells (»My Guy«) und den Beatles (»Love Me Do«) belegt waren.
Im Juli tat sich etwas in den Charts. Auf einmal standen nicht mehr die Dixie Cups, Mary Wells oder die Beatles an der Spitze, sondern wir. »I Get Around« war auf Platz eins gelandet, noch vor »My Boy Lollipop«. Ich konnte es nicht fassen. Unser Erfolg beschränkte sich nicht länger auf Schweden. »I Get Around« brachte uns außerdem die erste Goldene Schallplatte ein. Am erstaunlichsten war gar nicht mal, dass so viele Menschen unsere Single kauften. Es war das, was die Leute über unsere Platte sagten. Obwohl unsere Singles schon seit ein paar Jahren in den Charts gewesen waren, hieß es mit einem Mal, wir wären nach den Beatles das neue große Popwunder. Einige behaupteten sogar, wir wären besser als die Beatles und unsere Songs wären abwechslungsreicher, ausgefeilter und würden mehr positive Energien erzeugen.
Als wir im September »I Get Around« und »Wendy« in der Ed Sullivan Show spielten, ging die Hysterie richtig los. Wir trugen die gestreiften Hemden und weißen Hosen, die zu unserer Uniform werden sollten, das Beach-Boys-Pendant zum Beatles-Pilzkopf. So sind wir den Leuten im Gedächtnis geblieben. Das Bühnenbild war total abgefahren. Jemand hatte die Idee gehabt, Oldtimer aufzustellen. Wir spielten zwischen den Autos. Weil ich mich auf den Auftritt konzentrieren musste, bekam ich das Drumherum kaum mit, aber inzwischen habe ich die Aufzeichnung etliche Male gesehen. Ich fand es immer toll, dass die Mädchen so laut kreischen, wenn Dennis am Schlagzeug in Nahaufnahme gezeigt wird. Mike legte ein lustiges kleines Tänzchen hin, als Carl bei »I Get Around« das Gitarrensolo spielte. Einen Monat später traten wir mit vier Songs bei der T.A.M.I. Show auf. Das war ein irres Konzert: Außer uns standen die Miracles (mit Smokey Robinson, einem der besten Sänger und Songschreiber aller Zeiten), die Supremes (mit Diana Ross), Marvin Gaye, Lesley Gore, Jan & Dean, James Brown, die Rolling Stones und Chuck Berry auf dem Programm. Heute kann man sich ein solche Line-up nicht mehr vorstellen. Und wir waren mittendrin.
Der Erfolg war wunderbar, aber auch schwindelerregend. Am Anfang hatte ich nur mit meinen Brüdern und Freunden Musik machen wollen und das Geschäftliche meinem Vater überlassen. Wir waren in jeder Hinsicht eine Familien-Band. Aber in dem Jahr, in dem wir groß rauskamen, änderte sich alles. Mir machte es Angst. Alles ging so schnell. Ich war noch ein dummer kleiner Junge. Dass wir berühmt geworden waren, nahm ich gar nicht richtig wahr. Manchmal schon, aber meistens war ich zu sehr damit beschäftigt, Platten aufzunehmen, Stücke zu schreiben und auf Tournee zu gehen, anstatt einmal Luft zu holen und über alles gründlich nachzudenken. Ich spürte nur diese Aufregung, die einem Übelkeit verursachen konnte. Wir kletterten immer weiter nach oben, aber was erwartete einen, wenn es zu hoch hinausging? Was, wenn man stürzte? Ich bekam Angst, wurde nervös, schloss die Augen und versuchte, tapfer zu sein.
An dem Tag im Dezember, als wir am Gate auf den Flug nach Houston warteten, verließ mich der Mut. »Ich steige nicht ins Flugzeug«, sagte ich zu den anderen.
»Aber wie sollen wir sonst nach Houston kommen?«, fragte Mike.
»Ich kann da nicht rein.« Ich rief meine Mutter an und bat sie, mich abzuholen. Sie lachte und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Aber das half genauso wenig, wie die Augen zuzumachen.
Wir stiegen ins Flugzeug. Es raste über die Rollbahn, schneller und schneller, hob ab und stieg in die Höhe. Was erwartete uns, wenn wir immer höher stiegen? Dennis redete über irgendein Mädchen, das er zurückrufen sollte. Carl sagte irgendwas über die Harmonien in »I Get Around«. Plötzlich schwärmten meine Gedanken in alle Richtungen, und ich wurde ohnmächtig. Ich hatte jedenfalls das Gefühl. Für alle anderen sah es so aus, als würde ich schreien, mir die Hände vors Gesicht schlagen und in den Mittelgang fallen.
In Houston fuhren wir direkt ins Hotel. In meinem Zimmer wurde ich etwas ruhiger, was aber nicht hieß, dass ich mich tatsächlich beruhigte. Mike und Carl kamen zu mir. Ich starrte das Fenster an, als wäre es eine Wand. Mir ging unendlich viel durch den Kopf, aber nichts ergab einen Sinn.
Am nächsten Tag flog ich nach Hause zurück, während der Rest der Band blieb und die Auftritte absolvierte. Am nächsten Abend in Dallas sprang Glen Campbell für mich ein, und die Band reiste mit ihm weiter nach Omaha, Des Moines, Indianapolis und Louisville. Als sie wieder in L.A. waren, berief ich ein Treffen ein. »Ich werde nicht mehr mit der Band spielen«, verkündete ich.
»Du steigst aus?«, fragte Carl.
»Nein. Ich will nur nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich will zu Hause bleiben und komponieren.«
Zuerst glaubten sie mir nicht, aber ich wiederholte es so lange, bis sie es taten. Glen sprang noch ein paar Mal für mich ein, aber dann startete er eine Solokarriere, und die Band heuerte Bruce Johnston an. Bruce war Produzent bei Columbia Records und spielte in der Band Rip Chords. Seine Falsettstimme war meiner sehr ähnlich.
Ich blieb zu Hause und komponierte. Am Anfang war es fantastisch. Ich arbeitete an Stücken, von denen ich glaubte, sie könnten musikalische Grenzen verschieben. Aus den Stücken entstanden die Alben The Beach Boys Today! und Summer Days (And Summer Nights!!), dann verwandelten sie sich in Pet Sounds, aus Pet Sounds wurde SMiLE, und aus SMiLE wurde nichts. In der Zwischenzeit wurde der Druck wieder stärker. Ich hatte wieder Blackouts. Auch die Stimmen in meinem Kopf hörte ich immer häufiger. Ich versuchte, wunderbare Musik zu machen, die Band probte von morgens bis abends, und ich wurde mit dem Druck nicht fertig. Ich konnte die Zeit, in der ich mir alleine Songs ausdachte, und die Zeit, in der ich die Songs mit anderen spielte, nicht in Einklang bringen. Dass ich es auf der Bühne nicht mehr hinbekam, wusste ich, aber an manchen Tagen hatte ich den Eindruck, es auch im Studio nicht mehr zu schaffen.
Ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden konnte. Den anderen in der Band erzählte ich nichts. Vielleicht habe ich es ein, zwei Mal versucht, aber an ihren Blicken konnte ich ablesen, dass sie mich nicht verstanden. Einmal habe ich es meinem Vater erzählt, aber er runzelte nur die Stirn und sagte: »Stell dich nicht so an. Du bist kein Baby. Geh da rein und schreib ein paar gute Stücke.«
Und das tat ich. Ich schrieb ein paar gute Stücke. Und fiel langsam in ein schwarzes Loch. Später, sehr viel später, standen mir Leute zur Seite, die sich mit mir zusammen überlegten, was in einer solchen Situation zu tun war. Damals hatte ich dieses Netzwerk nicht. Stattdessen hatte ich Probleme. Leute, die mitbekamen, was ich so trieb, schauten weg. Dann hieß es nur: »Ach, Brian ist ein bisschen exzentrisch« oder »Brian ist eben Brian«. Aber niemand versuchte zu ergründen, was in meinem Kopf los war, oder half mir, aus dem schwarzen Loch herauszufinden.
Als Dr. Landy ging, entließ er mich in die Freiheit. Zuerst wusste ich nichts mit ihr anzufangen. Mein Leben war jahrelang im selben Trott verlaufen, und es war eine enorme Erleichterung, endlich herauszukommen. Ich hing in einer Art Warteschleife fest, und das meine ich nicht negativ. Meistens traf ich mich mit Melinda. Wir gingen essen und fuhren durch die Gegend. Fast jeden Abend landeten wir auf dem Hollywood Boulevard und gingen ins Kino. Melinda lachte über mich, weil ich wie ein kaufsüchtiger Tourist Hunderte von Dollar für Souvenirs ausgab. Manchmal schalteten wir das Radio ein: K-Earth 101. Das ist ein Oldie-Sender aus L.A. mit enormer Reichweite. Im Süden reicht er bis nach San Diego, im Norden bis nach Bakersfield. Als wir mit unserer Musik anfingen, hieß der Sender Boss Radio. Der Betrieb wurde 1941 aufgenommen, kurz vor meiner Geburt. Der Sendemast steht auf dem Mount Wilson, der zu den Saint Gabriel Mountains gehört. Ich bin nicht nach dem Berg benannt, und er ist nicht nach mir benannt. Nur ein lustiger Zufall. Abends hörten Melinda und ich Musik von Johnny Mathis, Nat King Cole, Randy Newman oder Kenny G.
Musik umkreiste mich als Idee. Nach Landys Weggang war Andy Paley einer der Ersten, die ich anrief. Andy blickt in der Popmusik auf eine lange Geschichte zurück. Er hat mit etlichen Leuten zusammengearbeitet und auch bei meinem ersten Soloalbum mitgewirkt. Wenn Landy der Bösewicht ist, dann ist Andy einer der Helden. Sobald ich das Gefühl hatte, wieder Musik machen zu wollen, rief ich ihn an. »Lass uns ein paar Stücke schreiben«, sagte er.
Wir schrieben den Song »Soul Searchin’«. Wir schrieben »Desert Drive«. Wir schrieben »You’re Still a Mystery«. Beim Komponieren hatten wir die Beach Boys im Hinterkopf, weil der Produzent und Bassist Don Was unbedingt ein Beach-Boys-Album machen wollte. Der Plan ging nicht auf, weil Carl die Songs nicht mochte – warum, weiß ich auch nicht. Dann wollte Sean O’Hagan von den High Llamas das Album mit uns machen. Dazu kam es auch nicht. Am Ende zerfaserte das ganze Projekt. Als wir noch an den Songs gebastelt hatten, benutzten wir weder die Aufnahmegeräte eines großen Studios noch den Vier-Spur-Rekorder bei mir zu Hause. Wir nahmen die Stücke mit einem Ghettoblaster auf. Waren sie sozusagen pflückreif, mieteten wir uns für ein paar Stunden in einem Studio ein. Ich rief Freunde an, wie Danny Hutton, der bei Three Dog Night gesungen hatte, und er kam vorbei und half, die Songs auszuarbeiten. Es fühlte sich fast so an wie in der guten alten Zeit, wie Freiheit. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, es alleine zu schaffen. Ich brauchte Andy an meiner Seite oder jemanden, dem ich vertraute und der mir Mut machte. Ich hatte Mordsangst, neue Musik zu machen. Eine Mischung aus Angst und Aufregung – das war es für mich eigentlich immer. Ich sah kein Album vor mir. Ich wusste nicht, was am Ende dabei herauskommen würde.
Manchmal spielte ich Dr. Marmer ein neues Stücke vor. Steve Marmer – so hieß der Arzt, bei dem ich nach Landys Weggang in Behandlung war. Er war einer der Menschen, die mir halfen, das seelische Gleichgewicht wiederzufinden. Wenn man gegen eine psychische Krankheit ankämpft, sind angeblich drei Faktoren entscheidend: Man muss das richtige Netzwerk, die richtigen Medikamente und den richtigen Arzt finden. Dr. Marmer war der richtige Arzt. Dr. Landy hatte sich in meine Musik eingemischt. Er hatte sich in alles eingemischt und mich unter Druck gesetzt. Dr. Marmer redete mit mir. Erzählte ich ihm, ich würde an Musik denken, sagte er, das sei eine gute Idee. Spielte ich ihm einen neuen Song oder eine Melodie vor, ermutigte er mich, weiterzumachen. Oft sprachen wir über meine Gedanken und Gefühle, manchmal nur über Musik. Nicht nur über meine Musik, auch über klassische Stücke oder Sänger, die wir beide mochten. Viele meiner Gedanken und Gefühle – auch solche, die ich zu unterdrücken versuchte – wurden erst deutlich, wenn ich über Musik redete. Später schaute Dr. Marmer sich eins meiner Konzerte an und war überglücklich. Er konnte kaum glauben, dass der Mensch auf der Bühne und der Mensch in seinem Sprechzimmer ein und dieselbe Person waren. Er konnte kaum glauben, dass ich alles so gut im Griff hatte. In Wahrheit werde ich mich auf der Bühne nie richtig wohlfühlen, aber heute weiß ich, wie ich einen Auftritt durchstehen kann. Und ob ich mich dort nun wohlfühle oder nicht, auf der Bühne kann ich immerhin ich selbst sein.
Ende 1993 rief mich Van Dyke Parks an. Tatsächlich hatten wir in den späten 1960ern bei SMiLE gar nicht so intensiv zusammengearbeitet, aber Anfang der 1970er »Sail on, Sailor« gemeinsam geschrieben. 1993 meldete er sich und fragte, ob ich bei einem seiner Songs die Leadstimme übernehmen wollte. Wie er meinte, passte das Stück perfekt zu mir. Es hieß »Orange Crate Art«. Er hatte es geschrieben, weil Orangen zum kalifornischen Lebensstil dazugehören, aber auch, weil die Leute immer behaupten, auf Orange würde sich nichts reimen. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Song wirklich singen wollte, deshalb besuchte er mich, um mich zu überzeugen. Natürlich merkte er sofort, dass ich gerade nichts anderes zu tun hatte. Ich saß nur im Schlafzimmer und schaute auf den Fernseher. Tatsächlich sah ich mir keine Sendung an. Ich schaute nur auf das Gerät und dachte an alle Sendungen, die dort früher gelaufen waren, und an alle Shows, die ich jemals gesehen hatte.
Van Dyke überredete mich, mit ins Studio zu kommen und etwas aufzunehmen. Das Equipment erinnerte mich an meinen Fernseher. Ich dachte an all die Sachen, die dort früher gelaufen waren. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich nun damit anfangen sollte. »Warum bin ich noch mal hier?«, fragte ich ihn. Er lachte. »Weil ich den Klang meiner eigenen Stimme hasse.«
Erst sang ich nur den einen Song, dann noch einen und noch einen. Damit hatte ich nicht gerechnet, und manchmal machte mich das so nervös, dass mir schlecht wurde, aber am Ende hatten wir ein ganzes Album zusammen. Es hieß wie der Song: Orange Crate Art