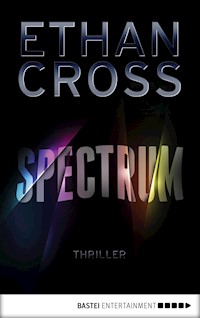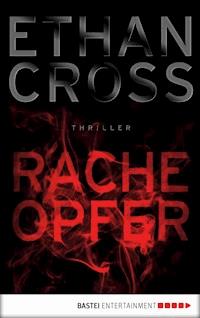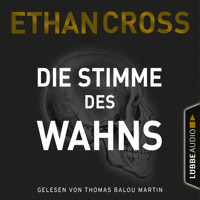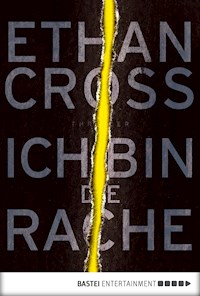
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Shepherd Thriller
- Sprache: Deutsch
Oft schon hat der Serienmörder Francis Ackerman jr. seinem Bruder, dem Regierungsagenten Marcus Williams, und dessen Kollegen geholfen, die grausamsten Verbrechen aufzuklären. Mittlerweile ist dem Killer das Agenten-Team der Shepherd Organization sogar irgendwie ans Herz gewachsen. Als die Shepherd-Agentin Maggie in die Hände des berüchtigten Serientäters "The Taker" fällt, nimmt Ackerman deshalb sofort die Verfolgung auf. Die Suche führt ihn und Marcus tief in das Herz eines Indianerreservats in New Mexico. Um den Taker aus seinem Versteck zu locken und Maggie zu retten, zettelt Ackerman einen blutigen Krieg an - einen Krieg, der viele Opfer fordern wird. Auf beiden Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumErster TeilKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Zweiter TeilKapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Dritter TeilKapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Vierter TeilKapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77Kapitel 78Kapitel 79Kapitel 80Kapitel 81Kapitel 82Kapitel 83Kapitel 84Kapitel 85Kapitel 86Kapitel 87Kapitel 88Kapitel 89Kapitel 90Kapitel 91Kapitel 92Kapitel 93Kapitel 94Kapitel 95Kapitel 96Kapitel 97Kapitel 98Kapitel 99Kapitel 100Kapitel 101Kapitel 102Kapitel 103Kapitel 104Kapitel 105Kapitel 106Über dieses Buch
Oft schon hat der Serienmörder Francis Ackerman jr. seinem Bruder, dem Regierungsagenten Marcus Williams, und dessen Kollegen geholfen, die grausamsten Verbrechen aufzuklären. Mittlerweile ist dem Killer das Agenten-Team der Shepherd Organization sogar irgendwie ans Herz gewachsen. Als die Shepherd-Agentin Maggie in die Hände des berüchtigten Serientäters »The Taker« fällt, nimmt Ackerman deshalb sofort die Verfolgung auf. Die Suche führt ihn und Marcus tief in das Herz eines Indianerreservats in New Mexico. Um den Taker aus seinem Versteck zu locken und Maggie zu retten, zettelt Ackerman einen blutigen Krieg an – einen Krieg, der viele Opfer fordern wird. Auf beiden Seiten.
Über den Autor
Ethan Cross ist das Pseudonym eines amerikanischen Thriller-Autors, der mit seiner Frau, drei Kindern und zwei Shih Tzus in Illinois lebt. Nach einer Zeit als Musiker nahm Ethan Cross sich vor, die Welt fiktiver Serienkiller um ein besonderes Exemplar zu bereichern. Francis Ackerman junior bringt seitdem zahlreiche Leser um ihren Schlaf und geistert durch ihre Alpträume. Neben der Schriftstellerei verbringt Ethan Cross viel Zeit damit, sich sozial zu engagieren, wobei ihm vor allem das Thema Autismus sehr am Herzen liegt.
ETHAN CROSS
ICH BIN DIERACHE
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Aaron Brown
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Taker«
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, USA
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: © STILLFX/shutterstock
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6088-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Erster Teil
Kapitel 1
Maggie Carlisle schrie und schrie, als sie auf einem Meer aus bleichen Knochen erwachte. Manche waren spröde und zerbarsten unter ihrem Gewicht, sodass Wolken aus Staub und Sporen emporstoben, die sich als widerliche dünne Schicht auf ihr Gesicht legten. Andere waren hart, feucht und klebrig und verströmten Verwesungsgeruch.
Kreischend warf Maggie sich herum und würgte von dem Gestank, der das Erdloch erfüllte. Als sie sich vor Ekel verkrampfte, durchzuckte Schmerz ihre Hüfte. Sie riss ihr Shirt hoch und sah, dass ein Rippenknochen in ihr Fleisch eingedrungen war. Schaudernd fragte sie sich, ob es besser wäre, den Knochen herauszuziehen, der im trüben Licht bleich schimmerte.
Trübes Licht?
Erst in diesem Augenblick wurde Maggie bewusst, dass sie sehen konnte, obwohl es hier unten stockdunkel gewesen war, als ihr Entführer den sandbedeckten Blechdeckel weggezogen hatte, unter dem sich seine sieben Meter tiefe persönliche Kammer des Schreckens verbarg.
Fieberhaft machte Maggie sich auf die Suche nach der Lichtquelle, kroch auf das schwache Leuchten zu, bis sie die Handlampe fand. Die Lampe benötigte keine Batterie; sie wurde mechanisch betrieben, indem man an einer Kurbel drehte. Maggie bemerkte, dass der Lichtstrahl bereits schwächer wurde. Erlosch die Lampe, würde sich wieder Finsternis ausbreiten, erfüllt von Staub und Gestank.
Vielleicht wäre es besser so, ging es Maggie durch den Kopf, denn der Anblick, der sich ihr bot, war kaum zu ertragen. Dem Verwesungsgestank allerdings würde sie auch in der Dunkelheit nicht entrinnen.
Im gelben Licht der Lampe sah Maggie, dass der gesamte Boden der tränenförmigen Höhle mit Knochen und anderen Überresten bedeckt war, die allesamt menschlicher Herkunft zu sein schienen. Die meisten Knochen waren weiß und trocken, ohne eine Spur von Blut oder Gewebe. Andere schimmerten feucht und stanken nach Verwesung. Maggie sah schwarze Käfer, die über die frischen Leichen wimmelten und sich am verrottenden Fleisch mästeten. Sie schloss die Augen und sehnte die Finsternis herbei, um das Festmahl der Insekten nicht mit ansehen zu müssen. Doch sie wusste, sie hätte dieses grauenhafte Bild auch im Dunkeln vor Augen. Der Gedanke, die schwarzen Käfer könnten sich in der Finsternis unter ihre Haut fressen und ihr Mahl fortsetzen, war so schrecklich, dass Maggie so heftig würgen musste, dass ihr Tränen über die Wangen liefen.
Sie beschloss, den Rippenknochen in der Wunde stecken zu lassen, denn sie fürchtete Blutverlust und Dehydrierung mehr als eine Infektion – obwohl es letztendlich wohl keine Rolle spielte. Maggie glaubte nicht, jemals wieder aus dieser Gruft herauszukommen.
In diesem Augenblick erlosch das Licht. Nach einer Schrecksekunde nahm Maggie alle Energie zusammen und kämpfte darum, ihre körperlichen Reaktionen in den Griff zu bekommen. Entschlossen schob sie die Gedanken an ihren bevorstehenden Tod beiseite, konzentrierte sich auf Erinnerungen an glückliche Zeiten und versuchte, die Abscheulichkeiten um sie her wenigstens für kurze Zeit zu vergessen.
Inmitten von Verfall und Dunkelheit richtete sie ihre Gedanken auf Tommy, ihren kleinen Bruder, und auf Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit. Sie hatten gern Verstecken gespielt, sie beide, getrieben vom kindlichen Ehrgeiz, den anderen zuerst aufzustöbern. Einmal war Tommy auf der Farm ihrer Großeltern bis hinauf unters Dach der Scheune geklettert, um sich dort zu verstecken, hatte aber kapituliert, als Maggie ihn fand, und seine Niederlage eingestanden.
Doch einige Zeit später, nachdem Tommy entführt worden war, hatte Maggie einsehen müssen, dass sie sich nicht halb so gut auf das Entdecken verschwundener Menschen verstand, wie sie geglaubt hatte.
Inzwischen hatte sie viele Jahre der vergeblichen Suche nach ihrem verschollenen Bruder und dessen Entführer hinter sich, ohne nennenswerte Fortschritte gemacht zu haben. In jüngster Zeit jedoch hatte sie Hilfe aus denkbar unwahrscheinlichen Quellen erhalten. Zum einen von Francis Ackerman jr., dem berüchtigten Serienkiller, der nun in Diensten der Regierung stand. Ackerman hatte mit seinem scharfen Verstand alte Unterlagen analysiert, bei denen Maggie trotz intensiven Studierens und Brütens nicht weitergekommen war, und darin mehrere Hinweise entdeckt, die bislang übersehen worden waren.
Maggies zweite Hoffung war ein Foto, das man ihr ein paar Monate zuvor anonym mit der Post zugeschickt hatte und das auf der Rückseite mit Initialen oder ähnlichen Kürzeln beschriftet war. Es war eine rätselhafte Aufnahme, stellte aber die womöglich einzige Chance Maggies dar, das Schicksal ihres verschwundenen Bruders vielleicht doch noch aufzuklären.
Maggies Gedanken schweiften zu Ackerman, dem Serienmörder, der inzwischen die Seiten gewechselt hatte und ihr Verbündeter geworden war. Inzwischen arbeitete Ackerman, so wie Maggie, für die Shepherd Organization, deren Aufgabe darin bestand, die gefährlichsten Psychopathen der Welt zur Strecke zu bringen, gegen die es sonst keine Mittel gab, weder juristischer noch kriminalistischer Art. Ackerman hatte Hunderten von Menschen das Leben gerettet, darunter Maggie selbst. Sie bezweifelte keine Sekunde, dass Francis Ackerman jr. ein anderer war als zu der Zeit, die er selbst als seine »dunklen Jahre« bezeichnete – und ein vorurteilsfreierer Mensch als Maggie hätte vielleicht den nächsten Schritt getan und einen neuen Anfang mit ihm gewagt. Doch Maggie brachte es einfach nicht fertig. Sie konnte sich nicht dazu überwinden, Ackerman seine Verbrechen zu vergeben, zu denen auch der Mord an einem ihrer engsten Freunde gehörte.
Umso mehr staunte Maggie über Frauen wie Emily Morgan. Ackerman hatte ihren Mann ermordet und sie selbst entführt; dennoch war Emily von seinem Opfer zu seiner Psychologin und später zu einer engen Freundin geworden. Maggie jedoch verabscheute Ackerman, obwohl sie ihm ihr Leben verdankte und fest daran glaubte, dass er ein anderer, besserer Mensch geworden war.
Doch Gefühle hin oder her – als Special Agent Maggie Carlisle nun in undurchdringlicher Dunkelheit auf einem Meer aus verrottenden Knochen trieb, tröstete sie allein der Gedanke, dass Ackerman ihre Überreste finden und die Bestie töten würde, die ihr den Bruder geraubt hatte und die nun auch für ihren Tod verantwortlich sein würde. Den Mann, den sämtliche Fahnder nur als den »Taker« kannten.
Maggie wusste, dass Ackerman dem Taker keine Gnade entgegenbringen würde. Ackerman war ein Jäger. Man brauchte ihm nur eine Zielperson und einen triftigen Grund zu nennen, in Aktion zu treten. Ließ man ihn dann von der Leine, war die Beute so gut wie tot.
Wenn Ackerman ihre Überreste in diesem Massengrab fand, würde er den Taker dafür büßen lassen, das wusste Maggie.
Doch selbst wenn Ackerman auf Rache verzichtete – den Mann, den Maggie liebte, konnte keine Macht auf Erden davon abhalten, den Taker zur Rechenschaft zu ziehen.
Special Agent Marcus Williams war Ackermans Bruder und selbst ein höllisch gefährlicher Mann. Zugleich war er aufrichtig, humorvoll und treu wie Gold. Maggie zweifelte keine Sekunde daran, dass Marcus für sie sterben würde, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.
Umso stärker schmerzten sie ihre Schuldgefühle. Denn sie war nicht zufällig in diese Situation geraten. Sie hatte sie selbst herbeigeführt. Aber Maggie war keine andere Möglichkeit eingefallen, das Ungeheuer, das ihren Bruder entführt hatte, aus der Reserve zu locken. Sie hatte sich ihm als Opfer anbieten müssen.
Maggie wusste, dass Marcus und Ackerman sich schnell und gnadenlos des Takers annehmen würden. Das Spiel war bereits gewonnen, der Fall praktisch abgeschlossen. Durch ihren Tod würde sie, Maggie, der Gerechtigkeit den Weg ebnen. Wenn sie an das Meer aus Knochen dachte, die um sie herum verrotteten, und an die vielen Leben, die der Taker geraubt hatte, erschien ihr die eigene Existenz als geringer Preis. Hauptsache, es wurden nicht weitere Familien zerstört, weiteres Blut vergossen, weitere Geschwister auseinandergerissen.
Bald hatten die Perversionen des Takers ein Ende. Bald würden seine Opfer gerächt sein.
Bald schmorst du in der Hölle, verfluchtes Monster.
Kapitel 2
Zwei Tage später
Nachdem Liana Nakai im Alter von acht Jahren zum ersten Mal den Spielfilm Annie gesehen hatte, betete sie zum Großen Geist, er möge sie aus dem Reservat holen, damit sie bei einem reichen Weißen leben könne wie das Waisenmädchen in dem Film.
Als Liana am Morgen nach dem Kinobesuch mutterseelenallein im elterlichen Hogan aufwachte, dem traditionellen Haus der Navajo-Indianer, hatte sie das Schlimmste befürchtet und geglaubt, ihrem Volk würde ihretwegen eine bittere Lehre erteilt. War die Navajo-Geschichte von dem Mädchen, das die Welt wegwünschte, durch sie, Liana, Wirklichkeit geworden? War sie jetzt ganz allein?
Zu Lianas unendlicher Erleichterung stellte sich bald heraus, dass ihre Mutter nur aufs Feld gegangen war, um den blauen Mais zu wässern, den ihre Familie im Tal anbaute. Lianas Ängste hatten sich als unbegründet erwiesen, als flüchtige Schatten. Dennoch wurde die junge Navajo monatelang von Albträumen geplagt.
Seitdem waren Jahre vergangen, und Liana – inzwischen Police Officer im Indianerreservat – war davon überzeugt, die Lektion von damals gelernt zu haben. Doch sie schien das Pech zu haben, jedes Mal den falschen Wunschträumen nachzuhängen. Damals, als kleines Mädchen, war es der Traum gewesen, von einem reichen Weißen aus der Armut im Reservat befreit zu werden. Diesmal, in jener folgenschweren Nacht, die ihrer aller Leben verändern sollte, war es der Wunschtraum, ein starker Mann möge erscheinen und sie, Liana, aus der Tristesse ihres Lebens befreien.
Es war die ereignisloseste Nacht der Woche und die langweiligste Schicht des Tages, als Liana wieder einmal zum Schreibtischdienst auf der Roanhorse Police Substation im Navajo-Reservat eingeteilt war. Die beiden anderen Beamten des winzigen Postens behandelten sie wie ein kleines Mädchen, das behütet werden musste, und hielten an der Tradition ihres Volkes fest, nach der männliche Krieger die schwachen Frauen zu beschützen hatten.
Sie unterschätzten Liana, und das verübelte sie ihnen. Körperlich konnte sie es mit ihren männlichen Kollegen aufnehmen, und was Verstand und Ausbildung betraf, war sie ihnen überlegen. Oft fragte sie sich, weshalb sie trotz ihres Abschlusses in Strafrecht wieder im Reservat gestrandet war und bei der Navajo Nation Police arbeitete, wo man ihr ein Viertel von dem bezahlte, was sie als Anwaltsgehilfin in einer Stadt der Bilagáana – das Navajo-Wort für »Weiße« – verdienen konnte.
Andererseits hatte sie einen triftigen Grund für ihre Rückkehr in die Reservation. Großmutter war krank und weigerte sich, das einzige Zuhause zu verlassen, das sie je gekannt hatte. Liana konnte es der alten Frau nicht verdenken. Die Vorstellung, unter Weißen zu leben, hatte sie selbst eingeschüchtert, zu Anfang jedenfalls. Viel Entscheidungsspielraum war Liana deshalb nicht geblieben. Sie konnte Großmutter ja schwerlich im Stich lassen, und die alternde Matriarchin gab nicht nach. Deshalb war Liana vorerst in dem Käfig gefangen, dem zu entkommen sie sich ihr bisheriges Leben lang abgestrampelt hatte.
Liana hatte eine langweilige Nacht erwartet, in der sie mal wieder so tun musste, als würde sie Berichte schreiben, während sie sich in Wahrheit die Zeit mit einem Hörbuch vertrieb, als es geschah: Eine Stunde nach Schichtbeginn flog die Tür des Polizeipostens auf, und der attraktivste Mann, den Liana je gesehen hatte, kam herein. Er trug Bluejeans, aber kein Hemd. Sein Oberkörper war nackt, sehnig und muskulös.
Und von oben bis unten voller Blut.
Lianas erster Gedanke war, dass der Fremde einen schlimmen Unfall erlitten hatte. Aber er schien keine Schmerzen zu haben und wirkte überhaupt nicht aufgeregt oder geschockt. Er schien vor nichts auf der Welt Angst zu haben. Ein Mann ohne Furcht.
Da stimmt was nicht, schrie es in Liana.
»Bleiben Sie ganz ruhig, Sir. Sagen Sie mir bitte, was passiert ist«, sprach sie ihn an. »Hatten Sie einen Unfall?«
»Wie kommen Sie darauf? Ach so, das Blut. Keine Bange, das ist nicht meins.«
»Aber … wessen Blut ist es dann?« Liana hatte die rechte Hand immer näher an den Taser geschoben, den sie an der Hüfte trug. Unbemerkt legte sie die Handfläche auf den Griff der Schockwaffe. »Sir, ich muss Sie bitten, mir Ihre Hände zu zeigen.«
Der Mann reagierte nicht. »Wie viele Officers sind zurzeit im Dienst?«, fragte er stattdessen. »Sind Sie hier die Einzige?«
»Zeigen Sie mir Ihre Hände. Sofort!« Liana zog den Taser und richtete ihn auf den gut aussehenden Fremden.
Der Fremde grinste. »Kein besonders netter Empfang, Blume der Apachen.«
»Ich bin Navajo«, rief Liana empört.
»Tja«, sagte der Fremde. »Shit happens. Sagen Sie mal, wenn ich ein Verbrechen melden möchte, muss ich da ein Formular ausfüllen?«
Liana zielte mitten auf die Brust des blutüberströmten Mannes. Mit der freien Hand knipste sie das Funkgerät an ihrer Schulter ein. »Hier Officer Nakai, Roanhorse. Ich brauche Verstärkung. Sofort.«
Die Stimme eines Kollegen antwortete. »Pitka hier. Bin in zwei Minuten bei dir. Was ist los?«
»Möglicherweise ein Mord. Beeil dich! Ich …« Liana versagte die Stimme.
Der blutüberströmte weiße Mann sah sich derweil in dem winzigen Posten um, als hätte er etwas Alltägliches zu erledigen; als wollte er eine Ruhestörung melden oder den Diebstahl seines Rasenmähers anzeigen.
Liana riss sich zusammen. »Ich bitte Sie nicht noch einmal, Sir. Heben Sie die Hände. Schön langsam. Keine plötzliche Bewegung.«
Der Fremde verdrehte die Augen, gehorchte dann aber und hob die Arme. Unter dem schimmernden Blut auf seiner nackten Haut spielten seine beeindruckenden Muskeln.
Liana stutzte, als sie in seinen Händen etwas Silbernes funkeln sah. Was ist das?
»Was haben Sie da in den Händen?«, fragte sie. »Fallen lassen, oder ich drücke ab!«
»Ich fürchte, das könnte ein Problem werden. Wissen Sie, die Dinger sind an meinen Handflächen festgeklebt.«
»Aber … wieso?« Liana war verwirrt. Im Polizeihandbuch stand nicht, wie man mit einem erkennbar Verrückten umgehen sollte, zumal in einer solchen Situation, und die Ausbildung an der Akademie half ihr auch nicht weiter. Liana war ratlos. Also hielt sie den Taser weiter auf den blutüberströmten Fremden gerichtet in der Hoffnung, dass endlich Ernie Pitka erschien, ihre Verstärkung.
Der Fremde sagte: »Oh, die habe ich selbst festgeklebt.«
Liana erstarrte. »Aber … warum? Und von wem ist das viele Blut?«
Der halbnackte Fremde lächelte. »Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich bin hier, um einen Mord zu melden.«
»Einen Mord?«
»Eigentlich sogar mehrere.«
Kapitel 3
Francis Ackerman jr. mochte die junge Beamtin der Navajo Nation Police auf den ersten Blick. Sie erinnerte ihn an die jugendliche Maya, an die er vor langer Zeit seine Unschuld verloren hatte. Aber da war noch mehr. Diese Indianerin hatte etwas an sich, das sie überaus anziehend machte – ein Funkeln in den Augen, ein inneres Feuer, das nur darauf wartete, entfacht zu werden und hell aufzulodern.
Der frühere Ackerman hätte es genossen, dieses innere Feuer mit Blut und Schmerzen langsam und genüsslich auszulöschen. Seine derzeitige Version, die er mittlerweile als »Ackerman 2.0« betrachtete, verspürte zwar auch das Verlangen, seine Macht zu demonstrieren und seine Überlegenheit durchzusetzen; auf der anderen Seite hatte er sich einem heiligen Auftrag verschrieben, der ihm ein hohes Maß an Selbstbeherrschung abverlangte.
Ackerman seufzte. Er wusste, er kam nicht daran vorbei, der jungen Indianerin physische Schäden zuzufügen – aber nur, weil es zum Plan gehörte, nicht zu seiner Erbauung. Natürlich würde er den Kick, den der Kampf ihm verschaffte, in vollen Zügen genießen, aber diesmal stürzte er sich nicht um des Vergnügens willen ins Handgemenge.
Und das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, ging es ihm durch den Kopf.
In diesem Moment meldete Officer Ernie Pitka – die Verstärkung, die Liana angefunkt hatte – mit atemloser Stimme über Funk, er sei jeden Augenblick bei ihr. Ackerman wusste nichts über die diensthabenden Officers und hatte keine Ahnung, ob die rasche Reaktion der Cops auf dessen Hingabe an den Polizeidienst zurückzuführen war oder ob zwischen Ernie und der jungen Polizistin etwas lief.
Ackerman speicherte diese Beobachtung zwischen Millionen anderen ab, um sie sich gegebenenfalls zunutze zu machen. Ihm war klar, dass seine Methoden und Machenschaften viele Menschen irritierten, aber die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten war nun mal eine Gerade. Wenn jemand, der ihm wichtig war, vermisst wurde, so wie jetzt, zögerte Ackerman nicht, jeden zu überrollen, der ihm auf dieser Geraden in die Quere kam.
Und diesmal standen ihm – ohne eigenes Verschulden – Liana und Ernie im Weg.
Die Tür flog auf, und ein untersetzter Indianer stürmte herein, verschwitzt, mit wirrem Blick, den Taser im Anschlag. Ernie Pitka war klein und muskulös und trug die erdfarbene Uniform der Navajo Nation Police. Er schwenkte den Taser wie ein Totem zur Abwehr böser Geister. Kaum erblickte er Ackerman, brüllte er: »Auf den Boden! Na los!«
Liana nutzte die Gelegenheit, um hinter dem Schreibtisch hervorzukommen und eine Position einzunehmen, in der sie ihrem Kollegen beistehen konnte. »Wird’s bald?«, rief sie. »Runter auf den Boden!«
»Ich hab aber keinen Bock«, sagte Ackerman.
»Auf den Boden, oder du kriegst eins mit dem Taser verpasst!«, brüllte Ernie.
Ackerman lachte. »Das wäre cool. Ich stehe total auf Elektroschocks. Nur muss ich Ihr nettes Angebot leider ablehnen, Kumpel. Kommen noch mehr von Ihrer Sorte, oder sind Sie beide heute Abend meine einzigen Spielgefährten?«
Ernie ignorierte Ackermans Bemerkung. »Ich sagte, auf den …«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, als Ackerman handelte. Eine kaum merkliche Bewegung beider Arme, ein Zucken der Handgelenke, und die Teleskopschlagstöcke, die er in beiden Händen hielt, schossen hervor. Es waren Waffen, wie sie an den Gürteln der meisten Polizeibeamten hingen. Kaum waren sie zu ihrer vollen Länge von fast einem Meter hervorgeschnellt, vergrößerten sie Ackermans Reichweite so sehr, dass der Abstand, den die beiden Cops zu ihm hielten, völlig bedeutungslos wurde.
Ackerman duckte sich leicht, wirbelte blitzschnell auf den Fersen herum und überraschte die beiden Cops damit völlig. Er hörte, wie ein Taser sich entlud und spürte, wie das Geschoss an seiner rechten Schulter vorbeizischte. Mit lautem Pochen gruben sich die dornigen Zinken in die Holzverschalung der Wand.
Ackerman reagierte gar nicht darauf. Er wusste, er wurde schnell und problemlos mit den beiden Gegnern fertig. Er beherrschte fast sämtliche Kampfsportarten und hatte seine Fähigkeiten im Lauf der Jahre an zahllosen und viel gefährlicheren Gegnern perfektioniert. Aber noch entscheidender war das psychologische Element: Aufgrund der neurochirurgischen Experimente, die sein wahnsinniger Vater an ihm vorgenommen hatte, kannte Ackerman keine Angst.
Früher war er voller Hass gewesen wegen der jahrelangen Folter durch seinen Erzeuger, und seine Wut auf die ganze Welt hatte ein Monster aus ihm gemacht – genau die perfekte Tötungsmaschine, zu der sein Vater ihn hatte formen wollen. Doch als Ackerman mit einem Bruder in Kontakt kam, von dem er bis dahin nichts gewusst hatte, änderte sich alles. Er erkannte, dass seine düstere Vergangenheit ihn auf genau jene gefahrvollen Missionen vorbereitet hatte, die er von nun an übernehmen sollte.
Und noch etwas war Ackerman bewusst geworden: Seine Furchtlosigkeit verschaffte ihm in fast jeder Situation einen Vorteil, denn er handelte einen winzigen Sekundenbruchteil schneller als alle anderen. Während seine Gegner einen Augenblick des Zweifels und der Unentschlossenheit durchlebten, analysierte Ackerman bereits die Situation und verhielt sich entsprechend.
Diesmal reagierte er, indem er sich auf dem Boden abrollte und mit dem Teleskopschlagstock einen kraftvollen Hieb auf Ernies Achillessehne führte. Als der Navajo zu Boden ging, drosch Ackerman ihm den anderen Schlagstock auf die Brust, trieb ihm die Luft aus der Lunge und setzte ihn vorübergehend außer Gefecht.
Liana feuerte einen Schuss ab, der Ackerman jedoch verfehlte. Er schleuderte einen der Schlagstöcke nach ihr. Die junge Navajo wurde von den Beinen gerissen, als die Metallwaffe sie in Höhe des Herzens traf, genau auf den Punkt.
Bevor der geschleuderte Schlagstock den Boden berührte, fischte Ackerman ihn aus der Luft und schmetterte ihn auf Lianas rechten Arm. Sie schrie auf. Ihr Taser fiel ihr aus der plötzlich kraftlosen Hand auf das stumpfe, abgetretene Linoleum, doch sie verbiss sich den Schmerz. Mit der Linken riss sie eine Dose Pfefferspray hervor, war aber viel zu langsam: Ackerman schlug ihr von hinten auf die Oberschenkel. Ihre Knie knickten ein, und sie ging erneut zu Boden. Leise klirrend rollte die Pfefferspraydose davon.
In diesem Moment hatte Ernie sich aufgerappelt, richtete die Glock 22 auf Ackerman und brüllte mit seltsam hoher Stimme: »Keine Bewegung!«
»Ach, Ernie …« Ackerman seufzte tief. Drei Sekunden später lag der junge Stammespolizist am Boden.
Als die beiden Cops sich stöhnend auf den Brettern wälzten, nahm Ackerman ihre Schusswaffen an sich, warf die Magazine und die Patronen in den Kammern aus, löste die Verriegelungen der Verschlüsse und trennte sie von den Griffstücken, was die Waffen vorerst unbrauchbar machte. Sobald das erledigt war, hob Ackerman die Taser auf und entfernte die Batterien, wobei er das Lied von Disneys sieben Zwergen vor sich hin pfiff: Heiho, heiho, wir sind vergnügt und froh.
Schließlich zog er sich einen Klappstuhl aus Stahlrohr heran, setzte sich und wartete, dass die beiden sich in ihre Niederlage fügten.
»Diese Dinger an Ihren Händen«, sagte Liana. »Die waren gar nicht angeklebt.«
»Wow!« Ackerman lächelte. »Sie sind ja ein kleiner Schnelldenker.«
»Wer sind Sie?«, fragte Liana mit zittriger Stimme.
»Haben Sie schon mal von der Büchse der Pandora gehört? Ich bin deren menschliche Version, sozusagen. Wenn Sie alles Böse, allen Schmerz und alle Schlechtigkeit, zu der Menschen fähig sind, über ein unschuldiges Kind ausschütten, und dieses Kind überlebt, kommt eine Kreatur wie ich dabei heraus. Ich bin die Quintessenz der schlimmsten Ungeheuer auf Erden. Ich bin die Nacht, erfüllt von einer Dunkelheit, die nur wenige gesehen haben, die aber alle fürchten.«
Liana starrte ihn an, als hätte er sich soeben zum wiedergeborenen Elvis erklärt. »Was … wollen Sie?«, fragte sie flüsternd.
Zur Antwort hielt er ihr beide Arme hin, als wollte er sie auffordern, ihm Handschellen anzulegen. »Ich bin hier, um mich zu stellen.«
Kapitel 4
Aus Gründen des Budgets gab es nur in den größeren Substationen der Navajo Nation Police Gefängniszellen, die diesen Namen verdienten. Die nächste Zelle befand sich in der mehr als hundert Meilen entfernten Polizeizentrale in Shiprock. Liana konnte sich nicht für die Aussicht begeistern, mit einem erkennbar geistesgestörten und obendrein brandgefährlichen weißen Mann auf dem Rücksitz mehr als zwei Autostunden fahren zu müssen. Hoffentlich erteilte der Captain ihr keinen entsprechenden Befehl, sobald er eintraf.
Liana und Ernie hatten den inzwischen gefügigen Angreifer in den kleinen Haftraum in einer Ecke der Roanhorse Substation gesperrt. Eine echte Zelle war es nicht, nur ein durch Gitter abgetrenntes Areal von zwei mal zwei Metern mit einer Pritsche an der Rückwand. Der Verschlag war nie dafür vorgesehen gewesen, Verbrecher festzuhalten. Die Officers in Roanhorse waren es einfach nur leid, zwei Stunden Autofahrt auf sich zu nehmen, um jemand in die Ausnüchterungszelle zu stecken. Ihr häufigster Kunde neigte dazu, Blase und Darm zu entleeren, ohne die Toilette aufzusuchen. Liana und Ernie hatten sich abgewechselt bei dem höchst undankbaren Job, den übelriechenden Streifenwagen zur Zentrale in Shiprock zu steuern. Doch vor die Wahl gestellt hätte Liana einen nach Fäkalien stinkenden Betrunkenen jederzeit einem blutüberströmten Irrsinnigen vorgezogen.
Der Fremde saß kerzengerade auf der Pritsche und ließ Liana und Ernie keine Sekunde aus den Augen. Die junge Navajo versuchte, den Ausdruck im Gesicht des Weißen zu deuten. Es war Neugier, in die sich ein Hauch von Spott mischte.
»Meine Güte«, murmelte Ernie. »So viel Blut.«
Ackerman zuckte die Achseln. »Man gönnt sich ja sonst nichts.«
»Wo ist das Blut her?«, fragte Liana. »Ist jemand verletzt? Haben Sie jemanden angegriffen?«
»Im Lauf der Jahre habe ich vielen Menschen furchtbare Dinge zugefügt, allerdings weit Schlimmeres als den Schaden, den ich heute Nacht zu verantworten habe.« Ackerman zuckte die Achseln. »Trotzdem werden mehrere Bewohner Ihres Kuhdorfes eine unvergessliche Nacht erleben. Und das ist erst der Anfang.«
»Was soll das heißen?«
»Gute Frage, aber ich fürchte, ich kann die Antwort nur dem Mann anvertrauen, der in diesem Kaff das Sagen hat.«
»Captain Yazzie ist unterwegs. Aber wenn Sie …«
»Ich meinte nicht Ihren vorgesetzten Officer, sondern den Mann, der die Fäden Ihres Vorgesetzten zieht.«
Liana dachte über diese Worte nach. In Roanhorse gab es nur einen, auf den diese Umschreibung passte: John Canyon, ihr aller Wohltäter, der den Ort gegründet hatte und fast sämtliche Einwohner auf seiner Ranch beschäftigte. Canyon hatte von seinem Vater eine kleine Schafzucht geerbt und eine der größten Schaf- und Rinderfarmen im Südwesten daraus gemacht. Jeder hier nahm stillschweigend hin, dass Canyon mit noch ganz anderen Dingen als mit Schafen handelte und dass nicht alle seine Aktivitäten legal waren.
Liana fragte sich, welche Verbindung der Fremde zu Canyon besaß. In was für dunkle Geschäfte mochte John Canyon verstrickt sein? Eines stand fest: Falls Canyon auf irgendeine Weise mit diesem narbigen Fremden zu tun hatte, würde Captain Yazzie die Sache persönlich in die Hand nehmen, um Canyon zu schützen.
Gleich an ihrem ersten Tag hatte Yazzie Liana ins Bild gesetzt, dass mit Canyon und der Ranch äußerst behutsam zu verfahren sei. Canyon war bei fast jedem im County beliebt und hatte beste Beziehungen sowohl zum Stammesrat als auch zur Regierung außerhalb der Reservatsgrenzen. Captain Yazzie hatte darauf bestanden, dass ihm jede Anzeige, jedes Problem, das mit John Canyon zu tun hatte, persönlich vorgelegt werden müsse. Sein Tonfall hatte deutlich gemacht, dass John Canyon über alle Zweifel erhaben und für den Arm des Gesetzes unantastbar sei, zumindest hier im Tal.
Liana hatte keine großen Probleme mit John Canyon, schon deshalb nicht, weil sie seinen Sohn Toby kannte. Sie seufzte. So lief es nun mal. Leute mit Geld und Macht manipulierten andere, um ihre Macht und ihren Reichtum zu vergrößern. Zumindest galt das für die Welt der Weißen, der Bilagáana. Deshalb hatte Liana John Canyon als notwendiges Übel akzeptiert. Außerdem musste sie ihm zugutehalten, dass Canyon illegale Umtriebe im County stärker eindämmte, als ein Cop es sich je erhoffen konnte. Trotzdem wurde sie den Gedanken nicht los, dass der Pakt, den Roanhorse mit dem Teufel geschlossen hatte, irgendwann die ganze Ortschaft ins Verderben reißen würde.
Sie schaute auf den seltsamen Fremden in der Ausnüchterungszelle und versuchte zu ergründen, welches Spiel er trieb. War zugleich mit diesem bedrohlichen Mann der Tag der Abrechnung gekommen?
Als die Hintertür des Postens sich öffnete und Captain Yazzie ins Office stapfte, fiel Liana ein Stein vom Herzen. Normalerweise spannte sie sich innerlich an, wenn Yazzie auftauchte; diesmal aber war sie froh, ihren Chef zu sehen.
Die hellbraune Uniform der Navajo Nation Police saß Yazzie wie angegossen. Der eins fünfundsechzig kleine Mann trug vom Hals abwärts die offizielle Dienstkleidung; der Revenger-Stetson aus Büffelleder allerdings, um den er ein Hutband aus der Haut einer Kupferkopfschlange gewunden hatte, widersprach sämtlichen Vorschriften. Die unvermeidliche John-Lennon-Brille mit kleinen Gläsern, die sich dem Licht anpassten, sodass er sie bei Tag und bei Nacht tragen konnte, draußen wie drinnen, verbarg seine Augen.
Der Captain kam zu ihr und tätschelte ihre Schulter. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Alles okay, Sir.«
»Wie gut, dass Pitka in der Nähe war.«
»Ich kann nicht behaupten, dass ich eine große Hilfe gewesen bin«, meldete Ernie sich betreten zu Wort. »Der Kerl hat uns fertiggemacht. Er sitzt nur deshalb in der Zelle, weil er von sich aus reinwollte. Ehrlich, Sir, das macht mir ’ne Scheißangst.«
»Beruhigen Sie sich, Officer«, entgegnete Yazzie. »Finden wir erst mal heraus, was hier los ist.«
»Da gibt es leider ein Problem, Sir«, sagte Liana. Sie hatte aus der Beobachtung des Gefangenen hundert Schlüsse gezogen und konnte sich tausend Möglichkeiten vorstellen, woher das Blut gekommen war, im Augenblick aber war ihr Kopf leer. »Der Fremde sagt, er spricht nur mit Mr. Canyon.«
Yazzies Gesicht wurde hart und abweisend. »Er hat sich namentlich nach Canyon erkundigt?«
Liana zuckte innerlich zusammen, als ihr klar wurde, dass ihr ein Fehler unterlaufen war.
Hat der Fremde Canyons Namen erwähnt? Oder habe ich nur meine eigene Schlussfolgerung ausgesprochen?
Liana versuchte, sich an das Gespräch zu erinnern, und antwortete schließlich: »Er sagte, er will mit dem Drahtzieher sprechen … oder so ähnlich.«
»Oder so ähnlich!«, rief Yazzie spöttisch. »Hat man Ihnen diesen bewundernswerten Scharfsinn auf der teuren Bilagáana-Schule beigebracht? Was genau hat der Kerl gesagt?«
Liana spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Hilfesuchend schaute sie zu Ernie, der seit der Junior High hinter ihr her war, doch Ernie zuckte nur hilflos mit den Schultern. »Der Gefangene sagte«, erklärte Liana schließlich, »dass er auf den Mann wartet, der die Fäden unseres Vorgesetzten zieht.«
»Was? Unser Gefangener spricht von jemandem, der meine Fäden zieht? Und Sie gehen sofort davon aus, dass Canyon damit gemeint ist? Eine interessante Schlussfolgerung.«
»Tut mir leid, Sir«, flüsterte Liana, den Kopf gesenkt. »Ich wollte damit nicht andeuten …«
Yazzie hob die Hand. »Es reicht, Nakai. Sie wurden angegriffen und können nicht mehr klar denken. Ich hätte Sie nicht bedrängen dürfen. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mir diese Geschichte aus erster Hand anhöre.«
Kapitel 5
Als der Möchtegern-Cowboy an die Gitterstäbe trat, hieß Ackerman ihn mit einem freundlichen Lächeln willkommen. »Ich würde Ihnen ja die Hand schütteln, Mister«, sagte er, »aber Ihre beiden Mitarbeiter haben darauf bestanden, mir Handschellen anzulegen.«
Yazzie gab keine Antwort, beobachtete Ackerman mit steinerner Miene. Der Ausdruck seiner Augen blieb hinter der runden Nickelbrille verborgen.
Ackerman fiel die Waffe auf, die der Captain an der Hüfte trug – ein Colt Peacemaker mit weißen Perlmuttgriffschalen. »Ihr Sechsschüsser gefällt mir«, sagte er. »Ein klassisches Beispiel für Americana. Bekannt als die ›Waffe, die den Westen gewann‹.«
Der Captain schwieg.
»Sie erinnern mich an einen anderen Polizeicaptain, den ich in Mexiko getroffen habe, auf der Straße nach Cancún. Es war das letzte Mal, dass ich im Ausland gewesen bin. In dem Zusammenhang muss ich Ihnen ein Kompliment machen. Ihre Leute hier sind viel gastfreundlicher als ihre mexikanischen Nachbarn im Süden. Jedenfalls, dieser längst verblichene Polizei-Capitán unterschätzte meine Ausdauer und die Mühen, die ich auf mich zu nehmen bereit bin, um Rache zu üben. Ich erwähne es nur, weil ich Parallelen zwischen Ihrer derzeitigen Situation und dem tragischen Ableben ziemlich vieler Menschen südlich der Grenze erkenne. Wissen Sie … dieser mexikanische Capitán hatte mir damals jemanden geraubt, an dem mein Herz hing. Genau wie Ihr Freund Canyon mir jetzt jemanden genommen hat, der mir nahesteht. Möchten Sie wissen, welches Schicksal Ihren Polizeikollegen südlich der Grenze ereilt hat?«
Yazzie verzog die Lippen. Ohne auf Ackermans Frage einzugehen, wandte er sich an Ernie. »Gehen Sie zum Tank draußen, Pitka, holen Sie ein paar Eimer Wasser und verpassen Sie unserem Freund hier eine kalte Dusche. Ich will diese blutige Schweinerei nicht mehr sehen.«
Liana fuhr auf. »Aber Sir, das Blut könnte ein Beweismittel sein. Wir können doch nicht …«
»Wir haben Blutspuren an den Griffen seiner Schlagstöcke«, fiel Yazzie ihr ins Wort. »Das reicht.«
Ackerman lächelte die junge Navajo an. »Li-änna. Der Name passt zu Ihnen, Blume der Prärie. Nehmen Sie einen Drink mit mir, sobald ich hier raus bin?«
»Die Wassereimer, Pitka«, befahl der Captain. »Sofort!«
Der junge Officer nahm Haltung an, nickte und eilte nach draußen.
Als die Tür krachend zuschlug, geschah etwas Unerwartetes.
Ackerman schnellte urplötzlich hoch und attackierte die Gitterstäbe mit explosiver Kraft und Wildheit. Sein Drehtritt traf mit solcher Wucht, dass sich das Eisen verbog und das ganze Gebäude klirrte und bebte.
Liana schrie auf. Erschrocken wichen sie und der Captain zurück.
Ackerman lachte. »Dieser mexikanische Cop, den ich erwähnt habe, der Typ, der mich beraubt hat, hat in meiner Obhut mehrere Wochen überlebt. Ich habe ihn mit seinem eigenen Fleisch gefüttert. Wir hatten ein kleines Spiel daraus gemacht. Vielleicht spiele ich es auch mit Ihnen, Captain. Würden Sie gern wissen, wie Sie schmecken? Ich muss gestehen, ich bin neugierig. Vielleicht teilen wir uns ein schönes Filet à la Yazzie, dazu ein kalifornischer Rotwein.«
Als Pitka mit den Wassereimern zurückkehrte, zuckte er zusammen, als er die weißen Gesichter Yazzies und Lianas bemerkte. »Was ist hier los?«, fragte er.
»Duschen Sie ihn ab«, sagte Yazzie mit rauer Stimme. »Wir wollen uns den Vogel mal genauer anschauen.«
Ackerman konnte die Beweggründe des Captains gut nachvollziehen. Auf einen normalen Menschen musste der Anblick eines Mannes, dessen Oberkörper in frisches Blut gebadet war, entnervend wirken. Ackerman grinste. Wenn Yazzie erst sah, was sich unter der Blutschicht verbarg, würde sein Entsetzen geradezu explodieren. Ackermans Körper wurde zu einem großen Teil von Narbengewebe verunstaltet. Einige der Wunden waren ihm vom eigenen Vater zugefügt worden. Ackerman senior hatte ihn unbeschreiblichen Torturen ausgesetzt, jeder nur vorstellbaren Qual, um ihn zu einer perfekten Mordmaschine zu formen. Andere Narben stammten von Kämpfen. Wieder andere hatte Ackerman sich selbst beigebracht.
Sein Vater war schlussendlich gescheitert. Ohne invasive Hirnchirurgie hatte er sein Ziel, seinen Sohn zum perfekten Killer zu formen, nicht erreichen können. Deshalb hatte er komplizierte Eingriffe an der Amygdala seines Sohnes vorgenommen und chirurgisch jene Bereiche des Gehirns verstümmelt, in denen die Angst und die primitiven Kampf-oder-Flucht-Reaktionen entstanden. Das alles hatte unauslöschliche Narben an Körper und Seele hinterlassen.
Ackerman trat vor und grinste den Deputy an. »Wasser Marsch, Ernie.«
Der Wasserschwall traf ihn voll. Das meiste Blut würde sich nur mit einer Bürste entfernen lassen, doch binnen weniger Sekunden spülte Ernie so viel davon ab, dass Ackermans Gesicht und seine Narben sichtbar wurden.
Liana schnappte nach Luft und schlug eine Hand vor den Mund, als ihr Blick auf die grauenerregende Reliefkarte fiel, zu der Ackermans Haut geworden war. Ackerman schaute an sich hinunter, was er nur selten tat; er dachte ungern an die Vergangenheit. Diesmal jedoch betrachtete er seine Wundmale mit analytischem Blick und versuchte, die Narben so zu sehen, wie Liana sie sehen würde. Er spannte die dicken Stricke seiner Armsehnen und beobachtete, wie die Relikte der zahllosen Schnitte, Verbrennungen und Schusswunden sich im künstlichen Schein der Leuchtstofflampen auf beinahe obszöne Weise bewegten.
Stieß sein nackter Oberkörper die junge Navajo ab, oder erregte er sie? Ein bisschen von beidem? Die Antwort auf diese Frage interessierte Ackerman sehr. »Es geht doch nichts über eine kalte Dusche«, sagte er zu Yazzie. »Ich fühle mich erfrischt. Ist Mr. Canyon bereits unterwegs?«
»Warum sollte er?«, fragte Yazzie.
»Beleidigen Sie mich nicht mit dem Versuch, so zu tun, als wären Sie ein echter Cop. Sie sind nur ein besserer Nachtwächter. Das gilt für alle hier. Sie bewachen Canyons Stadt und seine dreckigen Geschäfte, Yazzie. Ich nehme an, Sie haben mit ihm telefoniert, als Liana ihren Notruf abgesetzt hat. Oder haben Sie Ihren Herrn und Meister von unterwegs angerufen?«
»Herr und Meister? Unsinn! Aber Sie haben recht. Ich habe tatsächlich mit Canyon telefoniert. Er ist hierher unterwegs. Ich schlage vor, Sie trinken jetzt einen großen Schluck Wasser, und dann reden Sie. Sie können mit mir oder mit John Canyon sprechen. Aber ich muss Sie warnen. Wenn Canyon Ihnen eine Frage stellt, und die Antwort gefällt ihm nicht, reißt er Ihnen sämtliche Fingernägel aus.«
Ackerman grinste. »Ist eine Weile her, seit ich einen Partner hatte, der wirklich wusste, wie man Tango tanzt. Eine gute Folter weiß ich jederzeit zu schätzen.«
»Wir werden sehen, was von Ihrer großen Klappe übrig bleibt, wenn Big John erst hier ist«, höhnte Yazzie. »Sie wären verdammt noch mal besser dran, wenn Sie mir einfach sagen würden, was passiert ist.«
»Geduld, mein Freund. Geduld ist die erste der beiden Lektionen, die ein Jäger lernen muss.«
»Ach? Und die andere?«
»Sich stets auf der windabgewandten Seite der Beute zu halten. Sonst geht der Jäger hungrig nach Hause, oder er landet am Ende selbst in einem fremden Magen.«
»Und Sie sind ein Meisterjäger, was?«
»Ich bin Meister auf vielen Gebieten. Das Jagen ist nur eines davon. Ich genieße die Jagd. Aber mir macht der Todesstoß mehr Spaß als die Hatz.«
»Hören Sie.« Yazzie zog sich einen Stahlrohrsessel heran, dessen Beine über den Linoleumboden scharrten, und setzte sich. »Wir haben das technische Equipment, um ermitteln zu können, ob Ihr Körper mit menschlichem oder tierischem Blut bedeckt war. Aber wenn Sie es mir einfach sagen, ersparen wir uns den langwierigen Test.«
»Wissen Sie, Captain, ich liebe den Geruch von Blut. Schwedische Forscher haben vor Kurzem herausgefunden, dass ein einziges Molekül der Substanz, die freigesetzt wird, wenn die Lipide im Blut sich an der Luft zersetzen, schon genügt, um Menschen zurückschrecken zu lassen. Raubtiere hingegen lecken sich erwartungsvoll die Lefzen – genau wie ich. Blutgeruch regt bei mir den Speichelfluss an. Für mich ist dieser Geruch süß und verlockend, während er bei Normalsterblichen wie Ihnen Angst und Abscheu weckt. Das nennt man wohl Relativität der Wahrnehmung.«
»Ich bin beeindruckt. Aber wie wär’s, wenn Sie mir jetzt Ihren Namen sagen?«
Ackerman dachte nach. Seinen echten Namen musste er verschweigen, denn der Serienkiller Francis Ackerman jr. galt offiziell als tot. Die Shepherd Organization war sogar so weit gegangen, Ackermans Gesicht von einem plastischen Chirurgen drastisch verändern zu lassen, damit ihn niemand mehr erkannte.
»Nennen Sie mich Frankenstein«, sagte Ackerman schließlich. »Oder einfach nur Frank.«
Kapitel 6
Ackerman fand, dass seine körperlichen Entstellungen im breiten Spektrum möglicher Verunstaltungen irgendwo zwischen den Brandnarben Freddy Kruegers und den Kriegsverletzungen Rambos anzusiedeln waren. Zum Glück hatte sein Vater die Misshandlungen strategisch platziert, damit sie nicht sofort ins Auge stachen. Die Narben ließen sich allesamt unter einem T-Shirt mit langen Ärmeln verbergen, doch im Moment legte Ackerman es darauf an, dass jeder die Spuren der Feuerprobe, die sein Leben war, sehen konnte.
Er bemerkte, dass die junge Navajo den Blick nicht von seinem Oberkörper lösen konnte, doch ihm war klar, dass es nicht seine beneidenswerte Physis war, die Lianas Aufmerksamkeit fesselte. Er sah, wie sie die Narben analysierte und versuchte, auf eine Methode hinter dem Wahnsinn zu kommen. Ackerman nahm sich vor, sie später zu fragen, zu welchen Ergebnissen sie gelangt sei.
»Frankenstein«, sagte Captain Yazzie. »Frank. Wie niedlich. Ich sehe an der Kartenskizze Ihres Leidensweges, die Sie vermutlich Haut nennen, dass Folter bei Ihnen nicht viel ausrichten wird. Wie wär’s, wenn ich rede und Sie mich wissen lassen, ob ich auf der richtigen Fährte bin?«
In diesem Moment geschah es.
Ackerman spürte die Veränderung, gab sich aber alle Mühe, die Konzentration weiter auf den Polizeicaptain und die aktuelle Situation zu richten. Doch er spürte bereits den Atem im Nacken, den Schatten in seinem Rücken. Dann hörte er, wie sein Vater ihm über seine Schulter hinweg zuraunte: »Ich finde, du solltest diese Trottel töten, damit das Gelaber aufhört. Die Leute langweilen mich zu Tode.«
Und dann erschien er in Ackermans Blickfeld. Sein Vater, der als Serienmörder unter dem Namen Thomas White sein Unwesen getrieben hatte, kam zur Vorderseite der Zelle und baute sich vor Yazzie auf.
Ackerman verzog keine Miene, obwohl er innerlich aufschrie. In letzter Zeit hatte er immer wieder die Stimme seines Vaters gehört, ein Raunen und Flüstern in seinem Kopf, aber die Stimme hatte nur Sätze von sich gegeben, die Ackermans eigener Erinnerung entstammten. Vor ein paar Wochen jedoch, während der tödlichen Auseinandersetzung mit einem Serienmörder, der sich »Gladiator« nannte, hatte die Stimme sich verändert und Dinge gesagt, die auf ein eigenes Bewusstsein schließen ließen, eigene Erinnerungen. Und das war erst der Anfang gewesen. Als Ackerman nach dem Sieg über den Gladiator längere Zeit im Krankenhaus verbringen musste, war ihm Thomas White in Fleisch und Blut erschienen – zumindest hatte Ackerman es so wahrgenommen. Die Halluzination war derart lebhaft gewesen, dass er nach der Schwester geklingelt und sich erkundigt hatte, ob auch sie den durchgeknallten Arzt im Dreiteiler sah. Statt zu antworten, hatte die Schwester ihn fassungslos angestarrt, als wäre seine Zunge wie ein großer, rosaroter Blutegel aus seinem Mund gekrochen.
»Ist es nicht wundervoll, dass wir wieder vereint sind, Junior?«, sagte White.
In diesem Moment fragte Yazzie: »Was ist? Sind Sie noch da, Frank? Wie sieht es mit meinem Vorschlag aus? Wenn ich die Geschichte richtig erzähle, füllen Sie dann die Lücken?«
»Ich kann Sie nicht am Reden hindern«, entgegnete Ackerman. »Genauso wenig, wie Sie mich davon abhalten können, Sie zu ignorieren.«
Thomas White lachte auf. »Das ist die richtige Einstellung, Junior. Mach ein Spiel daraus, wie du es damals getan hast, um den Schmerz und die Angst zu überstehen, bis ich dich gelehrt habe, auf andere Weise damit fertigzuwerden.«
»Sie hatten recht«, sagte in diesem Moment Captain Yazzie. »Mr. Canyon hatte mich angerufen, nachdem ein Verrückter seine Ranch überfallen hatte.«
»Ich habe niemanden überfallen«, widersprach Ackerman. »Ich habe nur die Lage ausgekundschaftet und an den Stellen Druck ausgeübt, wo es angebracht war.«
»Mr. Canyon behauptet, Sie hätten einen seiner Trucks in Brand gesetzt und ihn dann in sein Treibstoffdepot rollen lassen.«
»Da hat er recht.« Ackerman nickte. »Es war das erforderliche Maß an Druck in der gegebenen Situation.«
»Und welche Situation war das? Wieso hatten Sie überhaupt das Bedürfnis, John zu schaden?«
»Ich musste seine Aufmerksamkeit erregen.«
Thomas White lehnte sich mit verschränkten Armen an die Gitterstäbe und schaute gelangweilt drein. »Du hättest seine ganze Familie aus dem Haus zerren und diese Kreaturen nacheinander töten sollen. Einer von ihnen hätte dir früher oder später verraten, was dieser Canyon der Konkubine deines Bruders Marcus angetan hat.«
Ackerman biss die Zähne zusammen und widersetzte sich dem heftigen Impuls, Maggies Ehre zu verteidigen.
Er ist bloß ein Trugbild, rief er sich ins Bewusstsein. Ein Geist, ein Hirngespinst, ein Gebilde deiner Fantasie …
Wie durch Watte hörte Ackerman den Captain sagen: »Sie wollten Canyon nur auf sich aufmerksam machen? Warum haben Sie dann nicht einfach sein Büro angerufen und einen Termin vereinbart? Das reicht normalerweise, um sich bemerkbar zu machen.«
Ackerman zuckte mit den Schultern. »Na klar. Ich hätte Sie auch hinaus in die Nacht zerren können, um Ihnen mit einer Kettensäge einen Körperteil nach dem anderen abzutrennen, bis Canyon meine Botschaft kapiert. Aber das wäre vielleicht ein wenig übertrieben gewesen. Also lassen Sie die Haarspaltereien. Ich finde, mein Vorgehen war angemessen.«
»Sie hätten zahlreiche Menschen töten können. Auf Canyons Farm stehen die Schlafbaracken seiner Leute.«
»Diese Variablen waren berücksichtigt. Gehen Sie davon aus, dass ich Ihrem matten Verstand stets zehn Schritte voraus bin. Außerdem ist Ihr Vorwurf gegenstandslos, weil bei der Explosion des Trucks niemand getötet wurde. Es war nur eine Ablenkung.«
»Eine Ablenkung wofür? Wozu brauchten Sie überhaupt Canyons Aufmerksamkeit?«
»Sie haben mich noch nicht nach dem Blut gefragt.«
»Ich wollte mich langsam bis dort vorarbeiten. Vorher aber möchte ich Sie etwas anderes fragen.«
Ehe Ackerman antworten konnte, trat Thomas White hinter ihn und legte ihm beide Hände auf die Schultern. Ackerman hätte schwören können, dass er die Berührung spürte.
»Darf ich eine kleine Änderung deines Plans vorschlagen?«, kroch Whites Stimme in Ackermans Kopf.
Zu beiden, zum Captain und seinem Vater, sagte er: »Ich höre.«
Yazzie beugte sich vor, beide Ellbogen auf die Knie gestützt. »Was haben Sie mit Tobias Canyon und seinen Begleitern gemacht? Sind sie tot?«
Ehe Ackerman antworten konnte, meldete sich White erneut zu Wort. »Ich gebe dir einen Rat. Du solltest die drei Cops töten, ihre Leichen wie Marionetten arrangieren, dich dann in der Zelle einschließen und dich selbst fesseln. Damit würdest du die ungeteilte Aufmerksamkeit dieses Mr. Canyon erregen, jede Wette.«
Wieder antwortete Ackerman beiden Männern zugleich: »Niemand muss hier sterben.« Er schaute zu Yazzie. »John Canyon, Ihr Wohltäter, hat mir jemanden weggenommen. Ich habe nur Gleiches mit Gleichem vergolten und mir seinen Sohn geschnappt. Gibt Canyon mir mein Herzblatt wieder, bekommt er seines zurück.«
Er konnte sich vorstellen, wie es hinter Yazzies John-Lennon-Brille arbeitete, wie sich die kleinen Rädchen im Hirn des Captains drehten. »Wer ist Ihr Freund? Wen genau soll John Canyon gekidnappt haben?«
»Eine Bundesagentin. Sie ist verschwunden, als sie hier bei Ihnen ermittelt hat. Ihr Name ist Maggie Carlisle. Sie erinnern sich bestimmt, Captain.«
»Ich fürchte, nein. Wie ich bereits dem FBI-Agenten und den Leuten vom Bureau of Indian Affairs gesagt habe: Diese Frau ist nie hier gewesen.«
Die bleiche Gestalt von Thomas White erschien hinter dem Captain, neigte den Kopf zur Seite und sagte zu Ackerman: »Er lügt dir ins Gesicht. Lässt du dir eine solche Respektlosigkeit gefallen, Junior?«
Ackerman ignorierte ihn. »Wirklich nicht?«, fragt er den Captain. »Wir konnten Maggies Mobiltelefon bis zu dieser Position hier zurückverfolgen. Sie hat einen Anruf getätigt, während sie hier war – eines ihrer letzten Gespräche, bevor sie spurlos verschwunden ist.«
»Dann muss sie hier gewesen sein, als wir alle unterwegs waren. Keiner meiner Officers hat die Frau gesehen. Aber darüber können wir später reden. Ich will Ihnen helfen, Ihre Freundin zu finden, Frank, wirklich. Aber zuerst muss ich wissen, ob es Canyons Sohn Toby und den anderen drei Jungs gut geht. Oder brauchen sie ärztliche Hilfe?«
Ackerman verdrehte die Augen und ließ sich auf die Pritsche an der Rückwand fallen. »Wenn Sie und Ihre Officers doch endlich aufhören würden, mir dämliche Fragen zu stellen! Ich will Ihnen etwas anvertrauen. Ich habe Dinge gesehen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Ich habe Schmerzen erlitten, die Sie um den Verstand bringen würden. Ich habe jede Verderbtheit kennengelernt. Ich habe die Höhen sadistischer Ekstase erlebt, die Qualen der Hölle erduldet, das Tal des Todes durchschritten. Und jetzt schauen Sie mir in die Augen und beantworten Sie mir eine einzige Frage: Wissen Sie, wo Maggie Carlisle im Augenblick ist?«
Mit einem entschiedenen Kopfschütteln sagte der Captain: »Keine Ahnung.«
»Dann sind Sie nutzlos für mich. Ich habe einen Vorschlag. Wir alle warten hier in friedlicher Eintracht, bis der Mann auftaucht, der meine Frage beantworten kann.«
»Und wenn Mr. Canyon auch keine Antworten auf Ihre Fragen hat?«, wagte Liana sich vor. »Oder wenn Ihre Freundin tot ist? Was dann?«
Ackerman erkannte, dass ihre Frage aufrichtig war. Sie versuchte nicht, zynisch zu sein; sie fragte aus Angst vor seiner Vergeltung.
Thomas White warf ein: »Eine gute Frage, Junior. Was wirst du tun, wenn Maggie nicht mehr unter uns weilt? Vielleicht würde ihr Tod mir die Gelegenheit bieten, in deinem fleischlichen Gewand auf eine kleine Spritztour zu gehen. Es sei denn, du besinnst dich auf deine wahre Natur und tust, wozu du geboren wurdest. Es könnte sein wie in den guten alten Zeiten. Vater und Sohn, wieder vereint im Blutrausch.«
Ackerman hob den Blick, schaute der verängstigten jungen Navajo in die Augen und antwortete düster: »Wenn Maggie tot ist, dann Gnade Gott euch allen.«
Kapitel 7
Ein Monat zuvor
Es war acht Jahre her, seit Maggie Carlisle das letzte Mal zu Hause gewesen war, aber in dieser Zeit hatte sich kaum etwas verändert. Alles war tadellos in Schuss. Dafür sorgte schon Helen, ihre Großmutter, obwohl sie bereits über siebzig war. Einmal wöchentlich scheuerte sie die Spülbecken mit ihrem Spezialmittel aus. Auch diesmal stieg Maggie der kräftige Geruch von Helens selbstgemachtem Essigreiniger in die Nase.
»Grandma?«, rief sie. »Mom?«
Nichts.
Maggie hatte angerufen und eine Nachricht hinterlassen, damit Grandma Helen ihr Zimmer vorbereiten konnte; deshalb hätte sie mit einer Begrüßung gerechnet. Zögernd betrat sie das Haus, lauschte. Der Stille nach zu urteilen war die Familie nicht daheim. Maggie durchquerte die Küche und sah die alten Magnete am Kühlschrank, unter denen verblasste Zettel steckten, die davor warnten, dass Softdrinks und Handys Krebs erzeugten. An die Küche schloss sich das Esszimmer an. Von dort folgte Maggie dem Flur zu ihrem alten Zimmer. Leise rumpelnd sprangen die Rollen ihres Trolleys über den knarrenden Holzboden. Dank Grandmas sorgfältiger Pflege glänzten die Bretter wie poliertes Kupfer.
In Maggis Zimmer roch es wie im ganzen Haus nach Essig, was darauf hindeutete, dass Helen es in Erwartung der Ankunft ihrer Enkelin frisch geputzt hatte. Maggie ging zum Fenstersitz und stellte ihr Gepäck ab. Behutsam schob sie die geliebten Stofftiere aus ihrer Kindheit beiseite, öffnete den Koffer, nahm ein sauberes, gefaltetes Bettlaken heraus, das ganz oben lag, und breitete es über dem Fenstersitz aus. Dann machte sie sich daran, ihre Kleidung auszupacken. Die perfekt gefalteten Stoffquadrate waren nach Tagen geordnet und auf die vorhergesagte Witterung abgestimmt. Als sie fertig war, baute sie ihre Toilettenartikel auf der Kommode auf, ging zum Bett und zog die frisch duftenden Bezüge ab, um sie noch einmal zu waschen. Maggie ging kein Risiko ein. Bettwanzen breiteten sich bekanntlich epidemisch aus. Bei dem Gedanken an Ungeziefer überlief sie eine Gänsehaut.
Schließlich hob sie die Matratze an, zog das Bettlaken ab und brachte alles in die Waschküche am Ende des Flures. Dort schnappte sie sich eine große Flasche vom Essigreiniger und einen Putzlappen und kehrte in ihr Zimmer zurück. Ihre alten Tagebücher und Zeichnungen lagen in den Schubladen des Nachttisches; deshalb wusste sie, dass Grandma Helen weder die Kommode noch den Nachttisch ausgewischt hatte, seit sie, Maggie, hier ausgezogen war. Helen legte großen Wert auf Privatsphäre. Wahrscheinlich hatte sie die Schubladen seit Maggies Weggang kein einziges Mal geöffnet.
Als Maggie sich über die Schubladen beugte, um sie auszuwischen, fiel ihr das kurze blonde Haar in die Stirn, und sie strich es nach hinten. Bald hatte sie sich von der obersten der drei Kommodenschubladen zur untersten vorgearbeitet. Die oberen beiden enthielten Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit – alte Fotos von Freunden und Familie, Auszeichnungen für schulische Leistungen, Buntstifte und anderen Krimskrams.
Das unterste Schubfach war dermaßen vollgestopft, dass Maggie es kaum aufbekam. Sie zog und zerrte; beinahe wäre sie nach hinten gekippt, als das Fach sich plötzlich mit einem Ruck öffnete. Drinnen fand sie ihre Beanie-Baby-Sammlung. Sie lächelte und arrangierte die kleinen Tierchen auf dem Stuhl. Weshalb sie die Figuren so geliebt hatte, wusste sie nicht mehr, konnte sich aber gut daran erinnern, dass sie ihr Glück geschenkt hatten.
Auf dem Boden der Schublade fand sie ein buntes Lisa-Frank-Notizbuch mit einem funkelnden Einhorn auf dem Einband, an das sie sich verschwommen erinnerte.
Nachdem sie das spiralgebundene Buch aus seinem Versteck geborgen hatte, widerstand sie dem Verlangen, sich das vierte Mal in dieser Stunde die Hände zu waschen, denn ihre sonnengebräunte Haut war bereits rot und kratzig. Während sie darauf wartete, dass die Familie zurückkehrte und der Essig in den Schubladen trocknete, hätte sie eigentlich ihr MacBook auspacken und ihre Notizen zum Taker-Fall durchgehen sollen, aber das grellbunte Notizbuch mit dem Einhorn hielt ihren Blick fest.
Na los, mach schon, sagte sie sich. Du kannst ja doch nicht widerstehen.
Erwartungsvoll schlug sie das Notizbuch auf, blätterte die Seiten durch und kicherte, als sie ihre kindliche Krakelschrift sah. Sie überflog ein paar Seiten und wollte das Buch schon zurücklegen, als sie im Buchblock etwas Steifes bemerkte.
Die Fotos, die Maggie zwischen den knittrigen Seiten fand, weckten eine Flut vergessener Erinnerungen. Es waren Familienfotos aus glücklichen Tagen. Eines zeigte ihren kleinen Bruder Tommy mit ihr selbst und ihrer Mutter auf einer Holzbank, die lächelnden Gesichter mit Butter und Zuckermais verschmiert. Maggie erinnerte sich verschwommen an diesen Tag; an der örtlichen Universität war damals ein Indianer-Event, »Powwow« genannt, veranstaltet worden. Ihr Dad, ein Fan des Discovery Channel, hatte darauf bestanden, dass sie das Powwow gemeinsam besuchten. Dabei hatte er dieses Foto geknipst.
Maggie erinnerte sich nur vage an die Empfindungen, die dieser Tag in ihr geweckt hatte. Wenn sie sich doch nur besser an diese glückliche Zeit erinnern könnte! Es musste einer der letzten Ausflüge gewesen sein, bei denen die Familie intakt gewesen war.
Das alles war so lange her, dass Maggie ihre Kindheit nur noch als Ansammlung blasser Schemen erschien – mit einer Ausnahme: Der Tag, an dem der Taker ihren Bruder entführt hatte, stand ihr noch klar und deutlich vor Augen.
Zwischen den Fotos lag ein vergilbtes Stück Papier. Maggie faltete es behutsam auseinander und entdeckte eine Zeichnung, einen kindlichen Blick auf das Powwow – grelle Farben und dreieckige Tipis, durchsetzt mit Federn, die wie Katzenschwänze aussahen. In der Mitte befand sich eine Gruppe indianischer Tänzer, mit Buntstiften ausgemalt. Die tanzenden Männer waren von der Seite zu sehen. Die Arme waren auf seltsame, unbeholfene Weise verdreht, um ihre Bewegungen anzudeuten.
Einen Tänzer jedoch hatte Maggie so gezeichnet, dass sein Gesicht dem Betrachter zugewandt war. Er war wie die anderen gekleidet; seine Augen jedoch waren durchdringende schwarze Löcher. Maggie überlief ein Frösteln; die Härchen auf ihren Armen und im Nacken stellten sich auf. Sie hatte das plötzliche Gefühl, sich übergeben zu müssen, während ein Sturm der Angst über sie hinwegfegte. Angespannt starrte sie auf die Zeichnung. Sie konnte nicht begreifen, weshalb diese schwarzen Augen eine solch verheerende Wirkung auf sie ausübten.
Im nächsten Moment zuckte sie heftig zusammen. Das Geräusch von Autotüren, die vor dem Haus zugeschlagen wurden, drang an ihre empfindlichen Ohren, die durch jahrelanges Training geschärft waren. Maggie faltete die Zeichnung zusammen, steckte sie mitsamt den Fotos zurück in das alte Notizbuch, erhob sich und ging den Neuankömmlingen entgegen. Bestimmt waren es Mom und Grandma Helen. Vielleicht sogar Marcus, der sie aufgestöbert hatte. Zwar hatte Maggie ihn über ein inzwischen beseitigtes Wegwerfhandy angerufen und ihn wissen lassen, dass er ihr nicht folgen solle, aber wenn Marcus sich auf ihre Fährte gesetzt hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis er sie fand.
Maggie verspürte Gewissensbisse wegen ihrer Heimlichtuerei, aber es ging nicht anders. Sie durfte Marcus nicht die ganze Wahrheit anvertrauen; dann würde er alles stehen und liegen lassen, um ihr zu helfen. Maggie wollte seine Hilfe aber erst dann, wenn es nicht mehr anders ging. Die Suche nach dem Taker war ihr Job, nicht seiner.
Am Wohnzimmerfenster zur Einfahrt blieb sie stehen, teilte den Spitzenvorhang und sah einen alten silbernen Buick und zwei Frauen, die Einkaufstaschen zum Haus trugen. Maggie stieß einen leisen Freudenschrei aus, rannte die Treppe hinunter und beeilte sich, die Tür zu öffnen. Sie lächelte, als sie das Erstaunen in den Augen ihrer Großmutter sah. Helens silbernes Haar war kurz geschnitten und wurde, wie Maggie wusste, nachts mit Wicklern gelockt. Auf ihrem noch immer attraktiven Gesicht spiegelte sich ihr eigenwilliges, manchmal ein wenig schwieriges Wesen.
»Du?«, rief Helen.
»In voller Schönheit.« Maggie streckte die Hände nach den Einkaufstüten aus. »Lass mich dir helfen.«
Helen schüttelte den Kopf. »Ich schaff das schon. Hilf lieber deiner Mutter.«
Erst jetzt wandte Maggie sich der anderen Frau zu. Zögernd sagte sie: »Hi, Mom.«
Die Frau, die wie eine ältere Version Maggies aussah, erwiderte nichts. Sie reichte ihr die Taschen, verriet aber durch keinen Blick und keine Geste, ob sie ihre Tochter erkannte. Ihre blonden Haare ergrauten bereits und waren zu dem gleichen französischen Zopf zurückgebunden, zu dem Helen jahrelang Maggies Haar geflochten hatte. Als Maggie ihrer Mutter ins blasse Gesicht schaute, sah sie das Blau der Venen dicht unter der Haut.
Plötzlich hellte das Gesicht ihrer Mutter sich auf. Zum ersten Mal schaute sie Maggie an, blickte aber auf seltsame Weise durch sie hindurch. »Hallo, Magpie«, murmelte sie.
Maggie lächelte wehmütig, als sie ihren alten Spitznamen hörte, der »Elster« bedeutete. Sie beobachtete, wie ihre Mutter mit müden Schritten zur Tür ging, ohne ihre Umgebung wahrzunehmen. Dabei lachte sie leise in sich hinein. »Elstern«, murmelte sie, »sind die klügsten Vögel der Welt. Sie gehören zu den wenigen Tieren, die sich selbst im Spiegel erkennen.«
Maggie kämpfte gegen die Tränen an. Naiv, wie sie manchmal war, hatte sie gehofft, dass es Mom besser ging, aber wie es schien, schlafwandelte sie weiterhin durch das Leben. Der Nebel, der ihren Verstand umhüllte, war hauptsächlich auf Medikamente zurückzuführen, von Antidepressiva bis hin zu Neuroleptika. Maggie und Helen hatten jahrelang über die Medikation und deren Dosierung gestritten; für Helen war es stets oberste Priorität gewesen, dass ihre einzige Tochter ruhig blieb und nicht versuchte, sich zu verletzen oder Schlimmeres.
Maggie ließ Helen und ihre Mutter zuerst das Haus betreten und jonglierte mit den Einkaufstaschen, als sie hinter den beiden die Tür verriegelte; dann folgte sie ihnen in die Küche, wo Helen sich daranmachte, die Einkäufe in die Schränke einzusortieren.
»Ich habe dich erst später erwartet, Maggie«, sagte sie. »Wie lange bist du schon hier?«
»Eine halbe Stunde vielleicht.« Maggie achtete darauf, ihrer Großmutter nicht in den Weg zu geraten, während sie in der Küche hantierte, denn Helen pflegte sie dann schmerzhaft ins Ohr zu zwicken. Die alte Dame hatte noch den strengen Ordnungssinn von früher, wie sich zeigte. Alle Konserven wanderten in den gleichen Schrank, sortiert nach Gemüse oder Obst, die wiederum sortiert waren nach Farbe, Schnitt und Dosengröße.
»Erzähl schon, Maggie«, forderte Helen sie auf. »Wie läuft es mit deinem Freund? Marcus, nicht wahr?«
Maggie musterte Helen verblüfft.
Woher weiß sie, dass ich einen Freund habe? Und woher kennt sie seinen Namen?
Sie hatte Helen nie von Marcus erzählt. Sie sprach mit niemandem über ihre Beziehungen. Mit wem auch? Dass sie Freundinnen gehabt hatte, lag ein paar Jahre zurück. Erst in letzter Zeit hatte sie neue Freundschaften geschlossen – mit Emily Morgan beispielsweise und mit Lisa Spinelli. Doch beide waren von vornherein über Marcus im Bilde gewesen.
Maggie öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder. Was sollte sie auch antworten?
Helen schien die Ratlosigkeit ihrer Enkelin nicht zu bemerken. Sie begann mit den Vorbereitungen für das Abendessen, wusch und schälte Kartoffeln, die sie aus der Speisekammer geholt hatte. Dabei warf sie hin und wieder vorwurfsvolle Blicke auf Maggie, als hätte sie mit ihrer Enkelin ein Hühnchen zu rupfen.
»Hat Marcus angerufen und sich nach mir erkundigt?«, fragte Maggie schließlich.
»Er macht sich Sorgen um dich.«
»Ich weiß.«
»Ich übrigens auch.«
»Dafür gibt es keinen Grund, Grandma.«
»Marcus kommt mir wie ein netter junger Mann vor.«
»Oh, das ist er.«
Helen hielt beim Kartoffelschälen inne, drehte sich um und schaute ihrer Enkelin in die Augen. »Magpie, ich muss dich etwas fragen. Etwas Wichtiges über dich und deinen Freund.«
»Okay.« Maggie seufzte unhörbar, denn sie befürchtete, sich einen Vortrag über vorehelichen Sex anhören zu müssen.
Helen nickte bedächtig und fragte mit traurigem Blick: »Ernährt ihr beide euch nachhaltig?«
Mit allem hatte Maggie gerechnet, nur damit nicht. »Äh …«, setzte sie an. »Ich …«