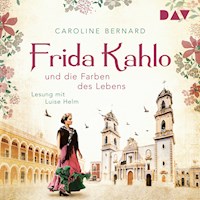10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
»Ich bin meine eigene Muse!« Frida Kahlo.
Endlich ist es so weit: Frida Kahlo hat ihre erste Einzelausstellung in New York – und sie ist ein rauschender Erfolg. Manhattans Kunstwelt feiert sie. Dann begegnet sie dem Fotografen Nickolas Muray und erlebt eine leidenschaftliche Amour fou. Nachdem sie künstlerisch aus dem Schatten ihres untreuen Manns Diego Rivera getreten ist, will sie auch in der Liebe ihren Gefühlen folgen. Doch Nick verlangt etwas scheinbar Unmögliches von ihr. Frida muss herausfinden, was sie wirklich will – in der Kunst und in der Liebe ...
Der neue Roman über Frida Kahlo: Einfühlsam und mit großer Kenntnis erzählt Bestsellerautorin Caroline Bernard von einer bisher unbekannten Seite der Welt-Ikone.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Sommer 1938: Frida ist an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen. Sie muss ihre Idee von der großen Liebe hinterfragen, vor allem aber will sie in der Kunst auf eigenen Beinen stehen. Denn noch immer wird sie nur als malende Ehefrau des berühmten Diego Rivera gesehen. Dann kommt die Einladung, in New York und Paris auszustellen. Frida sieht die Chance für ihren großen Durchbruch, doch werden ihre Bilder die Erwartungen der internationalen Kunstwelt auch erfüllen können? In New York verliebt sie sich in den Fotografen Nick Muray, und plötzlich befindet sie sich in einem Chaos der Gefühle. Gleichzeitig rückt die Kunst mehr und mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens und wird zu ihrer Rettung, denn in ihr findet sie Inspiration, nicht nur für ihre Rolle als Frau, sondern auch für die Liebe.
Über Caroline Bernard
Caroline Bernard ist das Pseudonym von Tania Schlie. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitet seit über zwanzig Jahren als freie Autorin. Sie liebt es, Geschichten von starken Frauen zu erzählen.
Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening liegen von ihr »Die Muse von Wien«, »Rendezvous im Café de Flore«, »Die Frau von Montparnasse«, »Fräulein Paula und die Schönheit der Frauen«, »Die Wagemutige« sowie der Roman »Frida Kahlo und die Farben des Lebens« vor, der lange Zeit die Bestsellerlisten anführte und in zahlreichen Ländern erschienen ist.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Caroline Bernard
Ich bin Frida
Eine große Geschichte von Liebe und Freiheit
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1 — Coyoacán, August 1938
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7 — New York, Oktober 1938
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19 — Coyoacán, kurz vor Weihnachten 1938
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22 — New York, Anfang Januar 1939
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33 — Paris, Abend des 9. März 1939
Kapitel 34
Kapitel 35 — Auf der SS Normandie, Ende März 1939
Nachwort
Liste der wichtigsten Bilder, die in New York bzw. Paris ausgestellt wurden
Briefe und Notizen sind an Originalzitate angelehnt, die aus folgenden Quellen stammen:
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Kapitel 1
Coyoacán, August 1938
Frida hatte die Leinwand in der Höhe verstellt, um im Stehen malen zu können. In ihr tobte es, unmöglich, jetzt stillzusitzen. Sie tauchte den Pinsel in die Farbe, ein tiefes Rot, mit dem sie die Blüten der Passionsblume ausmalen wollte. Die Blume stand für Leidenschaft, für große Gefühle. Doch Frida spürte eher ohnmächtigen Zorn. In einer heftigen Bewegung setzte sie den Pinsel auf die Leinwand, doch die kirschrote Farbe war zu wässrig, Farbtropfen spritzten nach allen Seiten und liefen über den Rand der Blüte hinaus. Mit der freien Hand griff sie nach einem Tuch, um die überschüssige Farbe abzunehmen. Warum hatte sie den Pinsel vorher nicht sorgfältiger abgestrichen? Sie versuchte sich zu zügeln, aber in ihrer Wut machte sie alles nur noch schlimmer. Sie drückte zu stark auf, die teure Leinwand drohte zu reißen. Schon wieder vollführte der Pinsel wilde Kreise. So wurde das nichts! Sie zwang sich, ein paarmal tief durchzuatmen. Dieses Bild war zu wichtig, sie durfte es nicht verderben. Sie brauchte einen dickeren Pinsel, um das Wasser von der Leinwand abzunehmen. Doch als sie ihn aus dem bunten Tongefäß, in dem er dicht an dicht mit ihren anderen Malutensilien stand, herauszog, kippte der Topf um und drohte vom Tisch zu rollen.
»Hijo de puta!«, entfuhr es ihr. Sie machte einen Satz und konnte ihn gerade noch rechtzeitig auffangen. Fulang-Chang, der in einer Ecke gesessen hatte, bleckte die Zähne und fing wild an zu kreischen. Der kleine Affe klemmte den Schwanz ein und flüchtete auf das Bücherregal.
Entnervt ließ Frida sich auf einen Stuhl sinken und zündete sich eine Zigarette an. Sie inhalierte tief, um sich zu beruhigen. »Das hättest du wohl gern, Diego Froschgesicht, dass ich mein Bild ruiniere. Aber den Gefallen werde ich dir nicht tun!«
In ihre Wut mischte sich Resignation, als sie an die Szene vom Vormittag dachte. Wie so oft hatte sie Diego das Mittagessen in sein Atelier nach San Ángel gebracht, an diesem Tag ein wenig früher als sonst. Sie hatte die Tortilla in einem Korb angerichtet, mit einem bestickten Tuch abgedeckt und sogar noch ein paar Blumen aus dem Garten dazugelegt. Im Atelier hatte sie ihn mit einer Frau vorgefunden, einer sehr gut gekleideten älteren Amerikanerin. Zuerst war sie erleichtert gewesen, immerhin hatte er keine seiner Geliebten bei sich. Aber dann hatte sie Helena Rubinstein, die berühmte Kosmetikunternehmerin und steinreiche Kunstsammlerin, erkannt.
»Das hier gefällt mir und das da drüben auch«, sagte die Rubinstein gerade und wies auf die Bilder, die Diego an der Wand arrangiert hatte. Als sie Frida sah, kam sie lächelnd auf sie zu.
Sie ist hier, um Bilder zu kaufen, ging es Frida durch den Kopf. Und er hat mir nichts davon gesagt.
Diego hatte sie inzwischen ebenfalls bemerkt, es war ihm sichtlich unangenehm, dass sie aufgetaucht war.
Frida stand wie erstarrt, den Korb mit dem Essen immer noch in der Hand, während Helena Rubinstein ihr die Hand reichte.
»Sie müssen Frida Rivera sein. Ein Freund hat mir erzählt, dass er kürzlich Bilder von ihnen gekauft hat.«
Frida nickte. Sie musste den amerikanischen Schauspieler Edward G. Robinson meinen, der vor einigen Wochen zwei ihrer Gemälde gekauft hatte. Vierhundert Dollar hatte er dafür bezahlt, ein kleines Vermögen, es waren ihre allerersten Verkäufe gewesen. Wenn die Rubinstein das wusste, dann würde sie bestimmt auch Arbeiten von ihr sehen wollen. Welche würde sie ihr zeigen? Die meisten waren in Coyoacán. Verflixt, sie war nicht darauf vorbereitet, warum hatte Diego sie denn nicht vorgewarnt? Während sie noch überlegte, nahm Diego ihr den Korb aus der Hand und hob das Tuch an.
»Frida, ist das etwa eine Tortilla?«, rief er begeistert. Er legte den Arm um sie. »Hm, wie das duftet. Helena, die müssen Sie probieren, meine Friducha macht die beste Tortilla von ganz Mexiko. Und sehen Sie, wie hübsch sie immer alles dekoriert. Da steckt Liebe drin.«
Frida starrte ihn entsetzt an. Was redete er denn da? Er sollte sie doch nicht für ihre Kochkünste loben. Sie war Malerin, keine Köchin!
Sie konnte förmlich sehen, wie das Interesse Helena Rubinsteins an ihr erlosch.
»Aber bevor wir essen, möchte ich Ihnen noch ein paar neuere Sachen von mir zeigen«, sagte Diego prompt und zog sie am Ellenbogen mit sich zu einem großen Tisch. »Ich habe schon etwas vorbereitet.«
Frida blieb stocksteif stehen. Was sollte sie jetzt machen? Die Erkenntnis traf sie tief: Diego hatte ihr nicht nur verheimlicht, dass Helena Rubinsein kommen würde, um Kunst zu kaufen, sondern er hatte sie dazu noch als seine Köchin vorgestellt und ihre Bilder mit keinem Wort erwähnt. Wie konnte er nur?
Die Rubinstein drehte sich noch einmal zu ihr herum.
»Vielleicht ein anderes Mal«, sagte sie, und Frida konnte die Verwunderung in ihrem Blick lesen.
Frida bebte immer noch vor Wut, wenn sie daran dachte. Sie war zurück nach Coyoacán gefahren und hatte eine neue Leinwand auf die Staffelei gestellt. Irgendwie musste sie ihren Gefühlen Luft machen, sonst würde sie noch verrückt. Seitdem traktierte sie ihr Bild. Wieder und wieder ließ sie die Begegnung vor ihrem inneren Auge ablaufen und schäumte vor Wut über Diego und über sich selbst. Sie hätte ihm die verdammte Tortilla ins Gesicht werfen sollen!
»Hijo de puta«, fluchte sie erneut und zündete sich eine weitere Zigarette an. Wieso nahm er ihr die Chance, ihre Arbeiten zu präsentieren? Noch dazu vor einer so wichtigen Sammlerin?
Sie stutzte, dann schlug sie sich mit der Hand vor die Stirn. Natürlich! Es musste mit dem Besuch von André Breton zusammenhängen. Der Franzose, Künstler und Vordenker des Surrealismus, hatte von April bis Juli mit seiner Frau Jacqueline in ihrem Haus gewohnt, und kurz vor seiner Ankunft hatte Frida Diego angekündigt, dass sie die Chance nutzen und sich und ihre Bilder ins rechte Licht setzen wolle. »Es wird Zeit, dass die Welt meine Bilder sieht«, hatte sie ihm erklärt. Zu Bretons Begeisterung hatte sie seine Schriften zum Surrealismus gelesen und viele angeregte Diskussionen mit ihm und Jacqueline geführt. Außerdem hatte sie wie zufällig im ganzen Haus ihre Bilder aufgehängt, und André hatte Frida kurzerhand zur Ikone der mexikanischen Surrealisten erklärt. Frida hatte ihm zwar vehement widersprochen, bedeutete Surrealismus doch Malerei jenseits der Realität. In ihren Bildern bildete sie jedoch ihr Leben ab, ihre Wirklichkeit. André hatte den Einwand einfach fortgewischt. Seine Bewunderung für ihre Gemälde kam ihr ein wenig übertrieben vor, aber so war er nun einmal, und als er ihr kurz vor seiner Abfahrt spätnachts vorschlug, eine Ausstellung in seiner Galerie in Paris für sie zu organisieren, und ihr einen grandiosen Erfolg versprach, da hatte sie sich am Ziel ihrer kühnsten Träume geglaubt. Die Vorstellung, dass ihre Bilder, die noch nie irgendwo gezeigt worden waren, eine ganze Ausstellung in der europäischen Kunstmetropole bekommen würden, elektrisierte sie. Vielleicht könnte das ihr Durchbruch werden.
Breton hatte ihr mit seinem Vorschlag, ohne es zu wissen, einen Ausweg gewiesen, nach dem sie schon seit längerer Zeit gesucht hatte. Sie war jetzt seit zehn Jahren mit Diego verheiratet. Sie spürte, dass er ihr entglitt, nicht nur wegen seiner zahllosen Geliebten, an die hatte sie sich inzwischen schon fast gewöhnt. Nein, sie spürte, dass sie neben ihm immer mehr zu verschwinden drohte. Um an der Seite dieses übermächtigen Genies bestehen zu können, brauchte sie etwas Eigenes, und das konnte nur die Kunst sein. Über die Malerei hatten sie damals zueinandergefunden. Was war eigentlich geschehen, dass er auf diesem Weg immer weitergegangen und sie zurückgeblieben war?
Mit André und Jacqueline hatte sie Pläne für die Reise nach Paris gemacht, und seit die beiden wieder weg waren, arbeitete sie mit Feuereifer an neuen Bildern. Diego hatte sich auffällig zurückhaltend gezeigt. Hatte er sich womöglich ausgeschlossen gefühlt und war eifersüchtig auf Breton? War das jetzt seine Retourkutsche? Wie konnte er nur so kleinlich sein! Sonst war er immer bereit, sie zu unterstützen, wenn es um ihre Kunst ging. Aber wenn andere Männer im Spiel waren, änderte sich das schlagartig. Er wurde zum Macho, der seine vermeintlichen Besitzansprüche auch schon mal mit der Pistole verteidigte. Oder gewährte er seine Unterstützung nur so lang, wie er wusste, dass sie ohnehin nur dilettierte? Rechnete er eigentlich gar nicht damit, dass sie tatsächlich Erfolg haben würde? Hielt er sie mit seinem Lob nur bei Laune? Mit einem ärgerlichen Schnauben drückte Frida die Zigarette aus und griff wieder zum Pinsel. Sie musste weitermalen. Sie durfte nicht zulassen, dass ihre Wut auf Diego sie am Vorwärtskommen hinderte.
»Ich werde es auch ohne dich schaffen, Diego Rivera Froschgesicht«, sagte sie laut zu sich selbst. »Ab jetzt bin ich nur noch Malerin, dein Essen kannst du dir zukünftig selbst machen.«
Der Gedanke tröstete sie.
»Du kannst wieder runterkommen, ich habe mich beruhigt«, rief sie Fulang-Chang zu, der sich immer noch oben im Regal verkrochen hatte.
Frida versuchte, sich wieder auf das angefangene Bild zu konzentrieren. Die Passionsblume war nur ein Detail. Bedeutsamer waren die Porträts ihrer Eltern und ihr Kleid, das durch die Luft zu schweben schien. Und sie selbst, nackt, mit einem Seil um den Hals, das ein ebenfalls nackter Mann mit Aztekenmaske immer enger zog. Auf einem Erdhügel saß ein Skelett und sah dabei zu.
Sie trat einen Schritt zurück, um das Bild im Ganzen betrachten zu können. Dabei schoss der Schmerz in ihren Fuß. »Blöder Huf«, schimpfte sie. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass auch der Unfall, der ihren Leib zerstört hatte, und die daraus resultierenden Fehlgeburten auf das Bild gehörten. Weil es die prägenden Erlebnisse in ihrem Leben waren.
Für die nächsten Stunden versenkte sie sich in ihre Arbeit und fand dabei ihre innere Ruhe wieder. Sie malte schnell, skizzierte einige Dinge nur, um sie nicht zu vergessen. Auf die rechte Seite die Umrisse eines Wolkenkratzers, der an das Empire State Building erinnerte. Zwei nackte Frauen, die auf einem Bett lagen, in die untere Ecke. Immer neue Details fügten sich zusammen, sie fragte nicht, aus welchem Winkel ihrer Erinnerungen sie kamen, sie gab ihnen einfach nur einen Platz auf der Leinwand. Mit raschen Strichen erwachten sie vor ihr auf der Leinwand zum Leben. Sie malte mit Präzision und Könnerschaft, keine Übermalungen mehr, keine zu feuchten Pinsel.
Fulang-Chang zupfte an ihrem Rock, ihm war langweilig, vielleicht hatte er auch Hunger.
»Ich habe jetzt keine Zeit. Geh zu Amala«, sagte sie und scheuchte ihn aus dem Atelier, ohne von der Arbeit aufzusehen.
Ein paar Stunden später wusch sie erschöpft die Pinsel aus und betrachtete das Gemälde. Es war noch lang nicht fertig, vor allem fehlte noch die Klammer, die die einzelnen Elemente zusammenhielt. Aber das Bild strahlte jetzt schon eine gewaltige Energie aus. Der Grundstein war gelegt. Am liebsten hätte sie weitergemalt, aber die Schmerzen im Rücken sagten ihr, dass es für heute genug war.
Mit diesem Bild beginnt etwas Neues, dachte sie plötzlich. Und Diego wird mich nicht daran hindern, als Malerin zu leben.
Ich bin eine Künstlerin. Das ist alles, was zählt.
Kapitel 2
Es war schon sehr spät am Abend.
Frida saß in ihrem Sessel und betrachtete die Abbildungen von Hieronymus Boschs Garten der Lüste in einem ihrer vielen Kunstbücher. Ihr war aufgegangen, dass die Anordnung verschiedener Elemente in ihrem Bild ganz ähnlich war. Sie war ganz in die wundersame Welt Boschs versunken, als sie schwere Schritte vernahm, die vor ihrem Zimmer verharrten.
Dann drang ein komisches leises Schaben durch die Tür. Wider Willen lächelte sie. Sie wusste, dass Diego gerade ungelenk auf einem Bein stand und die klobigen Schuhe an seiner Hose abwischte. Das machte er immer so, wenn er unsicher war. Und jetzt fuhr er sich mit den Händen durch das Haar und räusperte sich.
»Komm schon rein«, rief sie.
Er betrat den Raum, die Holzdielen hoben und senkten sich unter seinem Tritt. Frida wippte in ihrem Sessel auf und ab, was sie gegen ihren Willen zum Lachen brachte.
Diego lächelte sie hoffnungsvoll an. Er schien zu glauben, sie habe ihm die Szene vom Morgen verziehen. Dabei ging sie nur deshalb nicht auf ihn los, weil sie so eine tiefe Befriedigung durch das neue Bild verspürte. Trotzdem sollte er nicht ungestraft davonkommen.
»Wo ist denn Helena?«, fragte sie zuckersüß.
»Sie musste zum Flughafen. Aber sie lässt dich herzlich grüßen.«
Frida blickte ihn wortlos an.
»Es tut mir leid. Ich habe vergessen, es dir zu sagen.«
»Du hast es vergessen? Frau Rubinstein ist eine anerkannte Sammlerin. Hätte sie eines meiner Bilder gekauft, wäre das ein Signal für andere gewesen. Das wäre wichtig für mich gewesen. Wie kannst du so gleichgültig sein?«
Er wich ihrem Blick aus. »Aber sie hat mir etwas für dich mitgegeben. Einen Lippenstift, sie hat gemeint, das tiefe Rot würde dir wunderbar stehen.« Er reichte ihr ein kleines Päckchen.
»Und du meinst, damit ist die Sache vergessen? Ich will keinen verdammten Lippenstift, ich wollte ihr ein Bild verkaufen.« Sie schleuderte das Päckchen an die Wand.
Er starrte sie an, sie konnte das Begehren in seinen Augen lesen. Das machte sie noch wütender, sie spürte, wie der Zorn sich jetzt doch in ihrem Brustraum sammelte und nach oben drängte. Diego hob beschwichtigend die Arme.
»Reg dich nicht auf. Morgen kommen zwei Amis. Die sind bei mir aufgekreuzt, als Helena gerade gegangen war, und ich habe sie herbestellt. Sie haben etwas von mir gekauft, und jetzt wollen sie was von dir. Sie stinken vor Geld, sie nehmen bestimmt was.«
Frida winkte ab. »Lass es gut sein. Ich habe heute mit einem neuen Bild angefangen. Es wird sehr gut werden, das spüre ich. Ich will es mit nach Paris nehmen.«
»Darf ich es sehen?«, fragte er.
In ihre Augen trat ein Leuchten, als sie sein ehrliches Interesse spürte.
Diego stand lange vor der Staffelei und betrachtete jedes Detail.
»Frida, das ist grandios. Es ist voller Symbole, es hat eine ganz eigene Bildsprache.« In seiner Stimme lag Bewunderung, und sie bekam plötzlich Zweifel und ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hatte er Helenas Besuch wirklich nur vergessen? Er vergaß ja auch, Briefe zu lesen und Rechnungen zu bezahlen, er vergaß sogar zu essen, wenn er arbeitete.
»Aber es ist auch zum Fürchten«, sagte er und riss sie aus ihren Gedanken.
Sie zuckte mit den Schultern. »Das ist einfach mein Leben«, sagte sie, nachdem sie die verschiedenen Elemente erklärt hatte. »Aber ich habe noch keine Idee für einen Rahmen, der alles zusammenhält. Bisher ist es nur eine Collage.«
»In deiner Collage fehlt etwas«, sagte Diego, und sie hörte so etwas wie Enttäuschung heraus.
Frida blickte erneut auf das Bild, und da bemerkte sie es. Ihr Bild stellte ihr Leben dar, aber die wichtigste Person in ihren Leben fehlte: Diego.
Am nächsten Morgen wollte sie als Erstes ein paar Arbeiten für die Amerikaner heraussuchen, aber als ihr Blick auf das neue Bild fiel, fing sie stattdessen an zu malen und vergaß den Besuch. Gegen Mittag hörte sie sie über den Patio kommen. Sie lachten zu laut, und die Frau zeigte hierhin und dorthin und fand alles marvellous.
Diego führte sie in ihr Atelier, und Frida setzte ein Lächeln auf.
»Frida, das sind John und Maggie Richardson aus Philadelphia. Sie wollen deine Bilder sehen.« Dann trat er zur Seite, damit Frida den beiden die Hand geben konnte.
John übersah die Geste und ging schnurstracks zu ihrer Staffelei. Er beugte sich nach vorn und studierte kopfschüttelnd das Bild.
Frida spürte das brennende Bedürfnis, es vor seinen gierigen Blicken schützen zu müssen. »Ach, das ist nur eine Fingerübung und auch noch lange nicht fertig«, sagte sie schnell und hängte ein Stück Leinen über die Staffelei.
»Also, ich verstehe gar nicht, wie Sie das machen«, sagte Maggie.
»Sie meinen, wie ich male?«
»Nein, wie Sie das schaffen, zu malen. Ich habe kaum Zeit für solche Dinge. Ich kümmere mich um John, damit bin ich reichlich beschäftigt.«
Fulang-Chang kam neugierig angelaufen, und Maggie stieß einen weiteren Schrei des Entzückens aus. »Wie niedlich!«, rief sie und beugte sich zu ihm hinunter.
Der kleine Affe bleckte die Zähne, und sie zuckte erschrocken zurück. »John!«, rief sie.
»Sperr ihn doch bitte ein«, sagte Diego, und Frida hörte seinen Zorn heraus. Er mochte Fulang-Chang nicht, seitdem dieser einmal ein Bild von ihm mit seinen flinken Fingern zerfetzt hatte. Obwohl er hinterher gelacht und behauptet hatte, der Affe habe eben Kunstverstand.
Frida lockte das Tier herbei und setzte es sich auf die Schulter.
»Frida«, mahnte Diego.
»Mich stört er nicht.«
»Wo sind denn Ihre Bilder?«, fragte John. Er ging in ihrem Atelier herum, betrachtete alles ganz ungeniert, als gehöre es ihm schon, während seine Frau nervös zu dem Affen hinübersah.
»Verkaufen Sie das auch?«, fragte der Amerikaner und wies auf ein lebensgroßes Skelett aus Pappmaschee, das einen bestickten Unterrock trug und in einer Ecke von der Decke hing. »Guck mal, Maggie, das ist nice! Was kostet es?«
»Das verkaufe ich nicht. Das ist mein Schwesterchen. Sie sieht mir beim Malen zu.«
Diego schüttelte missbilligend den Kopf.
Wie um sie zu beruhigen, warf Frida der Puppe einen verschwörerischen Blick zu. Natürlich würde sie sich nicht von ihr trennen. Sie und die anderen Figuren aus Pappmaschee waren ihre Freunde, die mit ihr redeten, sie lobten oder beruhigten. Aber in Anwesenheit der Gringos rümpften sie die Nase und waren verstummt.
»Darling, sieh mal hier. Das ist wirklich entzückend. Das will ich haben!«
Maggie stand jetzt vor dem Puppentheater, das Frida in einem Schuhkarton erschaffen hatte. Die winzigen Puppen saßen um einen Tisch herum, ein Krokodil und ein Hund waren auch dabei. »Was kostet das?«, fragte sie.
Frida fing einen weiteren scharfen Blick von Diego auf, als sie erneut antwortete, dass es nicht zu verkaufen sei.
»Ich dachte, Sie sind an meinen Bildern interessiert?«, fragte sie. »Warten Sie, ich zeige Ihnen welche.« Sie ging zu der großen Truhe, die vor dem Fenster stand, hob den schweren Deckel an und nahm zwei Bilder heraus.
»Die sind aber klein«, sagte Maggie mit einem Ausdruck der Enttäuschung. »Haben Sie nichts Größeres?«
»Größer male ich nun mal nicht.«
»Das hat nichts zu bedeuten«, mischte sich Diego rasch ein. »Frida malt mit dem Herzen. Ihr gelingt es, in kleinen Formaten ganze Welten auszudrücken. Darin liegt ihre einzigartige Kunst.«
Frida legte die beiden Leinwände, die noch ungerahmt waren, auf einen Tisch.
Maggie wich entsetzt zurück, als ihr Blick auf das erste Gemälde fiel. Es zeigte eine nackte Frau auf einem Bett, der Körper blutüberströmt. Davor stand ihr Mann, der noch das Messer in der Hand hielt.
»Das Bild heißt Ein paar kleine Dolchstiche«, sagte Frida. »Ich wollte damit auf die vielen Morde an mexikanischen Frauen hinweisen. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt: Hier ist ein anderes.« Sie schob die Dolchstiche zur Seite, und darunter erschien eine weitere nackte Frau auf einem blutigen Laken. Zwischen den gespreizten Schenkeln war der Kopf eines Neugeborenen zu sehen. »Und das hier zeigt meine Geburt. Wenn Sie genau hinsehen, dann erkennen Sie, dass ich das Baby bin.«
Maggie schnappte nach Luft und wandte sich röchelnd ab.
»Und das nennen Sie Malen mit dem Herzen? Glauben Sie, wir hängen uns so etwas übers Sofa?« John griff nach der Hand seiner Frau und zog sie hinter sich her. »Auf Wiedersehen«, sagte er.
»Ich bringe Sie raus«, sagte Diego rasch und folgte ihnen.
Als er wieder zurück ins Atelier kam, rief er wütend:
»Ich denke, du willst Bilder verkaufen. Gestern hast du mich wegen Helena beschimpft, und heute bringe ich dir Kunden, und du vergraulst sie.«
Sie starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Das waren doch keine Kunden. Das waren Gringo-Idioten. Die hätten nie eines meiner Bilder gekauft.« Dann lachte sie. »Aber für den dämlichen Gesichtsausdruck dieser Frau war es die Sache wert.«
Mit einem Mal fiel Diego in ihr Lachen ein. »Du hast recht, das waren Idioten. Ich habe ihnen zwei völlig verhunzte Arbeiten angedreht, die eigentlich auf den Müll gehören, und sie haben es nicht gemerkt.«
Frida zündete sich eine Zigarette an.
»Meine Bilder sind zu gut für solche Leute. Sie gehören in die großen Museen, in den Louvre oder in das Museum of Modern Art. Nicht in die privaten Wohnzimmer irgendwelcher Menschen, die keinen Ahnung haben und nur Dekoration wollen. Helena hätte mir dabei helfen können, aber sie hat ja nur deine Köchin kennen gelernt.«
»Du übertreibst wie immer. Darf ich dich daran erinnern, dass du am Anfang unserer Ehe sogar Kochunterricht genommen hast? Du bringst mir jeden Tag einen Korb mit Essen. Woher sollte ich wissen, dass du deine Meinung geändert hast?«
Fridas Empörung fiel in sich zusammen. Er hatte ja recht. Sie hatte lange Zeit ihre Krankheit als Ausrede benutzt, um nicht zu arbeiten. Am Anfang des Jahres war sie am Fuß operiert worden, und danach hatte sie sich durch den Tag treiben lassen, weil sie sich erschöpft und deprimiert fühlte. Da war es ihr gerade recht gekommen, dass sie für Diego sorgen konnte. Aber diese Zeiten waren endgültig vorbei. Sie hatte beschlossen, ihr Leben zu ändern.
»Nun, Diego, merk dir, dass ich ab sofort nicht mehr für dein Essen zuständig bin. Ich bin Malerin, ich mache Kunst. Und mit diesem Bild werde ich das beweisen.«
Diego sah sie an, und sie konnte sehen, wie er sich fragte, ob sie das erst meinte und wie lang sie es durchhalten würde. Dann stellte er sich wieder vor die Staffelei. »Weißt du was? Ich glaube, das wird dir gelingen.«
Frida drehte sich zu ihm um. Er meinte es ernst. Ihr Unwillen verflog. Sie trat zu ihm und schmiegte sich in seine Arme.
»Ich habe Hunger. Hat Amala was vorbereitet?«, fragte er.
»Geh doch in die Küche und sieh nach«, gab Frida zurück. »Ich brauche jetzt einen Tequila.«
Später saßen sie am Tisch und aßen. Danach räumten sie gemeinsam auf. Es war spät geworden, und Diego verabschiedete sich in sein Schlafzimmer. Frida wollte erst vorübergehen, aber dann blieb sie in der offenen Tür stehen.
Er bemerkte sie nicht gleich, und sie beobachtete ihn dabei, wie er sich etwas schwerfällig auszog und auf das Bett legte. Auf einmal quoll Fridas Herz über vor Zärtlichkeit für diesen seltsamen Mann, der immer noch der Mann ihres Lebens war. Sie machte eine kleine Bewegung, Diego blickte zu ihr, und sie verlor sich in seinen dunklen Augen. Wen er mit diesem Blick ansah, in dem eine ganze Welt lag, der musste ihm verfallen.
Er ist doch mein Ehemann, dachte sie, um sich gleich darauf zu korrigieren: Nein, ist er nicht. Diego gehört niemandem und allen zugleich. Das machte es ja so schwer, mit ihm zu leben.
Er klopfte mit der flachen Hand auf die Matratze. »Komm, meine Friducha. Es tut mir leid, wie das mit Helena gelaufen ist. Ich habe nicht nachgedacht. Vielleicht hatte ich aber auch Angst, dass sie nur deine Bilder kauft, wenn sie sie sieht.«
Sie legte sich zu ihm, und er fing an, sie behutsam auszuziehen, während er ihr Liebesworte sagte.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen galt Fridas erster Gedanke wieder dem Bild auf der Staffelei. Neben dem Bett lag eine Nachricht von Diego.
Ich musste schon los. Ich habe mir eben noch mal dein Bild angesehen. Es wird großartig werden. Wir sehen uns später. Dein Froschgesicht.
Ohne sich anzuziehen, sprang sie auf und eilte auf nackten Füßen in ihr Atelier hinüber. Sie schlug das Tuch zurück, das Bild wurde von der Sonne getroffen und leuchtete. Frida stellte sich davor. War es so, wie sie es in Erinnerung hatte? Hatte es noch Bestand, war es noch so wichtig wie gestern? Oder hatten die Figuren aus Pappmaché sich seiner über Nacht bemächtigt, daran herumgekritzelt, ihm die Aura genommen, es entwertet und lächerlich gemacht? Das taten sie manchmal. Sie waren zwar ihr besten Freunde, immer für sie da, aber manchmal trieben sie Schabernack mit ihr. Und sie waren ihre schärfsten Kritiker.
Diego lachte sie aus, wenn sie ihm davon erzählte. »Was da spricht, sind deine eigenen Zweifel«, rief er.
Aber Frida wusste es besser.
»Guten Morgen, Schwesterchen«, begrüßte sie die Puppe, die sie freundlich ansah. Erleichtert atmete sie aus.
Sie ließ ihren Blick über die Elemente des Bildes wandern: die nackte Frau, ihr Kleid, die Passionsblume, die mexikanischen Pflanzen und ihre Eltern. Mehr oder weniger intuitiv waren all diese Dinge auf die Leinwand gekommen. Aber was war die Klammer, die alles formal zusammenhielt? Frida trat dicht an die Staffelei und sah in die Augen ihrer Mutter. Über ihr erhob sich ein feuerspeiender Vulkan. Sie setzte einen Vogel mit rotem Gefieder dazu, den sie auf dem Gemälde von Hieronymus Bosch gesehen hatte, ohne bereits zu wissen, wofür er stehen sollte.
»Die Dinge müssen viel enger zusammenstehen«, murmelte sie. »Sie gehören zusammen, als wären sie eins, es darf keine Abstände, keine Lücken zwischen ihnen geben. Aber wie soll das gehen?«
Sie ging auf und ab und sah immer wieder auf das Bild. So etwas war ihr noch nie passiert. Noch nie war das Gefühl, ein Bild malen zu müssen, so drängend gewesen. Es wollte aus ihr heraus, sie musste mit ihm etwas ausdrücken. Die alte Frida hätte vielleicht aufgegeben und dieses Bild unvollendet gelassen, weil sie nicht weitergewusst hätte. Aber die neue Frida würde dranbleiben. Sie würde so lang ausharren, bis sie eine Idee hätte. Sie merkte, dass ihr der Gedanke gefiel, sie sogar mit Stolz erfüllte.
Sie nahm einen Pinsel und mischte ein Rot an. Ein paar Stunden arbeitete sie weiter an dem Bild, machte hier einen Strich und radierte dort etwas aus. Aber sie kam nicht voran, der zündende Funke wollte nicht kommen. Tief in ihre Gedanken versunken, legte sie den Stift zur Seite und ging in die Küche, um, wie jeden Tag, Essen vorzubereiten.
Sie schnitt Zwiebeln und Tomaten und wusch den Mais für die Enchiladas. Dann hackte sie ein großes Bund Koriander, und plötzlich hielt sie inne. Was mache ich denn hier, das wollte ich doch nicht mehr. Die Zeiten, in denen Diego malt und ich koche, sind vorbei. Sie nahm das Gemüse und gab es den Hühnern, die sich wild gackernd auf die Leckerbissen stürzten.
Als sie auf dem Weg zurück ins Haus in eine Mulde im Sand trat, stach der altvertraute Schmerz in ihren rechten Fuß. Elfmal war er bei dem Busunfall gebrochen worden, und er war nie wieder richtig zusammengewachsen.
Sie humpelte in ihr Schlafzimmer, um die Tabletten zu holen, und bei jedem Schritt stöhnte sie auf. Wenn sie jetzt nicht aufpasste, würden die Schmerzen am Abend unerträglich sein. Sie beschloss, ein Bad zu nehmen. Die Wärme des Wassers tat ihr immer gut.
Nur mit Mühe gelang es ihr, in die Wanne zu steigen, aber dann streckte sie sich in dem heißen Wasser aus und begann sich zu entspannen. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Der Schmerz in ihrem Fuß ließ nach.
Vor der geschlossenen Tür hörte sie ein Kratzen. Das war Señor Xólotl, der hereinwollte. Der Hund winselte leise, dann, als Frida nicht reagierte, schlich er davon.
Sie öffnete die Augen wieder und sah ihre Füße mit den rot lackierten Nägeln, die am Ende der Wanne rechts und links neben dem Überlauf aus dem Wasser ragten. Die Narben, die sich am rechten Fußrücken über den großen Zeh zogen, riefen die Erinnerung an ihren Unfall und die Folgen hervor. Sie waren ein Sinnbild für ihr bisheriges Leben, für alles, was sie war.
Sie lag ganz still, und die Wasseroberfläche beruhigte sich und war wie ein Spiegel. Sie sah den Überlauf, an dem die Kette mit dem Stöpsel hing, zweimal. Und auch ihre Zehen wurden im Wasser gespiegelt.
Mit einem Ruck setzte sie sich auf, und das Bild verwackelte und verschwand. Aber ihre Idee hatte sie gefunden! Die gefüllte Badewanne beziehungsweise die untere Hälfte, die sie gerade vor sich sah, mit ihren Knien und den Füßen am Ende, würde den Rahmen für ihr Gemälde abgeben. Und die einzelnen Elemente ihres Bildes würden auf und im dunklen, halb durchscheinenden Wasser schwimmen.
Wasser war Leben, aus dem Wasser kam sie, das Wasser schenkte ihr Frieden und die Abwesenheit oder zumindest die Linderung von Schmerz. Und auf der Wasseroberfläche würde sie alle die Dinge malen, die das Wasser ihr gab. »Was mir das Wasser gab«, flüsterte sie. So würde sie das Bild nennen.
Sie versuchte, ganz still zu liegen, damit auch das Wasser wieder zur Ruhe kam. Aber vor Erregung atmete sie heftig, und es dauerte lang, bis alles ganz reglos war. Dann bewegte sie vorsichtig den Kopf und sah wieder in diesen Spiegel. Und mit ihm in ihr ganzes Bild.
Wie üblich kam Diego erst gegen Mitternacht nach Hause. Aber auch Frida war noch fleißig. Sie saß mit einem Skizzenblock am Tisch, als sie seine schweren Schritte im Flur hörte. Sie stand auf, schlug sich ein Tuch um die Schultern und ging ihm entgegen.
»Hallo meine Friducha. Wie schön, dass du noch wach bist.« Er klang ein bisschen aufgedreht, so, als hätte sie ihn bei irgendetwas ertappt. Sofort war sie alarmiert. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen, und roch ein fremdes Parfum. Sie hatte sich also nicht geirrt.
»Ist sie noch in San Ángel?«, fragte sie.
Er zuckte mit den Schultern. »Aber Frida …«
Plötzlich wich alle Energie, die sie gerade noch gespürt hatte, aus ihrem Körper. Dieses Auf und Ab in ihrer Beziehung kostete so unendlich viel Kraft. An einem Tag war sie Diego sehr nah, am nächsten stieß er sie vor den Kopf. Sie ertrug es nicht länger, ständig von ihm betrogen zu werden. Konnte er nicht wenigstens die Spuren seiner Eskapaden verwischen? War ihm denn völlig egal, dass sie darunter litt? Demütigte er sie womöglich mit Absicht? Sie ballte die Fäuste. Sie durfte sich das nicht länger gefallen lassen!
Doch als sie ihn beschimpfen wollte, hielt er ihr etwas hin.
»Hier. Für dich.«
Frida nahm die kleine Figur aus Jade in die Hand. Sie passte beinahe in ihre Faust. Bevor sie richtig sah, was es war, bemerkte sie die Weichheit des Steins, der von Diegos Hand ganz warm war. Sie öffnete die Finger und betrachtete den liegenden Hund. Aufmerksam, aus großen Augen sah er sie an, die Ohren gespitzt. Sie fuhr über seine Pfoten und konnte sogar die kleinen Krallen ertasten.
»Die Figur ist prähispanisch. Ein Bauer hat sie auf seinem Feld gefunden und mir gebracht. Ich habe sofort gedacht, dass ich sie dir schenken muss, damit du nicht traurig bist, wenn Señor Xólotl mal nicht bei dir ist.«
»Eigentlich vermisse ich dich.« Sie merkte, wie ihr Zorn verflog und Platz für Traurigkeit machte.
Seine Geste berührte sie. Diego sammelte alte Kunst wie ein Besessener. Er musste inzwischen Tausende von Stücken besitzen: Figuren, Keramik, kostbaren Schmuck der Indigenen aus allen Ecken Mexikos … Er liebte und kannte jedes einzelne Stück. Und er träumte davon, ein Museum für seine Sammlung zu bauen.
Wider Willen musste sie lächeln. Wenn Diego durchs Haus ging, wackelten die Wände, aber wenn er sie beschenkte, waren seine Bewegungen leicht die wie Flügel eines Schmetterlings.
Sie fing seinen Blick auf und sah sie beide in dem Spiegel des Kleiderschranks. Sie eine bunte Blume in einem weißen Nachthemd und mit einem rot schimmernden, üppig bestickten Tuch um die Schultern, er ein Koloss in einem viel zu warmen Tweedanzug. Genau so hatte sie ihn zum ersten Mal gesehen: Sie war bei der Fotografin Tina Modotti zu einer Party eingeladen gewesen, hatte vor einem Spiegel gestanden, ihre Frisur gerichtet und sich ein paar Blüten ins Haar gesteckt, da war er hinter ihr aufgetaucht und hatte sie so voller Begierde angesehen. Damals hatte sie sich in ihn verliebt.
Ich liebe ihn immer noch, dachte sie, obwohl er ein Monster ist und mich betrügt.
»Ich muss gleich wieder gehen. Ich wollte dir das nur schnell bringen. Damit du nicht traurig bist …«
Frida erstarrte. Also war die andere noch in San Ángel. Vielleicht wartete sie sogar im Auto auf ihn. Wahrscheinlich wieder eine dieser Gringas. Seit einiger Zeit galt es unter den reichen Amerikanern als schick, nach Mexiko zu kommen, um Bilder von Diego Rivera zu kaufen. Und die Frauen gönnten sich eine Nacht oder zumindest einen Flirt mit dem berühmtesten Maler Mexikos.
»Dann geh doch!«, schleuderte sie ihm entgegen. Die Hände in die Hüften gestemmt, sah sie ihm nach. »Was war ich nur für eine Närrin, als ich dich geheiratet habe!«, rief sie.
Alle hatten sie damals gewarnt, ihre Freundin Tina Modotti, ihre eigene Mutter, die verächtlich von der Hochzeit einer Taube mit einem Elefanten gesprochen hatte. Sie alle hatten Recht behalten. Diego war doppelt so alt wie sie, er hatte schon ein Leben hinter sich, war zweimal geschieden und als Frauenheld berüchtigt. Wie hatte sie allen Ernstes glauben können, sie würde ihn ändern? Bereits kurz nach der Hochzeit hatte Diego Affären gehabt, nichts Wichtiges in seinen Augen, nichts, was für Frida gefährlich sein könnte.
»Mein Körper ist nicht dafür gemacht, treu zu sein«, hatte er gesagt. »Das hat mir sogar mein Arzt bestätigt.«
Die Erkenntnis, dass Diego ihre romantische Idee der Liebe, die für sie immer und ewig zu sein hatte, nicht teilte, hatte sie gepeinigt. Wie konnte er auch nur an andere Frauen denken, wenn sie bei ihm war? Das konnte sie anfangs nicht begreifen. Sie hatte sich damit getröstet, dass seine Affären nichts an seiner tiefen Liebe zu ihr änderten.
»Wenn ich deine Treue nicht haben darf, dann will ich deine Loyalität!«, hatte sie verlangt.
»Ich verspreche es dir«, hatte er geantwortet.
Stöhnend drehte sie sich in ihrem Bett um, weil sie keinen Schlaf fand. Diego entglitt ihr. Er entfernte sich. Wie weit ging seine Unterstützung wirklich? Erst gestern hatte er sich lang das Wasserbild angesehen, aber nur, weil es ihm gerade in den Kram gepasst hatte. Er nahm seine Kunst wichtiger als ihre, so war es doch. Und dabei hatte er doch versprochen, loyal zu sein, wenn er schon nicht treu sein konnte. Auch dieses Versprechen hatte er gebrochen.
Vor lauter Grübeln fand sie keinen Schlaf. Schließlich stand sie wieder auf. Ihr Blick ging zu der Schatulle, in der sie die Dollars aufbewahrte, die ihr Edward Robinson für die Bilder gezahlt hatte. Vierhundert Dollar in neuen Zwanzig-Dollar-Scheinen. Es war gut, dass sie Geld hatte. Das machte sie unabhängig von Diego.
Sie hob den Kopf und sah sich selbst im Spiegel an. Ich bin einunddreißig Jahre alt, dachte sie, eigentlich eine Frau im besten Alter, aber ich fürchte, dass meine Krankheit mir weniger Zeit lässt als anderen. Was will ich im Leben erreichen? Ich bin nicht mehr jung genug, um mich an einen untreuen Mann zu binden. Ich bin talentiert, es ist an der Zeit, dass ich dieses Talent ausschöpfe.
Sie brachte ihr Gesicht dicht vor den Spiegel. Waren da die allerersten zarten Fältchen in ihren Mundwinkeln, verdeckt durch die schwarzen Härchen, den Anflug eines Damenbarts?
Lange stand sie so da. Ich werde das Wasserbild fertigstellen, versprach sie sich. Und dann werde ich das nächste Bild malen und danach wieder das nächste. Die Zeiten, in denen ich im Schatten des großen Diego Rivera vor mich hingepinselt habe, sind endgültig vorbei. Meine Bilder sind mein Leben. Sie helfen mir, mich selbst zu verstehen und meine Enttäuschungen und Katastrophen zu verarbeiten. Wenn ich nicht gemalt hätte, vielleicht wäre ich verrückt geworden oder hätte mich schon umgebracht. Ich wäre gern weiter Diegos Frau, aber wenn dieser Koloss mich unter sich zerquetscht, dann muss ich mich von ihm frei machen.
Sie lächelte ihrem Spiegelbild zu. Ich will meine Bilder nicht nur malen, sondern sie auch der Welt zeigen und verkaufen. Die Zeiten, in denen ich Geld von Diego genommen habe, sind auch vorüber.
Frida atmete tief ein und aus. Endlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie fühlte sich stark. Unabhängig. Frei. Ich werde es allein schaffen, dachte sie. Ich bin nicht länger Diegos Muse. Ich bin nicht länger Frida Rivera. Ich bin Frida. Frida Kahlo.
Kapitel 4
Frida streckte den Rücken durch und rollte mit den Schultern. Es war fast Mittag, und sie hatte schon stundenlang gearbeitet und dem Wasserbild immer neue Facetten hinzugefügt. Jetzt brauchte sie eine Pause. Außerdem wartete sie auf den Postboten. Wann kam er denn endlich? Sie hoffte auf Nachricht von Breton. Sie hatte ihm schon zweimal geschrieben und nach Neuigkeiten wegen der Ausstellung gefragt, aber er antwortete nicht. Hatte er zu viel versprochen? War das alles nur ein Hirngespinst, ein Traum, und sie würde für immer die Frau in Diegos Schatten bleiben? Sie war sich nicht sicher, ob sie diesen Rückschlag verkraften würde.
Missmutig setzte sie sich auf eine der kleinen Mauern in die pralle Augustsonne, stand aber gleich wieder auf und wanderte über den Patio bis zu dem großen Orangenbaum, der schon seit ihrer Kindheit hier stand. Sie pflückte ein Blatt ab und zerrieb es zwischen den Fingern. Der herbe, vertraute Duft beruhigte sie normalerweise. Dieser Innenhof war ihr Rückzugsort, sie liebte ihn über alles. Ringsum hatte sie üppig bepflanzte Tonkrüge aufgestellt, in denen Callas und Agaven wucherten. In kleineren Töpfen wuchsen Kakteen. Frida beugte sich hinunter, um die winzigen Blüten in Helllila zu bewundern. In jeder Nische, auf jeder Treppenstufe stand oder saß eine prähistorische Figur aus Terrakotta. Tauben und Stare nisteten in den eingemauerten Krügen unterm Dach. Hier gab es immer etwas zu sehen oder zu hören, und inmitten dieser Lebendigkeit, während sie stundenlang welke Blätter zupfte, fand Frida Ruhe und oft auch Inspiration für ihre Bilder. Sie strich über die glänzenden Blätter des Philodendron gloriosum, und ihr fiel auf, dass sie die Form eines Herzens hatten – oder einer Vulva, dachte sie mit einem Lächeln. Ihre Finger verharrten, und sie drehte eines der großen Blätter um und hielt es gegen die Sonne. Auf einmal spürte sie ein Kribbeln im Nacken, als würden Ameisen darüber laufen. Sie schloss die Augen und horchte in sich hinein. Wieder sah sie auf das Blatt. Es bedeutete etwas, aber was? Sie sah das Bild auf der Staffelei vor sich, die Stelle, an der sie die Gesichter ihrer Eltern gemalt hatte. Sie sah in die Augen ihrer Mutter, und da wusste sie es. Hinter diesem Blick verbarg ihre Mutter ihre verlorene Liebe zu einem Mann, der sich vor ihren Augen umgebracht hatte. Und in Papas Augen las sie die trotzige Gewissheit, dass er den anderen niemals ersetzen konnte, und dass er sich während seiner epileptischen Anfälle in eine Welt zurückzog, zu der sie keinen Zutritt hatte. Die Blätter müssen in dünnen Wurzeln auslaufen oder noch besser: in Blütenfäden, die sich ineinander verwirren wie Schamhaare, dachte sie. Mitten hinein werde ich meine eigene Lust und meine Kinderlosigkeit malen … vielleicht … kurz hielt sie inne, vielleicht könnte sie eine nackte Frau auf einem Bett in das Grün stellen. Nein, besser zwei Frauen, die sich zart berührten …
Auf einmal hatte sie es eilig, ihre Müdigkeit und auch der Postbote waren vergessen. Sie wollte zurück an ihre Staffelei.
Fulang-Chang sprang ihr vor die Füße, und sie nahm den Affen auf den Arm. Er schlang die Arme um ihren Hals und schmiegte sich an sie wie ein Kind. Dann plötzlich kratzte das Tier sie, sprang zurück auf den Boden und lief mit einem Klagelaut zurück zum Haus. Frida folgte seinem Blick. Durch das große Fenster konnte sie in ihr Atelier sehen, wo das unfertige Bild auf sie wartete.
Sogar Fulang merkt, wie nervös ich bin, stellte sie flüchtig fest, denn in Gedanken mischte sie bereits grüne Farbe an.
In diesem Augenblick trat der Postbote durch das Tor. Frida legte das Blatt auf eine Bank, hielt noch einmal kurz inne, speicherte das Bild, das vor ihren Augen entstanden war, in ihrem Gedächtnis ab, um es ja nicht zu vergessen. Dann ging sie dem Mann entgegen, der ihr einen ganzen Packen Briefe hinhielt. Meistens waren sie alle für Diego: Rechnungen, Mahnungen, Einladungen.
»Heute habe ich auch etwas für Sie, Señora Rivera. Aus Nueva York!«
»Danke!«
New York, nicht Paris? Frida nahm ihm den Brief aus der Hand. Die Schrift sagte ihr nichts. Neugierig drehte sie ihn um und blickte auf den Absender. Der Brief kam von einer Galerie Julien Levy.
Frida wischte sich die Finger an ihrem Rock ab, dann riss sie den Umschlag auf und überflog ungeduldig die Zeilen. Mr. Levy teilte ihr mit, dass er sich auf Empfehlung seines Freundes André Breton an sie wende, und fragte an, ob sie Interesse an einer Einzelausstellung in seiner Galerie habe.
Eine Ausstellung in New York? Das war ja noch viel besser als Paris. Hastig las sie die Zeilen noch einmal, ja, dieser Levy schlug ihr eine Einzelausstellung vor. Das war mehr, als sie sich je erträumt hatte. Und ob sie Interesse hatte! Das war die Gelegenheit, auf die sie gewartet hatte.
»Diego«, rief sie und eilte in sein Schlafzimmer. Es war ihr egal, dass er noch schlief. Diese Nachricht konnte sie keine Sekunde für sich behalten. »Diego, das glaubst du nicht.«
»Was ist denn, Friducha?«, fragte er und rieb sich die Augen.
Im Vorübergehen hob sie automatisch eines seiner riesigen Hemden auf und hängte es an den Haken. Sie ließ sie aus Amerika kommen, denn in Mexiko gab es keine Hemden in seiner Größe. Von dem Kleidungsstück stieg der schwache Duft eines Frauenparfums auf, aber das war ihr in diesem Augenblick egal.
»Julien Levy aus New York lädt mich ein, bei ihm auszustellen. Erinnerst du dich, wir waren mal dort. André hat mich empfohlen.« Dann ließ sie die Schultern sinken. »Aber hier steht: Galerie für Surrealismus. Dieser Levy stellt offensichtlich surrealistische Bilder aus.« Sie warf sich aufs Bett, landete halb auf Diego und hielt ihm den Brief hin.
Diego setzte sich auf, an das Kopfteil des Betts gelehnt, und zog Frida an seine Seite. »New York? Zeig mal her.« Er überflog die Zeilen, dann blickte er auf: »Er schreibt, er habe durch Breton von deinen Bildern gehört …«
»Genau. Wer weiß, was der ihm über mich erzählt hat …«
Diego sah sie an, dann schürzte er amüsiert die Lippen. »Du hast es doch darauf angelegt, dass Breton dich als Vorreiterin des Surrealismus sieht. Wochen, bevor er kam, hast du seine Schriften gelesen und anschließend das ganze Haus mit deinen Bildern gepflastert, so dass er sie gar nicht übersehen konnte. Und jetzt hast du, was du wolltest. Chapeau!
Frida lächelte in sich hinein. Diego hatte recht, sie hatte gewollt, dass André ihre Bilder mochte, weil sie gehofft hatte, ihrem Leben dadurch eine andere Richtung zu geben. Ihr Plan war aufgegangen. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass seine Beziehungen so weit reichten, dass er sie an eine New Yorker Galerie vermittelte. Oh Gott, ich werde meine Bilder in New York ausstellen, schoss es ihr durch den Kopf.
Sie keuchte und presste die Hand vor den Mund. Sie hatte doch keinen Schimmer, wie sie so etwas bewerkstelligen sollte. Wahrscheinlich hatte sie nicht mal genügend Arbeiten.
Wie würde Diego reagieren? »Freust du dich für mich?«, fragte sie ihn.
Diego sah sie feierlich an. »Frida, ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft.«
»Ich werde mich lächerlich machen.« Sie merkte, wie ängstlich ihre Stimme auf einmal klang.
Diego lachte, zog sie an sich und küsste sie stürmisch.
»Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu.«
»Du willst mich nur los sein, damit du dich ungestört rumtreiben kannst.« In dem Moment, als sie das sagte, spürte sie zu ihrer eigenen Verwunderung, dass sie die Vorstellung nicht besonders berührte. Nicht so wie früher. Weil sie jetzt etwas viel Wichtigeres dafür erhielt. Und ihre Verunsicherung würde sie auch in den Griff bekommen. Dies war ihr Traum, und den würde sie sich nicht nehmen lassen.
Diego ließ sich zum Glück nicht provozieren. »Frida, es wird Zeit, dass du der Welt deine Bilder zeigst. Was ich hier mache oder nicht mache, hat damit überhaupt nichts zu tun. Fahr nach New York.«
»Du wirst mich vermissen.«
Er nickte. »Das werde ich.«
»Dann komm mit!«
Wollte sie das wirklich? Dass er die ganze Zeit um sie herum war, ihre Schritte kontrollierte und immer im Mittelpunkt stand, während sie seine malende Ehefrau gab? Hatte sie das nicht lang genug mitgemacht?
»Du weißt, dass das nicht geht. Ich muss arbeiten.«
Seine Ablehnung traf sie trotzdem. »Aber ich bin immer mitgekommen, wenn du Aufträge in Amerika hattest. Ich habe mich um dich gekümmert. Ich war deine Dolmetscherin, deine Krankenschwester und deine Sekretärin, ich habe deine Briefe beantwortet und dir die Leute vom Hals gehalten. Ich war die ganze Zeit für dich da!«
Er verzog das Gesicht zu einem Lachen, dann registrierte er ihren bösen Blick und wurde wieder ernst. »Das stimmt nur zum Teil, Frida. Du hast in diesen Jahren einige deiner wichtigsten Bilder gemalt.«
»Aber ich hätte viel mehr malen müssen, ich hätte mehr lesen und lernen sollen. Stattdessen habe ich mich von dir vereinnahmen lassen und in den Tag hineingelebt. Egal, an welchem Bild ich gerade saß, wenn du mich gebraucht hast, habe ich alles stehen und liegen lassen. Ich habe die besten Jahre meines Lebens damit verbracht, mich um dich zu kümmern! Und du hast alles getan, damit das auch schön so bleibt. Aber damit ist jetzt Schluss.« Sie wunderte sich selbst, wie sicher sie klang. Das musste daran liegen, wie ernst es ihr war.
»Gib nicht mir die Schuld, Frida.« Diegos Stimme klang hart, aber dann wurde sie weicher. »Weißt du noch, als du damals mit deinen ersten Bildern zu mir gekommen bist, um mich zu fragen, ob du Talent hast?«
Frida nickte. Wie könnte sie das jemals vergessen. Damals war sie achtzehn gewesen und hatte Diego im Erziehungsministerium besucht und ihn sogar dazu gebracht, von seinem Gerüst herunterzuklettern, weil sie sich mit ihrem kranken Rücken nicht die wackelige Leiter hinauftraute. Ihr Herz wurde warm bei dem Gedanken.
»Damals habe ich dir gesagt, dass in dir eine großartige Malerin steckt und dass du unbedingt weitermachen sollst. Es wird nicht leicht werden. Ich verstehe auch, dass dir das Angst macht. In New York wirst du auf dich allein gestellt sein, du wirst für deine Bilder kämpfen müssen. Es reicht nicht, dass sie irgendwo hängen. Du wirst Werbung machen, die richtigen Leute treffen müssen, Argumente haben, über Preise verhandeln …« Frida wurde jetzt tatsächlich ein wenig mulmig, aber sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Diego nahm sie in den Arm. »Niemand wird das besser machen als du. Sei einfach du selbst, Frida.«
Frida war noch ganz in ihrem Glück gefangen, als der Postbote am nächsten Tag den lang ersehnten Brief von André Breton brachte. Er lud sie ein, ihre Bilder in seiner Galerie in Paris zu zeigen. Hat Levy sich schon gemeldet?, schrieb er. Vielleicht kannst du beides miteinander verbinden und gleich in New York ein Schiff nach Europa nehmen?
Frida schwirrte der Kopf, sie konnte an nichts anderes mehr denken. Das wurde jetzt doch ein bisschen viel. Erst Amerika und dann auch noch Europa? Wie lang wäre sie da unterwegs? Bestimmt Wochen, vielleicht sogar Monate. Sie musste unbedingt mit jemandem über ihre Zweifel sprechen. Mit Diego ging das nicht, sie befürchtete, dass er ihre Bedenken gegen sie auslegen würde. Sie rief ihre Freundin Lola Alvarez Bravo an.
»Kannst du kommen?«
»Was ist los, warum strahlst du so? Dann geht es jedenfalls nicht um Diego. Das beruhigt mich«, sagte Lola, als sie am Nachmittag kam, und legte ihren Fotoapparat neben die Flasche Tequila auf den Tisch. Lola ging niemals ohne ihre Kamera aus dem Haus. Sie war eine bekannte Fotografin. Ihre Arbeit kam für sie an erster Stelle. Niemals würde ihr in den Sinn kommen, sie für einen Mann aufzugeben. Vielleicht war sie deshalb geschieden.
Ich sollte mir Lola als Beispiel nehmen, dachte Frida flüchtig. Der Gedanke erschreckte sie.
Lola konnte es nicht lassen, gegen Diego zu sticheln. Sie kannte ihn gut, sie hatte selbst mal eine Affäre mit ihm gehabt, allerdings, bevor Frida ihn geheiratet hatte. Lola hatte zu denen gehört, die sie ausdrücklich vor einer Ehe mit ihm gewarnt hatten. »Er wird dich mit seiner Liebe zermalmen, bis nichts mehr von dir übrig bleibt«, hatte sie gesagt.
»Diesmal geht es ausnahmsweise nicht um Diego«, sagte Frida
»Es geht bei dir immer um Diego«, gab Lola trocken zurück.
Frida schob ihr den Brief von Julien Levy über den Tisch und beobachtete gespannt Lolas Reaktion, während die ihn las. Lola stieß einen Freudenschrei aus, dann sprang sie auf und nahm Frida in die Arme.
»Frida, das ist wunderbar. Ich gratuliere dir! Seit ich dich kenne, wolltest du Malerin sein. Aber dann musstest du ja Diego heiraten und hast diesen Traum aus den Augen verloren. Immer waren seine Bedürfnisse wichtiger als deine …«
»Lola, Diego ist mein Leben. Ich will nicht ohne ihn sein!«
Lola beschwichtigte sie. »Ich meine ja nicht, dass du ihn verlassen sollst. Du sollst nur die Prioritäten ein wenig verschieben. Aber jetzt ist es ja so weit. Frida, du hast es geschafft. Stell dir doch nur vor: eine Ausstellung. In New York. Nur mit deinen Bildern. Das wird dein Leben verändern. Ich kenne Julien Levy. Er hat den Ruf, Künstler zu lancieren und ihre Preise hochzuschrauben.« Sie verzog das Gesicht. »Meine Fotografien hat er allerdings nie gewollt, leider.«
»Du hast es doch auch ohne ihn geschafft«, sagte Frida. »Du bist Mexikos berühmteste Fotografin.«
Lola nickte. »Und du wirst Mexikos berühmteste Malerin werden. So eine Gelegenheit darfst du dir nicht entgehen lassen. Wenn schon mal ein Galerist eine Frau ausstellt, dann müssen wir zusammenhalten. Du musst für uns alle eine Bresche schlagen. Wann fährst du?«, fragte sie dann.
Frida antwortete nicht gleich, sondern schenkte Schnaps in zwei Gläser.
»Das ist noch nicht alles. André hat mich auch eingeladen. Nach Paris.« Frida hielt ihr auch den Brief Bretons hin.