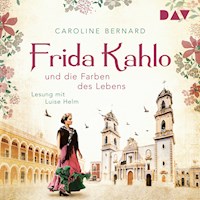10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
„Ich bin eine Revolution!“ Frida Kahlo.
Mexiko, 1925: Frida will Ärztin werden, ein Unfall macht dies zunichte. Dann verliebt sie sich in das Malergenie Diego Rivera. Mit ihm taucht sie in die Welt der Kunst ein, er ermutigt sie in ihrem Schaffen – und er betrügt sie. Frida ist tief verletzt, im Wissen, dass Glück nur geborgt ist, stürzt sie sich ins Leben. Die Pariser Surrealisten liegen ihr genauso zu Füßen wie Picasso und Trotzki.
Frida geht ihren eigenen Weg, ob sie mit ihren Bildern Erfolge feiert oder den Schicksalsschlag einer Fehlgeburt hinnehmen muss – doch dann wird sie vor eine Entscheidung gestellt, bei der sie alles in Frage stellen muss, woran sie bisher geglaubt hat ...
»Eine Liebeserklärung an die Kunst, an die Weiblichkeit, an die Freiheit und den Mut, sie jeden Tag neu zu erringen – ein wunderbar zartes und doch kraftvolles Herzensbuch.« Nina George.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Caroline Bernard
Caroline Bernard ist das Pseudonym von Tania Schlie. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitet seit zwanzig Jahren als freie Autorin. Sie liebt es, sich Geschichten über starke Frauen auszudenken. Mit Die Muse von Wien hat sie sich zum ersten Mal ein reales Vorbild für eine ihrer Romanfiguren gesucht. Caroline Bernard lebt als freie Autorin in der Nähe von Hamburg. Im Aufbau Taschenbuch erschien außerdem Rendezvous im Café de Flore.
Informationen zum Buch
Mexiko, 1925: Frida will Ärztin werden, ein Unfall macht ihren Traum zunichte.
Dann verliebt sie sich in das Malergenie Diego Rivera. Mit ihm taucht sie in die Welt der Kunst ein, er ermutigt sie in ihrem eigenen Schaffen – und er betrügt sie. Frida ist zutiefst verletzt, im Wissen, dass Glück nur geborgt ist, stürzt sie sich ins Leben. Mit Diego bereist sie die Welt, die Pariser Surrealisten liegen ihr genauso zu Füßen wie Picasso und Trotzki. Frida geht kompromisslos ihren eigenen Weg, egal ob sie mit ihren intensiven und farbenfrohen Bildern Erfolge feiert oder den Schicksalsschlag einer Fehlgeburt hinnehmen muss – doch dann wird sie vor eine Entscheidung gestellt, bei der sie alles in Frage stellen muss, woran sie bisher geglaubt hat.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Caroline Bernard
Frida Kahlo und die Farben des Lebens
Roman
Inhaltsübersicht
Über Caroline Bernard
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil I Die gebrochene Säule 1925–1930
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil II Auf der Grenze 1931–1935
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Teil III Die zwei Fridas
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Nachwort und Literatur
Impressum
Prolog
Dezember 1939
Am späten Vormittag betrat Frida mit raschen Schritten ihr Atelier. Um diese Zeit wirkten die Schmerztabletten immer am besten. Das Sonnenlicht fiel zähflüssig und golden durch die Fenster und ließ ihre Staffelei leuchten. »Guten Morgen, Schwesterchen«, begrüßte sie das Skelett aus Pappmaché, das sie bunt angemalt und in einen ihrer Unterröcke gesteckt hatte und das auf einem Stuhl in der Ecke auf sie wartete. Auf einer alten Tischlerbank standen ihre Farben in Glasfläschchen griffbereit. Daneben die irdenen Töpfe mit den Pinseln, den ganz feinen, deren Härchen nicht viel stärker waren als ihre Wimpern, und den gröberen, die sich anfühlten wie die Rasierpinsel ihres Vaters.
Die Wände waren über und über mit Fotos, Zeichnungen und alten Masken behängt, die im Sonnenlicht aussahen, als würden sie leben. Auf mehreren Tischen und niedrigen Schränkchen lagen und standen ihre Puppen und die Fabelwesen, die sie über die Jahre angefertigt hatte; ihre Bücher, Notizblöcke, Blumen in üppigen Bouquets und zig andere Dinge, die sie liebte und gern betrachtete und die ihr als Inspiration dienten. Für Fremde mochte dieser Raum unaufgeräumt und vollgestellt wirken, für Frida war hier alles an seinem Platz. Ihre Bücher standen nach Themen sortiert in den Regalen, die Ordner mit Zeitungsartikeln und Korrespondenz waren säuberlich beschriftet. Diego zog sie manchmal damit auf, aber Frida sagte dann, das sei das Erbe ihres deutschen Vaters. Sie brauchte beides: die vielen Dinge um sich herum und die Ordnung, die alles hatte.
Mit einem Lächeln nahm sie alles in sich auf und freute sich an dieser vertrauten, sorgfältig gestalteten Umgebung.
Voller Vorfreude stellte sie sich vor die Staffelei und griff nach dem Tuch, das sie am Vorabend über das Bild gehängt hatte. Zum ersten Mal hatte sie sich für ein Format in Lebensgröße entschieden. Aber diesmal musste es sein. Alle ihre Bilder waren ihr wichtig, aber dieses bedeutete ihr mehr als die anderen. Schwungvoll zog sie das Tuch zur Seite, und die beiden Köpfe erschienen. Zweimal sahen ihre eigenen Augen unter den dichten Brauen, die sich an der Nasenwurzel trafen und an die ausgebreiteten Schwingen eines Vogels erinnerten, sie an. Und dennoch waren die Unterschiede zwischen diesen beiden Fridas unübersehbar. Die linke hatte eine weißere, ebenmäßigere Haut als die rechte, deren Gesicht dunkel wie das einer Indiofrau war. Die linke Frau war zart geschminkt, die Frisur kunstvoll geflochten und in glänzende Wellen gelegt. Die rechte trug den Anflug eines Damenbartes, das Haar war streng zurückgenommen, es glänzte auch nicht so. Diese kleinen Unterschiede waren rätselhaft, man musste schon genau hinsehen, um sie benennen zu können.
Frida betrachtete das Bild lange, dann nahm sie den Pinsel in die Hand und arbeitete weiter am Hintergrund, der nur aus einem Himmel mit weißen Wolken bestand, aber ihre Gedanken waren bei den Fridas auf der Leinwand. Das sind die beiden Frauen, die ich in mir vereine, dachte sie, während sie weiße Tupfen auf die Leinwand setzte. Die Frau, die leben will, wie es ihr gefällt, und die Frau, die die Last von Tradition und Geschichte mit sich herumträgt.
In ihrer Brust fühlte es sich an, als würde ein großer Vogel heftig mit den Flügeln schlagen. Ein Gefühl, als würde ihr das Herz wummernd aus der Brust springen und das sie überkam, sobald sie wieder Diegos Worte hörte, das eine Wort, das ihr Leben verändern würde. Der Pinsel verharrte in der Luft. Sie musste sich auf das Bild konzentrieren, malen, sie musste sich in den beiden Fridas auf dem Bild finden, weil sie dabei war, sich zu verlieren.
Lange starrte sie auf die Leinwand, etwas fehlte, etwas ganz Entscheidendes. Und auf einmal wusste sie, was es war. Sie warf den Pinsel ungeduldig auf den Tisch, nahm sich keine Zeit, ihn auszuwaschen, und griff nach einem anderen. Sie mischte einen Rotton zusammen, der auch etwas Magenta enthielt, ihre Lieblingsfarbe, die für sie alles bedeutete, was Mexiko ausmachte: das Leben und die Liebe. Ohne den Blick von dem Bild zu nehmen, griff sie hinter sich in das Bücherregal nach einem ihrer vielen Anatomiebücher. Sie fand die Seite nach kurzem Blättern. Dann skizzierte sie mit raschen Strichen ihre Idee: Auf die Kleider der beiden Fridas malte sie jeweils ein Herz. Die Herzkammern und die Blutbahnen lagen offen, rote Arterien liefen über den Stoff. Eine endete offen auf dem weißen Kleid der europäischen Frida. Blut tropfte auf den Rock, vergeblich versuchte sie, die Blutung mit einer Klemme zu stillen.
Frida sah wieder auf die Hände, die sich die beiden Frauen reichten. Aber die Verbindung zwischen ihnen war viel stärker und sollte noch deutlicher werden! Sie malte eine feine, dünne Linie, eine Arterie, die die beiden Herzen miteinander verband. Es war dasselbe Blut, das durch sie beide floss, derselbe pulsierende Schlag, der ihnen Kraft gab. Gemeinsam würden die beiden Fridas, die sie in sich vereinte, genügend Kraft finden, um zu überleben, komme, was da wolle.
Teil I Die gebrochene Säule 1925–1930
Kapitel 1
September 1925
»Jetzt hör endlich auf zu trödeln und komm!«
Alejandro griff nach Fridas Hand und wollte sie hinter sich herziehen. Frida spürte die Gänsehaut zwischen ihren Schulterblättern, die sie immer bekam, wenn sie sich berührten. Dennoch machte sie sich von ihm los. »Einen Moment. Ich habe mein Heft liegenlassen.«
Als sie zurückkam, wartete Alejandro zusammen mit ihrem gemeinsamen Freund Miguel am Ende des Flurs auf sie. Frida verlangsamte ihre Schritte, um ihn ungestört zu beobachten. Alejandro Gómez Arías war gutaussehend, großgewachsen, hatte glänzendes Haar und trug seinen Anzug mit nonchalanter Lässigkeit. Alejandro war ihr gleich am ersten Tag aufgefallen. Er war drei Klassen über ihr und gehörte zu einer Gruppe von Freunden, die sich Cachuchas nannten, nach den Schiebermützen, die sie trugen. Die Cachuchas waren klug, kannten die neueste Literatur und liebten die Malerei. Ihr großes Vorbild war der Revolutionär José Vasconcelos, der als Bildungsminister eine Alphabetisierungskampagne gestartet hatte und neue Maßstäbe in der Kunst setzte. Bevor Frida zu ihnen gestoßen war, hatte die Gruppe ausschließlich aus jungen Männern bestanden. Es gingen ja auch nur ganz wenige Mädchen auf die Preparatoria. Frida bereitete sich hier, gegen alle Bedenken ihrer Mutter, auf das Medizin-Studium vor. Sie wollte Ärztin werden. Vor allem aber bedeutet die Prepa für Frida ein Stück Freiheit. Hier konnte sie endlich aus der Enge ihrer Familie und der Aufsicht von Eltern und Nachbarn entfliehen. Täglich fuhr sie aus dem verschlafenen Vorort Coyoacán mit der Straßenbahn in die Innenstadt.
Frida zog die gestrickten Strümpfe hoch, bis sie unter dem Saum des dunklen Faltenrocks verschwanden, und rannte los. Im Vorbeilaufen stieß sie Alejandro mit dem Ellenbogen an. »Wo bleibst du?«, dann stürmte sie an ihm vorbei die Treppe hinunter.
»Frida! Jetzt warte doch. Du benimmst dich unmöglich.«
Frida nahm die Kehre der Treppe mit zu viel Schwung, ihr Rock flatterte um ihre Beine. Sie hielt sich am Geländer fest und flog halb die Stufen hinunter.
»Frida!«, rief er noch einmal. »Du ruinierst den Ruf der Frauen an dieser Schule.«
Frida verdrehte die Augen. Sie liebte Alejandro von ganzem Herzen, aber warum wollte er einfach nicht verstehen, dass jede Art von Bewegung ein Teil von ihr war? Trotz der überstandenen Kinderlähmung und des verkümmerten rechten Beines. Sie konnte sich ein Leben ohne Schnelligkeit, ohne Klettern und Tanzen gar nicht vorstellen. Das musste er doch mittlerweile wissen. Warum verlangte alle Welt von ihr, sittsam eine Treppe hinunterzugehen und niemals außer Atem zu geraten? Weil sie eine Frau war? Natürlich war sie eine Frau, und sie war genauso ungestüm, wie sie sein wollte!
Abrupt blieb sie mitten auf der Treppe stehen, und Alejandro prallte in sie hinein.
»Mir gefällt aber, wie ich bin. Du hast doch nur Angst, dass ich schneller bin als du«, rief sie.
Schwer atmend stand er eine Stufe über ihr, sein dunkles Haar fiel ihm in die Stirn, seine Lippen leuchteten rot. Er beugte sich zu ihr herunter und presste seine Lippen auf ihre. Frida ließ sich küssen, dann schlüpfte sie unter seinen Armen hindurch und lief weiter die Treppe hinunter und durch den schattigen Innenhof.
Auf der Straße empfing sie die schwüle Hitze des Nachmittags. Es war September, die Regenzeit näherte sich dem Ende, und die Luft war feucht. Am Morgen hatte es leicht geregnet, und die Gebäude wirkten wie blankgeputzt.
Sie gingen die Calle Argentina in Richtung des Zócalo hinunter. Der Zócalo war der riesige, zentrale Platz der Stadt mit der Kathedrale und dem Nationalpalast. Hier trafen sich alle, Gaukler und Mariachis, Verkäufer und Gauner, Politiker und einfache Leute. Frida trödelte, weil sie keine Lust hatte, nach Hause zu fahren. Coyoacán war ja so langweilig. Einzige Abwechslung bot die staubige Plaza Hidalgo vor der Kirche. Aber dort kannte jeder jeden, man war immer unter den strengen Augen der Nachbarn und des Pfarrers. In den Straßen der Hauptstadt drängten sich die Menschen auf den Märkten und in den Straßencafés. Auf dem Zócalo wurde Musik gespielt, Leute liefen mit Transparenten herum oder zeigten Zaubertricks. Es gab immer etwas zu sehen. Und hier konnte sie Alejandro ungestraft küssen.
Die Terrassen der Cafés waren heute wegen des Wetters nicht gut besucht. Die Indiofrauen hatten trotzdem ihre einfachen Stände aus Holzplanken aufgebaut. Frida spannte ihren kleinen Schirm auf und flanierte langsam an den Auslagen vorbei. Die Händlerinnen saßen vor dem geschmiedeten Zaun um die Kathedrale oder im Schutz der Hauswände und boten Obst und Gemüse, Stickereien und Töpferwaren feil. Sogar die ersten Totenköpfe aus buntem Zuckerguss waren schon zu sehen, obwohl es noch ein paar Wochen bis zum Tag der Toten war.
»Musst du heute nicht zu Fernando?«, fragte Alejandro und versuchte, ihrem Schirm auszuweichen. »Es regnet doch gar nicht!«
»Aber der Schirm ist so hübsch, findest du nicht?« Frida drehte ihn in der Hand, so dass die Fransen, die am Saum angebracht waren, flatterten. »Und zu Fernando gehe ich heute nicht.«
Fernando Fernández war Werbegrafiker und ein Freund ihres Vaters, bei dem sie zweimal die Woche Zeichenunterricht nahm. Als Bezahlung half sie ihm in seinem Geschäft.
Vor Fridas Lieblingsstand, an dem Amulette und kleine, auf Blech gemalte Votivbilder verkauft wurden, blieben sie stehen. Auf diesen Bildchen, die als Dankesgaben oder Bittgesuche an die Schutzheiligen dienten, wurden die verrücktesten Geschichten von den Nöten und Sorgen der kleinen Leute erzählt. Frida fuhr mit dem Finger über die einzelnen Retablos und las die Inschriften. Fast wie der gemalte Ausdruck der mexikanischen Volksseele, dachte sie ehrfürchtig. Die ältere Indiofrau erkannte sie wieder.
»Mira«, sagte sie, »sehen Sie hier, die sind neu«, und wies auf ein paar Bildchen in der Größe von Postkarten.
»Schau mal, da bedankt sich eine Frau dafür, dass ihr Mann sie nicht beim Ehebruch erwischt hat, und schwört, ihm ab jetzt immer treu zu sein! Das könnte glatt von dir sein«, sagte Alejandro.
»Ich habe dir immerhin von Fernando erzählt. Und außerdem ist es nicht bis zum Letzten gekommen. Wenn ich dich das nächste Mal betrüge, dann bitte ich vorher um göttlichen Beistand, damit du mich nicht erwischst.«
Verflixt, warum hatte sie das gesagt? Rasch nahm Frida seine Hand und drückte einen Kuss darauf. »War nur Spaß«, murmelte sie unbekümmert. Ein etwa handtellergroßes Amulett erregte ihre Aufmerksamkeit. Es war leuchtend rot und hatte gelbe Einsprengsel. Daneben lag ein kleines Blechherz mit einem bunten Rand aus Emaille. In dem Herz waren ein Mann und eine Frau im Profil zu sehen, offensichtlich ein Liebespaar.
Frida nahm beide in die Hände und zeigte sie Alejandro. »Welches?«, fragte sie.
»Nimm das.« Er wies aufs Amulett.
»Ach nein. Ich nehme doch lieber das Herz.« Dabei sah sie ihn vielsagend an.
»Jetzt können wir«, sagte sie mit einem Lächeln zu ihm und hakte sich bei ihm unter, nachdem sie das Herz sorgfältig in den Taschen ihres Rocks verstaut hatte.
Neben ihnen fuhr eine von Pferden gezogene Straßenbahn, sie war kaum schneller als sie selbst. Der durchdringende Geruch der verschwitzten Tiere traf Fridas Nase.
»Das ist unsere«, sagte Alejandro und wollte einsteigen.
»Warte, ich habe meinen Schirm an dem Stand liegenlassen!«, rief sie. »Ich hole ihn schnell.«
Als sie wieder bei Alejandro ankam, war die Straßenbahn bereits abgefahren.
»Dann nehmen wir eben den Bus. Da stinkt es wenigstens nicht so«, schlug sie vor.
Die neuen Omnibusse fuhren noch nicht so lange in der Stadt. Die Fahrzeuge waren meistens alte Ford-Modelle aus Nordamerika, die umfunktioniert wurden. Aber es galt als schick, Bus zu fahren. Im selben Moment bog der rote Bus mit der Aufschrift Coyoacán um die Ecke. Frida lief neben dem Fahrzeug her, bis sie auf der Höhe der geöffneten Tür war.
»Halt! Ich will mit!«, rief sie dem Fahrer zu und sprang auf das Trittbrett.
Der Fahrer bremste, und das Bild der Heiligen Jungfrau von Guadelupe schlenkerte wie verrückt an der Frontscheibe hin und her.
»Und mein Freund auch«, sagte sie atemlos. Sie streckte Alejandro die Hand hin, auch er sprang auf.
Frida drängelte sich an den anderen Fahrgästen, die auf den langen Holzbänken zu beiden Seiten saßen, vorbei nach hinten. Der Omnibus fuhr wieder an, es ruckelte, und sie wurde gegen einen Mann mit einem dicken Bauch geschleudert. Mit Mühe fing sie sich und griff nach einer der Haltestangen. Alejandro quetschte sich neben sie. Sie konnte seinen Körper dicht an ihrer Seite spüren, sah zu ihm auf und lächelte ihn an. Durch die aufgestellten Fenster drang der Geruch von Tortillas herein. Der Fahrer nahm schwungvoll eine Kurve, und sie wurde noch enger an Alejandro gedrängt. Sie konnte spüren, wie sein Herz klopfte. In ihrem Unterleib spürte sie ein wohliges Ziehen.
»Entschuldige«, murmelte er, aber in seinem Blick las sie, dass auch er die Berührung genoss.
An der nächsten Haltestelle stiegen zwei Männer zu, ihre groben Jacken waren voller Farbkleckse. Frida konnte das Terpentin riechen, als sie sich neben sie stellten. Sie trugen Eimer mit sich, und der eine der beiden balancierte eine aus Zeitungspapier gedrehte Tüte in der Hand. Der Rand der Tüte glitzerte in der Sonne. Ab und zu stiegen ein paar Flitter auf.
»Ist das Gold?«, fragte Frida neugierig.
Der Mann nickte. »Für die Fresken in der Oper.« Er hielt ihr die Tüte hin, und sie konnte die winzigen Fetzen Goldlack erkennen.
Frida hörte flüchtig das Kreischen der entgegenkommenden Straßenbahn, ihre Aufmerksamkeit galt immer noch dem leuchtenden Goldstaub. Ein winziges Teilchen segelte durch die Luft und verfing sich in den Härchen ihres Unterarms. Sie versuchte, es mit der Fingerspitze abzunehmen. Plötzlich war ein schrilles Klingeln zu hören, der Bus wurde zur Seite gedrängt, geriet ins Schlingern. Hilflos versuchte, Frida den Haltegriff wieder zu fassen, den sie losgelassen hatte, um nach dem Goldstaub zu greifen.
Dann ein ohrenbetäubendes Knirschen und Quietschen, goldener Staub rieselte auf Frida nieder. Die Wucht des Aufpralls riss sie von den Füßen.
»Diós mio!«, hörte sie die Frau neben sich in Panik aufschreien. Sie sah die goldflimmernde Luft, hörte die hässlichen kreischenden Geräusche, Menschen schrien. Ihre Arme waren auf einmal unter ihr, die Beine in der Luft. Sie konnte nichts mehr sehen, nur das Gold, das auf ihren Armen glänzte. Dann kamen silberfarbene Splitter dazu, und Frida dachte an Diamanten. Dann wurde sie zu Boden geschleudert. Helles Sonnenlicht fiel auf sie und ließ sie glänzen, als sei sie selbst aus Gold. Wo war Alejandro? Eben war er doch noch ganz dicht neben ihr gewesen. Dann flog etwas auf sie zu, etwas Glänzendes, aber diesmal war es kein Gold, es war lang und spitz. Und dann kam der Schmerz.
Kapitel 2
Frida wachte auf und sah glitzernden Goldstaub. Oder war das da eine helle Lampe, die ihr ins Gesicht schien? Sie wollte an sich heruntersehen, aber sie konnte ihren Kopf nicht heben. Er fühlte sich an, als sei er auf dem Kopfkissen festgenagelt wie ihr ganzer Körper. Der fühlte sich völlig fremd an, gleichzeitig heiß und eiskalt und wie in Watte gepackt. Sie bemerkte, dass sie in einer Art Kiste lag, die jede Bewegung unmöglich machte. Sie versuchte, ihre Zehen zu bewegen, aber es ging nicht. Panik überschwemmte sie. Eine diffuse Erinnerung suchte sie heim: Lärm, Splitter, Kreischen. Ich bin tot, dachte sie verzweifelt. Ich bin tot und liege in einem Sarg.
»Frida. Ich bin hier, bei dir.«
Jemand beugte sich über sie und brachte sein Gesicht vor ihres. Wieso war Matita hier? Frida wollte den Namen ihrer älteren Schwester sagen, aber ihre Lippen wollten sich nicht öffnen. Matita war doch vor Jahren mit einem Mann durchgebrannt. Seitdem hatte niemand aus der Familie sie mehr gesehen. Also war Matita tot und sie auch?
Jetzt beugte Matita sich noch dichter über sie. Frida sah die Tränen in ihren Augen.
Wieder versuchte sie zu sprechen, aber ihre Zunge klebte am Gaumen, mehr als ein Stöhnen brachte sie nicht hervor. Und dann kam der Schmerz zurück. Unfassbarer Schmerz, der in Wellen durch ihren Körper ging, der grollte und zuckte, sich nur scheinbar ganz leicht zurückzog, um dann mit gesteigerter Wucht zuzuschlagen. Er war nicht lokalisierbar, er war überall. Er war unerträglich. Dann wurde alles dunkel.
Als sie das nächste Mal erwachte, saß Matita immer noch an ihrem Bett.
»Ich bin hier, Frida«, sagte sie wie beim ersten Mal. »Du bist im Krankenhaus. Du hattest einen Unfall. Der Bus …«
Langsam erinnerte sich Frida. Die Straßenbahn, die in den Bus gefahren war, Goldstaub und Scherben, Lärm, dann nichts mehr. Der Schmerz kam wieder, aber sie wollte nicht wieder einschlafen, nicht bevor sie Antworten auf ihre Fragen bekommen hatte.
»Alejandro?«, flüsterte sie. Die Wörter kamen wie zäher Brei aus ihrem Mund. »Wie geht es ihm?«
Matita träufelte ihr mit einem Löffel ein paar Tropfen Wasser auf die Lippen. »Er hat nicht so viel abbekommen wie du. Ihm geht es gut.«
»Wieso bist du hier? Wo sind Mama und Papa?«
Ihre Schwester legte ihr die Hand auf den Unterarm. »Ich habe von dem Unfall in der Zeitung gelesen. Sie haben deinen Namen genannt. Also bin ich gekommen.«
»Was ist mit mir? Ich kann mich nicht bewegen. Bin ich gelähmt?«
»Du hast viele Verletzungen, im … Unterleib. Man hat dich operiert.« Matita senkte den Blick.
Frida hob ganz vorsichtig den Kopf, nur ein paar Zentimeter, um an ihrem Körper herunterzusehen. Sie sah ein Betttuch, unter dem sich ihre schmale Silhouette abzeichnete. Ihre Füße waren mit Streckverbänden am Fußteil des Bettes befestigt. Sie spannte die Muskeln in ihren Oberschenkeln an, und der Schmerz durchzuckte sie. Mit einem Stöhnen legte sie sich zurück.
»Die Ärzte sagen, du sollst dich nicht bewegen, damit alles wieder gut zusammenwachsen kann«, sagte Matita. »Deshalb haben sie dich festgebunden.«
»Was soll zusammenwachsen? Sag es mir!«
Matita schluckte. »Du wirst es ja ohnehin erfahren: Die Haltestange im Bus hat sich in deine Hüfte gebohrt und ist aus der … aus deinem Unterleib wieder ausgetreten. Die Niere ist verletzt. Daneben ist ein Oberschenkelhals gebrochen, und dein linkes Bein elfmal …«
»Das linke?«, flüsterte Frida, »das gesunde Bein?«
Ihre Schwester nickte.
»Was noch? Ich will alles wissen.«
»Dein rechtes Bein hat auch was abbekommen. Der Fuß ist zerquetscht und ausgerenkt. Und deine linke Schulter war ausgekugelt.«
Frida schloss die Augen.
»Wo sind Mama und Papa?«, fragte sie noch einmal.
»Mama redet immer noch nicht mit mir. Was ich dir jetzt sage, weiß ich von Cristina. Sie stehen alle unter Schock zu Hause und … sie tragen schwarz. Als Mama von dem Unfall erfahren hat, hat sie tagelang nicht gegessen und nicht gesprochen. Sie weigert sich, ins Krankenhaus zu kommen.«
»Und Papa?«
»Er ist vor Sorge krank geworden. Du weißt schon …«
»Du meinst, er hatte einen Anfall?« Ihr Vater litt schon seit Jahren unter epileptischen Anfällen, aber es hatte lange gedauert, bis darüber in der Familie gesprochen werden durfte.
Mit einem Mal zuckten Erinnerungsfetzen in ihr auf. Sie war noch ein Kind gewesen, als Guillermo den ersten Anfall gehabt hatte. Das wilde Zucken der Beine, die verdrehten Augen … Drei Tage nach diesem Vorfall war ihre Schwester verschwunden. Erst Jahre später hatte sie verstanden, dass beides nichts miteinander zu tun hatte.
Matita seufzte tief. »Frida, du musst ihnen Zeit geben, sich an die Situation zu gewöhnen. Dein Unfall war ein Schock für sie. Und bis sie kommen, bin ich hier. Tag und Nacht.« Sie nahm Fridas Hand und drückte sie leicht. »Ich bin froh, dass wir uns wiedergefunden haben, auch unter diesen Umständen …«
Frida schloss die Augen.
Die Frau im übernächsten Bett begann mit leiernder Stimme das Ave-Maria zu beten. »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du …« Sie tat stundenlang nichts anderes und trieb Frida damit halb in den Wahnsinn. Wie sie dieses Krankenhaus hasste! Sie lag mit fünfundzwanzig anderen Frauen in einem großen, kahlen Saal, in dem es immer dämmrig war. Die kleinen Fenster waren so hoch angebracht, dass man nicht hinaussehen konnte. Die Luft war stickig und verbraucht, es war viel zu warm. Zwischen die Betten, aber nur an den Kopfenden, hatte man Paravents gestellt, die ein trügerisches Gefühl von Privatheit vermitteln soll. Frida hörte jedes Geräusch, das Schnarchen, Jammern und Weinen der anderen Frauen, doch die Betende zerrte besonders an ihren Nerven. Die anderen Frauen konnten sich wenigstens aufsetzen oder sogar ein paar Schritte tun. Sie dagegen war dazu verdammt, bewegungslos auf dem Rücken zu liegen und die Decke anzustarren. Ohne ihre Schwester wäre sie vor Langeweile umgekommen. Aber jedes Mal, wenn sie aus ihrem unruhigen Schlaf erwachte, war Matita an ihrer Seite. Wie unendlich dankbar war sie ihr dafür! Matita saß unverrückbar auf einem unbequemen Stuhl an ihrem Bett und strickte, gab ihr zu trinken, brachte ihr Essen mit und fütterte sie, las ihr vor und brachte sie mit verrückten Geschichten zum Lachen.
Frida versuchte stark zu sein, solange Matita bei ihr war. Aber wenn es draußen dunkel wurde, mussten alle Besucher gehen. Jeden Abend sah sie ihr schweren Herzens nach, und nachdem ihre Schwester ihr an der Tür beinah lautlos: »Bis morgen!« zugerufen hatte, lehnte sich Frida erschöpft in ihrem Bett zurück. Kurz darauf wurde das Licht gelöscht, und die Schatten suchten die Frauen heim. Jede hatte ihren eigenen Dämon, ihre eigenen Albträume.
Von einem der Nachbarbetten kam unterdrücktes Stöhnen, das in leises Wimmern überging, dann wurde es still.
Diese Stille lastete auf Frida wie ein Stein. Fast wünschte sie sich das Stöhnen und die Gebete der Frau im Nebenbett zurück. Dann hätte sie sich darüber ärgern können, und das würde sie von der namenlosen Verzweiflung ablenken, die sie hinterrücks überfiel. Bis vor ein paar Tagen, bis vor dem schrecklichen Unfall, war sie noch eine unbeschwerte Jugendliche mit einer glücklichen Zukunft gewesen, deren Leben voller Farben und Geheimnisse war, die nur darauf warteten, dass sie sie voller Freude und Neugier entdeckte und entschlüsselte. Aber jetzt? Es gab keine Geheimnisse mehr. Nichts mehr, was noch kommen könnte. Es war, als hätte ein Blitz die Erde erhellt und jeden Winkel ausgeleuchtet. Ihr Planet war ein Planet der Schmerzen geworden, durchsichtig wie Eis, und dahinter Leere. Frida hatte alle Lektionen des Lebens in einer einzigen Sekunde, in dem Moment des Unfalls lernen müssen. Sie würde ihr Leben lang krank sein und Schmerzen haben. Ihr Leben war vorüber, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte. Für den Rest der Nacht versuchte sich Frida ihr künftiges Leben auszumalen, und egal wie sehr sie sich mühte, sie fand nichts Schönes darin. Sie sah sich selbst als alte Frau, an deren Leben die Wunder vorübergegangen waren. Eine Welle der Panik überkam sie. Tränen überströmten ihr Gesicht, sie hob die Hand, um sie wegzuwischen, und spürte dabei den Schmerz, der durch ihren Rücken fuhr. Nicht einmal diese harmlose Erleichterung war ihr vergönnt! Nein, so wollte sie nicht leben. Dann lieber tot sein. Für die Ärzte war es doch ohnehin eine medizinische Sensation, dass sie mit ihren schweren Verletzungen immer noch lebte. Und wenn sie einfach aufhörte, für ein Leben zu kämpfen, das keinen Zauber mehr für sie bereithielt? Die Vorstellung bekam etwas Verlockendes und wiegte sie in einen unruhigen Schlaf.
Als sie am nächsten Tag aufwachte und zum Bett ihrer Nachbarin hinübersah, die am Abend zuvor gestöhnt hatte und dann abrupt verstummt war, war es leer. Eine Schwester war dabei, die Laken abzuziehen. »Kommt bestimmt gleich eine neue Patientin«, sagte sie zu Frida.
Ein Gedanke durchzuckte sie: Und wenn die Frau für sie gestorben war, an ihrer Stelle? Um ihr zu zeigen, wie es war, tot zu sein? Dass der Tod alles zunichtemachte und endgültig war? Und wenn es für sie doch ein Leben neben den Schmerzen gab? Oder vielmehr mit den Schmerzen? Würde sie den Mut haben, es zu versuchen? Immerhin lebte sie noch, obwohl niemand das für möglich gehalten hatte. Und wenn sie überlebt hatte, um es allen zu zeigen? Würde sie die Kraft dafür finden, wie schon einmal, nach ihrer Kinderlähmung?
»Ja«, sagte sie laut. Und noch einmal: »Ja!«
»Der Tod tanzt hier nachts um die Betten«, sagte sie, als Matita kurze Zeit später mit duftenden Zimtschnecken zum Frühstück kam. »Ich habe ihn gesehen. Aber mich kriegt er nicht!«
Ihre Schwester sah sie erschrocken an. »Frida! Was redest du denn da?«
»Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihm klargemacht, dass er mit mir noch nicht rechnen darf.« Sie grinste. »Kannst du mir bitte morgen Papier und Stift mitbringen«, bat sie dann, »und irgendetwas, worauf ich das Papier legen kann? Ich will Alejandro schreiben. Ich muss mir über ein paar Dinge Klarheit verschaffen.«
Alejandro war bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden, aber nicht schwer, er wurde zu Hause gepflegt. Das erzählten ihr die anderen Cachuchas, die sie in den folgenden Tagen besuchen kamen. Aber wenn Alejandro nicht selbst kommen konnte, warum schrieb er ihr denn nicht? War es ihm denn kein Bedürfnis, sie zu trösten und von ihr zu hören? War ihm egal, wie sehr sie litt? Gab er ihr womöglich die Schuld an dem, was passiert war? Hätte sie nicht getrödelt, hätte sie nicht auf dem Markt das Herz gekauft und dann auch noch ihren Schirm vergessen, dann hätten sie die Straßenbahn genommen, dann wäre der Unfall nicht passiert.
»Hast du mit Alejandro gesprochen? Ist er mir böse?«, fragte sie Miguel, als er am Nachmittag mit Blumen und Schokolade im Arm aufkreuzte. Sie konnte kaum den Blick von ihm lassen, so jung, so gesund, so abenteuerlustig sah er aus. »Sag schon, ist er mir böse und meldet sich deshalb nicht?« Miguel senkte den Blick und Frida konnte seine langen Wimpern bewundern. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Am besten fragst du ihn selbst.«
»Aber das kann ich nicht, wenn er nicht kommt! Soll ich etwa zu ihm gehen?«
Sie verbrachte eine unruhige Nacht. Einige Betten weiter leierte die Frau den Rosenkranz herunter, wieder und wieder. Frida schloss entnervt die Augen. Am liebsten hätte sie die Frau angeschrien, dass ihre Gebete nutzlos seien.
Sie selbst hatte schon vor Jahren erfahren, dass es keinen gütigen Gott gab … Sie konnte sich noch genau an diesen Tag erinnern. Sie war damals dreizehn gewesen und hatte mit ihren Schwestern wie üblich die Mutter zum Gottesdienst begleitet. Die Kirche San Juan Bautista lag nur wenige Straßen von ihrem Haus entfernt. Ihre Mutter hatte dort eine Bank reserviert, auf der ihr Name stand. Sobald Frida hinter ihr und den Schwestern das schwere Portal durchschritt, fand sie sich in einer anderen Welt. Aus der gleißenden Helle draußen kam sie in das kühle Dunkel der Kirche. Der Geruch von Weihrauch löste den nach in Fett gebackenen Churros ab. Aus dem Lärm der Straße war das leise Murmeln der Betenden geworden. Frida ging über den glatten Fliesenboden, der mit Holzdielen durchsetzt war. Die Bank knackte leise, als sie sich bekreuzigten und sich dann setzten. Frida ließ den Blick schweifen, heimlich, damit ihre Mutter es nicht bemerkte. Ihr gefielen das Gold am Altar, die brokatbestickten Altartücher und die Deckengemälde. Nicht wegen ihrer religiösen Bedeutung, sondern wegen der Farben. Durch ein Seitenfenster fiel ein dicker Strahl Sonnenlicht, in dem Millionen von winzigen Staubkörnern tanzten, in das Kirchenschiff und ließ Jesus am Kreuz aufleuchten. Frida folgte dem Lichtstrahl nach oben und bemerkte die tiefen Risse in der Holzdecke. In den Ecken hatten sich dicke Spinnweben angesammelt. Ein Blick zurück auf Jesus ließ ihn nicht mehr milde lächeln. Er sah gleichgültig aus. Und da war es Frida mit einem Mal klar geworden: Dieser schmächtige Mann am Kreuz konnte unmöglich der Retter der Welt sein! Wenn er es war, warum ließ er dann zu, dass auf den Straßen der Stadt Menschen erschossen wurden? Dass die Kirche in Mexiko ein Instrument der Unterdrückung und der Konterrevolution war? Warum hatte sie Kinderlähmung bekommen, obwohl sie ein unschuldiges Kind von sechs Jahren gewesen war? Warum litt ihr Vater, ein grundgütiger Mann, an epileptischen Anfällen? Zornig stieß sie die Luft aus, ihre Mutter sah sie warnend an. In Frida tobte es. Sie konnte nicht aufhören, über ihre Entdeckung nachzudenken und verspürte einen wilden Triumph. Sie trug allein an den Folgen der Polio, kein Gott spendete ihr dabei Trost. Aber dafür war sie frei! Frei, mit ihrer Behinderung umzugehen und sich nicht von ihr niederdrücken zu lassen. Frei von der Last der Religion. Auf sich selbst gestellt. Was für ein herrliches Gefühl. Als ihre Mutter zum Aufbruch drängte, verließ Frida als Letzte hinter ihren Schwestern die Kirche. Zum ersten Mal in ihrem Leben bekreuzigte sie sich nicht vor dem Altar. Sie zögerte, bevor sie den Fuß über die hohe Schwelle der Tür setzte, dann machte sie einen großen Schritt ins Freie. Der Blitz traf sie nicht. Sie atmete tief durch.
***
Ihre Eltern kamen erst drei Wochen nach dem Unfall ins Krankenhaus. So lange hatte Fridas Mutter gebraucht, um sich von ihrem Nervenzusammenbruch zu erholen.
Frida hatte sich angstvoll gefragt, ob ihre Mutter insgeheim ihr die Schuld an dem gab, was geschehen war.
Aber jetzt waren diese Zweifel vergessen, und sie war einfach glücklich, ihre Eltern zu sehen. Sie war immer noch in ihr Korsett geschnürt, aber immerhin konnte sie den Kopf leicht drehen und anheben, deshalb sah sie, wie ihre Mutter, gebeugt und schwer auf ihren Vater gestützt, ohne nach rechts und links zu sehen, auf ihr Bett zukam. Als sie Frida sah, fing sie haltlos an zu schluchzen. Sie sagte während des ganzen Besuchs kein Wort. In Guillermos Gesicht las sie Entsetzen und Schmerz.
»Mein Gott, Frida«, flüsterte er. Er wollte sie umarmen und ihr einen Kuss geben, doch die vielen Apparaturen, in die sie eingespannt war, hielten ihn davon ab. In einer hilflosen Geste wandte er sich ab.
»Ich werde wieder gesund, Papa«, sagte sie. »Ich will nach Hause. Ich halte es hier nicht länger aus. Kannst du nicht etwas tun?«
Sie sah, wie ein Ruck durch ihren Vater ging. Guillermo konnte stark sein, wenn er wollte. Und er wollte immer, dass es Frida gutging.
»Ich rede noch heute mit den Ärzten«, sagte er dann.
»Danke, Papa«, sagte Frida.
Eine Woche später wurde Frida aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei Krankenwärter legten sie auf eine Trage und verfrachteten sie in ein Auto, das ihr Vater gemietet hatte. Sie gaben sich große Mühe, vorsichtig zu sein, trotzdem schwankte die Trage, und Wogen von Schmerz gingen durch ihren Körper.
Egal. Endlich wieder nach Hause! Endlich wieder die Sonne im Gesicht spüren und die Vögel im Garten singen hören! Trotz ihrer Schmerzen lächelte sie. Seit langem war sie wieder glücklich und schöpfte Hoffnung.
Als sie an ihrem ersten Tag zu Hause in ihrem Bett nach draußen in den Patio geschoben wurde, war sie beinahe glücklich. Sie spielte mit den Hunden, ließ sich Blüten und Früchte bringen und hörte der Köchin zu, wie sie mit den Töpfen klapperte und dabei sang. Jedes Mal, wenn ihre Mutter an ihrem Lager vorüberkam, murmelte sie ihre Gebete, in die sich manchmal ein Kosewort schlich.
Einige Wochen später durfte sie zum ersten Mal aufstehen. Am Anfang schaffte sie nur wenige Schritte, aber mit der Zeit wurde sie kräftiger. Aber irgendetwas war nicht in Ordnung. Das Laufen und Stehen fielen ihr schwer, weil die Schmerzen im Rücken nicht abklingen wollten.
Doktor Calderón, ein entfernter Verwandter ihrer Mutter, war ratlos. »Wir müssen eine Röntgenaufnahme des Rückens machen. Das ist bisher im Krankenhaus versäumt worden.«
Frida bemerkte den sorgenvollen Blick, den ihr Vater mit ihrer Mutter wechselte. Dabei ging es nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um die Kosten, die die vielen Arztbesuche und Untersuchungen kosteten.
Kapitel 3
Herbst 1926
Frida stieß stille Verwünschungen gegen die Ärzte aus. Niemals hätte sie sich auf diese Behandlung eingelassen, wenn sie vorher gewusst hätte, dass sie einer Folter gleichkam! Sie hing an dicken Seilen von der Decke in einem kahlen Raum im Hospital Francés, eingeschnürt bis zur Bewegungslosigkeit. Ihre Zehenspitzen erreichten gerade eben den Fußboden. Unter der Anleitung von Doktor Calderón hatte der Orthopäde, Señor Navarro, ihren Kopf in die Seile gespannt und dann ihren Oberkörper mit Baumwollstoff bandagiert und mit Gips eingeschmiert. Immer neue Schichten hatte er aufgetragen, an ihrem schmerzenden Körper herumgedrückt und gestrichen, bis sie sich wie eine Mumie vorkam. Nun musste der dicke Panzer trocknen, in den man sie danach einsperren würde. Während sie bewegungslos verharrte, stellte sie sich vor, wie sie früher auf den Orangenbaum im Patio ihres Elternhauses geklettert war oder mit den anderen Kindern in halsbrecherischem Tempo auf dem Fahrrad die abschüssige Straße zur Plaza Hidalgo hinuntersauste. Sie war immer die Schnellste gewesen und hatte sich auch von Stürzen nicht abhalten lassen. Irgendwann hatten die anderen Kinder aufgehört, sie »Frida Hinkebein« zu nennen. Und über die Jahre war die Lust an der Bewegung ein Teil von ihr geworden. Ach, wie schön wäre es, jetzt einfach die Arme zu heben und zu tanzen!
»Wenn der Gips bricht, muss die Prozedur wiederholt werden«, hatte Doktor Calderón ihr eingeschärft. »Aber wenn alles gutgeht, kannst du nach drei oder vier Monaten wieder laufen.«
Der feuchte Gips auf ihrer Haut wurde kalt, sie fing an zu frieren. Sie dachte an Dostojewski, dessen Romane sie gerade verschlang. Frida verzog grimmig den Mund. Dostojewski war ein Meister darin, die innere Hölle zu beschreiben. Das passte doch! Wie tröstlich wäre es, wenn ihre Schwestern jetzt bei ihr wären und ihr vorlesen würden. Aber die Ärzte hatten Cristina und Matita nicht erlaubt, bei ihr zu bleiben. So blieb ihr nur die Flucht in die Erinnerung. Sie meinte zu spüren, wie der Fahrtwind ihr Gesicht streifte, wenn sie Rad fuhr. Zumindest in ihrer Vorstellung konnte sie alles tun, was sie wollte, das konnte ihr niemand nehmen. Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe, um zu fliegen?, ging es ihr durch den Kopf.
Sie versuchte, sich in dem Raum umzusehen, soweit ihr unbeweglicher Kopf das zuließ. Kein Fenster. Kein Grün, keine singenden Vögel, denen sie zuhören könnte. Sie sah nur die grauen Kacheln an der Wand vor sich. Einige waren gesprungen. Sie lenkte sich damit ab, Muster und Gegenstände in den Rissen zu erkennen, so wie sie es gern mit Wolken am Himmel machte. Auf einmal entstand ein Bild vor ihren Augen, ein großformatiges Gemälde voller Buntheit, mit lächelnden Menschen, Blumen und flatternden Kolibris in allen Farben. Der Künstler, der ein solches Bild hier auf die nackten Wände malen würde, direkt vor den Augen der Patienten, die hier von der Decke hingen und verzweifelt nach Ablenkung suchten, ein solcher Künstler wäre ein echter Wohltäter! Diego Rivera war so jemand. Vor ein paar Monaten, vor einer Ewigkeit!, hatte sie ihn einmal bei der Arbeit beobachtet und war hingerissen von seinen farbenprächtigen Riesengemälden gewesen, die ganze Geschichten erzählten und die man wie ein Buch lesen konnte.
Hinter ihren Schläfen pochte das Blut, sie konnte den eigenen Herzschlag hören. Die Fugen zwischen den Kacheln fingen an zu verlaufen und sich zu winden, aus dem Grau wurde ein schlieriges Rot. Es sah ein bisschen so aus, wie wenn sie die Augen zupresste und direkt danach in die Sonne sah. Der Raum wurde größer, die Konturen unschärfer, er schien sich in die Breite auszuwalzen. Frida schloss für einen Moment erschöpft die Lider, aber sofort wurden der Druck ihres Herzschlags und die Übelkeit größer. Ihre Augen fingen an zu brennen. Jetzt bloß nicht weinen. Sie könnte sich ja nicht mal die Tränen abwischen oder den Rotz von der Nase. Allein der Gedanke daran ließ ihre Tränen stärker fließen. Sie kämpfte nicht mehr dagegen an. Ihre Tränen tropften auf den Boden direkt unter ihr und verliefen sich in den Fugen.
***
Frida machte sich an diesem Morgen besonders sorgfältig zurecht. Die weiße Bluse mit dem bestickten Ausschnitt verbarg das verhasste Gipskorsett. Ihr krankes Bein steckte unter einem langen geblümten Rock. Wer nicht wusste, wie kaputt ihr Körper war, hätte denken können, eine Königin würde auf ihrem Bett ruhen. Sie hatte sich mit schönen Dingen umgeben. Ihr Kopf lag auf einem Leinenkissen, in das mit buntem Garn Corazón gestickt war. Neben ihr auf einem kleinen Tisch lagen Bücher und ihr Lippenstift. An dem hölzernen Kopfende des Bettes hatte sie Fotos und bunte Retablos aufgehängt. In der Zimmerecke stand eine große Voliere mit zwei grünen Papageien. Frida sah sich um und war zufrieden. Sie war bereit für Alejandro, der sich für den Nachmittag angesagt hatte.
Coyoacán war eine knappe Stunde vom Zentrum entfernt, für Frida lag die Stadt aber gerade in unerreichbarer Ferne. Wenn ihre Freunde sie besuchten, dann fragte Frida sie aus. Sie wollte alles wissen, in welchen Lokalen sie gewesen waren, welche Musik sie gehört hatten, wen sie getroffen hatten, ob es ihren Lieblingsmarktstand noch gab, welche Ausstellungen sie besucht hatten … Ihre Neugierde kannte keine Grenzen, denn durch die Erzählungen ihrer Freunde konnte sie sich zumindest einbilden, dabei gewesen zu sein. Sie fragte auch nach Alejandro, aber die Antworten beunruhigten sie.
Er war schon lange nicht mehr da gewesen, obwohl sie ihm unzählige Briefe geschrieben und ihn so dringend gebeten hatte, zu kommen. Er musste sie doch auch vermissen! Warum kam er denn nicht, sooft es ihm möglich war? Sie waren doch ein Liebespaar! Oder wollte er nichts mehr von ihr wissen, weil sie krank war? Sie hatte sich jedenfalls alle Mühe gegeben, möglichst gesund und verführerisch auszusehen. Die dicken Verbände an ihren Beinen sollte er auf keinen Fall sehen.
Als sie seine Schritte im Patio hörte, nahm sie schnell den Handspiegel und den Lippenstift, um die sie Cristina gebeten hatte, und zog die Lippen nach. Dann versuchte sie, so malerisch wie möglich auf ihrem Bett zu liegen.
Er betrat den Raum, und sie spürte sofort, dass etwas anders war. Er sah atemberaubend gut aus, das dichte Haar hatte er zurückgekämmt, sein Gang war federnd und energisch. Aber in seinem Lächeln lag etwas, das ihr nicht gefiel. Er blieb in der Tür stehen, offensichtlich war er gefangen von dem, was er sah.
»Frida, du siehst aus wie … ich dachte …, man hat mir von deinen Verletzungen und diesem Korsett erzählt … aber du wirkst auf mich wie eine … mein Gott, du bist so wunderschön!«
»Du hättest früher kommen sollen, dann hättest du meinen Anblick eher genießen können«, sagte sie mit einem ironischen Unterton. Aber dann strahlte sie ihn an. Er begehrte sie also immer noch, sie hatte ihn wieder in ihren Bann geschlagen.
Alejandro beugte sich über sie und küsste sie leicht auf beide Wangen. Frida schlang die Arme um ihn und zog ihn an sich. Wie sie seinen Duft vermisst hatte! Wie schön es war, die Arme um ihn zu legen! Sie hätte stundenlang so verharren können, doch Alejandro machte sich los und setzte sich auf die Bettkante. Sie wollte nach seiner Hand greifen, aber er versteckte die Hände zwischen den Knien.
»Wie geht es dir?«, fragte er. Seine Stimme hatte etwas Förmliches, Zurückhaltendes.
Meine Güte, er tat ja so, als würde er einen Krankenbesuch bei einer alten Tante machen und nicht bei der Frau, die er heiraten wollte!
»Ich habe dir doch oft genug geschrieben, wie sehr ich mich langweile und wie sehr ich dich vermisse. Mindestens einmal die Woche.«
»Frida …«
Sie seufzte. Mit einem resignierten Lächeln sagte sie: »Frau Luna hat mich nach dem Unfall noch nicht wieder besucht.« Mit diesem Ausdruck umschrieb sie ihre monatliche Blutung. »Diese Stange hat mich entjungfert. Sie ist dir zuvorgekommen. Vielleicht bin ich ja auch schwanger von ihr.«
»Ich dachte, das hätte Fernández bereits erledigt«, sagte er, und Frida hörte die unterdrückte Wut aus seinen Worten heraus.
Sie biss sich auf die Lippen. Sie hatte Alejandro von ihrem Flirt mit Fernando berichtet, weil sie Ehrlichkeit in ihrer Beziehung für das Allerwichtigste hielt. Und auch ein kleines bisschen, weil sie ihn provozieren wollte. Er wollte ihr doch wohl jetzt nicht die Schuld dafür geben, dass er nicht früher gekommen war. Irgendwie lief dieses Gespräch aus dem Ruder.
»Ich habe dir Bücher mitgebracht«, sagte er rasch und griff nach der Aktentasche, die er neben dem Bett abgestellt hatte.
»Oh, wie schön. Lesen kann ich inzwischen wieder, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Und die deutschen Bücher aus der Bibliothek meines Vaters habe ich alle schon durch. Zeig her!«
Er legte Herman Melvilles Moby Dick und Jane Austens Stolz und Vorurteil neben sie.
Sie griff nach seiner Hand und wollte sie an ihre Lippen ziehen.
»Frida, ich muss dir etwas sagen.«
Na also, sie hatte doch gleich gespürt, dass er etwas auf dem Herzen hatte. Beunruhigt ließ sie seine Hand los und stützte sich mit den Unterarmen ab, um ihren Oberkörper etwas weiter nach oben in das Kissen zu schieben. Dabei fuhr ihr der Schmerz in den Rücken. Mit einem zischenden Laut sog sie die Luft ein, aber es war nicht nur Schmerz, sondern auch Angst vor dem, was er sagen würde. »Okay. Was ist los? Nun sag schon. Ich kann die Wahrheit vertragen.«
»Ich werde nach Europa gehen und dort studieren.«
Frida zuckte zusammen und starrte ihn an. Das war es also! Als sie noch gesund gewesen war, hatten sie und Alejandro Reisepläne geschmiedet. Sie wollten nach Amerika, nach Europa. Und jetzt fuhr er ohne sie und versuchte, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, indem er ihr Untreue vorwarf. Das versetzte sie in einen Abgrund der Traurigkeit.
»Das war immer unser Traum«, flüsterte sie.
Jetzt griff er nach ihrer Hand. »Du wirst wieder gesund. Aber das braucht noch Zeit.«
»Die du nicht hast …«
Er sah sie vorwurfsvoll an. »Du bist ungerecht. Meine Tante in Berlin hat mich eingeladen zu kommen. Ich kann bei ihr wohnen, solange ich in Deutschland bin. Sonst könnte ich mir eine solche Reise nie leisten. Was hätten wir denn davon, wenn ich jetzt darauf verzichte? Wir wissen doch gar nicht, wann du wieder gesund bist.«
»Wann fährst du?«
»In zwei Wochen.« Er zögerte. »Und ich muss jetzt auch gehen. Es gibt so viel vorzubereiten.«
»Du kommst doch noch mal, um dich zu verabschieden?«
»Aber sicher«, sagte er, aber in seinem Blick las sie, dass er log.
Frida sah ihm durch das Fenster nach, wie er rasch über den Hof ging und durch das Tor auf die Straße trat. Sie meinte, seine Erleichterung zu spüren. Da geht meine Liebe hin, dachte sie traurig. Sie starrte noch minutenlang auf das Tor. Dann wischte sie sich mit dem Handrücken den Lippenstift ab. Gerade hatte sich ein weiterer Traum in Luft aufgelöst. Sie würde nicht Ärztin werden, sie würde nicht nach Europa fahren. Und sie würde nicht mit Alejandro leben.
Cristina betrat ihr Zimmer. »Ist er schon wieder gegangen?«, fragte sie. »Das war aber ein kurzer Besuch. Oh, er hat dir Bücher mitgebracht?« Sie griff nach der Jane Austen, legte sie dann aber zur Seite und nahm sich Moby Dick. »Leihst du mir das? Immer bringen dir die Leute Geschenke mit.«
»Wir können gern tauschen«, sagte Frida.
Cristina verzog den Mund. »So habe ich es nicht gemeint«, sagte sie. »Nur manchmal hätte ich gern ein bisschen von der Aufmerksamkeit, die alle dir schenken.« Als sie Fridas raschen Blick bemerkte, lenkte sie ein. »Sieh mal, ich war hinten im Obstgarten und habe ein paar Blüten für dich gepflückt.« Sie legte einige Bougainvilleen und kleine, blaue Glockenblumen auf Fridas Bett. Sofort stieg ihr zarter Duft Frida in die Nase.
»Oh, die sind schön. Wunderschön, so zart und doch so voller Leben. Schnell, gib mir mal den Stift.«
»Auch Papier?«
Frida schüttelte den Kopf. Sie nahm eine der winzigen Glockenblumen in die linke Hand, knöpfte die Bluse auf und fing an, sie auf ihr verhasstes Korsett zu malen. Sie fand Gefallen an dem, was sie tat, und zu den Blüten gesellten sich Schmetterlinge, kleine Grimassen und der Kopf ihres Lieblingspapageis. Sie war völlig vertieft und hörte erst auf, als keine Stelle in ihrer Reichweite mehr frei war. Jetzt bin ich zwar immer noch gefangen, aber immerhin in einer bunten Welt, dachte sie, als sie erschöpft in die Kissen zurücksank. Erst jetzt spürte sie den Schmerz wieder, der durch ihren Körper lief.
»Das ist bezaubernd«, sagte ihr Vater, als er gegen Abend wie immer zu ihr kam, »so voller Leben.«
»Ich versuche nur, die Welt um mich herum ein bisschen schöner zu machen. Außerdem kann ich beim Malen meine Schmerzen vergessen. Aber erzähl mir lieber, was du gemacht hast. Was hat das Leben dir heute geschenkt?«
Guillermo setzte sich vorsichtig auf die Bettkante und sammelte seine Gedanken. »Ich war auf dem Zócalo und habe die Gebäude auf der Ostseite fotografiert. Du weißt doch, das Projekt für die Regierung. Sieh nur, ich habe dir heimlich ein paar Blüten des Jacarandabaumes gepflückt, der vor dem Nationalpalast steht.« Mit einem Lächeln legte er die leuchtend violetten Blüten vor sie auf die Bettdecke. »Vielleicht kannst du die auch malen.« Während er sprach, sah er immer wieder auf die kleinen Zeichnungen.
»Jetzt sieht das Korsett gar nicht mehr so bedrohlich aus«, sagte er. Dann sprang er auf. »Ich bin gleich zurück.«
Frida hörte ihn draußen mit ihrer Mutter reden, konnte aber nicht verstehen, was er sagte. Ein paar Minuten später kam er mit dem großen Malkasten unter dem Arm zurück, der in seinem Büro im Regal stand und den Frida schon als Kind immer hatte haben wollen. In der anderen Hand trug er die Palette und ein großes Glas mit Pinseln in verschiedenen Stärken und Längen.
»Willst du mir wieder Malunterricht geben?«, fragte Frida. Sie erinnerte sich gern an diese gemeinsamen Stunden mit ihrem Vater.
»Nein. Aber ich glaube, du brauchst die Sachen jetzt dringender als ich«, sagte er und legte den Malkasten umständlich auf ihr Bett. »Auf die Idee hätte ich schon viel früher kommen sollen.«
»Ich kann nicht aufstehen, Papa. Ich kann mich nicht einmal aufsetzen. Wie soll ich da malen?«
»Deine Mutter hat da eine Idee. Ich gehe gleich morgen zu Agosto. Er wird dir eine Staffelei bauen, die wir auf dein Bett stellen und auf der du im Liegen malen kannst.« Er eilte aus dem Zimmer und schleppte kurz darauf einen ziemlich großen Spiegel herbei. »Wozu hast du ein Himmelbett«, fragte er und klatschte in die Hände. »Wir bringen diesen Spiegel über deinem Kopf an. Dann kannst du besser sehen, was du auf dein Korsett malst.«
»Ich könnte mich selbst malen, mich und mein Leben. Und die Geschichten, die du mir erzählst«, sagte Frida, und Hoffnung stieg in ihr auf. »Ich könnte mir mein Leben schönmalen, so wie eben auf dem Korsett.«
»Was hast du gesagt?«, fragte ihr Vater.
»Ach, nichts«, gab sie zurück. Der Gedanke hatte ja gerade erst von ihr Besitz ergriffen, und sie fand ihn so kostbar und verletzlich, dass sie ihn noch nicht teilen wollte. Sie öffnete den Malkasten mit den Ölfarben und fuhr mit dem Finger über das Blau und das Magentarot. Blau wie die Blüten des Jacaranda, Rot wie ihr Blut, Rot wie die Röcke der Frauen auf dem Markt … In ihr stiegen sofort Bilder auf, die sie in diesem Rot malen würde. Am liebsten hätte sie sofort angefangen.
Guillermo rief ungeduldig nach Cristina, damit sie ihm half, den Spiegel anzubringen, und riss Frida aus ihren Träumen. Ihre Schwester kam und stieg auf die Matratze ihres Betts, um den schweren Spiegel zu halten, während ihr Vater ihn mit Gurten befestigte. Cristina stieß dabei unabsichtlich mit ihrem Fuß in Fridas Seite. Die schrie vor Schmerz auf, biss dann aber die Zähne zusammen und sagte rasch: »Ist nicht schlimm, mach weiter!«
Als ihre Schwester und ihr Vater den Spiegel aufgehängt hatten, sahen sie Frida erwartungsvoll an. Frida hob den Blick … und erschrak. Das sollte sie sein? Dieses abgehärmte, schmerzverzerrte Gesicht sollte ihres sein? Dieses magere Wesen?
»Ich muss einen Moment allein sein, bitte, ich muss mich erst an diese Vogelscheuche über meinem Bett gewöhnen.«
Riesige dunkle Augen, schwarz umschattet von Müdigkeit und Schmerz. Darüber die schwarzen Brauen, die aussahen wie Vogelschwingen und das Gesicht dominierten. Eingefallene Wangen ohne Farbe, eine spitze Nase. Darunter der fein geschnittene Mund, der von Lippenstiftresten rot war und leuchtete. Und dann ihr Hals, der weiß im Ausschnitt der Bluse zu sehen war, die Hände mit langen Fingern und roten, spitz gefeilten Nägeln, mit denen sie so elegant durch die Luft spielen konnte und die jetzt wie zum Gebet übereinandergelegt waren. Ihr Blick wanderte wieder nach oben, zu ihrem Haar. Es war in der Mitte gescheitelt und streng zurückgekämmt. Weil sie keinen Pony trug, war die hohe, helle Stirn zu sehen. Einzelne dunkle Härchen bildeten einen Schatten um den Haaransatz. Sie stellte sich vor, wie sie dieses Gesicht malen würde, und zu ihrer Überraschung veränderte es sich auf einmal. Unter dem Schmerz tauchte ein Lächeln auf, ein Ausdruck von Hoffnung und von verhaltener Zuversicht. Und wenn sie durch das Malen nicht nur ihre Umgebung bunter gestalten würde, sondern ihr ganzes Leben verändern könnte?
Am nächsten Morgen nach dem Aufwachen galt Fridas erster Blick wieder ihrem Oberkörper, den sie in dem leicht schräggestellten Spiegel über ihrem Kopf gut sehen konnte. Immer wieder entdeckte sie neue Einzelheiten, fragte sich, wie dieses müde Gesicht auf andere wirken musste. Sie studierte ihr Gesicht so lange, bis endlich Agosto, der ein paar Häuser weiter seine Schreinerei hatte, die Staffelei brachte. Es war ein einfaches Konstrukt aus mehreren, miteinander verbundenen und verstellbaren Leisten. Zwei wurden rechts und links neben ihrem Körper auf das Bett gelegt, dann wurde die Malunterlage aufgeklappt und mit zwei Stützen von hinten festgehalten. Dabei konnte man den Winkel stufenlos verstellen, so weit, dass die Unterlage sich direkt über Fridas Gesicht befand. Ihr Vater kam und besah sich zufrieden die Konstruktion, legte ein Blatt auf die Staffelei, dann ließ er Frida allein.
Als sie zum ersten Mal den Pinsel in die Farbe tauchte und einen Strich auf das Papier machte, fühlte sie eine wahre Welle des Glücks in sich aufsteigen. Fast hätte sie vor Erleichterung geschluchzt. Wenn sie schon nicht in die Welt gehen konnte, dann könnte sie sich vielleicht die Welt nach ihren Vorstellungen auf die Leinwand holen. Allein die schwungvolle Bewegung, mit der sie den Pinsel führte, tat ihr gut. Am Anfang malte sie einfach drauflos, Linien und Kreise, um ein Gefühl zu bekommen. Denn schließlich malte sie im Liegen, und die ungewohnte Position, in der sie den Pinsel halten musste, bereitete ihr noch Schwierigkeiten. Ein paar Farbspritzer trafen ihre Bluse und das Kopfkissen, weil sie die Farbe zu nass auf den Pinsel gab, aber das würde sie spielend lernen.
Sie wusste noch nicht, was sie konkret malen wollte. Am liebsten alles! Ein Bild, das ihr geholfen hätte, die Stunden auszuhalten, als ihr das Gipskorsett angepasst wurde. Ein Bild, das ihr die Schönheiten und Möglichkeiten des Lebens aufzeigte, während sie gerade davon abgeschnitten war. Ein Bild voller Farben, das die elenden Fugen in den grauen Kacheln übertönen würde! Ja, genau das wollte sie malen! Natürlich war sie noch eine Anfängerin, aber in ihr keimte die Gewissheit, dass sie am Anfang von etwas ganz Neuem stand, das ihrem Leben einen neuen Inhalt geben würde.
Vor Glück darüber seufzte sie noch einmal tief auf und tunkte den Pinsel wieder in die Farbe.
Als Guillermo ihr erstes Bild sah, ein Porträt ihrer Indio-Köchin Amelda, war er beeindruckt. Amelda hatte sich anfangs gesträubt, sich malen zu lassen, weil sie befürchtete, ihre Seele würde auf der Leinwand eingesperrt werden. Aber Frida hatte sie überreden können.
»Ich habe auch Adriana gemalt«, sagte Frida voller Stolz und wies auf ein anderes Bild, das neben ihrem Bett an der Wand lehnte. Guillermo betrachtete es eingehend. Es zeigte ihre ältere Schwester Adriana in einem tief ausgeschnittenen Kleid vor einer Kirche. Diese Kirche hatte sie von einer Fotografie Guillermos kopiert.
»Was sagt denn deine Mutter dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr der Gegensatz zwischen deiner leicht bekleideten Schwester und dem Gotteshaus entgangen ist.«
Frida lächelte. »Ich habe es ihr nicht gezeigt. Und Adriana gefällt es. Ich musste es ziemlich oft übermalen, aber das Retuschieren habe ich ja zum Glück bei dir gelernt. Auch die Arbeit mit den feinen Dachshaarpinseln. Ist auch gut so, weil ich auf der Staffelei nur Platz für kleine Formate habe.«
»Und wenn niemand Zeit hat, für dich Modell zu sitzen?«
»Du meinst, wenn ich kein Opfer finde? Dann male ich mich selbst.«
Als ihr Vater gegangen war, sah Frida wieder nach oben auf ihr Bild im Spiegel. Dort sah sie die Gestalt, die sie am allerbesten kannte: sich selbst. Sie nahm den Pinsel zur Hand.