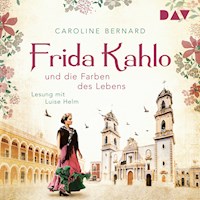16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine lebenshungrige Fotografin und ihre große Liebe - Gerda Taro und Robert Capa.
»Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen meinen Fotos und deinen: Du willst die fliegende Kugel zeigen. Ich zeige, was die Kugel mit dem Menschen macht, den sie trifft.«
1935: Im Pariser Exil schließt die junge Gerta mit dem Fotografen André einen Pakt: Er bringt ihr das Fotografieren bei, sie kümmert sich darum, wie er seine Bilder verkaufen kann. Bald werden die beiden als Gerda Taro und Robert Capa gefeiert, und sie verlieben sich. Als dann in Spanien der Bürgerkrieg ausbricht, wagt es Gerda als erste Frau, an vorderster Front zu fotografieren – und ihre Bilder gehen um die Welt. Doch so sehr Gerda und Robert auch für ihre Ideale einstehen wollen, sie riskieren damit alles ...
Die Geschichte der großen Liebe zwischen dem legendären Fotoreporter Robert Capa und Gerda Taro – einer Fotografin, deren künstlerisches Werk erst viel zu spät gewürdigt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Paris, 1935: Gerta aus Deutschland ist jung, schön und Sozialistin im Exil. Durch André, einen mittellosen Fotografen aus Ungarn, entdeckt sie ihre Passion für die Fotografie. Er bringt ihr alles bei, was er weiß, dafür hilft Gerta ihm, seine Fotos zu verkaufen. Doch als die Aufträge ausbleiben, kommt ihr eine Idee: Fortan sind sie nicht mehr die jüdischen Flüchtlinge Gerta und André, sondern Gerda Taro und Robert Capa – ein erfolgreiches Fotografenduo aus Amerika. Schon bald entwickelt sich aus der Zusammenarbeit eine leidenschaftliche Liebe.
Als im Juli 1936 der Spanische Bürgerkrieg ausbricht, gibt es für Gerda kein Zögern. Zusammen mit Robert fährt sie nach Barcelona und fotografiert, den Zweifeln ihrer männlichen Kollegen zum Trotz, als erste Frau inmitten der Gefechte. Die Bilder sorgen weltweit für Furore. Gerda und Robert sind derweil immer häufiger mit der Frage konfrontiert: Können sie den waghalsigen Drang nach dem nächsten großen Foto mit einem gemeinsamen Leben vereinbaren?
Über Caroline Bernard
Caroline Bernard ist das Pseudonym von Tania Schlie. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitet seit über zwanzig Jahren als freie Autorin. Sie liebt es, Geschichten von starken Frauen zu erzählen.
Ihr Roman »Frida Kahlo und die Farben des Lebens« führte lange Zeit die Bestsellerlisten an und ist in zahlreichen Ländern erschienen.
Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening liegen von ihr außerdem »Die Muse von Wien«, »Rendezvous im Café de Flore«, »Die Frau von Montparnasse«, »Fräulein Paula und die Schönheit der Frauen«, »Die Wagemutige« und »Ich bin Frida« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Caroline Bernard
Der Blick einer Frau
Sie riskiert ihr Leben, um die Welt zu ändern
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog — Am Strand bei Barcelona, August 1936
Kapitel 1 — Mexiko-Stadt, Anfang August 1996, sechzig Jahre später
Kapitel 2 — Berlin, 1931
Kapitel 3 — Paris, Dezember 1933
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6 — Paris, Frühling 1934
Kapitel 7 — Paris, September 1934
Kapitel 8
Kapitel 9 — Mexiko-Stadt, 1996
Kapitel 10 — Paris, Anfang 1935
Kapitel 11
Kapitel 12 — Paris, Sommer 1935
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15 — Mexiko-Stadt, 1996
Kapitel 16 — Paris, Ende 1935
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23 — Mexiko-Stadt, August 1996
Kapitel 24 — Barcelona, August 1936
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29 — Paris, Ende September 1936
Kapitel 30 — Mexiko-Stadt, 1996
Kapitel 31 — Paris, Anfang 1937
Kapitel 32
Kapitel 33 — Paris, April 1937
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39 — Madrid, Juli 1937
Kapitel 40 — Mexiko-Stadt, XXX 1996
Nachwort
Impressum
Prolog
Am Strand bei Barcelona, August 1936
Gerda döste auf dem Rücksitz des Hispano vor sich hin. Die Erschöpfung nach einem langen Tag in sengender Hitze forderte ihren Tribut. Die Sonne stand schon tief über dem Meer, und sie kniff die Augen zusammen. Das Glitzern machte sie halb blind, ihr Kopf dröhnte. Im Vorüberfahren sah sie am Strand junge Rekruten, ungefähr ein Dutzend, in einer Reihe hintereinander. Sie exerzierten. Ebenso wie die Trupps von Männern, die Gerda den ganzen Tag fotografiert hatte und die für die Verteidigung der Spanischen Republik ausgebildet wurden: Handwerker, Lehrer, Bauern. Sie alle hatten ihre Werkzeuge aus der Hand gelegt und die Waffen aufgenommen. Barcelona hatte sich gegen die Putschisten erhoben und Franco und seine Schergen vertrieben. Anfangs hatten die Menschen ihren Sieg kaum fassen können, aber nun waren sie in einem wahren Siegestaumel. Auf den Plätzen und Straßen der Stadt wurde getanzt und gefeiert – und exerziert.
Wieder sah sie zu der Gruppe hinüber. Scharf hoben die Männer sich im Gegenlicht vor dem weißen Sand ab. Aber etwas war anders. Gerda sah noch einmal hinüber. Das waren keine Männer, es waren Frauen!
Ihre Kopfhaut begann zu kribbeln, und diesmal kam es nicht von der Hitze.
»Halten Sie an«, rief sie dem Fahrer zu und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Beim Aussteigen griff sie nach ihrer Kamera. Ihre Erschöpfung hatte sie vergessen. In Barcelona waren nicht nur die Männer aufgestanden, es waren auch sehr viele Frauen unter den Kämpfenden. Und hier war der Beweis. Voller Stolz sah sie zu den Frauen hinüber. Am liebsten wäre sie zu ihnen hinübergelaufen, um sie zu umarmen.
Aber deshalb war sie nicht hier. Sie war hier, um zu fotografieren. Und Bilder von kämpfenden Frauen hatte die Welt noch nie zuvor gesehen. Diese Fotos würden eine Sensation werden!
Gerda stieg aus dem Wagen und ging geduckt auf die Gruppe zu. Es war wichtig, dass die Spanierinnen nicht merkten, dass sie fotografiert wurden. Gerda wollte echte Bilder. Gestellte Fotos von mit Gewehren posierenden Männern gab es genug, die konnten ihre Kollegen machen.
Sie war jetzt hellwach und spürte diese Erregung, die sie immer überkam, wenn sie einem guten Bild auf der Spur war. Für diese Momente voller Magie war sie Fotografin geworden. Sie hatte nur noch Augen für die Frauen, die stramm standen, das Kinn angehoben und die Augen geradeaus in der drückenden Hitze. Im Gegenlicht, auf einer kleinen Düne vor dem graublauen Meer sahen sie aus wie … wie ein Pfeil, der in den Himmel geschossen wird, dachte Gerda. Die Frauen wirkten ebenso müde und abgekämpft wie sie selbst. Aber sie schienen ihr Letztes zu geben und erfüllt von ihrer Mission zu sein. Genau wie ich, dachte Gerda wieder.
Beim Anblick der breiten Gürtel, mit denen die Frauen ihre Mono Azuls, wie die unförmigen Blaumänner genannt wurden, eng in der Taille geschnürt hatten, ging ein Lächeln über ihr Gesicht. Obwohl sie sich im Dreck wälzten und in brüllender Hitze exerzierten, ließen sie sich ihre Weiblichkeit nicht nehmen. Einige hatte die Ärmel hochgekrempelt. Und alle sahen entschlossen aus, kämpferisch, auch die, die kein Gewehr in der Hand hatten. Eine kleine Armee von jungen Frauen. Ihr Anblick machte Gerda stolz und rührte sie gleichzeitig.
Noch ein paar Schritte, und sie konnte gegen das Rauschen der Brandung hören, was die Anführerin rief: Sie war die einzige, die Uniform trug. Ihr Käppi machte sie als Angehörige der anarchosyndikalistischen CNT erkennbar.
»Heldenhafte spanische Frauen, Arbeiterinnen, Patriotinnen! Erhebt euch und verteidigt die Republik gegen die Faschisten! Lieber aufrecht sterben als auf Knien leben! Für die Freiheit von Spanien! No pasarán! Sie werden nicht durchkommen!«
Zur Antwort reckten die Frauen die Fäuste und riefen wie aus einem Mund: »No pasarán!«
Gerdas Arm zuckte. Am liebsten wäre sie in den Schlachtruf der Frauen eingefallen, aber stattdessen hob sie die Kamera. Sie verbrannte sich die Finger an dem metallenen Gehäuse und fluchte leise. Sie hielt den Apparat auf Brusthöhe und sah von oben durch den Sucher, doch bis sie so weit war, hatten die Frauen die Arme schon wieder gesenkt. Verflixt, sie war zu spät. Der Moment war vorüber. Gerda ließ die Kamera sinken. Es waren nur noch zwei Aufnahmen auf dem Film, und die mussten sitzen. Aber hier wartete ein lohnendes Motiv. Sie musste nur den einen, den magischen Moment erwischen. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete sie weiterhin die Frauen und hielt die Kamera bereit.
Ein prüfender Blick in den Himmel, die Sonne war schwer wie Blei. Nach kurzem Zögern beschloss Gerda, um die Frauen herumzugehen, dann hätte sie besseres Licht. Dabei konnte sie ihren Blick nicht von den Spanierinnen lassen. Sie waren jung und schön, trugen Lippenstift, und würden sie nicht in diesen plumpen Blaumännern stecken, könnte man meinen, sie seien auf dem Weg zum Markt oder zum Frisör und nicht in den Krieg. Wahrscheinlich hatten sie sich gerade als Freiwillige gemeldet, und dies war ihr erstes Training. Ihre Kinder hatten sie zu Hause zurückgelassen, ihre Arbeit, ihre Männer. Gerda spürte, wie ihr die Kehle vor lauter Stolz eng wurde. Für euch bin ich hier, dachte sie, um euren Mut und eure Schönheit zu zeigen.
In diesem Augenblick entsicherte die Anführerin ihren Revolver und reichte ihn an die erste der Frauen in der Reihe. Die war höchstens zwanzig, ihr Gesicht war noch ganz weich, eine Schönheit mit dunklen Locken. Und sie trug geschnürte Schuhe mit Hacken und eine Handtasche. Gerda hob wieder die Kamera, als die Anführerin auf eine Tonne wies, die in einiger Entfernung stand.
Sie bemühte sich, möglichst ruhig ein- und auszuatmen und sah durch den Sucher, während die Frau mit dem Revolver sich den Riemen ihrer Handtasche quer über die Brust legte und sie auf ihren Rücken schob. Dann ließ sie sich auf das linke Knie fallen, den rechten Fuß stellte sie auf und legte den Pistolenarm auf dem Oberschenkel ab, um besser zielen zu können.
Ihre Beine bildeten zwei exakte rechte Winkel. Eine geometrische Figur, schoss es Gerda durch den Kopf. Ein Quadrat. Perfekt für ihre Mittelformatkamera, die quadratische Negative machte. Sie konnte die feinen Strümpfe sehen, die einen Streifen Haut zwischen der Hose und den Schnürschuhen aufblitzen ließen.
Die Frau öffnete leicht den Mund und kniff die Augen zusammen.
Das ist es, dachte Gerda, das ist mein Motiv. In einer fließenden Bewegung ließ sie sich ebenfalls auf die Knie fallen, ohne den Blick von der Schützin abzuwenden. Ein spitzer Stein bohrte sich in ihre Kniescheibe, sie achtete nicht darauf. Stattdessen beugte sie sich noch ein wenig hinunter und sah nun leicht nach oben zu der Frau, die ganz allein vor dem weiten Himmel kniete. Sie hielt den Atem an. Jetzt, dachte sie und legte den Finger an den Auslöser. In diesem Augenblick gab es nur sie und diese Frau. Beide hochkonzentriert auf ihre Aufgabe, die Welt um sie herum ausgeblendet.
Gerda meinte die Anspannung zu spüren, mit der die Frau vor ihr den Zeigefinger leicht krümmte, um auszuprobieren, wie sich das anfühlte, wie viel Druck sie brauchen würde, um den Hahn durchzuziehen und abzudrücken. Sie glaubte das leise Klicken zu hören.
Jetzt, dachte sie wieder und drückte selbst ab. Den Bruchteil einer Sekunde später löste die Frau vor ihr den Schuss aus. Gleichzeit waren der Knall und das Scheppern des getroffenen Metalls zu hören. Die perfekte geometrische Figur, die die Schützin abgegeben hatte, löste sich auf, weil sie von dem Rückstoß nach hinten gedrückt wurde. Davon abgesehen hatte die Frau nichts von ihrer lässigen Eleganz eingebüßt. In einer mühelosen Bewegung stand sie auf und klopfte sich den Staub von der Hose. Dann reichte sie die Pistole an die nächste Frau weiter.
Gerda ließ die Kamera sinken. Auch sie stand auf, klopfte sich den Staub ab und rieb ihre schmerzende Kniescheibe.
Die Frau hatte sie bemerkt und sah sie neugierig an. Gerda winkte ihr zu. Wie einer Schwester. Dann ging sie zurück zum Auto. Sie hatte gerade das beste Foto des Tages gemacht.
Kapitel 1
Mexiko-Stadt, Anfang August 1996, sechzig Jahre später
Christina kniff die Augen zusammen und hielt das Negativ ins Sonnenlicht, das durch das Dachfenster hereinfiel. Sie erkannte eine Frau auf Knien, die einen Revolver in der Hand hielt und auf etwas zielte. Ihre Beine und die Hand mit der Pistole bildeten rechte Winkel. Nur die Pistole ragte über diesen fiktiven Rahmen hinaus.
Was für ein geniales Foto, dachte sie. Hier stimmte wirklich alles, der Bildaufbau war perfekt und das Motiv irgendwie herzzerreißend: eine junge, schöne Frau mit Handtasche und in hohen Schuhen, die merkwürdigerweise mit einer Pistole zielte. So ein Foto hätte ich gern gemacht, dachte Christina.
Bevor sie in Selbstmitleid über ihre verpatzte Karriere als Fotografin verfiel, wandte sie sich wieder ihrem Fund zu. In dem Koffer lagen noch viel mehr Fotonegative.
Schon den ganzen Vormittag war sie hier, in brütender Hitze und Staub, um den Dachboden leerzuräumen. Die heiße Luft umgab sie wie Watte. Sie hatte bereits Mengen von alten Büchern, Kleidungstücken und Kinderspielzeug entsorgt. Nur ein Paar Schlittschuhe hatten ihr Interesse erregt. Die ehemaligen Besitzer mussten weit in der Welt herumgekommen sein, in Mexiko konnte man nicht Schlittschuhlaufen.
Dann war sie auf diesen Koffer voller Fotos gestoßen. Die karierte Pappe des alten Gepäckstücks war an einigen Stellen aufgerissen. Die Schnappverschlüsse klemmten, aber Christina war neugierig und wollte unbedingt wissen, was sich darin befand. Geduldig hatte sie an den Verschlüssen herumgeruckelt, bis sie aufgesprungen waren. Als sie den Deckel endlich aufgeklappt hatte, war sie auf zwei flache Kartons aus dicker Pappe gestoßen, so groß wie Pralinenschachteln, darunter lag ein dicker Briefumschlag.
Die Schachteln waren innen unterteilt wie ein Setzkasten. In den Kammern, die jemand mit eingeklebten Pappstreifen hergestellt hatte, standen aufrecht Negativrollen, von denen ein leicht metallischer Geruch ausging. Da hatte Christina zum ersten Mal einen überraschten Laut ausgestoßen. Negative! Mit wachsender Neugierde hatte sie den Karton weiter inspiziert und auf der Innenseite des Deckels handschriftlich nummerierte Quadrate entdeckt. Jedes Quadrat ließ sich einer Filmrolle zuordnen. Neben den Nummern waren Begriffe notiert. Blitzschnell überflog Christina die Anzahl der Filmrollen, am Ende stand die Zahl siebenundvierzig, jede wahrscheinlich mit bis zu sechsunddreißig Aufnahmen. Das mussten Hunderte von Fotos sein!
Sie stieß einen Pfiff aus und sah sich die Eintragungen auf dem Deckel der ersten Schachtel näher an. Jemand hatte sie mit Bleistift vorgenommen, einige waren überschrieben und ausradiert, andere durch Kaffee- oder andere Flecken unleserlich. Christina beugte sich zur Seite, damit mehr Licht auf die Schrift fiel. Jetzt konnte sie einzelne Beschriftungen lesen: 47: REFUGIÉS DE BARCELONE, stand da auf Französisch, darüber, im Kasten mit der Nummer 35: PROTECTION DES OEUVRES D’ART. Zum Glück sprach sie genügend Französisch, um zu verstehen, dass es um Flüchtlinge aus Barcelona und um die Rettung von Kunstschätzen ging. Daneben fand sie aber auch spanische Einträge: 44: CAMPO DE PRISONEROS MOROS, Lager für maurische Gefangene. Sie nahm die dazu passende Filmrolle aus dem Fach, zog den Filmstreifen vorsichtig heraus und hielt ihn gegen das spärliche Licht. Auf den ersten Negativen waren Männer zu erkennen, die Mützen auf dem Kopf und aufgerollte Wolldecken über der Schulter trugen. Bei mehreren Fotos fiel ihr die ungewöhnliche Perspektive auf: Sie waren aus einer strengen Untersicht aufgenommen.
Behutsam legte Christina die Rolle zurück und las weitere Inschriften. Es gab Fotos von Krankenhäusern, vom Leben der Bauern, von militärischen Übungen. Sie sah wieder in den Koffer und griff nach dem dicken Umschlag. Weitere Negative rutschten heraus, diesmal nicht aufgerollt, sondern als Streifen, die in beschrifteten Papierhüllen steckten. Als sie Jahreszahlen von 1936 bis 1939 und dazu Orte in Spanien las – Guernica, Madrid und Barcelona –, keimte in ihr eine Ahnung: Die Fotos waren im Spanischen Bürgerkrieg gemacht worden. Oder? Sie würde das zu Hause im Lexikon nachschlagen, aber wenn sie sich richtig erinnerte, war der Krieg 1936 ausgebrochen, nachdem der spanische General Franco gegen die gewählte republikanische Regierung geputscht hatte. So oder so ähnlich war es ihnen in der Schule erklärt worden, denn der damalige mexikanische Präsident Lázaro Cárdenas hatte Tausende von Flüchtlingen aus Spanien, vor allem Kinder, aufgenommen.
Wieder pfiff Christina durch die Zähne. Wie es aussah, hatte hier jemand einen Krieg in Unmengen von Fotos festgehalten. Wer mochte dieser jemand sein? Sie blätterte durch die Umschläge mit den Negativen.
Wahllos nahm sie einzelne heraus und hielt sie gegen das Licht. Ein Wunder, wie gut sie erhalten waren. Einige Fotos verrieten durch Unschärfe oder falsche Belichtung, dass sie in Eile gemacht worden waren. Aber das ließ sich wohl nicht umgehen, wenn man in einem Kampf fotografierte. Andere Bilder wiesen höchste technische Perfektion auf und wirkten genauestens durchkomponiert. Das hier waren keine Schnappschüsse.
Christina nahm wieder das erste Foto in die Hand, das mit der Frau und der Pistole. Erneut hielt sie es gegen das Licht und betrachtete es lange. War das da im Hintergrund das Meer? Konzentriert betrachtete sie jeden Millimeter des kleinen Bildes, kippte es leicht hin und her, doch es half nichts. Das Negativ war zu klein, um Einzelheiten zu erkennen. Nachdenklich schob sie es zurück in den Umschlag.
Christina dachte nach. Der Eigentümer des Hauses war Botschafter gewesen. Das hatte seine Tochter gesagt, die sie hier hinaufgeschickt hatte, um den Dachboden auszuräumen. War er der Fotograf? Irgendwie glaubte sie das nicht. Es kam ihr unwahrscheinlich vor, dass ein Laie im Krieg Hunderte von Fotos knipste.
»Hallo? Wie weit sind Sie denn da oben?«
Christina zuckte zusammen. Wie lange saß sie hier schon und starrte auf ihren Fund?
»Noch ein paar Kisten, dann fege ich schnell durch und bin fertig!«, rief sie nach unten.
Hastig legte sie alles zurück in den Koffer und schloss den Deckel. Er wog kaum etwas. Sie stellte ihn neben die Tür, dann trug sie erst die anderen Kisten hinunter. Noch ein paar Mal musste sie gehen, und immer, wenn sie wieder oben ankam, warf sie einen nachdenklichen Blick auf den Koffer.
Während sie den Dachboden fegte, dachte sie über ihren Fund nach. Ihr wurde klar, dass sie diese Fotos gern mit nach Hause nehmen und mehr über sie herausfinden würde. Schon lange hatte sie nichts mehr so berührt. Es fühlte sich an, als hätte sie eine Art Schatz gefunden, der nur auf sie gewartet hatte, der für sie bestimmt war. Schließlich hatte sie selbst Fotografie studiert. Nur konnte sie leider nicht davon leben, deshalb musste sie ja solche Jobs annehmen und fremde Dachböden ausräumen. Aber jetzt stand sie hier vor einem Koffer mit einem Vermächtnis aus der Vergangenheit. Und irgendwie fand sie, dass er ihr gehören sollte.
»Jetzt fang mal nicht an zu spinnen«, sagte sie zu sich selbst, aber mehr, um der Enttäuschung vorzubeugen, falls die Besitzerin des Hauses, die Fotos behalten wollte.
»Das war’s«, sagte sie und lehnte den Besen an die Wand neben der Treppe. Als sie wieder unten war, stand Doña Izquaro in der Tür.
»Hier sind Negative drin.« Christina zeigte auf den Koffer. »Ziemlich viele. Vielleicht wollen Sie sie aufheben?«
Sie hielt den Atem an. Was, wenn die Frau Ja sagte?
Doch die verdrehte nur die Augen: »Wenn Sie wüssten, wie viele Fotos meines Vaters ich schon entsorgt habe. Ich habe die, die ich brauche, mehr will ich nicht.«
Christina atmete erleichtert auf. Dann fiel ihr noch etwas ein: »War Ihr Vater mal in Europa? In Spanien?«
»Er war Konsul in Marseille. Warum fragen Sie?«
»Ach, nur so.«
Zwei Stunden später kam Christina, in ein Handtuch gewickelt, aus dem Badezimmer, wo sie sich den Staub und die Hitze des Tages vom Körper gewaschen hatte. Barfuß tappte sie auf die Loggia hinaus und zog die Rollläden aus dünnem Bambus hoch, die sie zum Schutz gegen die Sonne angebracht hatte. Jetzt am Abend lag die Loggia im Schatten, doch hinter den Häusern gegenüber glomm noch der letzte Rest der untergehenden Sonne. Eine leichte Brise wehte herein. Christina öffnete das Handtuch ein Stück weit und genoss die Kühle auf ihrer feuchten Haut. Als sie ins Zimmer zurückkam, erschrak sie beinahe vor dem Pappkoffer, den sie auf dem Tisch abgestellt hatte. Er kam ihr auf einmal groß und unübersehbar wie ein Elefant vor. Sie umrundete ihn einmal, so als wäre er eine Skulptur in einem Museum, dann setzte sie sich davor und starrte ihn an. Aber bevor sie ihn aufmachte, aß sie die Enchiladas, die sie auf dem Heimweg gekauft hatte. Sie kaute schnell und merkte dabei, wie hungrig sie war. Den letzten Bissen spülte sie mit einem Schluck Bier hinunter, dann wischte sie sich sorgfältig die Hände ab, bevor sie den Koffer öffnete.
Sofort stieg ihr wieder der schwach metallische Geruch der Filmrollen in die Nase, der für sie wie eine Verheißung war. In diesem Koffer gab es noch so viel zu entdecken, dass sie es kaum erwarten konnte. Schnell fand sie den Umschlag von vorhin und ließ den Negativstreifen auf den Tisch gleiten.
Das Foto von der Frau mit der Pistole lag vor ihr. Zwischen zwei Fingerspitzen hob sie es hoch und hielt es gegen das Licht. Sie mochte es, und jetzt wusste sie auch, warum: Weil es eine Frau zeigte. Eine schöne Frau mit Waffe. Und zwar nicht wie die männliche Fantasie eines Flintenweibes, sondern ganz natürlich. Christina stand auf und ging zu der Kommode hinüber, die sie schon seit Studentenzeiten begleitete und die neben dem Fenster stand. In der obersten Schublade lag ihre Lupe. Sie griff danach, kehrte zurück zum Tisch und richtete nun die Lupe auf das Negativ, um es genauer betrachten zu können. Der Mund der Schützin war leicht geöffnet, ihr Zeigefinger lag am Abzug. Sie war jung und fixierte ein Ziel. Aber warum trug sie Schuhe mit Absätzen und eine Handtasche? Nachdenklich legte Christina das Negativ vor sich auf den Tisch und nahm einen anderen Umschlag aus dem Koffer. Auch auf diesem Streifen waren Frauen zu sehen. Sie standen in einer Reihe hintereinander, die erste hielt ein Gewehr. Einige trugen Berets oder Helme auf dem Kopf und breite Gürtel.
Christina konnte einzelne Gesichter erkennen, entschlossene Blicke. Auf einem Foto sah sie einen Mann, der neben einer Frau mit einem Gewehr im Anschlag kniete und ihr zeigte, wie sie es zu halten habe. Diese Aufnahmen waren sehr gelungen, Perspektiven und Bildausschnitte waren gut gewählt. Sie schob sie wieder in den Umschlag.
Christina lehnte sich zurück und atmete aus. In ihr verfestigte sich die Ahnung, dass sie hier einen Schatz gefunden hatte. Dass diese Fotos ihr Leben verändern könnten.
Jetzt spinn mal nicht, dachte sie im nächsten Moment und grinste dabei in sich hinein.
Aber irgendetwas musste es doch bedeuten, dass ausgerechnet sie auf diesen Fund gestoßen war. Sie, die das Besondere dieser Aufnahmen erkannte. Jemand anderes hätte die Bilder vermutlich einfach wie die anderen Dinge auf dem Dachboden in den Müll geworfen. Doch das hätte Christina niemals über sich gebracht. Diese Hinterlassenschaft war eine Aufgabe, dessen war sie sich zunehmend sicher. Sie trug jetzt die Verantwortung für diese Fotos.
Nachdenklich griff sie wieder nach ihrem Bier und nahm einen letzten Schluck, bevor sie die Flasche zurück neben den leeren Teller stellte. Als erstes wollte sie herausbekommen, ob die Fotos tatsächlich aus dem spanischen Bürgerkrieg stammten und wer sie gemacht hatte. Zorui würde ihr helfen. Eduardo Alfonso Ruíz, genannt Zorui, war ein Freund ihrer Mutter, und sie kannte ihn schon von Kindheit an. Er hatte ein beachtliches Geschichtswissen, außerdem war er eine Generation älter und vielleicht waren ihm die Ereignisse noch näher. Und er hatte eine Dunkelkammer, einen Leuchttisch und einen Vergrößerer. Er würde wissen, wie mit so alten Negativen umzugehen war. Wie man darauf achtete, sie nicht zu viel Licht und Bewegung auszusetzen. Es wäre eine Katastrophe, wenn das Material ihr unter den Fingern zerbröseln würde. Bei diesem Gedanken fiel ihr Blick auf den Negativstreifen vor ihr. Schnell schob sie ihn zurück in den Umschlag und legte ihn zurück in den Koffer. Am besten, sie machte sich sofort auf den Weg zu Eduardo, dachte Christina, während sie den Deckel schloss und die goldenen Schnallen am Koffer zuschnappen ließ.
Als sie sich erhob, fiel ihr Blick auf die Uhr. Meine Güte, es ging ja schon auf Mitternacht zu. Zorui hatte längst geschlossen. Sie würde bis morgen früh warten müssen.
Kapitel 2
Berlin, 1931
Seine Mutter hatte ihm extra neue Schuhe gekauft, robuste, geschnürte Schuhe, die eher aussahen, als wollte man mit ihnen wandern als über die Berliner Boulevards streifen. Als Endre Friedmann vier Wochen nach seinem Aufbruch in Budapest am Anhalter Bahnhof Berlin ankam – wobei er den größten Teil des Wegs über Wien, Brünn, Prag und Dresden zu Fuß gegangen war, weil er das Geld, das seine Mutter ihm mitgegeben hatte, lieber für andere Dinge als für die Eisenbahn ausgegeben hatte –, waren die Sohlen durchgelaufen und die Schnürsenkel hatte er schon mehrfach neu zusammenknoten müssen. Die derbe Lederjacke, die er Tag und Nacht trug, konnte mehr vertragen. Sie war unverwüstlich und schützte ihn vor Regen ebenso gut wie vor Kälte.
Als er an diesem Augusttag aus dem Zug stieg, trug er die Jacke allerdings über dem Arm, denn es war heiß. Die Lokomotive stieß eine Dampfwolke aus. Klebrig hüllte sie ihn ein und nahm ihm dem Atem. Als sie sich verzogen hatte, machte er ein paar Schritte in Richtung Ausgang, blieb dann aber mitten auf dem Bahnsteig stehen und zündete sich eine Zigarette an. Er nahm einen tiefen Zug und blickte sich um, sah Menschen durch die Lichtstrahlen hasten, welche durch die großen, bogenförmigen Fenster der Bahnhofshalle fielen. Berlin! Hier würde ein neues Leben für ihn beginnen, ein freies Leben. Endlich wäre er unabhängig von seiner Familie, auch von seiner Mutter. Er liebte sie zwar, aber mit ihrem Hin und Her zwischen Behüten und Vernachlässigen hatte sie ihm das Leben schwergemacht. Beim Abschied hatte sie ihm nicht eine einzige Ermahnung mit auf den Weg gegeben.
»Jetzt kann ich ja doch nicht mehr auf dich aufpassen«, hatte sie stattdessen gestöhnt und ihm dabei über das störrische Haar gestrichen. Das hatte sie sein ganzes Leben lang getan. Oder es zumindest versucht. Endre war ein Draufgänger. Als Kind war er auf dem Dach herumspaziert, und sie war beinahe selbst abgestürzt, als sie ihn von dort heruntergeholt hatte. Als Jugendlicher war er oft erst morgens nach Hause gekommen, und sie hatte die ganze Nacht um ihn gebangt und einen Schrei ausgestoßen, wenn er mit blauen Flecken und zerrissener Kleidung, aber grinsend zur Tür hereingekommen war. An anderen Tagen hatte sie schlicht keine Zeit für Endre und seinen Bruder gehabt, weil sie das Schneidergeschäft vor dem Bankrott zu retten versuchte. Dann waren die Jungen sich selbst überlassen.
Jetzt würde er endlich auf eigenen Füßen stehen. Wenn auch in schlechten Schuhen. Und endlich wäre er auch der repressiven politischen Situation in Budapest entkommen. General Horthys Regime unterdrückte jede freie Meinungsäußerung und vor allem die Juden. Einmal war Endre sogar verhaftet worden. Es war das einzige Mal, dass er sich erinnern konnte, dass sein Vater tätig geworden war. Er hatte ihn aus dem Gefängnis geholt. Danach war klar, dass Endre nicht in Budapest bleiben konnte. Er sprach einigermaßen Deutsch, und so wurde beschlossen, dass er in Berlin die Universität besuchen sollte. Seine Mutter kaufte ihm die Bergsteigerschuhe und ein Paar Knickerbocker, denn für lange Hosen war er ihrer Meinung nach zu jung. Endre hatte sie ausgelacht: Er sei siebzehn und würde bald achtzehn werden. Dafür, allein als politischer Flüchtling nach Deutschland zu gehen, sei er alt genug, aber nicht für lange Hosen? Seine Mutter war unerbittlich geblieben.
Endre warf die Zigarette ins Gleisbett. Er wusste nicht recht, wo er hinsollte. Ein Hotel konnte er sich jedenfalls nicht leisten. Und er wusste nicht, ob man in Berlin auf einer Parkbank übernachten durfte, – zudem barg es das Risiko, ausgeraubt zu werden. Unschlüssig sah er sich um.
Eine junge Frau näherte sich. Sie trug tiefroten Lippenstift und ein spöttisches Lächeln auf den Lippen, ihre Beine waren lang und schlank, und sie stolzierte auf atemberaubend hohen Absätzen. Und sie kam auf ihn zu. Endre starrte sie an.
»Suchen Sie ein Zimmer? Ich kann Ihnen helfen. Es kostet nicht viel.«
Sie hatte ein Zimmer für ihn. Und sie siezte ihn!
»Ja«, war alles, was er herausbrachte.
Sie machte auf ihren hohen Absätzen kehrt und winkte ihm, ihr zu folgen. Auf dem Weg versuchte er, mit ihr ins Gespräch zu kommen, merkte aber schnell, dass sein Deutsch nicht gut genug war. Sie sprach wenig und wenn, dann ratterte sie die Sätze nur so herunter. Er legte sich gerade ein Kompliment auf Deutsch zurecht, als auf einmal ein offener Lastwagen wild hupend von hinten heranraste. Endre sah die jungen Männer in SA-Uniformen auf der Ladefläche. Sie zeigten den Hitlergruß und hielten Schilder hoch, auf denen stand: Juda verrecke! Er wandte sich ab, obwohl sie ja nicht wissen konnten, dass er Jude war. Die Blonde an seiner Seite schenkte den Männern dagegen ein kokettes Lächeln. Jetzt fand er sie gar nicht mehr so attraktiv und fragte sich stattdessen, wo sie denn eigentlich hinwollte.
Da bog sie in eine kleine Straße ein und betrat eine Mietskaserne. Endre hielt die Luft an. In dem schummrigen Hausflur stank es durchdringend nach Katzenpisse und Kohl. Während er hinter der Frau die Treppen emporstieg, versuchte er, möglichst flach zu atmen, aber irgendwann musste er doch Luft holen. In diesem Moment klopfte die Frau an eine Tür im dritten Stock, und jemand öffnete.
Endre musste zweimal hinsehen, um zu erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Doch anscheinend stand vor ihm eine Frau. Eine, die so unglaublich dick war, dass ein paar Knöpfe ihres schmutzigen Kittels abgerissen waren. Sie trug einen Dackel auf dem Arm, der sich an ihren Busen schmiegte.
»Was ist?«, blaffte sie, und Endre starrte auf den Leberfleck an ihrer Oberlippe, der auf und ab wippte.
»Ich habe einen Mieter für dich«, sagte die blonde Frau.
Die Wirtin machte schweratmend einen Schritt zur Seite und ließ sie beide eintreten.
»Da hinten«, sagte sie.
Die junge Frau stöckelte voran und lotste Endre über einen dunklen Flur. Rechts und links gingen Türen ab, und er fragte sich, in welchem Zimmer wohl die Blonde wohnte. Am Ende des Flurs lag eine winzige Küche, an die sich ein noch kleinerer, fensterloser Raum anschloss.
»Das wär das Zimmer«, sagte die dicke Wirtin.
Das Zimmer war nicht mehr als eine Abseite. Als er eintrat, schlug ihm warme, abgestandene Luft entgegen. Ein schmales Bett stand dort, ansonsten gab es noch einen Stuhl, sonst nichts.
»Kostet zwei Mark in der Woche. Im Voraus.«
Endre wollte wieder gehen, aber dann dachte er an die schöne Frau, die seine Wohnungsgenossin sein würde. Also nickte er.
Die beiden Frauen sahen sich an, und die Wirtin reichte der Blondine ein Geldstück.
»Viel Vergnügen, Grünschnabel«, sagte diese zu ihm, bevor sie schwungvoll ihr Haar zurückwarf und verschwand.
Erst jetzt verstand Endre, dass sie lediglich eine Vermittlerin gewesen war. Auch in Buda gab es Wirte, die Schlepper an die Bahnhöfe schickten, damit sie Reisende als Mieter anwarben. Und nun war er darauf reingefallen.
Nachdem die Wirtin ihm einen Stups versetzt hatte, um die Tür hinter ihm schwerfällig ins Schloss zu ziehen, fragte er sich, ob er sich ärgern sollte oder nicht, kam aber zu keinem Ergebnis. Stattdessen spürte er Müdigkeit in sich aufsteigen und legte sich auf das Bett. Das Kissen roch ebenso wie die ganze Wohnung, das ganze Haus: Nach verkochtem Kohl.
Morgen suche ich mir etwas Besseres, dachte er, bevor er einschlief.
Am nächsten Morgen wachte Endre hungrig auf. Als er in die Küche kam, saß seine Wirtin am Tisch, vor sich eine Tasse Kaffee und eine Scheibe Brot, die dick mit Honig beschmiert war. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Erwartungsvoll blieb er stehen, aber die Frau hatte nur Augen für ihren Dackel. Er saß auf ihrem Schoß und sie sprach in gurrenden Lauten mit ihm und fütterte ihn mit einer Scheibe Wurst. Für Endre hatte sie keinen Blick.
Mit knurrendem Magen schob er sich zwischen dem Tisch und dem Herd an seiner Wirtin vorbei, durchquerte Flur und Treppenhaus und holte erleichtert Luft, als er auf dem Bürgersteig stand. Nachdem er sich von einem freundlichen älteren Herrn hatte den Weg erklären lassen, machte er sich auf zur Hochschule für Politik in der Nähe des Doms, wo er sich einschreiben wollte. Die Hochschule war privat, weshalb er keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Zeugnissen haben würde, und sie war links orientiert, nahm also auch arme Studenten auf. Das hatte er in Budapest von Freunden erfahren, die vor ihm nach Berlin gegangen waren und begeisterte Postkarten schrieben. Ob er ernsthaft studieren wollte, wusste er noch nicht zu sagen, aber eingeschrieben zu sein bedeutete für ihn, dass er in Berlin bleiben konnte und Zugang zu verbilligten Fahrkarten und einem Studentencafé hatte, wo er für wenig Geld essen konnte.
Hierhin führte ihn sein erster Weg, sobald die Formalitäten abgeschlossen waren. Endre hatte seit dem Vortag nichts gegessen. Er verschlang einen Teller Suppe und ließ sich Nachschlag geben, dann ging es ihm schon besser.
Die kommenden Tage verbrachte Endre damit, die Stadt zu erkunden. Morgens führte ihn sein erster Weg stets zum Studentencafé, anschließend ging er in die Vorlesungen, und weil ihn nichts in sein Zimmer zog, streunte er durch die verschiedenen Viertel, döste auf Parkbänken und sah den Enten auf dem Spreekanal zu, die so geschäftig mit der seichten Strömung paddelten, als seien sie auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Nur ging sein Geld langsam zur Neige, und er vermisste seine Freunde. Bisher hatte er mit den anderen Studenten im Café nie mehr als ein paar Worte gewechselt, da er fürchtete, sein Deutsch würde hierfür nicht reichen.
Als er sich jedoch fünf Tage nach seiner Ankunft gerade mal wieder über ein Geländer des Spreekanals beugte, hörte er hinter sich plötzlich jemanden Ungarisch sprechen. Entzückt drehte er sich um.
Auf diese Weise lernte er György Kepes kennen. Kepes lud ihn sogleich auf ein Bier ein. Die Ungarn in der Diaspora hielten zusammen, liehen sich Geld und beschafften sich Arbeit, meinte er. Endre schöpfte Hoffnung.
Zwei Tage später erwischte seine Wirtin ihn dabei, wir er ihrem Hund das Futter aus dem Napf stahl. Sie warf ihn hochkant hinaus. Jetzt hatte er nicht einmal mehr ein Bett. Endre schlief abwechselnd bei György und dessen Bekannten und manchmal sogar in Hausfluren. Es war klar, dass er dringend eine Arbeit brauchte. Er fragte überall nach, aber ohne Erfolg, weil sein Deutsch zu schlecht war.
György nahm ihn mit in eine Versammlung ungarischer Juden, obwohl er mit dem Judentum abgeschlossen hatte. Aber nach der Versammlung gab es immer etwas zu essen. An einem Abend traf Endre dort Simon Guttmann, einen kleinen Mann in einem zerknitterten Anzug, der eine Fotoagentur in Berlin hatte und zahllose Ungarn beschäftigte. Das interessierte Endre, denn er hatte schon oft vor den Litfaßsäulen gestanden und die Fotos in den Magazinen bewundert. In Budapest hatte er eine Freundin gehabt, die Fotos machte. Das könnte doch auch etwas für ihn sein! Ohne zu überlegen, fragte er Guttmann, ob er nicht für ihn arbeiten könnte.
»Kennen Sie sich mit Fotografie aus?«
»Klar«, log Endre.
»Dann kommen Sie morgen um sieben in die Friedrichstraße, Ecke Jägerstraße, 2. Stock. Seien Sie pünktlich.«
Als er am nächsten Tag die Tür öffnete, auf der ein Schild mit der Aufschrift Dephot angebracht war, fand er sich in einem Gewimmel von Sekretärinnen, Schreibtischen, klingelnden Telefonen und schreienden Menschen wieder, die in allen möglichen Sprachen in die Telefone redeten.
Er hatte die Tür gerade hinter sich geschlossen, da rempelte ihn jemand an, um an ein klingelndes Telefon zu kommen. »Yes, of course. Tomorrow? No problem.« Der Mann knallte den Hörer auf die Gabel und eilte weiter, während das Telefon gleich wieder zu klingeln begann. Niemand schien sich zuständig zu fühlen. Endre schaute noch unentschlossen zwischen dem davonhastenden Mann und dem klingelnden Apparat hin und her, als sich die Tür hinter ihm erneut öffnete und ein Mann hereinkam. Er war braungebrannt und trug einen Fotoapparat um den Hals.
»Warum gehen Sie nicht ans Telefon?«, blaffte er Endre an.
Der war so perplex, dass er den Hörer abnahm.
»Hallo?«
»Wer ist da?«, kam es vom anderen Ende der Leitung.
Endre schüttelte sich, dann sagte er: »Atelier Dephot. Was kann ich für Sie tun?« Aus den Augenwinkeln sah er, dass der braungebrannte Mann den Daumen hob und dann in einem Raum rechts neben der Eingangstür verschwand. Offensichtlich machte er es richtig.
»Ich brauche sofort ein Team in der Kantstraße. Großer Verkehrsunfall. Sofort! Und ich will Umbo, keinen anderen.«
»Ein Team? Umbo?«
»Mensch, sind Sie taub? Wo hat man Sie denn aufgegabelt?«
Endre sah hilflos um sich. Er war zwar nicht taub, aber er hatte keine Ahnung, was der Mann von ihm wollte. Zum Glück kam in diesem Moment der Braungebrannte zurück und nahm ihm den Hörer mit einem Kopfschütteln aus der Hand. Endre zuckte mit den Schultern. Er wollte jetzt erst mal mit Guttmann sprechen. Wo war er denn nur?
Da entdeckte er ihn. Das kleine Männchen saß inmitten des Chaos an einem Schreibtisch, und sein bestens gepflegter Schnurrbart zuckte, als er Endres Blick auffing. Mit einem Schmunzeln winkte er ihn zu sich, und Endre sah, dass er wieder den zerknitterten Anzug vom Vorabend trug. Er sah aus, als hätte er darin geschlafen.
»Umbo ist unser bester Porträtfotograf«, sagte Guttmann zur Begrüßung. »Das nächste Mal wissen Sie besser Bescheid, wenn Sie ans Telefon gehen.«
»Ich … ich wollte gar nicht … er hat mir gesagt, dass ich …« Nach Worten ringend zeigte Endre auf den Mann am Eingang, der immer noch – oder schon wieder – telefonierte.
Guttmann winkte ab. »Die Dunkelkammer ist da hinten. Nun gehen Sie schon.«
Nach ein paar Tagen übernahm Endre bereits alle möglichen Arbeiten in der Agentur, weil es überall mehr als genug zu tun gab. Er ging immer selbstbewusster ans Telefon und lernte mit jedem Tag mehr Namen von Zeitungen, Journalisten und Filmstars kennen. Endre war dankbar für die Abwechslung, denn die Arbeit als Gehilfe in der Dunkelkammer war nicht ganz das, was er sich erhofft hatte. Über Stunden hinweg Abzüge in die verschiedenen Flüssigkeiten zu tauchen, langweilte ihn. Dafür hörte er gern aufmerksam zu, wenn seine Kollegen die Fotos kommentierten. Technik, Bildaufbau, was sie gelungen und was sie schlecht fanden.
Als Umbos Assistent ausfiel und er nach jemandem verlangte, der ihm die Fotoausrüstung trug, meldete Endre sich. Nun musste er zwar stundenlang schwere Kameras und Stative durch Berlin schleppen, aber er konnte auch genau zusehen, wie Umbo arbeitete. Was er sich hier abguckte, würde er nie wieder vergessen. Es kam nämlich nicht darauf an, eine Filmschauspielerin möglichst schön abzulichten, sondern ihre Seele zu fassen zu bekommen. Umbo gelang das durch besondere Bildausschnitte und durch verführerische Überbelichtungen, die Lippen und Augen der Frauen aus einem ansonsten maskenhaften Gesicht hervorstechen ließen. Während Endre ihm schnaufend durch unzählige Berliner Treppenhäuser folgte, um Straßenszenen von oben zu schießen, erzählte Umbo ihm von seinen Anfängen in Berlin. Er hatte in der Ringbahn und in Parks übernachtet und wäre beinahe verhungert. Endre hörte zu und merkte sich Vieles. Vor allem, dass in der Fotografie wahre Wunder steckten und dass aus jedem etwas werden konnte.
Obwohl die Agentur sich vor Aufträgen nicht retten konnte, war Guttmann oft zu klamm, um seine Leute gleich zu bezahlen. Mehr als einmal musste er Kameras versetzen, um die dringendsten Rechnungen zu bezahlen. Endre blieb trotzdem, wo hätte er auch sonst hinsollen? Außerdem gab es bei Dephot noch viel für ihn zu lernen.
Inzwischen war es Herbst geworden, und Endres Geld reichte trotz der Arbeit vorn und hinten nicht. Mehr als zwei Monate war er schon mit der Miete seines neuen Zimmers im Rückstand, als ihm eine weitere Idee kam, um an Geld zu kommen. Er kaufte Heizkohle möglichst günstig im Zentraldepot, das außerhalb der Stadt lag, und schleppte sie eigenhändig ins Büro. Dann verkaufte er sie portionsweise an seine Kollegen. Damit verdiente er zwei bis drei Mark in der Woche. Für ihn war es der Unterschied zwischen Verhungern und Leben.
Trotz seiner prekären finanziellen Situation ließ Endre sich das Leben nicht vermiesen. Er war überzeugt, es in Berlin zu etwas zu bringen. Die Abende verbrachte er in Cafés mit ungarischen Freunden, er hatte eine Arbeit und einen Schlafplatz. Und manchmal brachte ihm eine der Sekretärinnen eine Stulle mit ins Büro, dann war sein Tag gerettet.
»Wir brauchen jemanden, der nach Kopenhagen fährt und Trotzki fotografiert.«
Guttmann wedelte mit dem Telefonhörer in der Hand und sah die Anwesenden nacheinander fragend an. Niemand meldete sich.
»Kopenhagen? Viel zu weit. Und wer zahlt die Reise?«
»Trotzki? Der lässt sich nicht fotografieren.«
»Mensch, wir haben Ende November. Ich hab keine Lust, mir da den Hintern abzufrieren. Kalt ist mir auch hier.«
So waren die Reaktionen.
Endre wusste nicht, wer Trotzki war. Er wusste gerade mal, wo Kopenhagen lag. Aber was er nicht wusste, das konnte er schließlich nachlesen. Und dies hier war seine Chance, zum ersten Mal selbst zu fotografieren. Er hatte Umbo hundertmal zugesehen, wie man Porträts machte. Entschlossen trat er einen Schritt nach vorn.
»Ich mach das.«
Am nächsten Tag reiste Endre dritter Klasse nach Kopenhagen, nur um zu erfahren, dass Leon Trotzki, der Gegenspieler Stalins, ständig von Leibwächtern umgeben war und niemanden an sich heranließ, schon gar keinen Fotografen. Stundenlang lungerte Endre mit den Abgesandten anderer Zeitungen und Bildagenturen vor dem Sportpalast, wo der Revolutionär eine Rede halten sollte, herum, rauchte und wartete darauf, ihn vielleicht beim Eintreffen zu erwischen. Drinnen waren keine Fotografen erlaubt, das hatte er bereits erfahren.
Aber wenn Trotzki jetzt aus einem Auto steigen würde, dann würden sich alle anwesenden Fotografen auf ihn stürzen und keiner würde ein gutes Foto schießen. Er musste sich etwas einfallen lassen. Was hätte Umbo in dieser Situation getan? Endre suchte die Umgebung nach einer Erhöhung, einem Zaun oder einem Baum ab. Aber auf die Idee waren schon seine Kollegen gekommen und froren sich auf Pfählen und Ästen hockend die Finger steif. In diesem Moment fuhr ein Lastwagen vor, und Arbeiter sprangen von der Ladefläche und begannen damit, Leitern, Werkzeug und Transparente ins Innere des Gebäudes zu tragen. Bevor er es sich anders überlegen konnte, verbarg Endre die kleine Leica unter seiner Jacke, hängte sich ebenfalls eine der Leitern über die Schulter und reihte sich in die Schar der Männer ein, die den Saal betraten. Er folgte ihnen bis vor die Tribüne, dann stellte er die Leiter ab und verhielt sich möglichst unauffällig, bis sich der Saal langsam füllte und er sich unter die Besucher mischen konnte. Endre beobachtete, wie die Bühnenarbeiter die letzten Scheinwerfer aufstellten, dann suchte er sich einen Platz in der ersten Reihe, rechts von der Mitte, schräg vor dem Rednerpult. So hätte er Trotzki genau im Fadenkreuz der beiden Scheinwerfer. Er überprüfte seine Kamera und stellte sie schon mal vorsorglich auf die Belichtung ein. Auch das hatte er sich bei Umbo abgeguckt. Er dankte ihm im Stillen, dann wartete er, bis Trotzki auf die Bühne trat, um seine Rede zu halten. Endre war nur wenige Meter von ihm entfernt. Seelenruhig hob er die Kamera vor das Gesicht und machte seine Fotos.
Während der gesamten Rückfahrt in dem eiskalten Waggon vergrub sich Endre in seiner Lederjacke und grinste in sich hinein. Er hatte seinen ersten Auftrag gemeistert. Kurz überfiel ihn die Angst, dass die Fotos missraten sein könnten. Und wenn er falsch belichtet hatte? Wenn die Bilder verwackelt waren? Immerhin hatte Trotzki nicht gerade stillgehalten. Doch dann beruhigte er sich wieder. Irgendetwas würde schon dabei sein.
Sobald Endre in Berlin ankam, ging er zu Dephot in die Dunkelkammer. Er konnte den Moment kaum abwarten, in dem die Fotos im Entwicklerbad Form annahmen. Sie waren gut! Besonders das mit den hochgerissenen Fäusten, auf dem Trotzki aussah, als würde er mit der ganzen Welt ringen. Und das andere, in dem seine Brillengläser im Licht der sich kreuzenden Scheinwerfen blitzten wie Waffen. Er legte Guttmann die Abzüge auf den Tisch, dann ging er nach Hause, um sich auszuschlafen.
Als er am nächsten Tag in die Agentur kam, brüllte Guttmann ihn an. Wie er es wagen können, ihm die Fotos auf den Tisch zu legen und dann abzuhauen? Aber er grinste dabei.
»Ich habe drei Nächte nicht geschlafen«, verteidigte sich Endre.
»Für diese Fotos hätte ich einen Monat nicht geschlafen, Sie Weichei!«
»Können Sie sie verkaufen?«, wagte er zu fragen.
Wieder grinste Guttmann. »Ist schon passiert. Der Berliner Welt-Spiegel will sie haben, für eine ganze Seite.«
»Aber nur, wenn Sie meinen Namen nennen.«
Da wich Guttmann doch das Grinsen aus dem Gesicht, stattdessen lief er rot an. »Für wen halten Sie sich eigentlich? Grün hinter den Ohren, aber Ansprüche haben. Gehen Sie mir bloß aus den Augen!«
Erhobenen Hauptes marschierte Endre an den anderen Kollegen vorbei in die Dunkelkammer. Einige klatschten.
Und am nächsten Tag lag der Welt-Spiegel auf seinem Platz. Die Fotos prangten auf einer ganzen Seite. Und darunter stand tatsächlich sein Name: Friedmann.
Der 30. Januar 1933 veränderte alles. Trotzki-Fotografen standen nicht mehr besonders hoch im Kurs. Unter seinem Fenster hatte die SA ihre Aufmarschstrecke. Jede Nacht weckten ihn die grölenden Männer und brachten ihn um den Schlaf.
Als am 27. Februar 1933 der Reichstag brannte, ging er hin, um Fotos zu machen. Er trug seine Kamera offen über der Jacke.
Plötzlich zischte jemand neben ihm: »Mensch, bist du lebensmüde? Komm da weg.«
Endre erkannte seinen Kollegen Konrad von Dephot, mit dem er in der Dunkelkammer arbeitete, aber er verstand immer noch nicht, was los war. Da sah er die beiden SA-Männer, die mit gezückten Revolvern auf sie zu rannten.
Er und Konrad liefen um ihr Leben und blieben erst stehen, als sie sich in der Dunkelheit des Tiergartens sicher glaubten.
»Geh nicht nach Hause«, sagte Konrad. »Hau ab. Ich mach dasselbe. Viel Glück.«
Noch in der Nacht ging Endre zu Freunden, um sich Geld für eine Fahrkarte zu leihen. Als er in den Zug stieg, presste er die Leica, für die er wochenlang auf Essen verzichtet hatte, fest an den Körper. Er wusste nicht genau, wohin er sollte, und weil er Freunde in Wien hatte, fuhr zuerst dorthin, und dann, im September 1933, weiter nach Paris.
Kapitel 3
Paris, Dezember 1933
Gerda rieb die klammen Hände aneinander. Ihre Finger waren steif vor Kälte und trafen kaum die Tasten der Schreibmaschine. Aua! Schon wieder hatte sie sich einen Finger eingeklemmt, diesmal zwischen dem E und dem R. Aber eine Pause war nicht drin. Bis Montag musste sie noch dreißig Seiten abtippen, wobei sie stillschweigend Rechtschreibfehler im Text korrigierte. Spitz zahlte zwar nur einen Hungerlohn, aber sie konnte es sich trotzdem nicht leisten, ihn zu verärgern. Würde er sie rauswerfen, so wäre das eine Katastrophe. Er zahlte nur so viel, dass es für die Miete reichte, aber es war der einzige Gelderwerb, den sie gerade hatte. Als Flüchtling aus Deutschland bekam sie keine Arbeitserlaubnis. Paris war voll mit Arbeit suchenden Deutschen, und die Franzosen fürchteten die Konkurrenz. Also blieb ihr nur Schwarzarbeit. Gerda saugte an ihrem schmerzenden Finger und beugte sich wieder über die Tastatur. Die Texte, die sie für den Analytiker René Spitz abtippte, waren kompliziert und voller Fachbegriffe. Aber meistens gelang es ihr, den Kopf mehr oder weniger abzuschalten und sich nur auf die Handschrift zu konzentrieren.
Wenn es nur nicht so kalt wäre! Sie zog den Mantel enger um den Körper. Wenn sie noch eine Jacke gehabt hätte, hätte sie die auch noch angezogen. Aber sie trug schon alle Kleidung übereinander, die sie besaß. Suchend sah sie sich um und entdeckte am Haken hinter der Tür Ruths Schal. Den hatte sie vorhin wohl vergessen.
Vielleicht aber auch nicht. Gerda lächelte bei dem Gedanken. Ruth Cerf wollte schön und elegant sein, und dafür nahm sie Leid in Kauf. Es war ihr zuzutrauen, dass sie trotz der Kälte ohne Schal ausging. Und oft hatte sie Glück und jemand hatte Mitleid mit ihr und lud sie in ein Café ein. Oder sie hat ihn für mich dagelassen, dachte Gerda und allein bei dem Gedanken wurde ihr schon wärmer.
Als sie mit neunzehn mit ihrer Familie von Stuttgart nach Leipzig gezogen war, hatte sich Gerda für modern und für einen halbes Flapper Girl gehalten. Immerhin hatte sie ein Internat in der Schweiz besucht, rauchte und trug ihr Haar kurz und Schuhe mit hohen Absätzen. Aber dann hatte Ruth in Leipzig auf der höheren Mädchenschule neben ihr gesessen und sie in eine unbekannte Welt mitgenommen. Die Gaudigschule war eine Vorreiterin der Reformpädagogik, dort gab es sogar einen sozialistischen Schülerbund. Gerda wurde dort rasch Mitglied. Ruth war Jüdin wie Gerda, aber sie ging sehr offensiv mit ihrem Judentum um. Gerda ging mit ihr in den Jüdischen Turnverein und lernte Ruths Freunde kennen. Viele von ihnen waren Mitglieder der KPD, auch Ruth. Über sie kam Gerda mit linken Ideen in Berührung und war bald selbst überzeugte Sozialistin. Die Linken waren eben einfach interessanter und netter als die Rechten. Einer von ihnen war Willy Chardack, den alle »Dackel« nannten, und dann war da noch Georg Kuritzkes. Georgs Eltern führten einen kommunistischen Salon in Leipzig, Georg war ein bekanntes Gesicht der linken Leipziger Jugend. Gerda verliebte sich auf der Stelle in den schönen jungen Mann und seinen Idealismus. Sie hatte die damals beste Zeit ihres Lebens gehabt, voller Liebe, aber auch mit Träumen für eine bessere Zukunft.
Gerda seufzte tief auf, während sie mit dem Finger über das Papier fuhr, um die richtige Zeile im Manuskript zu finden. Wie aufregend ihr Leben damals gewesen war. Sie hatten nächtelang diskutiert und getanzt, gemeinsame Ausflüge gemacht und Flugblätter geklebt. Unbesiegbar hatten sie sich gefühlt.
Doch dann war der 30. Januar 1933 gekommen. Die guten Zeiten in Deutschland waren vorüber. Die meisten ihrer alten Freunde waren schon lange nicht mehr im Land, weil es dort zu gefährlich für sie war. Georgs jüngerer Bruder war von braunen Schlägern krankenhausreif geprügelt worden und war kurz danach über die Grenze gegangen. Andere waren verhaftet worden, unter ihnen Gerda. Eigentlich waren sie SA-Männer auf der Suche nach ihren beiden jüngeren Brüdern gewesen, aber als sie die nicht finden konnten, hatten sie Gerda mitgenommen. Zum Glück hatten sie keine Ahnung gehabt, dass auch sie Flugblätter in den Dörfern rund um Leipzig verteilt hatte. Ihr wurde immer noch schlecht, wenn sie an die Wochen in der Haft dachte. Sie hatte im Gefängnis die Unschuldige und Verängstigte gespielt und war jedes Mal in Tränen ausgebrochen, wenn man sie zum Verhör geholt hatte. Einer der Polizisten war ihr auf den Leim gegangen und hatte sie beschützt. Ihr Vater hatte sie letztlich frei bekommen, weil sie durch ihre Eltern polnische Staatsbürgerin war und der polnische Konsul sich für sie eingesetzt hatte. Aber es war klar gewesen, dass sie beim nächsten Mal nicht so viel Glück haben würde. Sobald sie wieder frei gewesen war, hatte sie deswegen Pläne für ihre Ausreise geschmiedet.
Ruth und Willy waren schon vor ihr nach Paris gekommen. In Paris hatten sich die drei dann wiedergetroffen, und während Willy rasch bei einem Freund unterkam, beschlossen Gerda und Ruth, sich zusammen etwas zu suchen, weil es so einfacher war, über die Runden zu kommen. Und wenn die Lage völlig aussichtlos schien, konnte man sich gegenseitig aufmuntern. Das Zimmer, in dem sie nun wohnten, war so klein, dass Ruth und sie das Bett teilen mussten. Kalt war es auch, aber immerhin hatten sie seit ein paar Wochen ein Zuhause.
Gerda stand auf und wickelte sich Ruths Wollschal um den Oberkörper. Dabei stieg ihr der vertraute Duft nach Chanel N° 5 in die Nase, und sie musste lächeln. Ruth würde lieber ohne Unterwäsche ausgehen als ohne Parfum. Als sie zum Tisch zurückging, traf sie ein eisiger Hauch. Durch das Fenster im Dach des schäbigen Dienstbotenzimmers am Port Royal zog es wie Hechtsuppe. Dafür hatte man von hier oben eine tolle Aussicht: In die eine Richtung ging es nach Montparnasse, wo das Dôme lag, Gerdas Lieblingscafé mit dem üppigen Dekor, das viele Pariser frequentierten. Sie saßen auf der Terrasse in den Stühlen mit den geflochtenen Sitzflächen und Lehnen, gestikulierten und lachten und labten sich an riesigen Platten mit Meeresfrüchten, die auf einem Bett aus giftgrünem Seetang serviert wurden. Gerda fand es todschick, wie die Leute hier saßen, die Schalentiere knackten und mit einem Glas eiskalten Weißwein hinunterspülten. Leider hatte sie dieses Vergnügen bisher noch nie gehabt, sondern immer nur von der Straße aus sehnsüchtig zugesehen. Das Lokal war viel zu teuer.
Ich werde es schaffen, hier so viel Geld zu verdienen, dass ich es mir leisten kann, im Dôme Champagner zu trinken, schwor sie sich.
Doch bisher verlief ihr Leben in Paris leider nicht so rosig, wie sie sich das während der Fahrt im Nachtzug vorgestellt hatte.
Ein paar Tage, nachdem sie aus der Schutzhaft entlassen worden war, war sie in Saarbrücken in den Zug gestiegen. Sie konnte ihr Glück immer noch nicht fassen. Das Schlimmste hatte sie hinter sich. Jetzt konnte es doch nur aufwärts gehen, sie sprach perfekt Französisch, war jung und aufgeweckt und würde sich in Paris schon durchschlagen, so dachte sie und träumte von funkelnden Lichtern, von romantischen Spaziergängen an der Seine, vom Flanieren auf den Champs-Élysées.
Am Morgen ihrer Ankunft stieg sie am Ostbahnhof aus dem Zug und gab ihren Koffer an der Gepäckaufbewahrung ab. Sie wollte als erstes in die berühmte Rue de Rivoli, die den Louvre säumte. Ihre Französischlehrerin im Internat hatte in den höchsten Tönen von der Prachtstraße geschwärmt, und während der ganzen Zugfahrt hatte Gerda sich ausgemalt, wie sie unter den Arkaden die Auslagen der Geschäfte bestaunen würden. Sie schwelgte in Träumen von schönen Kleidern und Schuhen aus feinstem Leder. Den ganzen Weg vom Bahnhof war sie zu Fuß gegangen und hatte sich dabei an den großen Plätzen orientiert: Place de la République, Place de la Bastille, Place de l’Hôtel de Ville. Hier fing die Rue de Rivoli an, die ihre Erwartungen noch übertroffen hatte. Sie kam an Cafés vorüber, wo in den Auslagen Gebäckteilchen wie kleine Kunstwerke dekoriert waren, und ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Sie flanierte sie durch den Tuileriengarten und stand in der Dämmerung auf dem Pont Neuf. Vor ihr glitzerte die Seine, die Türme von Nôtre-Dame leuchteten golden, auf den Uferstraßen waren die Lichter der Autos wie Perlen aneinandergereiht. Und darüber spannte sich ein samtblauer Himmel, so nah, dass sie meinte, ihn berühren zu können.
Niemals hätte ich mir Paris so schön vorgestellt, dachte sie. Es ist noch viel schöner, als Madame Fournier erzählt hat. Und hier wird mein neues Leben beginnen.
Sie stand noch lange da und ließ sich vom Glanz der Stadt überwältigen. Doch irgendwann musste sie sich der Frage stellen, wo sie übernachten sollte.
Mit schweren Beinen nahm sie den langen Weg zurück zum Bahnhof und holte ihre Tasche. Dann ging sie zur Metrostation und suchte auf dem Plan nach der richtigen Linie, um nach Montmartre zu kommen. Dort sollten die Hotels am billigsten sein. Sie schleppte ihr Gepäck die schier endlosen Treppen zum Bahnsteig hinunter, aber sie konnte kein Schild erkennen, das ihr die Richtung wies. Auf gut Glück nahm sie den rechten Gang, der sich nach ein paar Metern wieder teilte, suchte nach einem Hinweisschild, aber mit den Ortsnamen, die die Richtung angaben, konnte sie nichts anfangen. Eine Ewigkeit irrte sie in schier endlosen Gängen umher, in denen es muffig roch, stieg weitere Treppen hinauf und hinunter. Dann hörte sie hinter sich Schritte, die näher kamen. Plötzlich war ein Mann hinter ihr und raunte ihr Obszönitäten ins Ohr. Normalerweise ließ sich Gerda von derartigen Dingen nicht aus der Bahn werfen. Ein kesser Spruch, und der vermeintliche Verehrer zog Leine. Aber inzwischen war sie entnervt und verunsichert. Der Mann machte ihr Angst, und Gerda beschleunigte ihre Schritte. Da vorn war ein Bahnsteig, und gerade fuhr ein Zug ein. Gerda lief so schnell, wie es ihr Gepäck ihr ermöglichte, und sprang im letzten Moment in den Waggon. Die U-Bahn war gestopft voll, es roch nach ungewaschenen Leibern. Unsanft bekam sie einen Ellenbogen in die Rippen gestoßen, dennoch atmete sie erleichtert aus.
Es war purer Zufall, dass die Bahn in ihre Richtung fuhr. Nach ein paar Stationen las sie Abesses auf dem Schild am Bahnsteig. Sie packte ihren Koffer und drängelte sich zum Ausgang. Dann schleppte sie ihr Gepäck eine weitere Treppe hinauf. Inzwischen hatte sie kaum noch Gefühl in ihren Armen. Ich nehme das erste Hotel, an dem ich vorbeikomme, schwor sie sich. Als sie auf der Straße stand, stellte sie fest, dass ihre Tasche geöffnet war. Sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie jemand im Gedränge geöffnet und ein paar Sachen herausgenommen haben musste. Das elegante Kleid, das ihre Tante Tessa ihr zum Abschied genäht hatte, war nicht mehr da. Und ihr Schal fehlte auch.
Als sie eine Stunde später endlich in einem Bett eines mittelmäßigen Hotels lag, weinte sie vor lauter Enttäuschung über ihre Traumstadt.
Gerda verzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln, als sie an ihren ersten Tag in Paris dachte, und zog Ruths Schal enger um sich. Seitdem hatte sie noch mehrfach mit den Schattenseiten der prachtvollen Großstadt Bekanntschaft machen müssen. Aber sie war zäh. Jeden Tag war sie in das Café gegangen, von dem Ruth ihr noch in Leipzig erzählt hatte. Ein paar Tage nach ihrer Ankunft hatten sie sich schließlich wiedergesehen und beschlossen, zusammenzuziehen. Und immerhin hatte sie jetzt eine feste Bleibe. Wenn sie in die andere Richtung aus dem Fenster sah, waren es nur ein paar Minuten ins Quartier Latin. Dazu musste sie nur über das Gelände des Krankenhauses Cochin gehen. Gleich auf der anderen Seite fing der Jardin de Luxembourg an. Sie spazierte oft auf den geharkten Wegen bis zum Boulevard Saint-Michel. Ohnehin lief sie den ganzen Tag durch die Stadt, denn die Metro war teuer. Und seit man sie dort bestohlen hatte, mied sie die U-Bahn, wo es ging.
Am Boulevard Saint-Michel gab es billige Cafés, vor allem das Café Capoulade, wo sich ihre Freunde trafen. Gerda sah sich dort sitzen und einen saftigen Croque Monsieur essen … Meine Güte, jetzt dachte sie schon wieder ans Essen! Kein Wunder, denn außer einer Tasse dünnen Kaffee hatte sie heute noch nichts zu sich genommen, und draußen wurde es langsam schon dunkel.
Die Tür hinter ihr öffnete sich, und Ruth kam herein. Sie war durchnässt und fror womöglich noch mehr als Gerda, obwohl sie gerade sechs Stockwerke hinaufgelaufen war. Aber sie waren beide dünn wie Bohnenstangen, und der Wind pfiff ihnen förmlich durch die Rippen.
»Ich hasse sie«, schimpfte Ruth, und Gerda wusste sofort, von wem sie sprach. Ihre Freundin arbeitete zurzeit als Hausmädchen bei einer Frau, die sie schikanierte. Aber weil sie im Gegensatz zu Gerda kaum Französisch sprach, fand sie nur niedere Beschäftigungen. Es ging sogar noch schlimmer: Bei ihrer letzten Anstellung hatte der Hausherr nackt unter seinem offenen Bademantel am Türrahmen gelehnt. Ruth war aus dem Haus geflohen, aber die Leute hatten sich über sie beschwert und ihr viel Ärger mit der Fremdenpolizei eingebracht.
»Hassen tun wir Hitler und die Nazis«, sagte Gerda geduldig.
Ruth rollte mit den Augen, bevor ihr Blick auf den Schal fiel, den Gerda trug. Erleichtert atmete sie aus. »Ach, hier ist er, ich hatte schon Angst, ich hätte ihn verloren.«
Gerda stand auf und wollte ihn abnehmen, doch Ruth schüttelte den Kopf.
»Ich zieh mir erst mal was Warmes an.«
Gerda musste lachen. »Was denn? Du hast nichts anderes.«
»Dann lege ich mich eben ins Bett. Aber ich habe das hier!« Sie hielt ein kleines Päckchen Zeitungspapier hoch, in das etwas eingewickelt war. »Ich musste Madame Tee kochen und habe die Blätter mitgehen lassen. Die sind noch gut.«
Gerda ging hinüber zum Waschtisch und füllte Wasser in ihren einzigen Topf.
»Hast du auch etwas zu essen?«
Traurig schüttelte Ruth den Kopf.
In diesem Augenblick klopfte es, und Gerda musste einen Schritt zur Seite machen, damit Willy Chardack genügend Platz hatte, um einzutreten und die Tür hinter sich zu schließen.
»Seht mal, was ich hier habe«, sagte er und zog ein Baguette und ein Glas Sülze aus der Tasche. »Ich habe ein Fresspaket von meiner Mutter bekommen. Hinterher gibt es Schokolade.« Willy studierte an der Sorbonne Medizin. Seine Familie unterstützte ihn, und er teilte oft mit Gerda und Ruth. Unschlüssig drehte er sich einmal um die eigene Achse und schien nicht zu wissen, wohin er die Sachen stellen sollte. Also umarmte er Gerda mit dem Glas in der einen und dem Brot in der anderen Hand.
»Wie schön, dass du da bist«, murmelte sie an seiner Schulter.
»Willy, du bist ein Schatz! Hast du zufällig auch eine Arbeit für mich dabei, von der ich leben kann?«, fragte Ruth. Sie hatte sich auf das Bett gelegt und stopfte die Decke um sich fest. Willy setzte sich ans Fußende, während Gerda den Tauchsieder in den Topf hielt, um Tee zu kochen.
»Ohne dich würden wir hier verhungern«, sagte Gerda.
Willy winkte ab und wuschelte sich durch sein gelocktes Haar. »Du solltest auch studieren. Du sprichst sehr gut Französisch …«