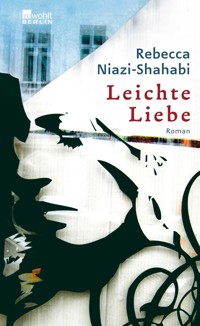9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Beim Versuch, schlanker, schlauer, schöner zu werden, mal wieder gescheitert? Den Traumjob knapp verpasst? Egal, denn wer hat eigentlich behauptet, dass Glücklichsein der Normalzustand ist? »Ich bleib so scheiße, wie ich bin« macht Schluss mit der Selbstoptimierung. Schluss mit der Wahnsinnsidee, dass man das Leben besonders effektiv zu nutzen habe. Besser werden heißt wahnsinnig werden, also: Bleiben Sie dick, faul, jähzornig – und glaubwürdig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Das Zitat von 1 BLEIBEN SIE DICK, EITEL, GIERIG, JÄHZORNIG - UND GLAUBWÜRDIG ist entnommen aus: Horst Bienek, Werkstattgespräche mit Schriftstellern, DTV, München 1965. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Taschenbuch Verlages.
Das Zitat von Max Frisch ist entnommen aus: Max Frisch, Unsere Gier nach Geschichten, In: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Vierter Band, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlages.
Das Ziat von Max Frisch ist entnommen aus: Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlages.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95914-8
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagabbildung: Martina Kiesel
Innengestaltung: Oliver Sperl, Berlin
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Dieses Buch könnte Ihr Leben verändern,
indem Sie nach der Lektüre davon überzeugt sein
werden, nichts mehr an sich ändern zu müssen.
In unseren Zeiten eine durch und durch
revolutionäre Angelegenheit: Sich nicht ändern
zu wollen provoziert. Es ist ein Statement
gegen das System, das schon längst das Credo
»Höher, schneller, weiter« nicht mehr nur für
Produkte, sondern auch für die eigene Person
verinnerlicht hat.
EINLEITUNG
»Finde Deine wahre Schwäche und kapituliere vor ihr. Darin liegt der Weg zum Genie.«
Moshé Feldenkrais
Niemand ist perfekt. Dieser Makel wird heutzutage allerdings nur denen verziehen, die wenigstens versuchen, perfekt zu werden. Die Selbstverbesserungspropaganda ist allgegenwärtig: Sie begegnet uns auf T-Shirts und Postkarten, in TV-Serien und auf Teebeuteln, auf facebook, in Frauenzeitschriften und auf Werbeplakaten. Von Freunden, esoterischen Gurus, Sportartikelherstellern und von Bundesministerien werden wir angemahnt, an uns zu arbeiten. Sie alle sind sich einig: Wir sollen das Unmögliche versuchen, nicht träumen, sondern unseren Traum leben. Wer etwas auf sich hält, steht nach einer Niederlage auf und versucht es frischen Mutes noch einmal. Um nicht zurückzufallen, lernen wir jeden Tag dazu und wagen das Neue. Schon Kinder werden früh zur Selbstoptimierung angehalten. Denn je eher man ihre Talente entdeckt, desto gezielter kann man sie fördern.
Doch sobald man seine eigene Verbesserung in Angriff nimmt, stellt man fest, dass es nicht gerade wenig ist, was einen vom perfekten Selbst trennt. So vieles an uns scheint verbesserungswürdig: unser Körper, unsere berufliche Situation, unser Charakter, unsere Beziehungen und unser Liebesleben. In den Buchhandlungen sind der Selbstoptimierung inzwischen ganze Abteilungen gewidmet, und an dem Angebot an Ratgebern lässt sich das Pensum ablesen, das man als fortschrittlicher Mensch abzuarbeiten hat. Wir sollen abnehmen und Sport treiben, gesünder essen, unsere Kommunikationsfähigkeit entwickeln, mehr Erfolg im Beruf haben, Weinkenner werden, leidenschaftlicher lieben, gelassener mit unseren Kindern umgehen, unsere Chakren öffnen, glücklich und zufrieden sein, uns bilden und kreativer leben – und wenn uns das alles überfordert, dann kaufen wir uns einen Ratgeber, in dem uns verraten wird, wie wir unsere Work-Life-Balance wiederherstellen.
Unser Leben ist das einzige, das uns zur Verfügung steht, da scheint es ganz natürlich, dass wir alles daran setzen, möglichst viel daraus zu machen. Aber aus der Freiheit, sein Leben zu gestalten, ist längst ein Zwang geworden. Für jede Chance, die man nicht ergreift, muss man sich rechtfertigen. Viele Menschen tragen lebenslänglich eine Last in Form Hunderter unerledigter Selbstverbesserungsprojekte mit sich herum und glauben, erst glücklich sein zu dürfen, wenn sie dünn, reich, ausgeglichen und klug sind. Und mit jedem Tag, an dem sie nicht ihr Bestes geben, haben sie das Gefühl, gegenüber dem, was sie theoretisch erreichen könnten, ins Hintertreffen zu geraten.
In der heutigen Anfeuerungs- und Ermutigungskultur traut man sich kaum zuzugeben, dass man zu den Menschen gehört, die selten das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Nicht einmal seinen besten Freunden darf man sagen, dass man schon wieder, trotz fester Vorsätze, die Diät abgebrochen, den Sport hingeschmissen, die neue Stelle nicht gesucht hat. Man verschweigt lieber, dass man neulich wider besseres Wissen seinen Partner angeschrien hat, statt gewaltfrei mit ihm zu kommunizieren. Denn die Freunde werden kein Verständnis mehr haben, wenn man unter sich, unter seinem unerträglichen Partner und unter dem langweiligen Job leidet: Wer nicht an sich arbeitet, hat das Mitgefühl anderer nicht verdient!
Du kannst die Welt nicht ändern, du kannst nur dich ändern – den Wahrheitsgehalt dieser These zweifelt selten jemand an. Doch wenn sie stimmt, wie ist es dann zu erklären, dass sich die hundertste Anleitung zum Glücklichsein genauso erfolgreich verkauft wie die erste. Dass Diätbücher immer noch der Renner sind. Dass Millionen von Menschen Biografien verschlingen, denen zufolge man sich seine Träume erfüllen kann, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Und wer trotz aufrichtigem Bemühen bei seiner Selbstverbesserung nur langsam vorankommt, kann unter Dutzenden von Ratgebern auswählen, die ihm verraten, wie man das Universum zu Hilfe ruft.
Es gibt Augenblicke im Leben, in denen wird uns bewusst: Bereits seit Jahren und völlig vergeblich bekämpfen wir unsere größten Schwächen und sind weiter denn je von unserem Traumkörper, dem Traumpartner oder dem Traumjob entfernt. Dass auch andere an dem utopischen Projekt der Selbstoptimierung scheitern, wird ausgeblendet. Anstatt uns in diesen Momenten einzugestehen, dass wir unsere Macht zur Selbstgestaltung überschätzen, reden wir uns lieber ein, wir seien gerade besonders faul und undiszipliniert, um uns anschließend vorzunehmen, uns noch mehr anzustrengen, diese ungeliebten Charaktereigenschaften zu überwinden. Wir ignorieren unsere Widerstände und Selbstzweifel, die doch so wertvolle Hinweise darauf sein könnten, was uns wirklich Spaß machen würde. Stattdessen nehmen wir jeden Tag aufs Neue den zähen Kampf gegen unser unperfektes Ich wieder auf.
Aber was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn wir so blieben, wie wir sind? Könnten wir unsere Zeit nicht in angenehmere Dinge investieren als in unsere unerfreuliche Selbstverbesserung?
Auf den folgenden Seiten habe ich versucht – gegen den allgemeinen Trend –, ein Plädoyer für das konzeptionslose Dahinleben zu entwerfen, weil ich glaube, dass der konzeptionslose gegenüber dem minutiös durchgeplanten Lebensweg unbestreitbare Vorteile hat. Es droht nämlich durchaus nicht gleich das soziale Abseits, wenn man Gelegenheiten ergreift, anstatt Ziele zu verfolgen, und wenn man nur lernt, wo es unbedingt erforderlich ist. Kurz: Wenn man das Leben anfängt, bevor man perfekt ist.
Auf dem Weg, ein besserer Mensch zu werden, steht uns niemand anderes im Weg als wir selbst. So lautet ein weiterer beliebter Motivationsspruch. Und das ist ein Glück: Da es bei den meisten unserer Selbstverbesserungsprojekte darum geht, sich zu normieren, rettet uns unsere Faulheit und Mutlosigkeit davor, ein angepasster Mensch zu werden. Wer die allseits angeforderte Selbstoptimierung ablehnt, erkämpft sich sein Recht, so zu sein, wie er gerade ist. Er macht sich unabhängig von dem Trugbild seines besseren Selbst und von all den Menschen, die angeblich wissen, wie man es erreicht.
Und sollte doch mal wieder einer dieser Selbstverbesserungsgurus den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag an uns herantragen, dann kann man ihm mit einem ganz schlichten Argument den Wind aus den Segeln nehmen: Wer besser werden will, hat’s nötig!
1BLEIBEN SIE DICK, EITEL, GIERIG, JÄHZORNIG – UND GLAUBWÜRDIG
VOM MÄRCHEN DER PERMANENTEN WEITERENTWICKLUNG
»Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann, oft unter gewaltigen Opfern, für sein Leben hält.«
Max Frisch
Andere sind alkohol- oder fernsehsüchtig, rauchen schachtelweise Zigaretten, essen Schokolade oder haben zu viel Sex. Ich war süchtig nach Lebensläufen. Es war ein regelrechter Zwang. Wann immer ich sie in die Hand bekam, studierte ich sie genau: die Lebenswege erfolgreicher Menschen, bekannter Künstler, Sportlerinnen, Forscher, Tänzer, Schauspielerinnen, Architekten, Regisseure, Weltumsegler, Schriftsteller. Wann haben sie angefangen zu üben, zu schreiben, zu tanzen, zu entwerfen oder zu segeln? Wie lange dauerte es, bis sie damit berühmt wurden? Wann haben sie sich entschieden, sich dieser einen Sache zu widmen? Mussten sie dafür ihr altes Leben hinwerfen und ein neues beginnen? Wichtigste Frage dabei: Kann ich das auch noch schaffen? Wird es möglich sein – wenn ich gleich heute anfange –, das Ruder herumzureißen und doch noch etwas aus meinem Leben zu machen?
Je älter ich wurde, desto schwieriger wurde es, Lebensläufe zu finden, die ich mit meinem Werdegang vergleichen konnte: Viten von Balletttänzern und Orchestermusikerinnen, die mit drei oder vier Jahren das erste Mal ihr Instrument in der Hand gehalten oder die ersten Tanzschritte geprobt hatten, wurden sofort aussortiert. Das war für mich sowieso nicht mehr aufzuholen, denn ich habe als Kind keinen Tanz- oder Musikunterricht gehabt, und auch sonst gab es nichts, was ich als Kind schon gerne getan hätte und an dem sich in der Gegenwart nahtlos anknüpfen ließe.
Irgendwann war ich in dem Alter, in dem die erste Karriere vieler Menschen schon wieder zu Ende ist. Die Lebensläufe, die mir geben konnten, wonach ich suchte, waren echte Raritäten. Existierten Menschen, die vielleicht erst mit 28 Jahren ihre wahre Bestimmung gefunden hatten und dann umso schneller durchgestartet waren? Wie hießen sie, was machten sie heute, wann konnte man Interviews mit ihnen im Radio hören, in denen sie schildern, wie sie rückblickend begreifen, dass ihr Erfolg ohne die Brüche in ihrer Biografie nicht denkbar wäre.
Ich dürstete danach, von Frauen und Männern zu lesen, die den Mut gehabt hatten, mit Mitte vierzig oder fünfzig ihre Träume zu verwirklichen. Auch ich würde hart arbeiten, wenn sich ein lohnendes Ziel gefunden hätte. Ich war bereit, den ersten Schritt zu tun, wenn ich die Gewissheit hätte, dass der Weg Schritt für Schritt in die richtige Richtung führte. Aber bis zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als sei ich nur wahllos auf einem Acker neben meinem eigentlichen Lebensweg herumgetrampelt, und diese Tatsache machte mich traurig und verzweifelt.
Wie hatte das passieren können, einem Menschen wie mir, mit so vielen Talenten und Möglichkeiten, wie mir zeit meines Lebens von Lehrern, Eltern und Freunden versichert wurde. So viele Chancen warteten auf mich, warum ergriff ich sie nicht?
Ich muss meine Talente nutzen – aber wie?
Zehn Jahre Aufschub verschafften mir die Erkenntnis, dass wir eine durchschnittlich zehn Jahre höhere Lebenserwartung haben als vorangegangene Generationen, ich also getrost bei allen Angaben ein ganzes Jahrzehnt dazuzählen durfte. Hatte ich die Biografie einer Frau entdeckt, die im Jahr 1960 im reifen Alter von 32 Jahren ihren Traummann gefunden hatte, mit ihm gemeinsam nach Rio ausgewandert war und dort eine Tanzschule und eine Familie gegründet hatte, dann konnte man guten Gewissens behaupten, dass sie nach heutiger Rechnung ungefähr 42 Jahre alt gewesen war – also in meinem Alter.
Bald musste ich mir eingestehen, dass für Menschen wie mich nur noch eine überraschende Karriere möglich war. Nur ein ungewöhnliches Ereignis würde aus meinem Leben noch eine Erfolgsgeschichte machen.
Viele Menschen warten insgeheim darauf, dass etwas passiert, was ihrem Dasein eine entscheidende Wendung gibt. Ein Einfall oder eine Begegnung, der oder die sie plötzlich ihr Leben unter ganz neuen Gesichtspunkten sehen lässt, sodass, was ihnen bisher willkürlich und unzusammenhängend erschien, mit einem Mal Struktur erhält. Dieses Ereignis wäre wie ein schon verloren geglaubtes Puzzlestück, das, kaum an seinen Platz gesetzt, die Vergangenheit ordnet, sodass sich die Zukunft wie ein roter Teppich vor einem ausrollt: Man braucht nur noch dieser Spur zu folgen.
In Zukunft wird alles besser, aber wann fängt sie an?
Bis es so weit ist, kommt es uns so vor, als befänden wir uns im »falschen« Leben. Einzige Hoffnung dabei: Das wirkliche Leben möge bald beginnen.
Wer das falsche Leben lebt, hat ein latent schlechtes Gewissen, ganz gleich, was er tut – ob er gerade arbeitet, Urlaub macht, fernsieht, im Internet surft, raucht, isst, liebt oder schläft. Das richtige Leben würde sich anders anfühlen, im wirklichen Leben würde sich eins zum anderen fügen, und alles würde einem leicht von der Hand gehen. Wir wären erfolgreich, aktiv und gesund, beliebt und mit dem richtigen Partner zusammen. Und viel glücklicher und zufriedener als in diesem falschen Leben.
Ein wirkliches Leben ist eines, das gelingt, wo wir also die Zeit, die uns gegeben ist, dazu nutzen, aus unseren Talenten und Möglichkeiten das Beste zu machen. Wir haben die Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten; ein seltenes Privileg, um das uns viele Menschen beneiden.
Dieses falsche Leben ist noch viel falscher als das »falsche Leben«, von dem der Philosoph Theodor W. Adorno spricht und damit die Situation des Menschen in der modernen Warenwelt meint. In diesem modernen Leben sei es, so Adorno, unmöglich, privat so zu leben, wie es den eigenen Überzeugungen entspräche. Man werde, ob man wolle oder nicht, Teil des Systems und könne zum Beispiel wenig Einfluss darauf nehmen, wie seiner eigenen Meinung nach mit den natürlichen Ressourcen umzugehen sei. Bei Adorno gibt es also noch ein Richtig und Falsch. Das Richtige ist man theoretisch selbst und das Falsche, das sind die Bedingungen. Glücklich, wer so empfindet, denn der hat eine Ausrede zur Hand, was die eigene, fahrige Lebensplanung betrifft.
Wir haben die Freiheit, unser Leben zu gestalten, also haben wir auch die Pflicht, es zu tun.
Alle anderen haben Schuldgefühle, weil sie aus verschiedenen Gründen nicht alles aus ihren Möglichkeiten herausholen. Ständig befindet man sich im Rechtfertigungsmodus: Eigentlich könnten wir mehr aus uns machen, wenn wir uns ein klein wenig mehr anstrengen würden, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, regelmäßig zum Yoga zu gehen, um ausgeglichener zu werden, und eigentlich wollten wir uns nach einem neuen Job umsehen, denn der alte macht uns schon lange keinen Spaß mehr. Eigentlich sind wir nicht dick, denn wir werden demnächst abnehmen und regelmäßig ins Fitnessstudio gehen usw. Wer ein richtiges Leben führen möchte, hat viel zu tun. Aber weil wir gar nicht genau wissen, was denn das richtige Leben für uns ist, können wir uns nicht entschließen, endlich all das, was uns in der Theorie gut und richtig vorkommt, in Angriff zu nehmen.
Aber eines wissen wir ganz sicher: Eigentlich sind wir nicht die Person, die wir gerade sind, sondern die, die wir sein könnten! Dieser Person, die wir sein könnten, sind wir etwas schuldig – und wir versündigen uns gegen sie mit jedem Tag, an dem wir nicht unser Bestes geben oder es zumindest versuchen.
Eigentlich bin ich dünn – ich muss nur noch abnehmen.
An die Erforschung der Ursachen, warum wir nicht das tun, was wir uns vorgenommen haben, verschwenden wir einen Großteil unserer Lebenszeit. Wir durchforsten unsere Kindheit und die Kindheit unserer Eltern nach Hinweisen darauf, woran es liegen könnte, dass es uns so schwerfällt, uns aufzuraffen und zusammenzureißen. Wir wühlen in unserem Seelenleben, um unserem Neid, unserer Disziplinlosigkeit und unserer Ungeduld auf den Grund zu gehen. In Mußestunden, die wir eigentlich genießen sollten, rätseln wir herum, was die geheimnisvolle Ursache unserer Traurigkeit und Lustlosigkeit sein könnte. Von dieser Tätigkeit lassen wir uns auch nicht durch die offensichtliche Tatsache abhalten, dass es anderen ganz genauso geht. (Nicht umsonst sind Bücher über Glück und Lebenskunst Megabestseller.)
Besonders an Silvester wird Rechenschaft abgelegt und Bilanz gezogen, deswegen ist es für viele Menschen der schlimmste Tag des Jahres.
Je länger wir dieses »falsche« Leben führen, desto mehr unperfekte Vergangenheit entsteht, die wir in der Zukunft wieder wettmachen müssen. Die versäumten Gelegenheiten türmen sich neben unseren Um- und Holzwegen, und es wird immer schwieriger, einen Schlachtplan zu entwerfen, mit dem sich die eigene Vita noch logisch zu Ende erzählen ließe.
Erleichterung und Atempausen von diesem »Vita-Terror« verschaffen uns nur die Situationen, in denen unser Handlungsspielraum auf null zusammenschnurrt, wie es zum Beispiel bei Katastrophen der Fall ist. Wenn eine Innenstadt unter Wasser steht und jeder weiß, was zu tun ist. Wenn Leben und Gegenstände gerettet werden müssen, dann darf man sich für eine kurze Weile als sinnvolles Mitglied der Gemeinschaft empfinden, ohne das Gefühl zu haben, schon wieder seine Zeit zu verschwenden.
An der Kluft zwischen dem »falschen« und dem »wirklichen« Leben leiden wir. Aber das »wirkliche« Leben ist ein merkwürdiges Trugbild: Sobald man sich ihm nähert, weicht es vor einem zurück. Nicht selten vergehen Jahre, bis man es schafft, einen festen Vorsatz in die Tat umzusetzen; und hat man sich dann endlich im Fitnessstudio oder beim Salsa-Kurs angemeldet, beginnt zu joggen oder schreibt an der Drehbuchidee, die man seit einer Ewigkeit mit sich herumträgt, oder sitzt allein auf einer Insel, so wie man es sich schon lange vorgenommen hat, überfällt einen prompt die Frage: Was hat das mit mir zu tun? Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, dass mir das Spaß machen könnte?
Irgendwann dämmert es uns: Unser »falsches« Leben ist echt. Es ist wirr und ungeplant, es gefällt uns nicht, und außerdem haben wir uns das alles ganz anders vorgestellt, aber wir erleben es gerade und es ist auch nicht zu stoppen. Aber wider besseres Wissen halten wir an der Vorstellung vom »wirklichen oder echten« Leben fest. Es ist unsere einzige Hoffnung.
»Singen, Malen, Bücher schreiben –es ist nie zu spät, noch einmal richtig loszulegen.«
Titelthema der Frauenzeitschrift »Laviva« im Oktober 2011
Es gilt, eine Kluft zu überbrücken zwischen der Person, die wir jetzt gerade sind, und der, die wir in Zukunft sein könnten. Daher werden wir zum Erklärungskünstler und Geschichtenerzähler. Wir erklären unseren Status quo, wie es dazu gekommen ist und was wir bald alles anders machen werden. Der Schmerz, nicht derjenige zu sein, der wir sein könnten, ist ungeheuer inspirierend, und so erzählen wir jedem, der es hören will, das Märchen von unserem besseren Selbst. Wir fühlen uns wie das schlafende Dornröschen, welches vom richtigen Prinzen mit einem Kuss zum »wirklichen« Leben erweckt werden will – ärgerlich ist, dass wir nicht in einem gläsernen Sarg konserviert werden, bis es so weit ist.
Bis das wirkliche Leben beginnt, können Sie 100 Jahre warten.
UNSER LEBEN: EINE UNPERFEKTE GESCHICHTE
Immer, wenn wir etwas erzählen, was uns gerade eben oder schon vor Jahren passiert ist, erzählen wir dies in Form einer Geschichte. Diese Geschichten über unser Leben räumen Unwichtiges beiseite, sie geben dem Chaos aus unseren Irrtümern, versäumten Gelegenheiten, ungenutzten Chancen, kaputten Beziehungen usw. einen sinnvollen Zusammenhang und uns eine Bestimmung. Ohne sinnvolle Zusammenhänge kann man nicht erzählen.
Zufälle glücklicher und unglücklicher Art, Begegnungen und erzwungene Gemeinschaften prägen das Leben mehr, als einem lieb ist. Wer kann sagen, ob es richtig war, sich für das eine Studium und gegen das andere zu entscheiden? Und wer weiß, wie sich die Dinge für einen entwickelt hätten, wenn man mehr dafür gelernt und nicht so viel Party gemacht hätte? Was wäre aus einem geworden, wenn die Eltern einen als Jugendlichen ins Ausland geschickt oder einem den Schauspielunterricht bezahlt hätten, oder wenn man mit Anfang zwanzig nicht so schüchtern und unsicher gewesen wäre. Vieles lässt sich naturgemäß erst in der Rückschau beurteilen, manches noch nicht einmal dann.
Wie sich aus einem zufälligen Ereignis eine Lebensgeschichte konstruieren lässt, illustriert folgendes Fallbeispiel:
Ein freiberuflich tätiger Mann, Mitte vierzig, kämpft zeit seines Lebens ohne besonderen Erfolg gegen seine Unpünktlichkeit. Schon als Kind kam er ständig zu spät zur Schule, obwohl seine Eltern darauf achteten, dass er jeden Morgen rechtzeitig das Haus verließ. Auch zu privaten Verabredungen war er selten pünktlich, was ihn manche Freundschaft kostete. Als junger Mann verpasste er – im wahrsten Sinne des Wortes – die Frau seiner Träume. Abgehetzt und durchgeschwitzt erschien er zu spät bei Bewerbungsgesprächen. Er verlor Jobs, verärgerte Fremde und Bekannte, versäumte Züge und Gelegenheiten.
Eines Tages muss er für einen Auftrag nach Mallorca fliegen. Er steht sehr früh auf, verlässt das Haus später, als er geplant hat, die U-Bahn fällt aus, das Taxi bleibt im Stau stecken, kurzum, als unser Mann am Flughafen erscheint, ist sein Flugzeug schon weg. Unglücklich kehrt er nach Hause zurück, wo er am Abend die Nachrichten schaut und erfährt, dass die Maschine, die er am Morgen verpasst hat, abgestürzt ist.
Dieses zufällige Ereignis kommt unserem Mann natürlich ganz und gar nicht zufällig vor. Das Unglück versöhnt ihn von einer Sekunde auf die andere mit seinem Schicksal: Seine so erfolglos bekämpfte Unpünktlichkeit, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt wie ein Fluch vorgekommen war, wird auf einmal zum Segen, denn sie rettete ihm im entscheidenden Moment das Leben.
Die nachträgliche Deutung des Ereignisses ist jedoch nicht das Ereignis selbst. Es ist eine gute, logische und interessante Geschichte, aber eine Geschichte. Denn der Flugzeugabsturz hat nichts mit der lebenslangen Unpünktlichkeit unseres Mannes zu tun.
Die Geschichten, die wir über uns erzählen, haben ein Janusgesicht: Weil sie unsere Schwächen und Stärken rechtfertigen, nehmen sie uns genau aus diesem Grund in Geiselhaft.
Was ist damit gemeint? Das bedeutet, dass ich die Geschichte, die ich mir selbst und anderen als meine Biografie präsentiere, auch bis zum bitteren Ende leben muss. Ich kann nicht einfach heute aus dem aussteigen, was ich gestern noch meinen Freunden als die »Wahrheit« über mich selbst verkauft habe.
Man kann die Wahrheit nicht erzählen. Die Wahrheit ist keine Geschichte. Alle Geschichten sind erfunden, Spiele der Einbildung.
Max Frisch
Die meisten Menschen wissen, wie es sich anfühlt, wenn die eigene »Wahrheit« einem jeden weiteren Schritt unmöglich macht. Eine sehr weit verbreitete Einschätzung der eigenen Persönlichkeit lautet: Mir fällt es schwer, Dinge, die ich einmal angefangen habe, zu Ende zu bringen. Viele meinen, dies als besonders spezifisch für den eigenen Charakter erkannt zu haben, und sind nun ein Leben lang damit beschäftigt, sich von diesem Fluch zu befreien. Vielleicht wurde es uns auch von Eltern und Lehrern gesagt, und wir haben ihnen geglaubt, doch ganz gleich, ob wir selbst zu dieser Einschätzung gekommen sind oder ob wir sie übernommen haben: dass diese Geschichte unfrei macht, liegt auf der Hand.
Wer diese Geschichte über sich für wahr hält, kann nicht eine gerade begonnene Ausbildung abbrechen oder einen Job kündigen, der ihm nicht liegt, einen Tanzworkshop, der keinen Spaß mehr macht, sausen lassen oder ein Englischlehrbuch früher als geplant beiseitelegen, ohne von Gewissensqualen gefoltert zu werden.
Fehler, die wir an uns bekämpfen, bestimmen unser Leben.
Die meisten Beschreibungen unseres Charakters sind der Erwartungshaltung unserer Umwelt geschuldet. Wir wollen uns rechtfertigen, warum wir nicht das tun, was von uns verlangt wird, zum Beispiel mehr zu arbeiten und unsere Sexualpartner zu lieben. Wir meinen sogar, dass die Erwartungen der Umwelt berechtigt sind, deswegen sagen wir auch nicht: »Dazu habe ich keine Lust«, oder schlicht und einfach: »Das liegt mir nicht«, sondern wühlen in unserer Vergangenheit nach Gründen, die uns moralisch entlasten: Vielleicht bin ich ja nur so träge, weil ich nicht an mich glaube. Und dass ich nicht an mich glaube, ist die Schuld meiner Eltern, denn sie haben mich als Kind nicht genug gelobt.
Eine andere, sehr weit verbreitete Rechtfertigungsgeschichte lautet: Ich liebe meinen Partner nicht, weil ich selbst nie geliebt worden bin und daher erst lernen muss, mich selbst zu lieben.
Dass man sich damit den Blick auf den wahren Charakter seines Partners verstellt, wird in Kauf genommen.
Es ist anstrengend, ständig das Beste aus sich und seinem Leben machen zu müssen.
Aber wer so empfindet, mit dem stimmt etwas nicht: Andere betrachten ihr Leben als Herausforderung und gehen mit Freude an die Arbeit, nur wir nicht. Nur wir stopfen das Essen so lieblos in uns hinein, sitzen am liebsten auf dem Sofa, haben keine Lust, ein Musikinstrument zu erlernen, interessieren uns weder für Kunst und Literatur noch für irgendetwas anderes und können die meisten Menschen nicht ausstehen. Nur wir bleiben mit einem Partner zusammen, den wir nicht lieben. Wir werden misstrauisch gegenüber unseren Wünschen und Bedürfnissen, machen sie zu Schwächen und Fehlern. Das nennt man Selbsterkenntnis, und Selbsterkenntnis ist ja angeblich der erste Schritt zur Besserung.
Doch die entdeckten Charakterfehler entwickeln ein Eigenleben, und wie im Märchen werden sie zum Bann, in den man sich immer tiefer verstrickt, je stärker man versucht, ihm zu entkommen.
Manche dichten sich lieber einen Charakterfehler an, statt zu sagen: »Dazu habe ich keine Lust«, oder: »Den Idioten kann ich nicht ausstehen«.
Dass eine Biografie in dem Moment entsteht, in dem man sie erzählt, beschreibt der Philosoph und Pädagoge Professor Jürgen Henningsen in seinem Aufsatz Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte – Max Frisch und die Autobiografie.
Was an einer Lebensgeschichte stimme, seien lediglich die Rahmendaten, alles andere sei Interpretation. Meistens weiß der Interpret nichts davon, dass er der Erfinder seiner Geschichte ist, kommt sie ihm doch so logisch und überzeugend vor, dass er sie für sein Leben hält.
Als Beispiel für seine These zitiert Jürgen Henningsen Passagen aus der Autobiografie The Education of Henry Adams, in denen der amerikanische Historiker Henry Adams (1838 – 1918) ein bestimmtes Ereignis in seiner Kindheit zum Schlüsselerlebnis erklärt, welches seiner Meinung nach seine Persönlichkeit und seinen Werdegang geprägt hat:
Henry Adams, dessen Urgroßvater John Adams und Großvater John Quincy Adams Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen waren, schildert in seiner Autobiografie, wie er im Alter von vier Jahren an Scharlach erkrankte. Im Winter 1842 wird der kranke Henry in Leinentücher gewickelt von einem Haus in ein anderes getragen. Der erwachsene Henry schreibt sechzig Jahre später, dass er den heftigen Schmerz unter den Tüchern, den er durch den Luftmangel verspürte, und den Lärm des Möbelrückens nie vergessen konnte. Es sei diese Krankheit gewesen, welche ihn untüchtig für den Erfolg gemacht habe. Zunächst sei die Beeinträchtigung nur eine körperliche gewesen, so blieb er im Wachstum um sechs bis acht Zentimeter hinter seinen Brüdern zurück. Aber auch sein Charakter und seine geistigen Fortschritte schienen an dieser Schwächlichkeit teilgehabt zu haben. Henry Adams vermutet: Seine zarten Nerven, seine Gewohnheit zu zweifeln und seine Scheu vor der Verantwortung sind auf seine Kinderkrankheit zurückzuführen.
Jürgen Henningsen betont noch einmal, dass nicht die Krankheit als solche, als factum brutum, sondern die Art und Weise ihrer sprachlich-geistigen Verarbeitung für besagte »Veränderung« des Charakters ursächlich ist. Henry Adams versucht, sich und seinen Lesern zu erklären, warum er der geworden ist, der er ist. Doch worum geht es ihm in seiner Autobiografie wirklich?
Tatsächlich ist die Lebensgeschichte, so wie sie uns Henry Adams erzählt, eine Rechtfertigung dafür, nicht Präsident der Vereinigten Staaten geworden zu sein. Irgendwie wurde das in seiner Umgebung von ihm erwartet – sonst müsste er nicht seinen sehr erfolgreichen Werdegang als Historiker und Schriftsteller mit seinen schwachen Nerven und seiner schwächlichen Konstitution rechtfertigen. Entstammte er einer armen Bergarbeiterfamilie, in der kaum einer seiner Vorfahren lesen und schreiben gelernt hatte, hätte er uns seine Lebensgeschichte ganz anders erzählt! Trotz Scharlach.
EINE WOCHE NICHT MEHR RECHTFERTIGEN
Wir haben Angst, abgelehnt zu werden, wenn wir bestimmten Kriterien nicht entsprechen. Durch Geschichten, mit denen wir uns rechtfertigen, signalisieren wir wenigstens unsere Bereitschaft, nach dem Motto: Ich würde so gerne tun, was du von mir verlangst, aber dieses oder jenes hindert mich daran. Ich habe das als Kind nie gelernt; ein Trauma hat zu meinem Fehlverhalten geführt; ich bin überarbeitet, es tut mir so leid; ich habe das vorher nicht gewusst, jetzt habe ich eingesehen, dass ich mich ändern und an mir arbeiten muss, vielleicht eine Therapie oder ein Selbsterfahrungskurs . . .?
Ängste kann man abbauen, indem man ihnen begegnet: Sagen Sie also nächstes Mal in Situationen, in denen man von Ihnen etwas verlangt, einfach nur: »Dazu habe ich keine Lust«, oder »Mach doch selber« oder »Gute Idee, aber für mich zu anstrengend.« Beobachten Sie, wie sehr diese Weigerung, sich zu rechtfertigen, Ihr Gegenüber ärgert. Wachsen Sie daran.
Typische Erwartungen, die von unserer Umgebung an uns gestellt werden und denen Sie sich in Zukunft verweigern könnten:
Warum verdienst du nicht mehr Geld?
Sei doch mal romantischer!
Du hattest dir doch vorgenommen, abzunehmen und mehr Sport zu machen.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du Kinder hast?
Statt immer nur vor dem Computer zu hängen, könntest du auch mal ein Buch lesen.
Glaubst du, alles dreht sich immer nur um dich?
Weißt du eigentlich, dass sich Müll nicht von selber runterträgt und Einkäufe nicht durchs Fenster in den Kühlschrank fliegen?
Hörst du mir eigentlich zu?
Warum lässt du dir das alles gefallen?
Du musst nicht jeden verachten, nur weil er dich langweilt, auch gewöhnliche Leute können nett sein.
Meine Eltern sind auch Menschen.
Man erlebt sich meistens nur dann als Erfinder seiner Rechtfertigungsgeschichte, wenn es einem partout nicht gelingt, sich etwas Überzeugendes auszudenken: Ich beneide Henry Adams, ich hatte nämlich als Kind keinen Scharlach, dabei hätte ich den gut gebrauchen können. Ich war als Schulkind sehr unsportlich und wurde damit von meinen Mitschülern, aber auch von meinen Eltern aufgezogen. Ich litt darunter, zumal ich es nicht ändern konnte. Die Coolness zu sagen, dass mir der blöde Sport keinen Spaß machte, hatte ich als Vierzehnjährige nicht. Deswegen wünschte ich mir sehnlich, dass unser Hausarzt beim nächsten Besuch eine Krankheit bei mir entdecken würde, welche meine sportlichen Leistungen in einem ganz anderen Licht erscheinen ließe. Ich malte mir aus, wie ich mit meinen Eltern im Sprechzimmer sitze und der Arzt meinen Eltern mitteilt, dass ich an der seltenen Krankheit XY leide und er sich frage, wie ich mich in dieser Verfassung überhaupt auf den Beinen halten könne. In diesem Augenblick würde meine mangelnde sportliche Performance zu einer körperlichen Höchstleistung aufsteigen. Die Krankheit würde mich ein für alle Mal vom Sportunterricht befreien, ich dürfte auf der Bank sitzen und lesen, Mitschüler würden sich bei mir entschuldigen, dass sie mich immer als Letzte in die Hockeymannschaft gewählt haben, und meine Eltern müssten mich zu Hause bedienen.
Glücklicherweise brach keine Krankheit bei mir aus, die meine Unsportlichkeit hätte entschuldigen können, denn aus seiner eigenen Geschichte wieder auszusteigen, ist sehr schwierig. Am Anfang genießt man die Vorteile, doch irgendwann kommen auch die Nachteile. Entweder bleibt man länger krank, als einem lieb ist, oder man simuliert und muss fürchten, dass die Sache irgendwann auffliegt.
Ein anderes Ich, das ist kostspieliger als der Verlust einer vollen Brieftasche, versteht sich. Er müsste die ganze Geschichte seines Lebens aufgeben, alle Vorkommnisse noch einmal erleben, und zwar anders, sodass sie nicht mehr zu seinem Ich passen.
Max Frisch, »Mein Name sei Gantenbein«
Dabei wäre es doch vielleicht möglich, dass nicht nur die Rechtfertigung in Form der Krankheit in sich zusammenfällt, sondern die angebliche Unsportlichkeit gleich mit.
Auf jeden Fall lassen sich die eigenen Schwächen auch durch die beste Geschichte nicht in den Griff bekommen. Man glaubt zwar, durch die Erklärungen wieder Kontrolle über sein Leben erlangt zu haben, muss aber bald feststellen, dass dies ein Irrtum ist: Wie gut man seine Charakterschwächen auch analysiert und begründet, ändern lassen sie sich dadurch noch lange nicht! Sie scheinen durch die Erforschung sogar noch ins Unermessliche zu wachsen.
Max Frisch, der sich in seinem Werk mit dem Thema Selbstüberwindung beschäftigt hat, ist mit einer Figur berühmt geworden, der es nicht mehr gelingt, sich mit ihrer Lebensgeschichte zu identifizieren: Der Bildhauer Anatol Ludwig Stiller will das Leben, das er und seine Frau Julika führen, nicht mehr weiterleben und flieht aus seiner Schweizer Heimat in die USA. Nach zwei Jahren kommt er zurück und sagt, als er bei seiner Einreise in die Schweiz verhaftet wird: »Ich bin nicht Stiller.«
Doch Stiller wird von seiner Umgebung dazu überredet, zu seinem alten Leben zurückzukehren, und natürlich ist bald alles zwischen ihm und seiner Frau so unglücklich und verfahren wie zuvor. Julika konnte ihren egozentrischen Mann nie verstehen und kann es auch jetzt nicht. Stiller glaubt, Julika nicht lieben zu können, und fühlt sich ihr gegenüber dadurch permanent im Unrecht. Beide bemühen sich, den anderen zu verstehen, doch ihr Bemühen ist zum Scheitern verurteilt. Am Schluss kommt es genau zu der Katastrophe, die Stiller eigentlich durch seine Weigerung, Stiller zu sein, vermeiden wollte: Als seine Frau Julika an Tuberkulose erkrankt und operiert werden muss, schafft Stiller es nicht, sie im Krankenhaus zu besuchen, und sie stirbt ganz allein.
Freiheit ist vor allen Dingen die Freiheit vor der eigenen Geschichte.
Die Figur des Bildhauers Stiller verkörpert die tiefe Angst, keine Macht über sich selbst und das eigene Schicksal zu haben. Manchmal ahnt man, dass man mit dem Versuch, sich selbst zu verbessern, seine Lebenszeit verschwendet. Hellsichtige Momente, die sehr schmerzhaft sind, denn gleichzeitig ist man davon überzeugt, dass das Leben nur lebenswert ist, wenn man diesen einen Makel oder diese eine Schwäche besiegen könnte. Aber ist es das wirklich?
Es ist eine viel bemühte literarische These, dass jeder Versuch, sich zu überwinden, etwas Tragisches hat. Und es ist ganz klar, wie diese Bücher und Filme enden: Der Protagonist entdeckt am Ende seines Lebens, dass es nicht sein Makel war, der ihn unglücklich gemacht hat, sondern einzig und allein sein lebenslanger Versuch, ihn zu bezwingen.
Es ist an der Zeit, für ganz schwere Fälle von Selbstverbesserungswahn ein Programm anzubieten, welches den Betroffenen hilft, aus ihrem absurden Bemühen auszusteigen. Ich habe einmal versuchsweise den Begrüßungstext für die Homepage dieser Aussteigerorganisation geschrieben. Dafür habe ich lediglich den Text auf der Startseite von Exit – einem Aussteigerprogramm für Rechtsradikale – ein klein wenig verändert. Das Ergebnis ist nicht besonders elegant, aber es ist ja nur ein Entwurf:
Ende der Leseprobe