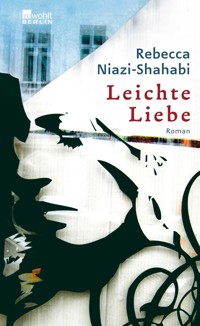Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ankerherz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Anarchisch wie ein behaarter Außerirdischer vom Planeten Melmac , charmant wie ein Lächeln von Magnum und stilsicher wie die Anzüge von Sonny Crockett Als Jungs wollten wir so männlich die Stirn runzeln können wie Colt Seavers, als Mädchen träumten wir von der Karriere einer Ballerina namens "Anna". Wir staunten über die universellen Talente des Ehepaars Jonathan und Jennifer Hart, das zwischen zwei Beischläfen ganze Mafia-Syndikate hinter Gitter brachte. Wir verpassten nie eine Folge "Cosby-Show" oder "A-Team" und ja: mancher von uns schmierte sich tatsächlich Nivea-Creme in die Haare, um so lässig auszusehen wie Remington Steele. COLT SEAVERS, ALF & ICH weckt Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend. An den Trash und den Glamour und den Quatsch der Achtzigerjahre, als die Welt auch im Fernsehen noch ein wenig übersichtlicher war. 23 ganz persönliche Geschichten über die Helden unserer Jugend. Ein Buch mit "Alf", "Anna", "Dallas", "Das A-Team", "Das Traumschiff", "Die Bären sind los", "Die Bill Cosby-Show", "Die Profis", "Drei Engel für Charlie", "Ein Colt für alle Fälle", "Eine schrecklich nette Familie", "Hart aber herzlich", "Hulk", "Kir Royal", "Knight Rider", "MacGyver", "Magnum", "Miami Vice", "Remington Steele", "Simon & Simon", "Tatort", "Teenage Mutant Hero Turtles" und "Trio mit vier Fäusten".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rebecca Niazi-Shahabi,
Titus Arnu, Anne Philippi u. a.
COLT SEAVERS, ALF & ICH
20 Autoren über die wahren
Helden unserer Jugend
COLT SEAVERS, ALF & ICH
20 Autoren über die wahren Helden unserer Jugend
EDITION CAMPFIRE
Originalausgabe
April 2014
Alle Rechte vorbehalten.
© 2014 by Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt
Texte: Reimund Abel, Titus Arnu, Iris Bahr, Volker Bleeck, Simone Buchholz, Detlef Dreßlein, Jenny Hoch, Timon Karl Kaleyta, Steffi Kammerer, Stefan Krücken, Christian Löer, Karin Michalke, Anna Mielke, Rebecca Niazi-Shahabi, Anne Philippi, Okka Rohd, Bastian Schlange, Ulli Tückmantel, Birgit Weidt, Takis Würger
Herausgeber: Philip Laubach-Kiani, Dohren
Übersetzung aus dem Englischen: Andrea O’Brien („Undercover in Pastell“ von Iris Bahr, S. 26-33)
Umschlaggestaltung, Illustrationen und Satz: Henning Weskamp, Hamburg
Reihengestaltung: Ana Lessing, Berlin
Herstellung: Sieveking Agentur für Kommunikation, München
eBook: Max Dombrowski, Berlin
BILL COSBYS FAMILIENBANDE / DIE BILL COSBY-SHOW > 201 FOLGEN > USA 1984–1992 > ZDF 1987–1990 > SO 15.50–16.20 UHR
BILL COSBY UND DIE SCHNEEHASEN MEINES OPAS
Auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher von Opa Arnu laufen lange nur Western und Gangsterfilme. Erst bei den vier Enkelkindern wechselt das Programm – und Titus Arnu zieht von nun an einmal die Woche bei den Cosbys ein.
Mein Opa war das, was man gemeinhin einen einfachen Mann nennt. Er war Bergmann im Saarland, musste in beiden Weltkriegen Schützengräben ausheben und arbeitete für sein Leben gern im Garten. Er hatte kein Abitur, dafür kannte er sich mit dem Veredeln von Rosen aus. Er hatte immer ein Taschenmesser dabei, mit dem er Sachen aus Holz schnitzte, ein Schiff, ein Tier oder ein Wasserrad. Ich mochte ihn sehr. Er sagte gerne lustige Gedichte in saarländischer Mundart auf, spielte Mundharmonika und sang oft Volkslieder. In seinem Gartenhäuschen stapelten sich Hunderte von Western-Romanen. Dort saß er am liebsten, paffte Zigarren der Marke „Schneehase“, summte vor sich hin und las stundenlang.
Am zweitliebsten saß er in seinem Wohnzimmer und schaute fern. Er hatte einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem ausschließlich Western und Gangsterfilme liefen. Wenn etwas anderes kam, schimpfte er über die unfähigen Idioten beim Fernsehen und schaltete aus. Unser Opa besuchte uns öfters mal und blieb für mehrere Wochen, immer hatte er einen Koffer voller Western-Romane dabei. Manchmal beklagte er sich, dass es keinen Fernseher bei uns gab. Denn meine Eltern hatten beschlossen, dass es für mich und meine drei Geschwister besser sei, ohne Fernsehen aufzuwachsen.
Als der erste Fernseher ins Haus kam, war ich schon 15 Jahre alt, es muss 1981 oder 1982 gewesen sein. Mein Opa hatte sich einen neuen Farbfernseher gekauft, und bei einem seiner Besuche brachte er seine alte Schwarz-Weiß-Kiste als Geschenk mit. Seine offizielle Begründung: damit die Enkelkinder nicht ohne Fernsehen aufwachsen müssen. Inoffiziell ging es ihm aber wohl auch darum, dass er bei uns abends nicht nur seine Western-Romane zu lesen hatte, sondern dass er auch bei uns fernsehen konnte, wenn Western oder Gangsterfilme gesendet wurde. Meine Geschwister und ich hatten das Fernsehen nie richtig vermisst, aber als die Glotze dann da war, mussten wir erst mal einiges aufarbeiten, und zwar systematisch. Flipper, Catweazle, Biene Maja, die gesamten Siebzigerjahre waren schließlich eine Bildungslücke.
Der Fernseher stand nicht im Wohnzimmer, sondern in einem „Hobbyraum“ im Dachgeschoss unseres großen Einfamilienhauses. Das Glotzen wurde nicht reglementiert, aber wir übertrieben es trotz der langen TV-freien Phase in unserem Leben nicht. Mein kleiner Bruder war ziemlich fernsehaffin, aber ich kann mich nicht erinnern, mal länger als zwei Stunden im Hobbyraum herumgehangen zu haben. Nur die „Muppet Show“ und „Bill Cosbys Familienbande“, die damals beide im ZDF zu sehen waren, fesselten mich wirklich. Die „Muppets“ liefen am Samstagnachmittag, die „Cosbys“ am Sonntagnachmittag. Wenn das Wetter schlecht war und ich meine Ruhe haben wollte vor den Vorschlägen meiner Eltern, was ich noch aufräumen oder im Garten helfen könnte, verkrümelte ich mich gerne ins Hobbyzimmer, zu den Cosbys.
Bei der Familie Cosby fühlte ich mich wohl. Vielleicht lag das in erster Linie daran, dass wir Arnus vier Geschwister waren und die Cosbys anfangs auch vier Kinder hatten: Rudy, Vanessa, Theo und Denise. Erst in der zehnten Folge der ersten Staffel (englischer Titel: „Bon Jour Sondra“, deutsch: „Ein Sommer in Paris“) taucht plötzlich eine Sondra auf, die älteste Tochter der Familie. Zu den Schauspielerinnen, die für die später hinzugefügte Rolle der Sondra vorsprachen, zählte unter anderem auch Whitney Houston. Aber das nur am Rande. Wahrscheinlich waren es auch die ewigen Diskussionen der Teenager mit ihren Eltern und die Kämpfe der Geschwister untereinander, die mir irgendwie bekannt vorkamen.
Und es lag natürlich auch an den sympathischen Eltern der TV-Sippe: Die Hauptpersonen sind Bill Cosby als Heathcliff „Cliff“ Huxtable, ein Gynäkologe, und seine Frau Claire (Phylicia Rashad), eine Anwältin. Wie meine eigenen Eltern waren beide berufstätig (meine Mutter war Lehrerin, mein Vater Vermessungsingenieur). Cliff Huxtable schien, im Gegensatz zu meinem Vater, immer gut gelaunt und verständnisvoll zu sein. Probleme wurden bei den Huxtables grundsätzlich mit viel Verständnis und Humor gelöst. Wenn die Kinder Probleme hatten, kam zufällig immer gerade Dr. Huxtable von der Arbeit heim und nahm sich sofort aller Sorgen an, ohne die Geduld zu verlieren. Im Gegenteil: Sein warmes, herzliches Lachen allein konnte die meisten Konflikte beenden.
In der ersten Folge, die am 20. September 1984 auf NBC ausgestrahlt wurde, hieß Dr. Huxtable noch Clifford mit Vornamen, so steht es zumindest auf seinem Praxisschild, später wurde der Name in Heathcliff abgeändert. Die Familie wohnt in einem Brownstone-Haus in der Stigwood Avenue 10 in Brooklyn. Die Huxtables sind nicht reich, aber sie gehören zur gehobenen Mittelschicht, und sie erleben den Alltag einer typischen amerikanischen Familie.
Die Hautfarbe der Huxtables war mir ziemlich egal, die Leute hätten auch gelb, grün oder blau sein können – ich schaute schließlich auf dem geschenkten Schwarz-Weiß-Fernseher meines Opas. Was mich mehr beeindruckte, war die Herzenswärme und der Witz, der die Figuren ausmachte. Die Rolle des Dr. Huxtable war dem grandiosen Komiker Bill Cosby auf den Leib geschrieben. Der Vater des Hauses hatte ein Faible für Jazz, eine Schwäche für unnütze Geräte und als Heimwerker zwei linke Hände – so wie ich sie später selbst auch haben sollte. Obwohl Cliff Huxtable in der Serie das Alter von 50 Jahren erreicht, leidet er nicht unter einer Midlife-Crisis und verliert weder die Geduld noch die Liebe zu seiner stets gut aussehenden und auch nachts perfekt geschminkten Gattin. Ein Traum, wenn das im wirklichen Leben auch so laufen könnte.
Es ist aber keineswegs so, dass bei den Huxtables alles eitel Sonnenschein gewesen wäre, sonst wäre die Serie ja stinklangweilig gewesen. Viele Konflikte in der New Yorker Familie entstehen durch die Bildungsambitionen der Eltern, die es als Arzt und Anwältin schließlich ziemlich weit gebracht haben. Cliff Huxtables Meinung nach kommt für seine Kinder nur ein einziges College infrage, das Hillman College, auf das er selbst gegangen ist. Seine Kinder sehen dies anders. Tochter Denise (Lisa Bonet) besucht zwar das Hillman, will die Schule aber immer wieder abbrechen. Oder die typischen Diskussionen um Haustiere: Cliff ist gegen jede Art von Haustier, weil er sich als Junge auf seinen Kanarienvogel Charlie gesetzt hat und das Trauma anscheinend nicht verarbeitet hat. Nur Goldfische würde er tolerieren, die will aber keiner haben. Die Dialoge sind ziemlich gut geschrieben, fast jeder Streit wird mit einem humorvollen Spruch von Cliff Huxtable beendet. Die achtjährige Vanessa sagt in einer Folge, in der sie mit den Eltern diskutiert, ob sie einen nicht altersgerechten Kinofilm anschauen darf: „Es gibt keinen Spaß in meinem Leben!“ Darauf Cliff: „Wenn du älter wirst, wird es noch schlimmer.“
Mit der Figur Theo (Malcolm-Jamal Warner), dem einzigen Jungen der Familie, konnte ich mich nicht wirklich identifizieren, obwohl er ungefähr das gleiche Alter hatte wie ich. Theo ist zu Beginn der Serie ein Schulversager, sein Interesse konzentriert sich fast komplett auf Mädchen, er wirkt begriffsstutzig und ein bisschen trottelig. Später studiert er an der Uni in New York und findet irgendwie seinen Weg. Ich interessierte mich vor allem für Denise, die hübscheste der vier Huxtable-Töchter, gespielt von Lisa Bonet, die ein paar Monate jünger ist als ich. Sie erinnerte mich an meine damalige Freundin, die genauso sprunghaft und anstrengend war wie Denise Huxtable. 1987 spielte Bonet die Epiphany im Film „Angel Heart“ an der Seite von Mickey Rourke; wegen der darin enthaltenen Sexszenen bekam sie ziemlichen Ärger – sie musste aus der „Cosby-Show“ verschwinden. Später heiratete Lisa Bonet den Rocksänger Lenny Kravitz, was ich bis heute nicht ganz verstehen kann.
Was die Familie Obama später darstellte, hatte die Familie Huxtable schon 30 Jahre früher erfunden – das Rollenmodell für die schwarze Mittelschicht in den USA: zwei erfolgreiche, berufstätige schwarze Eltern mit ganz normalen, gut ausgebildeten Teenager-Töchtern. Die „Cosby-Show“ galt als erste Serie, die mit den gängigen Stereotypen brach und eine gebildete und erfolgreiche schwarze Familie porträtierte, in der Konflikte pädagogisch wertvoll und politisch korrekt gelöst wurden. Zuvor waren Schwarze meistens als Gangster, Sportler oder Soldaten im amerikanischen Fernsehen zu sehen gewesen.
Fünf Staffeln in Folge waren die Geschichten über die Familie Huxtable das erfolgreichste Format im amerikanischen Fernsehen, auch beim weißen Publikum. Die Sitcom sorgte dafür, dass der Donnerstagabend zu einem Selbstläufer für NBC wurde. Was nach der „Cosby-Show“ auf dem Sender ausgestrahlt wurde, war automatisch ebenfalls erfolgreich – bis die „Simpsons“ die Huxtables ablösten. Mit der Saga um die Arzt- und Anwaltsfamilie aus Brooklyn wurde Bill Cosby sehr reich, das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte das Einkommen des Hauptdarstellers 1986 und 1987 auf mindestens 84 Millionen Dollar pro Jahr.
In der Serie gibt es viele Verweise auf die afroamerikanische Kultur – zum Beispiel ist bei einem Gastauftritt von Stevie Wonder zum ersten Mal ein Sampler im Fernsehen zu bestaunen, jenes Gerät, das später für den Hip-Hop zentrale Bedeutung bekam. Dennoch bekam Cosby auch Kritik zu hören, gerade auch von Schwarzen. Es hieß, er zeichne ein zu heiteres, harmonisches Bild der Familienwirklichkeit, die tatsächlichen Lebensbedingungen der schwarzen Amerikaner sei weitaus trauriger. Der idealisierte Fernsehvater Dr. Huxtable wurde deshalb besonders gerne von afroamerikanischen Komikern aufs Korn genommen – beispielsweise in der vom gleichen Sender ausgestrahlten Sitcom „The Fresh Prince of Bel-Air“. Will Smith als Prinz spart darin nicht mit Seitenhieben auf schwarze Karrieristen, die ihre Wurzeln verleugnen. Rassismus und Benachteiligung kommen in der „Cosby-Show“ tatsächlich nicht als ernsthaftes Problem vor.
Nach 202 Episoden ging die „Cosby-Show“, die als erfolgreichste US-Sitcom der Achtzigerjahre gilt, im Jahr 1992 zu Ende. Die beiden letzten Staffeln hatten weniger Zuschauer gehabt als die früheren. Zudem waren die fünf Kinder der Fernsehfamilie längst zu alt, um noch glaubhaft in die Serie integriert zu werden, und die ersten Besuche der Enkelkinder bei Opa Huxtable konnten den Charme der kleinen Rudy aus den ersten Folgen nicht wettmachen. Damals hieß es, die Abkürzung des Fernsehsenders NBC stehe nicht für „National Broadcasting Company“, sondern für: „Need Bill Cosby“ (Wir brauchen Bill Cosby). NBC schaffte es nicht, eine Serie zu etablieren, die nur ansatzweise so beliebt war. Noch schlimmer: Cosby unterschrieb einen Vertrag beim Konkurrenten CBS, dessen Kürzel daraufhin uminterpretiert wurde: „Continue Bill’s Success“ – CBS setzt Bills Erfolg fort.
Zu Beginn des Jahres 2013, mehr als 20 Jahre nach dem Ende der „Cosby-Show“, hatte NBC plötzlich eine ganz neue Idee – und verpflichtete Bill Cosby, mittlerweile 76 Jahre alt. In einer neuen Serie soll er das Oberhaupt einer Multi-Generationen-Familie spielen. „Ich glaube, dass es da draußen Zuschauer gibt, die eine Komödie sehen wollen, in der es um Wärme, Liebe und Klugheit geht – und die lieber auf das ganze Party-Gedöns verzichtet“, sagte Cosby. NBC verpflichtete nicht nur Bill Cosby, sondern auch den Produzenten Tom Werner, der schon in den Achtzigern für die „Cosby-Show“ verantwortlich war.
Warum geht Cosby, der zum Serienstart im Herbst 77 Jahre alt sein wird, das Risiko ein, seine Karriere womöglich mit einem Flop beenden zu müssen? „Ich bin kürzlich aufgetreten, der Saal war ausverkauft. Da stand ein junger Mann auf, er war etwa 17 Jahre alt, und fragte mich, wie es Rudy und Theo gehen würde und was aus ihnen geworden sei“, sagte Cosby einer amerikanischen Zeitung. „Da wurde mir klar, dass viele junge Menschen keine Ahnung davon haben, was ich eigentlich mache. Dass ich ein witziger Kerl bin, der immer noch interessante Geschichten erzählen kann.“
Ein witziger Kerl, der Geschichten erzählen kann. Bis auf die beiden linken Hände erinnert mich Cosby mit den Jahren immer mehr an meinen Rosen veredelnden Opa.
DIE BÄREN SIND LOS > 26 FOLGEN > USA 1979–1980 > ZDF 1980–1984 > SA 16.35–17 UHR
BUTTERMAKER UND DIE PROBLEMBÄREN
Ein Knittergesicht mit Hang zu Pferdewetten, eine Gruppe rebellischer Kinder und ein Spiel, das hierzulande kein Mensch verstand: Das sind die Zutaten für die beste, anarchischste, lässigste Kinderserie überhaupt. Stefan Krücken über „Die Bären sind los“
Die Lieblingsserie meiner Kindheit beginnt damit, dass ein Mann einen weißen Cadillac mit großer Freude in einen Pool fährt, nachdem er um seinen Lohn geprellt wurde. Der Kerl heißt Buttermaker, Morris Buttermaker, und aus heutiger Sicht ist das auffälligste Detail des Vorspanns nicht sein fragwürdiges Hawaii-Shirt. Nicht die schmutzige Kappe auf seinem Schädel. Und auch nicht die daumendicke, erkaltete Zigarre zwischen seinen Fingern.
Buttermaker trägt einen Bierdosenhalter am Gürtel.
Heute würde die Kombination aus Alkohol, Stumpen und erfrischender Aggression in einer Kinderserie vermutlich zu Online-Petitionen empörter Eltern führen, zu facebook-Dauerfeuer und Boykott-Aufrufen gegen den Sender. „Die Bären sind los“ (Originaltitel: „The Bad News Bears“, gedreht 1979 und 1980), ist so ziemlich das Anarchischste, was Kindern je im Fernsehen angeboten wurde. Wie die Bären 30 Jahre später wohl aussähen, politisch und auch sonst korrigiert? Der Bierdosenhalter wäre gewiss nicht das einzige Detail, das auf der Strecke bliebe.
In der TV-Serie – die auf dem Erfolg eines gleichnamigen Kinofilms mit Walter Matthau aufbaute – geht es um eine Baseballmannschaft in Los Angeles, die „Weever Bears“, die an einer Schule für schwer erziehbare Kinder abschlägt. Es sind Kinder aus zerrütteten Verhältnissen: Rabauken, Rebellen, Tunichtgute, denen es an Selbstbewusstsein, Disziplin und einer Perspektive fehlt. Buttermaker, ein verlotterter Ex-Baseball-Profi mit Hang zu Pferdewetten (gespielt vom großartigen Knittergesicht Jack Warden), wird wegen seiner Fahreinlage von einem Gericht dazu verdonnert, die „Weever Bears“ zu trainieren. Sozialarbeit, die schiefgehen muss: Das erste Spiel verlieren die Bären mit 0–48, und auch danach läuft es kaum besser.
Meine Brüder und ich liebten diese Serie, obwohl wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie Baseball funktioniert. Ein Treffer mit der Keule, ein hölzernes Plock!, ein fliegender Ball, Jubel – das versteht man auch ohne zu wissen, was ein „Strike-Out“ ist. Flogen wiederum aus Frust die Handschuhe und wurde geflucht – und es wurde ausgiebig geflucht, wenn die Bären los waren –, war klar, dass die nächste Niederlage besiegelt war.
Die Mannschaft verlor ständig, aber die Kinder wurden für mich zu Helden. Da ist zum Beispiel Tanner, ein kleiner schwarzhaariger Junge, der seinen Trainer vorzugsweise „Butterblume“, „Butterkeks“ oder „Buttereimer“ nennt, gerne Schiedsrichter nach vermeintlichen Fehlentscheidungen vors Schienbein tritt und bei jeder sich nicht bietenden Gelegenheit eine Schlägerei anzettelt. Oder Engelberg, der übergewichtige Fänger, den seine Mitspieler liebevoll „Fettie“ nennen, was dazu führt, dass Engelberg noch mehr Süßigkeiten in sich hineinstopft. Einen Schlaumeier muss es auch geben, Leslie, ein schmächtiges Kerlchen mit Brille, der immerzu auf der Reservebank hockt und die Statistik führt. Tanner nennt ihn bevorzugt „Brillenschlange“.
Pädagogisch ist das alles so unfassbar wertlos, dass Lehrkräfte an Waldorfschulen schon nach wenigen Minuten Herzrhythmusstörungen bekämen. Aus der Perspektive meines Pausenhofs in Dormagen, einer eher grauen Chemiestadt an der nördlichen Stadtgrenze von Köln, stimmte hingegen alles. Kinder sind manchmal kleine Schurken, das gehört so, und Tanners gab es an jeder Ecke. Ich muss dazu sagen: Ich bewundere Menschen, die sich an jedes Detail ihrer Kindheit erinnern können, die noch alle Geschichten und Erlebnisse parat haben, als seien sie gestern geschehen. Ich vermag das nicht. Doch ich weiß noch genau, wie interessant ich vor allem Kelly fand, einen Burschen mit langen blonden Locken und einem Motorrad, auf dessen Sozius immer ein anderes Mädchen hockte. Kelly war unglaublich cool. Er brachte eine rebellische Note mit, bevor irgendjemand in unserer Familie überhaupt von den bösen Winden der Pubertät wusste. Die Bären tanzten auch auf Partys, waren hinter Mädchen her, sie bewarfen Autos mit Dreckklumpen, um sie eine Straßenecke weiter in einer von ihnen eröffneten Waschanlage gegen Dollar zu reinigen. Sie durften schlicht alles, was wir nicht durften. Oder woran wir nicht mal dachten.
Wie es sich für eine anständige Kinderserie gehört, rücken die Problembären mit jeder Folge enger zusammen, werden Freunde und gewinnen schließlich. Aber das Gewinnen ist gar nicht so wichtig, und genau das macht die Serie so sympathisch. Es geht um etwas anderes: Anders sein ist toll. Außenseiter? Es lebe der Loser! Ein komischer Kauz mit Hang zu schnellen Bieren und schnellen Pferden bringt Kindern bei, was wirklich zählt: das Herz. Buttermaker kommt dabei ohne Zeigefinger aus und ohne die moralische Keule, die Eltern so gerne einsetzen. Den Mini-Rocker Kelly, zum Beispiel, überredet er in seine Mannschaft, indem er immer wieder mit ihm wettet. Um dann am Basketballkorb oder am Airhockey-Tisch zu verlieren. Er besticht den Jungen, er versucht es wieder und wieder, bis der Junge schließlich sagt: „Oh, dem komischen Typ bin ich aber etwas wert.“
Ist das nachahmenswert? Ist das die richtige Botschaft?
Ja, warum eigentlich nicht! Buttermaker wird zum Freund der Kinder, weil er nach Regeln handelt, die sie verstehen. Respekt muss man sich verdienen. Den kann man nicht herbeibrüllen. Eine Art Bösewicht gibt es natürlich auch, Turner, den Trainer des Erzrivalen, der „Lions“. Die „Lions“ sind sehr diszipliniert und funktionieren wie ein Kommando kleiner Roboter. Im entscheidenden Spiel gegen die Bären schreit Turner seine Schützlinge an und schlägt eines der Kinder. Buttermaker hingegen wechselt das schwächste Teammitglied von der Reservebank ein, um ein Zeichen zu setzen. Gewonnen hat er schon, bevor das Spiel beendet ist.
Heute habe ich selber vier kleine Kinder. Ihre Lieblingsserie heißt: „Die Bären sind los“. Wieder und wieder hallt die Titelmelodie „Los Toreadores“ aus der Oper „Carmen“ durchs Wohnzimmer. Auf DVD, denn ein Sender bringt die „Bären“ nicht. In den meisten anderen Sendungen, die sie sonst ansehen, sind die Rollen anders verteilt: Eltern sind entweder gleichgültig oder übervorsichtig (das Väter-Bild in vielen Kinderserien wird von nörgelnden Waschlappen dominiert), die Handlung ist sehr korrekt und damit in der Regel langweilig. Wer einen Nachmittag mit „Lauras Stern“, „H2O – Plötzlich Meerjungfrau“ oder einer psychedelischen Neuauflage des „Kleinen Prinzen“ zugebracht hat, sehnt sich bald nach Morris Buttermaker.
Und nach seinem Bierdosenhalter.
MIAMI VICE > 113 FOLGEN > USA 1984–1989 > ARD 1986–1992 > DI 21.45–22.30 UHR
UNDERCOVER IN PASTELL
Waffen, Kokain, Pornos und Striperinnen. Als Einschlaf-Programm für eine Zehnjährige scheint die Welt von „Miami Vice“ eher ungeeignet. Doch Iris Bahr schenken Crockett und Tubbs einige der unbeschwertesten Momente ihrer Kindheit.
Dem Zauber von „Miami Vice“ erlag ich eher zufällig. Meine Eltern befanden sich gerade in der Hochphase ihrer Scheidung. An den Abenden, an denen mein Vater „länger im Büro“ war, wie meine Mutter es nannte, zog sie sich in ihre Trauer zurück und häkelte riesige Tischdecken mit hochkomplexen Mustern, für die sie eigentlich den Nobelpreis für Kunst und Handarbeit verdient hätte. Ich war mir selbst überlassen, was unweigerlich dazu führte, dass ich mich zwecks Dauerberieselung vor die Glotze fläzte. Klar, es gab das „A-Team“, „Wer ist hier der Boss?“, die „Bill Cosby-Show“ und diverse andere Formate der seichten Unterhaltung, aber eines Abends, als ich länger als sonst aufblieb, zeigten sie eine Sendung, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Unterlegt von coolen Synthesizerbeats sauste ich nach einer witzigen Titeleinblendung über den Ozean und blickte kurz darauf zwischen verheißungsvollen Palmwedeln hindurch in den tiefblauen Himmel. Zack! Zack! Zack! Ein Bild jagte das nächste, im Takt der Musik – rosa Flamingos, saubere, bunte Häuser, und dann das Beste: Zwei Traumtypen in Leinenanzügen, die mich mitnehmen sollten auf ein Abenteuer unter strahlender Sonne, auf die Reise durch ein sexy, kokainstrotzendes, pulsierendes Tropenwunderland. Zwar hatte ich mit meinen zehn Jahren noch keinen blassen Schimmer von Sex, Kokain oder tropischem Pulsieren, aber die Welt von „Miami Vice“ wurde trotzdem zu meinem persönlichen Wunderland.
Die Stadt selbst war mir nicht unbekannt, im Gegenteil, ich war seit frühester Kindheit mit ihr vertraut. Mein Dad besaß ein Apartment in einer weitläufigen weißen Reihenhaussiedlung Miamis, bewohnt von kanadischen Frostopfern und neurotischen New Yorkern, die schon 30 Jahre zuvor ihren Ruhestand geplant hatten. Jeder, der schon mal dort war, weiß, Miami ist eine seltsame Stadt. Man misstraut an diesem Ort offenbar der wunderbaren Wirkung von Sonnenschein und trägt deshalb besonders dick auf mit dem Glück und der positiven Lebenseinstellung: bonbonfarbene Gebäude, Neonreklamen, Pappschilder mit Palmen drauf zum Verdichten der echten Exemplare.
Unser bescheidenes Apartment mit Meerblick hatte, ungelogen, pfirsichfarbene Sofas, einen gelben Teppich und eine Froschtapete. Ja, richtig, die Tapete war mit Fröschen übersät, lauter fette Frösche mit vorstehenden Zähnen hockten auf Seerosenblättern und grinsten Teetassen an.
Trotz dieses albtraumhaften Amphibiendekors fand ich Miami klasse. Dort konnte ich dem trüben Winter in der Bronx entfliehen, den Depressionen meiner Mutter und dem Zorn meines Vaters, ihren ewigen Streitereien, meinen Ängsten, Sorgen und Nöten… Kaum waren wir in Florida angekommen, schmolzen sie einfach dahin. Doch weil diese Besuche selten waren und von kurzer Dauer, erschien mir die Möglichkeit, wöchentlich vor dem Fernseher in die Zauberwelt Miamis abzutauchen, wie ein Geschenk des Himmels.
Ein weiteres Himmelsgeschenk war Sonny Crockett, gespielt vom verträumten Don Johnson. Glaubt man den Gerüchten, war er nicht die erste Wahl des Produzenten für die Rolle. Eigentlich hätte Nick Nolte sie bekommen sollen. Obwohl ich Nolte super finde, war und ist er alles andere als verträumt. Während Nolte die Idealbesetzung für eine Art Onkelfigur mit Hang zum unkontrollierten Alkoholismus verkörperte, war Crockett ein echter Traumtyp mit einer elegant geschmeidigen Statur, perfektem Gesicht und formvollendetem Dreitagebart. (Man sagt ihm ja sogar nach, er hätte den Bartschatten in der Modewelt etabliert. Es gibt sogar einen speziellen Rasierer namens Miami Vice oder so ähnlich, mit dem die Fans unrasiert genauso gepflegt aussehen können wie Sonny Crockett.) Crocketts Gesichtsbehaarung vermittelte mir das Gefühl, in einen erwachsenen Mann verliebt zu sein – bis dato hatte ich lediglich für River Phoenix, Michael Jackson (ja, ich weiß) und Meeno Peluce aus den „Zeitreisenden“ geschwärmt. Und nicht zu vergessen: diese Grübchen. Einfach göttlich! Crocketts Grübchen waren Mulden der Geborgenheit, in denen man sich zusammenkuscheln und sanft entschlafen wollte. Außerdem war seine Sonnenbräune echt, nicht aufgesprüht oder aus der Flasche. Ein echter Parforceritt waren natürlich seine Klamotten: ein Sexgott im atmungsaktiven Pastellgewand. Gut, ich war zwar nicht gerade ein Modeguru, aber sogar als Kind erkannte ich auf den ersten Blick, dass Crockett mit seinen abgefahrenen, maßgeschneiderten Blazern über den lässig bunten T-Shirts und perfekt sitzenden weißen Leinenhosen ein echter Hipster war. In diesem Aufzug hätte Nolte doch niemand ernst genommen! Wenig überraschend, dass der Kostümbildner der Serie ständig nach Mailand und Paris flog, um die neuesten Modetrends anzuzapfen. Sehr überrascht hat mich lediglich, dass diese Person den Namen Bambi trug.
Wie wir alle wissen, neigt Hollywood dazu, alles glamouröser darzustellen, als es eigentlich ist, doch keine andere Krimiserie hatte es bis dato mit der Glitzerwelt dermaßen auf die Spitze getrieben wie „Miami Vice“. Ihre Helden waren zwei Undercover-Polizisten, die mit ihren edlen Outfits sogar italienische Filmstars in den Schatten stellten und Karossen fuhren, die sich nicht mal die Drogendealer leisten konnten, hinter denen sie her waren. Natürlich konnten sich die echten Polizisten in Miami mit keinem einzigen Aspekt dieser Serie identifizieren. Aber ich war schließlich kein Polizist. Ich war nur ein Kind auf der Suche nach ein bisschen Illusion, und die Wirklichkeit ging mir sonst wo vorbei.
Sie fragen sich vermutlich, wann ich zu Tubbs komme, der von Philip Michael Thomas dargestellt wurde. Den habe ich nicht vergessen. Der Rest der Welt offenbar schon, denn seine Karriere war mit dem Ende von „Miami Vice“ schlagartig beendet. Tubbs war wichtig für die Harmonie und Heiterkeit der Serie. Klar könnte man sich an dieser Stelle über seine Persönlichkeit auslassen, aber ich kann mich offen gestanden an keine solche erinnern. Selbstverständlich kam es gut, wenn er während eines kritischen Undercover-Jobs mal wieder mit jamaikanischem Slang punktete, und klar lieferte er auch ein paar nette Kalauer, wie in der Episode mit dem Gaststar, der von vertikaler Integration spricht, woraufhin Tubbs nachfragt: „Du meinst, die laufen die ganze Zeit mit einer Dauer-erektion rum?“, oder seine Reaktion auf Crocketts Haustier, das Krokodil namens Elvis: „Hey Mann, hau mir bloß damit ab. Ich steh ja nicht mal auf Krokolederschuhe.“ Aber wenn ich ehrlich bin, war mir die Dynamik zwischen Tubbs und Crockett nie ganz klar. Crockett war eindeutig sexy, cool, stilvoll und draufgängerisch. Tubbs hingegen hatte deutlich weniger Sex-Appeal, und ein Draufgänger war er gefühlte zwei Sekunden pro Sendung. Es war aber nicht so, dass Crockett mutig und Tubbs feige gewesen wäre, oder Tubbs immer ernst dreinblickte, während Crockett ständig Witze riss. Ja gut, Tubbs war schwarz und Crockett braun gebrannt, aber das reichte nicht annähernd für den beliebten Serien-Typus „ungleiches Paar“. Am Ende entsprachen die beiden ungefähr demselben Schema: Angetäuschter Anarcho-Undercover-Cop knallt die Bösen gleich im Dutzend ab, fuchtelt gern mal am helllichten Tag mit der Wumme herum und erlebt skurrile und größtenteils komische Abenteuer. Für mich stellten die beiden nicht etwa zwei Seiten einer Medaille dar, sondern verschiedene Teile derselben Seite, wie ein leckerer Butterkeks mit Schokoglasur oder Vanilleeis mit Schokostückchen.
Während die beiden eine echte Augenweide waren, hätte ihr Chef, der Lieutenant, lediglich im Radio eine attraktive Figur abgegeben. Womöglich hatten die Produzenten befürchtet, ihre Hauptdarsteller seien nicht anziehend genug, deshalb stellten sie ihnen wohl den lurchigsten Latino mit Haarimplantat an die Seite, den sie auftreiben konnten. Mit seiner viel zu langen, üppigen schwarzen Föhnwelle, die wie angeklettet an seiner hohen Stirn hing, wirkte er wie die Ethnoversion von Krusty, dem Clown aus den „Simpsons“. Vielleicht sollte ich die Schuld nicht bei den Produzenten suchen. Möglicherweise hatte Crockett Minderwertigkeitskomplexe, so unwahrscheinlich das auch klingen mag, und vom Produzenten gefordert: „Ich will, dass der Boss aussieht wie ein ekelhafter Pädo mit dem gruseligsten Haaransatz, den man sich vorstellen kann, damit die Leute auch merken, dass ich makellose Gesichtszüge und volles Haupthaar habe.“
Dem Lieutenant muss man allerdings hoch anrechnen, dass er seine Rolle hervorragend spielte, und seinem unheimlichen Haaransatz, dass er seinem Träger große Autorität verlieh.
Sieht man von dem Lieutenant ab, war der Unterschied zwischen Guten und Bösen in „Miami Vice“ sonnenklar: Die Bösen trugen Schnurrbärte. Immer. Fehlten die, waren sie entweder nicht ganz böse, kriegten noch die Kurve oder waren einfach Kollegen.
Und die Typen mit den buschigen Schnurrbärten? Die waren der letzte Abschaum und verdienten ihr Geld mit Drogen, Prostitution, Menschenhandel mit Minderjährigen, Mord. Doch ihre dunklen Machenschaften trieben sie immer noch in Miami, weshalb sie selbstverständlich jede Menge Spaß dabei hatten, feierten, soffen, lachten und vögelten. Aber wir, die Guten, hatten Glück, denn am Ende jeder Episode waren die Bösen tot. In einem Mega-Schusswechsel weggepustet. Untermalt von cooler Chartmusik. Keine komplizierte Auflösung, Nachwehen oder andere Auswirkungen. Und wie bestellt wartete die Folgewoche gleich mit neuen Bösewichten auf.