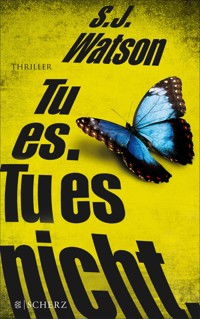Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ohne Erinnerung sind wir nichts. Stell dir vor, du verlierst sie immer wieder, sobald du einschläfst. Dein Name, deine Identität, die Menschen, die du liebst – alles über Nacht ausradiert. Es gibt nur eine Person, der du vertraust. Aber erzählt sie dir die ganze Wahrheit? Als Christine aufwacht, ist sie verstört: Das Schlafzimmer ist fremd, und neben ihr im Bett liegt ein unbekannter älterer Typ. Sie kann sich an nichts erinnern. Schockiert muss sie feststellen, dass sie nicht Anfang zwanzig ist, wie sie denkt – sondern 47, verheiratet und seit einem Unfall vor vielen Jahren in einer Amnesie gefangen. Jede Nacht vergisst sie alles, was gewesen ist. Sie ist völlig angewiesen auf ihren Mann Ben, der sich immer um sie gekümmert hat. Doch dann findet Christine ein Tagebuch. Es ist in ihrer Handschrift geschrieben – und was darin steht, ist mehr als beunruhigend. Was ist wirklich mit ihr passiert? Wem kann sie trauen, wenn sie sich nicht einmal auf sich selbst verlassen kann? »Man muss sagen: Chapeau, der Mann hat es wirklich gefunden, das Rezept für den perfekten Thriller.« taz »Es ist fast unmöglich, diesen mitreißenden, glaubwürdigen und daher nahegehenden Thriller aus der Hand zu legen.« Bücher »Mitreißend, ein echter Pageturner.« Stern »Schlicht und einfach der beste erste Thriller, den ich jemals gelesen habe.« Tess Gerritsen
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 47 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
S. J. Watson
Ich. Darf. Nicht. Schlafen.
Psychothriller
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Mutter und für Nicholas
Morgen wurde ich geboren
Heute lebe ich
Gestern hat mich umgebracht
Parviz Owsia
Teil einsHeute
Das Schlafzimmer ist seltsam. Fremd. Ich weiß nicht, wo ich bin, wie ich hier gelandet bin. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll.
Ich habe die Nacht hier verbracht. Die Stimme einer Frau hat mich geweckt – zuerst dachte ich, sie läge mit mir zusammen im Bett, doch dann merkte ich, dass sie die Nachrichten verlas und ich einen Radiowecker hörte –, und als ich die Augen aufschlug, war ich hier. In diesem Zimmer, das ich nicht kenne.
Meine Augen gewöhnen sich an das Halbdunkel, und ich schaue mich um. Ein Morgenmantel hängt an der Kleiderschranktür – für eine Frau, aber eine, die viel älter ist als ich –, und eine marineblaue Hose liegt ordentlich über der Lehne eines Stuhls am Frisiertisch, aber sonst kann ich wenig erkennen. Der Radiowecker sieht kompliziert aus, aber ich finde den Knopf, der ihn hoffentlich zum Verstummen bringt. Es klappt.
Auf einmal höre ich hinter mir ein zittriges Einatmen und merke, dass ich nicht allein bin. Ich drehe mich um. Ich sehe nackte Haut und dunkles, graugesprenkeltes Haar. Ein Mann. Sein linker Arm liegt auf der Decke, und am Ringfinger der Hand steckt ein goldener Ring. Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Typ ist also nicht nur alt und grau, denke ich, sondern auch noch verheiratet. Ich habe nicht nur mit einem verheirateten Mann gevögelt, sondern vermutlich noch dazu bei ihm zu Hause, in dem Bett, das er normalerweise mit seiner Frau teilt. Ich sinke zurück, um mich zu sammeln. Ich sollte mich schämen.
Ich frage mich, wo die Ehefrau ist. Muss ich befürchten, dass sie jeden Augenblick hereingeschneit kommt? Ich stelle mir vor, wie sie am anderen Ende des Zimmers steht, kreischt, mich als Schlampe beschimpft. Eine Medusa. Ein Schlangenhaupt. Ich überlege, wie ich mich verteidigen soll, falls sie tatsächlich auftaucht, und ob ich dazu überhaupt imstande bin. Der Typ im Bett wirkt jedoch völlig unbesorgt. Er hat sich auf die andere Seite gerollt und schnarcht weiter.
Ich versuche, ganz still zu liegen. Normalerweise kann ich mich erinnern, wie ich in eine derartige Situation geraten bin, aber heute nicht. Ich muss auf einer Party gewesen sein, in einer Bar oder einem Club. Ich muss ganz schön betrunken gewesen sein. So betrunken, dass ich mich an gar nichts erinnere. So betrunken, dass ich mit einem Mann nach Hause gegangen bin, der einen Ehering trägt und Haare auf dem Rücken hat.
So behutsam wie möglich schlage ich die Decke zurück und setze mich auf die Bettkante. Zuallererst muss ich auf die Toilette. Ich ignoriere die Hausschuhe vor meinen Füßen – mit dem Ehemann zu vögeln, ist eine Sache, aber ich könnte niemals die Schuhe einer anderen Frau tragen – und schleiche barfuß auf den Flur. Ich bin mir meiner Nacktheit bewusst, habe Angst, die falsche Tür zu erwischen, in das Zimmer eines Untermieters zu platzen, eines halbwüchsigen Sohnes. Erleichtert sehe ich die Badezimmertür halboffen stehen, gehe hinein und schließe ab. Ich setze mich, benutze die Toilette, drücke die Spülung und wende mich zum Waschbecken, um mir die Hände zu waschen. Ich greife nach der Seife, aber irgendetwas stimmt nicht. Zuerst kann ich nicht benennen, was es ist, aber dann sehe ich es. Die Hand, die die Seife gefasst hat, sieht nicht wie meine aus. Die Haut ist faltig, die Finger dick. Die Nägel sind nicht lackiert und abgekaut, und wie bei dem Mann, neben dem ich vorhin aufgewacht bin, steckt ein schlichter goldener Ehering an der Hand.
Ich starre einen Moment darauf und wackele dann mit den Fingern. Prompt bewegen sich die Finger der Hand, die die Seife hält. Ich schnappe nach Luft, und die Seife flutscht ins Waschbecken. Ich blicke in den Spiegel.
Das Gesicht, das mich daraus ansieht, ist nicht meines. Das Haar hat keine Fülle und ist viel kürzer geschnitten, als ich es trage, die Haut der Wangen und unter dem Kinn ist schlaff, die Lippen sind dünn, der Mund nach unten gezogen. Ich schreie auf, ein wortloses Keuchen, das in ein entsetztes Kreischen übergehen würde, wenn ich es zuließe, und dann bemerke ich die Augen. Sie sind von Falten umgeben, ja, aber trotz allem erkenne ich sie: Es sind meine. Die Person im Spiegel bin ich, aber zwanzig Jahre zu alt. Fünfundzwanzig. Noch mehr.
Das kann nicht sein. Ich beginne zu zittern und halte mich am Waschbeckenrand fest. Ein weiterer Schrei drängt aus meiner Brust, und dieser bricht als ersticktes Keuchen hervor. Ich trete zurück, weg vom Spiegel, und erst jetzt sehe ich sie. Fotos. An die Wand geklebt, an den Spiegel. Bilder, dazwischen gelbe Haftzettel, Notizen mit Filzstift geschrieben, feucht und wellig.
Ich lese wahllos eine. Christine, steht da, und ein Pfeil zeigt auf ein Foto von mir – ein Foto von diesem neuen Ich, diesem alten Ich –, auf dem ich an einem Kai auf einer Bank sitze, neben einem Mann. Der Name kommt mir bekannt vor, aber nur vage, als müsste ich mich anstrengen zu glauben, dass es meiner ist. Auf dem Foto lächeln wir beide in die Kamera und halten Händchen. Er ist gutaussehend, attraktiv, und als ich genauer hinsehe, erkenne ich in ihm den Mann, mit dem ich geschlafen habe, der noch im Bett liegt. Darunter steht das Wort Ben, und daneben Dein Mann.
Ich keuche auf und reiße es von der Wand. Nein, denke ich. Nein! Das kann nicht sein … Ich überfliege die übrigen Fotos. Sie alle zeigen mich und ihn. Auf einem trage ich ein hässliches Kleid und bin dabei, ein Geschenk auszupacken, ein anderes zeigt uns beide im Partnerlook in wetterfesten Jacken, wie wir vor einem Wasserfall stehen, während ein kleiner Hund unsere Füße beschnüffelt. Daneben ist ein Bild, auf dem ich neben ihm sitze, an einem Glas Orangensaft nippe und den Morgenmantel trage, den ich vorhin in dem Schlafzimmer gesehen habe.
Ich trete noch weiter zurück, bis ich kalte Fliesen im Rücken spüre. Im selben Moment erfasst mich eine schwache Ahnung, die ich mit Erinnerung assoziiere. Als mein Verstand versucht, sie zu ergreifen, schwebt sie davon, wie Asche in einem Lufthauch, und mir wird klar, dass es in meinem Leben ein Früher gibt, ein Vorher, doch ich kann nicht sagen, vor was, und dass es ein Jetzt gibt und dass zwischen diesen beiden Polen nur eine lange stumme Leere ist, die mich hierher geführt hat, zu mir und ihm, in dieses Haus.
Ich gehe zurück ins Schlafzimmer. Noch immer habe ich das Bild in der Hand – das von mir und dem Mann, neben dem ich aufgewacht bin –, und ich halte es vor mich. »Was geht hier vor?«, sage ich, schreie ich. Tränen strömen mir übers Gesicht. Der Mann setzt sich im Bett auf, die Augen halb geschlossen. »Wer bist du?«
»Ich bin dein Mann«, sagt er. Sein Gesicht ist verschlafen, zeigt keine Spur von Verärgerung. Er sieht meinen nackten Körper nicht an. »Wir sind seit vielen Jahren verheiratet.«
»Was soll das heißen?«, sage ich. Ich will weglaufen, weiß aber nicht, wohin. »›Seit vielen Jahren verheiratet‹? Was soll das heißen?«
Er steht auf. »Hier«, sagt er und reicht mir den Morgenmantel, wartet, während ich ihn anziehe. Er trägt eine Pyjamahose, die ihm zu groß ist, ein weißes Unterhemd. Er erinnert mich an meinen Vater.
»Wir haben 1985 geheiratet«, sagt er. »Vor zweiundzwanzig Jahren. Du –«
Ich falle ihm ins Wort. »Was –?« Ich spüre, wie mir das Blut aus dem Gesicht weicht, das Zimmer beginnt, sich zu drehen. Eine Uhr tickt, irgendwo im Haus, und es klingt so laut wie Hammerschläge. »Aber –?« Er macht einen Schritt auf mich zu. »Wie –?«
»Christine, du bist jetzt siebenundvierzig«, sagt er. Ich sehe ihn an, diesen Fremden, der mich anlächelt. Ich will ihm nicht glauben, will nicht mal hören, was er da sagt, aber er redet weiter. »Du hattest einen Unfall«, sagt er. »Einen schlimmen Unfall. Mit Kopfverletzungen. Es fällt dir schwer, dich an Dinge zu erinnern.«
»Was für Dinge?«, sage ich und meine eigentlich, Doch bestimmt nicht die letzten fünfundzwanzig Jahre? »Was für Dinge?«
Er macht einen weiteren Schritt auf mich zu, nähert sich mir, als wäre ich ein verängstigtes Tier. »Alles«, sagt er. »Manchmal schon seit du Anfang zwanzig warst. Manchmal sogar noch früher.«
Daten und Altersangaben schwirren mir durch den Kopf. Ich will nicht fragen, aber ich weiß, ich muss. »Wann … wann war der Unfall?«
Er sieht mich an, und sein Gesicht ist eine Mischung aus Mitgefühl und Furcht.
»Als du neunundzwanzig warst …«
Ich schließe die Augen. Noch während mein Verstand versucht, diese Information abzulehnen, weiß ich irgendwo, dass sie der Wahrheit entspricht. Ich höre mich selbst, wie ich wieder anfange zu weinen, und sogleich kommt dieser Mann, dieser Ben, zu mir an die Tür. Ich spüre seine Nähe, bewege mich nicht, als er die Arme um meine Taille legt, leiste keinen Widerstand, als er mich an sich zieht. Er hält mich. Gemeinsam wiegen wir uns sacht, und ich merke, dass mir diese Bewegung irgendwie vertraut vorkommt. Sie tröstet mich.
»Ich liebe dich, Christine«, sagt er, und obwohl ich weiß, dass ich jetzt eigentlich das Gleiche zu ihm sagen sollte, schweige ich. Ich sage nichts. Wie kann ich ihn lieben? Er ist ein Fremder. Nichts ergibt irgendeinen Sinn. Ich will so vieles wissen. Wie ich hier gelandet bin, wie ich mit dem Leben zurechtkomme. Aber ich weiß nicht, wie ich fragen soll.
»Ich habe Angst«, sage ich.
»Ich weiß«, erwidert er. »Ich weiß. Aber das brauchst du nicht, Chris. Ich bin für dich da. Ich werde immer für dich da sein. Alles wird gut. Vertrau mir.«
Er sagt, er will mir das Haus zeigen. Ich fühle mich ruhiger. Ich habe einen Slip und ein altes T-Shirt angezogen, das er mir gegeben hat, mir dann den Morgenmantel um die Schultern gelegt. Wir treten auf den Flur. »Das Bad hast du ja schon gesehen«, sagt er und öffnet die Tür daneben. »Hier ist das Arbeitszimmer.«
Ich sehe einen Schreibtisch mit einer Glasplatte und darauf etwas, das ein Computer sein muss, obwohl es lächerlich klein ist, eher wie ein Spielzeug. Daneben steht ein Aktenschrank in Stahlgrau, darüber hängt ein Wandplaner. Alles ist sauber, ordentlich. »Hier arbeite ich manchmal«, sagt er und schließt die Tür. Wir überqueren den Flur, und er öffnet eine andere Tür. Ein Bett, eine Frisierkommode, Kleiderschränke. Alles sieht fast genauso aus wie in dem Zimmer, in dem ich aufgewacht bin. »Manchmal schläfst du hier«, sagt er, »wenn dir danach ist. Aber normalerweise wachst du nicht gern allein auf. Du kriegst Panik, wenn du nicht erkennen kannst, wo du bist.« Ich nicke. Ich fühle mich wie eine Mietinteressentin, der man eine neue Wohnung zeigt. Eine mögliche Mitbewohnerin. »Gehen wir nach unten.«
Ich folge ihm die Treppe hinab. Er zeigt mir ein Wohnzimmer – braunes Sofa mit passenden Sesseln, ein flacher, an der Wand befestigter Bildschirm, der, wie er mir erklärt, ein Fernseher ist –, Esszimmer, Küche. Alles ist mir fremd. Ich empfinde gar nichts, nicht mal, als ich auf einem Sideboard ein gerahmtes Foto von uns beiden sehe. »Hinterm Haus haben wir einen Garten«, sagt er, und ich schaue durch die Glastür in der Küche nach draußen. Es wird gerade erst hell, der Nachthimmel färbt sich tintenblau, und ich kann die Silhouette eines großen Baumes und eine Hütte am hinteren Ende eines kleinen Gartens erkennen, aber sonst nichts. Mir wird klar, dass ich nicht mal weiß, in welchem Teil der Welt wir sind.
»Wo sind wir hier?«, frage ich.
Er tritt hinter mich. Ich kann uns beide als Spiegelung in der Scheibe sehen. Mich. Meinen Mann. Beide mittleren Alters.
»Nordlondon«, antwortet er. »Crouch End.«
Ich trete zurück. Panik steigt hoch. »Verdammt«, sage ich. »Ich weiß noch nicht mal, wo ich lebe …«
Er nimmt meine Hand. »Keine Sorge. Alles wird gut.« Ich drehe mich zu ihm um, sehe ihn an und warte darauf, dass er mir erklärt, wie, wie denn alles gut werden soll, aber er tut es nicht. »Soll ich dir deinen Kaffee machen?«
Einen Moment lang bin ich wütend auf ihn, doch dann sage ich: »Ja. Ja, bitte.« Er füllt einen Wasserkessel. »Schwarz bitte«, sage ich. »Ohne Zucker.«
»Ich weiß«, sagt er und lächelt mich an. »Möchtest du Toast?«
Ich sage ja. Er muss so viel über mich wissen, trotzdem fühle ich mich wie am Morgen nach einem One-Night-Stand: Frühstück mit einem Fremden in seinem Haus, abtaxieren, wann man endlich die Flucht antreten und nach Hause gehen kann.
Aber das ist der Unterschied. Angeblich ist das hier mein Zuhause.
»Ich glaube, ich muss mich hinsetzen«, sage ich. Er sieht mich an.
»Mach es dir doch schon mal im Wohnzimmer bequem«, sagt er. »Ich bring den Kaffee dann rüber.«
Ich gehe aus der Küche.
Einige Augenblicke später kommt Ben mir nach. Er gibt mir ein Buch. »Das ist ein Album«, sagt er. »Es könnte dir helfen.« Ich nehme es ihm aus der Hand. Es hat einen Plastikeinband, der wie altes Leder aussehen soll, es aber nicht tut, und drum herum ist eine unordentlich gebundene Schleife. »Bin gleich wieder da«, sagt er und geht aus dem Raum.
Ich setze mich auf das Sofa. Das Album liegt schwer auf meinem Schoß. Es mir anzusehen, kommt mir vor, als würde ich rumschnüffeln. Ich sage mir, dass das, was da drin ist, mit mir zu tun hat. Mein Mann hat es mir gegeben.
Ich löse die Schleife und schlage eine beliebige Seite auf. Ein Foto von mir und Ben, auf dem wir sehr viel jünger aussehen.
Ich knalle das Album zu. Ich fahre mit den Händen über den Einband, fächere die Seiten auf. Das muss ich jeden Tag machen.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin sicher, dass da ein schreckliches Versehen vorliegt, und doch kann das nicht sein. Die Beweise sind da – in dem Spiegel oben, in den Falten an den Händen, die das Album vor mir streicheln. Ich bin nicht der Mensch, für den ich mich hielt, als ich heute Morgen aufwachte.
Aber wer war das?, denke ich. Wann war ich diese Person, die im Bett eines Fremden aufwachte und nur an Flucht dachte? Ich schließe die Augen. Ich habe das Gefühl zu schweben. Haltlos. In Gefahr, verlorenzugehen. Ich muss mich irgendwie verankern. Ich schließe die Augen und versuche, mich auf etwas zu konzentrieren, irgendetwas Greifbares. Ich finde nichts. So viele Jahre meines Lebens, denke ich. Einfach weg.
Dieses Album wird mir sagen, wer ich bin, aber ich will es nicht öffnen. Noch nicht. Ich möchte eine Weile hier sitzen, meine gesamte Vergangenheit ein leeres Blatt. Im Schwebezustand, irgendwo zwischen Möglichkeit und Tatsache. Ich habe Angst davor, meine Vergangenheit zu erkunden. Was ich erreicht habe und was nicht.
Ben kommt zurück und stellt ein Tablett vor mir ab. Toast, zwei Tassen Kaffee, ein Kännchen Milch. »Alles in Ordnung?«, fragt er. Ich nicke.
Er setzt sich neben mich. Er hat sich rasiert, trägt Hose, Hemd und Krawatte. Er sieht nicht mehr wie mein Vater aus. Jetzt sieht er aus, als würde er in einer Bank arbeiten oder in irgendeinem Büro. Aber nicht schlecht, denke ich, dann schiebe ich den Gedanken beiseite.
»Ist das jeden Tag so?«, frage ich. Er legt eine Toastscheibe auf einen Teller, bestreicht sie mit Butter.
»So ziemlich«, sagt er. »Möchtest du auch?« Ich schüttele den Kopf, und er nimmt einen Bissen. »Du scheinst Informationen speichern zu können, solange du wach bist«, sagt er. »Aber dann, wenn du schläfst, geht das meiste verloren. Schmeckt dir der Kaffee?«
Ich bejahe, und er nimmt mir das Album aus den Händen. »Das hier ist eine Art Sammelalbum«, sagt er und schlägt es auf. »Vor ein paar Jahren hat es bei uns gebrannt, und dabei haben wir viele alte Fotos und Sachen verloren, aber hier drin ist noch so einiges.« Er zeigt auf die erste Seite. »Das ist dein Abschlusszeugnis«, sagt er. »Und das ist ein Foto von dir auf deiner Abschlussfeier.« Ich schaue hin. Auf dem Bild lächele ich, blinzele in die Sonne, ich trage ein schwarzes Gewand und einen Filzhut mit einer goldenen Quaste. Dicht hinter mir steht ein Mann in Anzug und Krawatte, den Kopf von der Kamera abgewandt.
»Bist du das?«, frage ich.
Er schmunzelt. »Nein. Ich hab meinen Abschluss nicht zur selben Zeit gemacht wie du. Damals hab ich noch studiert. Chemie.«
Ich schaue zu ihm hoch. »Wann haben wir geheiratet?«, frage ich.
Er dreht sich zu mir und nimmt meine Hand mit beiden Händen. Ich bin ein wenig überrascht, wie rau seine Haut ist, vermutlich noch an die Weichheit der Jugend gewöhnt. »In dem Jahr, nachdem du deinen Doktor gemacht hattest. Da waren wir schon ein paar Jahre zusammen, aber du – wir – wir wollten beide warten, bis du mit der Promotion fertig warst.«
Klingt sinnvoll, denke ich, obwohl es mir ein wenig zu vernünftig vorkommt. Ich frage mich, ob ich überhaupt wild darauf war, ihn zu heiraten.
Als könnte er meine Gedanken lesen, sagt er: »Wir waren sehr verliebt«, und schiebt dann nach: »Wir sind es noch immer.«
Dazu fällt mir nichts ein. Er lächelt. Er trinkt einen Schluck Kaffee, ehe er wieder das Album auf seinem Schoß mustert. Er blättert ein paar Seiten weiter.
»Du hast englische Literatur studiert«, sagt er. »Dann hast du verschiedene Jobs gehabt, nach der Uni. Nur Gelegenheitsjobs. Als Sekretärin. Verkäuferin. Ich glaube, eigentlich wusstest du nicht so recht, was du machen wolltest. Ich hab meinen Bachelor gemacht und dann eine Lehrerausbildung. Ein paar Jahre lang mussten wir uns ziemlich nach der Decke strecken, aber dann bekam ich eine Beförderung, und na ja, so haben wir’s bis hierher geschafft.«
Ich schaue mich im Wohnzimmer um. Es ist elegant, behaglich. Bürgerliche Langeweile. Über dem Kamin eine gerahmte Waldlandschaft, neben der Uhr auf dem Kaminsims Porzellanfigürchen. Ich frage mich, ob ich diese Deko mit ausgesucht habe.
Ben redet weiter. »Ich unterrichte an der Mittelschule, hier ganz in der Nähe. Ich bin jetzt Fachbereichsleiter.« Er sagt das ohne einen Anflug von Stolz.
»Und ich?«, frage ich, obwohl ich die einzig mögliche Antwort in Wahrheit schon weiß. Er drückt meine Hand.
»Du konntest nicht mehr arbeiten. Nach dem Unfall. Du bist nicht berufstätig.« Offenbar spürt er meine Enttäuschung. »Musst du auch nicht. Ich verdiene nicht schlecht. Wir kommen zurecht. Es geht uns gut.«
Ich schließe die Augen, lege eine Hand an die Stirn. Das wird mir alles zu viel, und ich möchte, dass er den Mund hält. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so viel auf einmal verarbeiten kann, und wenn er immer noch mehr draufpackt, fahre ich irgendwann aus der Haut.
Aber was mache ich denn den lieben langen Tag?, möchte ich fragen, aber weil ich die Antwort fürchte, sage ich nichts.
Er hat seinen Toast aufgegessen und bringt das Tablett in die Küche. Als er zurückkommt, trägt er einen Mantel.
»Ich muss zur Arbeit«, sagt er. Ich merke, wie ich mich innerlich verkrampfe.
»Keine Sorge«, sagt er. »Alles wird gut. Ich ruf dich an. Versprochen. Denk immer dran, heute unterscheidet sich in nichts von irgendeinem anderen Tag. Alles wird gut.«
»Aber –«, setze ich an.
»Ich muss los«, sagt er. »Tut mir leid. Aber vorher zeig ich dir noch rasch ein paar Dinge, die du vielleicht brauchst.«
In der Küche erklärt er, in welchen Schränken ich was finde, zeigt mir ein paar Reste im Kühlschrank, die ich am Mittag essen kann, und deutet auf eine an die Wand geschraubte Wischtafel neben einem schwarzen Textmarker an einem Stück Kordel. »Hier schreibe ich manchmal Nachrichten für dich auf«, sagt er. Ich sehe, dass er das Wort Freitag in akkuraten, gleichmäßigen Großbuchstaben hingeschrieben hat und darunter die Worte Wäsche? Spaziergang? (Telefon mitnehmen!) Fernsehen? Unter dem Wort Lunch hat er notiert, dass im Kühlschrank noch etwas Lachs vom Vortag ist, und Salat? hinzugefügt. Am Schluss hat er geschrieben, dass er gegen sechs wieder zu Hause sein müsste. »Du hast auch ein Notizbuch«, sagt er. »In deiner Handtasche. Hinten drin stehen wichtige Telefonnummern und unsere Adresse, falls du dich verläufst. Außerdem ist ein Handy drin –«
»Ein was?«, sage ich.
»Ein Telefon«, sagt er. »Schnurlos. Mobil. Du kannst es überall benutzen. Außerhalb des Hauses, überall. Es ist in deiner Handtasche. Schau aber lieber noch mal nach, falls du weggehst.«
»Mach ich«, sage ich.
»Prima«, sagt er. Wir gehen in die Diele, und er nimmt eine abgegriffene Ledertasche, die neben der Tür steht. »Dann geh ich jetzt.«
»Okay«, sage ich. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich fühle mich wie ein Kind, das nicht zur Schule darf und allein zu Hause bleibt, während die Eltern zur Arbeit gehen. Fass nichts an, höre ich ihn im Kopf sagen. Vergiss nicht, deine Medizin zu nehmen.
Er kommt zu mir herüber. Er küsst mich, auf die Wange. Ich hindere ihn nicht daran, aber ich erwidere den Kuss auch nicht. Er wendet sich zur Tür und will sie schon öffnen, als er verharrt.
»Ach ja!«, sagt er und dreht sich zu mir um. »Das hätte ich beinah vergessen!« Seine Stimme klingt plötzlich gezwungen, die Begeisterung gespielt. Er strengt sich richtig an, natürlich zu wirken; offensichtlich hat er sich schon länger innerlich darauf vorbereitet, das zu sagen, was nun kommt.
Und dann ist es doch nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. »Heute Abend fahren wir weg«, sagt er. »Nur übers Wochenende. Es ist unser Jahrestag, und da hab ich mir gedacht, ich buch uns ein Zimmer. Ist das in Ordnung?«
Ich nicke. »Klingt doch nett«, sage ich.
Er lächelt, wirkt erleichtert. »Mal was, worauf man sich freuen kann, nicht? Ein bisschen Seeluft? Wird uns guttun.« Er wendet sich wieder zur Tür und öffnet sie. »Ich ruf dich später an«, sagt er. »Frag nach, wie du zurechtkommst, ja?«
»Ja«, sage ich. »Mach das. Bitte.«
»Ich liebe dich, Christine«, sagt er. »Vergiss das nie.«
Er schließt die Tür hinter sich, und ich drehe mich um. Ich gehe zurück in die Küche.
Später am Vormittag sitze ich in einem Sessel. Der Abwasch ist erledigt und steht ordentlich auf dem Abtropfständer, die Wäsche ist in der Maschine. Ich habe mich beschäftigt.
Aber jetzt fühle ich mich leer. Es stimmt, was Ben sagt. Ich habe keine Erinnerung. Nichts. Es gibt keinen Gegenstand in diesem Haus, den ich meine, schon einmal gesehen zu haben. Kein einziges Foto – weder rings um den Spiegel oben im Bad noch in dem Album vor mir – löst eine Erinnerung daran aus, wann es aufgenommen wurde. Ich kann mich an keinen Moment mit Ben erinnern außer heute Morgen, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mein Kopf fühlt sich vollkommen leer an.
Ich schließe die Augen, versuche, mich auf etwas zu konzentrieren. Irgendetwas. Gestern. Letztes Weihnachten. Irgendein Weihnachten. Meine Hochzeit. Da ist nichts.
Ich stehe auf. Ich gehe durchs Haus, von Zimmer zu Zimmer. Langsam. Ziellos, wie ein Gespenst. Ich lasse meine Hand an den Wänden entlanggleiten, über Tische und Möbel, ohne jedoch etwas richtig zu berühren. Wie bin ich hier gelandet?, denke ich. Ich sehe mir die Teppiche an, die gemusterten Läufer, die Porzellanfigürchen auf dem Kaminsims und die Zierteller auf den Regalen im Esszimmer. Ich versuche, mir einzureden, dass das mir gehört. Alles mir gehört. Mein Zuhause, mein Mann, mein Leben. Aber diese Dinge gehören nicht zu mir. Sie sind nicht Teil von mir. Im Schlafzimmer öffne ich die Kleiderschranktür und sehe Reihen von Kleidungsstücken, die ich nicht kenne, ordentlich aufgehängt, wie leere Versionen einer Frau, der ich nie begegnet bin. Einer Frau, durch deren Haus ich wandere, deren Seife und Shampoo ich benutzt habe, deren Morgenmantel ich ausgezogen habe und deren Hausschuhe ich trage. Sie bleibt mir verborgen, eine geisterhafte Präsenz, distanziert und unberührbar. Heute Morgen habe ich mit schlechtem Gewissen meine Unterwäsche ausgewählt, habe zwischen Slips, Socken und Strumpfhosen gekramt, als hätte ich Angst, ertappt zu werden. Ich hielt die Luft an, als ich ganz hinten in der Schublade Dessous aus Seide und Spitze fand, die eindeutig nicht nur getragen, sondern auch gesehen werden sollen. Ich sortierte alles wieder genauso, wie ich es vorgefunden hatte, nahm nur einen blassblauen Slip heraus, zu dem es einen ähnlichfarbigen BH gab, und zog beides an, ehe ich dicke Socken überstreifte, dann eine Hose und eine Bluse.
Ich setzte mich an den Frisiertisch und musterte mein Gesicht im Spiegel, näherte mich vorsichtig meinem Bild an. Ich strich über die Linien auf meiner Stirn, die Hautfalten unter den Augen. Ich lächelte und betrachtete meine Zähne, die Fältchen, die sich um die Mundwinkel zusammenzogen, die Krähenfüße, die sichtbar wurden. Ich bemerkte Flecken auf meiner Haut, eine Verfärbung auf der Stirn, die aussah wie ein nicht ganz verblasster Bluterguss. Ich sah mich nach Make-up um und schminkte mich ein bisschen. Ein wenig Puder, ein Hauch Rouge. Ich stellte mir eine Frau vor – meine Mutter, wie mir nun klar ist –, die dasselbe tat und es ihre Kriegsbemalung nannte, und heute Morgen, als ich meinen Lippenstift mit einem Kosmetiktuch betupfte und den Lidstrich noch einmal nachzog, schien das Wort genau passend. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in einen Kampf ziehen oder als würde ein Kampf auf mich zukommen.
Mich zur Schule schicken. Make-up auflegen. Ich versuchte, mir meine Mutter vorzustellen, wie sie etwas anderes tat. Irgendetwas. Vergeblich. Ich sah nur konturlose riesige Lücken zwischen winzigen Inseln der Erinnerung, Jahre der Leere.
Jetzt bin ich in der Küche und öffne Schränke: Nudeltüten, Reispackungen mit der Aufschrift Arborio, Dosen mit Kidneybohnen. Ich erkenne diese Nahrungsmittel nicht. Ich erinnere mich, Käse auf Toast gegessen zu haben, Fisch aus dem Kochbeutel, Sandwichs mit Corned Beef. Ich nehme eine Dose heraus, auf der Kichererbsen steht, ein Beutelchen mit etwas, das Couscous heißt. Ich weiß nicht, was diese Dinge sind, und erst recht nicht, wie man sie kocht. Wie überlebe ich denn dann, als Ehefrau?
Ich sehe zu der Wischtafel hoch, die Ben mir gezeigt hat, bevor er ging. Sie hat eine schmutziggraue Farbe, Worte sind daraufgeschrieben und weggewischt worden, ersetzt, verbessert, und jedes hat einen schwachen Rückstand hinterlassen. Ich frage mich, was ich wohl finden würde, wenn ich in der Zeit zurückgehen und die Schichten entziffern könnte, ob es möglich wäre, auf diese Weise in meine Vergangenheit einzutauchen, doch mir wird klar, dass es zwecklos wäre, selbst wenn es mir gelänge. Ich bin sicher, dass ich lediglich Botschaften und Listen finden würde, einzukaufende Lebensmittel, zu verrichtende Aufgaben.
Ist das wirklich mein Leben?, denke ich. Ist das alles, was ich bin? Ich nehme den Stift und schreibe eine weitere Notiz auf die Tafel. Für heute Abend packen?, lautet sie. Nichts Weltbewegendes, aber von mir.
Ich höre ein Geräusch. Eine Melodie, die aus meiner Handtasche kommt. Ich öffne sie und kippe den Inhalt aufs Sofa. Mein Portemonnaie, ein paar Taschentücher, Stifte, ein Lippenstift. Eine Puderdose, eine Quittung für zwei Kaffee. Ein Notizbuch, sehr klein, mit einem Blumenmuster auf dem Deckel und einem eingesteckten Stift.
Ich finde etwas, von dem ich annehme, dass es das Telefon sein muss, von dem Ben gesprochen hat – es ist klein, aus Plastik und mit einer Tastatur, die es wie ein Spielzeug aussehen lässt. Während es weiterklingelt, blinkt ein kleiner Bildschirm. Ich drücke einen Knopf, von dem ich hoffe, dass er der richtige ist.
»Hallo?«, sage ich. Die Stimme, die antwortet, ist nicht Bens.
»Hi«, sagt sie. »Christine? Spreche ich mit Christine Lucas?«
Ich will nicht antworten. Mein Nachname kommt mir so fremd vor wie heute Morgen mein Vorname. Ich habe das Gefühl, dass das bisschen fester Boden, das ich mühsam gewonnen habe, wieder verschwunden ist, durch Treibsand ersetzt.
»Christine? Sind Sie das?«
Wer kann das sein? Wer weiß, wo ich bin, wer ich bin? Ich begreife, dass es Gott weiß wer sein könnte. Ich spüre Panik in mir aufsteigen. Schon schwebt mein Finger über dem Knopf, der das Gespräch beenden wird.
»Christine? Ich bin’s. Dr. Nash. Bitte sagen Sie doch was.«
Der Name ist mir fremd, aber ich sage trotzdem: »Wer ist da?«
Die Stimme nimmt einen anderen Tonfall an. Erleichterung? »Hier spricht Dr. Nash«, sagt er. »Ihr Arzt.«
Ein neuer Panikschub. »Mein Arzt?«, frage ich. Ich bin nicht krank, will ich hinzufügen, aber noch nicht mal das weiß ich. Ich merke, wie mein Verstand ins Trudeln gerät.
»Ja«, sagt er. »Aber keine Angst. Wir arbeiten nur zusammen an Ihrem Gedächtnis. Ihnen fehlt nichts.«
Ich registriere seine Wortwahl. Wir arbeiten zusammen. Er ist also noch jemand, an den ich mich nicht erinnere.
»Was meinen Sie mit arbeiten?«, frage ich.
»Ich versuche, Ihnen dabei zu helfen, Fortschritte zu machen«, sagt er. »Herauszubekommen, was genau Ihre Gedächtnislücken hervorgerufen hat und ob wir irgendwas dagegen tun können.«
Das klingt vernünftig, aber mir kommt ein anderer Gedanke. Warum hat Ben mir nichts von diesem Arzt erzählt, ehe er heute Morgen zur Arbeit ging?
»Und wie?«, frage ich. »Was machen wir?«
»Wir treffen uns seit einigen Monaten häufiger. Etwa zweimal die Woche.«
Es scheint unmöglich. Noch jemand, den ich regelmäßig sehe und der bei mir keinerlei Eindruck hinterlassen hat.
Aber ich bin Ihnen noch nie begegnet, möchte ich sagen. Sie könnten Gott weiß wer sein.
Ich sage nichts. Dasselbe trifft auf den Mann zu, neben dem ich heute Morgen aufgewacht bin, und der hat sich als mein Ehemann entpuppt.
»Ich erinnere mich nicht«, sage ich stattdessen.
Seine Stimme wird weich. »Keine Sorge. Das weiß ich.« Wenn das stimmt, was er sagt, dann weiß er es nur allzu gut. Er erklärt mir, dass unser nächster Termin heute ist.
»Heute?«, frage ich. Ich überlege, was Ben mir am Morgen gesagt hat, denke an die Liste von Aufgaben an der Tafel in der Küche. »Aber mein Mann hat mir kein Wort davon gesagt.« Mir fällt auf, dass ich den Mann, neben dem ich aufgewacht bin, zum ersten Mal so bezeichne.
Ein kurzes Zögern am anderen Ende, dann sagt Dr. Nash: »Ich glaube nicht, dass Ben von unseren Treffen weiß.«
Ich registriere, dass er den Namen meines Mannes kennt, sage aber: »Das ist doch absurd! Wieso sollte er nicht? Er hätte es mir gesagt!«
Ein Seufzer. »Sie müssen mir vertrauen«, sagt er. »Ich kann Ihnen alles erklären, wenn wir uns sehen. Wir machen wirklich Fortschritte.«
Wenn wir uns sehen. Wie soll das gehen? Der Gedanke, ohne Ben das Haus zu verlassen, ohne dass er auch nur weiß, wo ich bin oder bei wem, macht mir Angst.
»Tut mir leid«, sage ich. »Ich kann nicht.«
»Christine«, sagt er. »Es ist wichtig. Wenn Sie in Ihrem Notizbuch nachsehen, werden Sie feststellen, dass ich die Wahrheit sage. Haben Sie es da? Es müsste in Ihrer Tasche sein.«
Ich nehme das Büchlein mit dem Blumenmuster vom Sofa und sehe erschrocken die Jahreszahl, die in goldenen Lettern auf dem Einband steht. Zweitausendsieben. Zwanzig Jahre weiter, als es sein sollte.
»Ja.«
»Schauen Sie auf das Datum von heute«, sagt er. »Dreißigster November. Da müsste unser Termin stehen.«
Ich begreife nicht, wie es November sein kann – morgen Dezember –, aber ich blättere trotzdem die hauchdünnen Seiten bis zum heutigen Datum durch. Dort steckt zwischen den Blättern ein gelber Zettel, und darauf steht in einer Handschrift, die ich nicht kenne: 30. November – Termin bei Dr. Nash. Darunter steht: Nicht Ben sagen. Ich frage mich, ob er das gelesen hat, ob er meine Sachen durchsieht.
Ich befinde, dass es dafür keinen Grund gibt. Die anderen Tage sind ohne Einträge. Keine Geburtstage, keine abendlichen Verabredungen, keine Partys. Gibt das hier wirklich mein Leben wieder?
»Okay«, sage ich.
Er erklärt, dass er herkommen und mich abholen wird, dass er weiß, wo ich wohne, und dass er in einer Stunde da sein wird.
»Aber mein Mann«, sage ich.
»Das geht in Ordnung. Wir sind längst wieder zurück, wenn er nach Hause kommt. Versprochen. Vertrauen Sie mir.«
Die Uhr auf dem Kaminsims schlägt, und ich schaue zu ihr rüber. Sie ist altmodisch, ein großes Zifferblatt mit römischen Zahlen in einem Holzgehäuse. Sie zeigt halb zwölf an. Daneben liegt ein silberner Schlüssel, um sie aufzuziehen, etwas, woran Ben bestimmt jeden Abend denkt. Sie sieht beinahe aus wie eine Antiquität, und ich frage mich, wie wir an so eine Uhr gekommen sind. Vielleicht hat sie keine Geschichte, oder zumindest keine mit uns, sondern ist einfach nur ein Stück, das wir irgendwo gesehen haben, in einem Geschäft oder auf dem Flohmarkt, und einem von uns gefiel sie. Wahrscheinlich Ben, denke ich. Ich merke, dass sie mir nicht gefällt.
Ich treffe mich nur dieses eine Mal mit ihm, denke ich. Und dann, wenn Ben heute Abend nach Hause kommt, werde ich es ihm erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihm so etwas verschwiegen habe. Wo ich doch völlig abhängig von ihm bin.
Aber Dr. Nashs Stimme hat etwas seltsam Vertrautes. Anders als Ben kommt er mir nicht absolut fremd vor. Irgendwie fällt es mir bei ihm sogar fast leichter zu glauben, dass ich ihm schon mal begegnet bin, als bei meinem Mann.
Wir machen Fortschritte, hat er gesagt. Ich muss wissen, was für Fortschritte er meint.
»Okay«, sage ich. »Kommen Sie her.«
Als Dr. Nash eintrifft, schlägt er vor, irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen. »Was halten Sie davon?«, fragt er. »Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, den weiten Weg bis zu meiner Praxis zu fahren. Ich wollte heute eigentlich sowieso nur mit Ihnen reden.«
Ich nicke und sage ja. Ich war im Schlafzimmer, als er ankam, und beobachtete, wie er seinen Wagen parkte und abschloss, sah, wie er sich durchs Haar fuhr, die Jacke glattstrich und seine Aktentasche nahm. Das ist er nicht, dachte ich, als er den Arbeitern zunickte, die Werkzeug aus einem Lkw luden, doch dann kam er den Weg zu unserem Haus hoch. Er sah jung aus – zu jung, um Arzt zu sein –, und ich hatte nicht erwartet, dass er ein Sportsakko und eine graue Cordhose tragen würde, obwohl ich nicht weiß, was ich erwartet hatte.
»Am Ende der Straße ist ein Park«, sagt er. »Ich glaube, da gibt’s auch ein Café. Sollen wir dahin?«
Wir gehen zusammen los. Die Kälte ist schneidend, und ich ziehe meinen Schal fester um den Hals. Ich bin froh über das Handy in meiner Tasche, das Ben mir gegeben hat. Und froh, dass Dr. Nash nicht darauf bestanden hat, irgendwo hinzufahren. Ein Teil von mir vertraut diesem Mann, aber ein anderer, größerer Teil sagt mir, er könnte Gott weiß wer sein. Ein Fremder.
Ich bin eine erwachsene Frau, aber ich bin beschädigt. Es wäre für diesen Mann ein Leichtes, mich irgendwohin zu bringen, obwohl ich nicht weiß, was er dann mit mir machen wollte. Ich bin verletzlich wie ein Kind.
An der Hauptstraße, an die auf der anderen Seite der Park grenzt, müssen wir auf eine Lücke im fließenden Verkehr warten. Die Stille zwischen uns ist bedrückend. Eigentlich wollte ich ihm erst Fragen stellen, wenn wir in dem Café sind, doch urplötzlich rede ich los. »Was für eine Art Arzt sind Sie?«, frage ich. »Was machen Sie? Wie sind Sie an mich gekommen?«
Er schaut mich an. »Ich bin Neuropsychologe«, sagt er. Er lächelt. Ich würde gern wissen, ob ich ihm diese Frage jedes Mal stelle, wenn wir uns treffen. »Mein Spezialgebiet sind Patienten mit Hirnstörungen, und ich befasse mich schwerpunktmäßig mit neueren funktionellen, bildgebenden Verfahren in der Neurologie. Ich interessiere mich schon länger vor allem für die Erforschung von Erinnerungsprozessen und -funktionen. Ich habe in der einschlägigen Fachliteratur über Sie gelesen und Sie ausfindig gemacht. Es war nicht sehr schwer.«
Hinter einem Auto, das weiter vorn um die Kurve kommt, tut sich endlich eine Lücke auf. »Fachliteratur?«
»Ja. Es gibt ein paar Fallstudien über Sie. Ich hab mich mit der Einrichtung in Verbindung gesetzt, in der Sie behandelt wurden, ehe Sie wieder nach Hause konnten.«
»Warum? Warum wollten Sie mich finden?«
Er lächelt. »Weil ich dachte, dass ich Ihnen helfen kann. Ich arbeite schon länger mit Patienten, die ähnliche Probleme haben. Ich bin überzeugt, dass man ihnen helfen kann, aber sie benötigen eine intensivere Behandlung als die übliche eine Stunde pro Woche. Ich hatte ein paar Ideen, wie sich echte Fortschritte erzielen ließen, und wollte ein paar davon ausprobieren.« Er stockt kurz. »Außerdem habe ich eine Arbeit über Ihren Fall geschrieben. Die maßgebliche Arbeit, könnte man sagen.« Er lacht, verstummt aber wieder, als ich nicht mitlache. Er räuspert sich. »Ihr Fall ist ungewöhnlich. Ich glaube, wir können sehr viel mehr über die Funktionsweise des Gedächtnisses erfahren, als wir derzeit wissen.«
Das Auto fährt vorbei, und wir überqueren die Straße. Ich merke, dass ich unruhig werde, angespannt. Hirnstörungen. Erforschung. Sie ausfindig gemacht. Ich versuche, ruhig zu atmen, mich zu entspannen, aber es gelingt mir nicht. Es gibt mich jetzt zweimal, in demselben Körper; die eine ist eine siebenundvierzigjährige Frau, ruhig, höflich, die weiß, welches Verhalten angemessen ist und welches nicht, und die andere ist Mitte zwanzig, und sie schreit. Ich kann nicht entscheiden, welche ich bin, aber die einzigen Geräusche, die ich höre, sind die Autos und der Lärm der Kinder im Park, daher vermute ich, dass ich die erste bin.
Auf der anderen Straßenseite bleibe ich stehen und sage: »Hören Sie, was ist eigentlich los? Ich bin heute Morgen in einem Haus aufgewacht, das ich noch nie gesehen habe, in dem ich aber anscheinend wohne. Ich lag neben einem Mann, den ich nicht kenne und der mir sagt, dass ich seit über zwanzig Jahren mit ihm verheiratet bin. Und Sie scheinen mehr über mich zu wissen als ich selbst.«
Er nickt bedächtig. »Sie haben Amnesie«, sagt er und legt eine Hand auf meinen Arm. »Sie haben schon sehr lange Amnesie. Sie können keine neuen Erinnerungen speichern, daher haben Sie so ziemlich alles vergessen, was Sie als Erwachsene erlebt haben. Jeden Tag wachen Sie auf, als wären Sie eine junge Frau. An manchen Tagen wachen Sie als Kind auf.«
Irgendwie klingt es noch schlimmer, wenn er, ein Arzt, es ausspricht. »Dann ist es also wahr?«
»Leider ja. Der Mann bei Ihnen zu Hause ist Ihr Ehemann Ben. Sie haben vor vielen Jahren geheiratet. Lange vor Beginn Ihrer Amnesie.« Ich nicke. »Sollen wir weitergehen?«
Ich sage ja, und wir gehen in den Park. Ein Pfad verläuft außen herum, und in der Nähe ist ein Kinderspielplatz gleich neben einer Hütte, aus der ich Leute kommen sehe, die Tabletts mit Essen und Getränken tragen. Wir gehen in das Café, und ich setze mich an einen der rissigen Resopaltische, während Dr. Nash an der Theke Kaffee für uns bestellt.
Als er zurückkommt, hat er in jeder Hand einen Plastikbecher mit starkem Kaffee, seiner mit, meiner ohne Milch. Er löffelt Zucker aus der Dose auf dem Tisch in seinen Kaffee, ohne mir welchen anzubieten, und das überzeugt mich mehr als alles andere, dass wir uns schon vorher begegnet sind. Er blickt auf und fragt mich, wie ich mich an der Stirn verletzt habe.
»Was –?«, sage ich zuerst, doch dann fällt mir der Bluterguss ein, den ich heute Morgen gesehen habe. Mein Make-up hat ihn offensichtlich nicht kaschiert. »Das da?«, sage ich. »Ich weiß nicht. Ist jedenfalls nicht weiter schlimm. Tut gar nicht weh.«
Er antwortet nicht. Er rührt in seinem Kaffee.
»Mein Mann kümmert sich also zu Hause um mich?«, frage ich.
Er blickt auf. »Ja, aber das war nicht immer so. Zuerst war Ihr Zustand so ernst, dass Sie rund um die Uhr betreut werden mussten. Erst seit einiger Zeit kann Ben Sie allein versorgen.«
Dann ist das, wie ich mich jetzt fühle, also eine Verbesserung. Ich bin froh, dass ich mich nicht an die Zeit erinnern kann, in der es schlechter um mich stand. »Er muss mich sehr lieben«, sage ich, eher zu mir selbst als zu Dr. Nash.
Er nickt. Eine Pause entsteht. Wir trinken beide einen Schluck Kaffee. »Ja. Das muss er wohl.«
Ich lächele und schaue nach unten, auf meine Hände, die den heißen Becher halten, auf den goldenen Ehering, die kurzen Fingernägel, auf meine sittsam gekreuzten Beine. Ich erkenne meinen eigenen Körper nicht.
»Warum weiß mein Mann nicht, dass wir uns treffen?«, frage ich.
Er seufzt und schließt die Augen. »Ich will ehrlich sein«, sagt er, faltet die Hände und beugt sich auf seinem Stuhl vor. »Zu Anfang habe ich Sie gebeten, Ben nicht zu erzählen, dass Sie zu mir kommen.«
Jähe Angst durchfährt mich wie ein Echo. Aber er macht dennoch einen vertrauenerweckenden Eindruck.
»Reden Sie weiter«, sage ich. Ich möchte glauben, dass er mir helfen kann.
»Viele Leute – Ärzte, Psychiater, Psychologen und so weiter – sind in der Vergangenheit an Sie und Ben herangetreten, weil sie mit Ihnen arbeiten wollten. Aber er hat sich heftig dagegen gesträubt, Sie von diesen Spezialisten behandeln zu lassen. Er hat klipp und klar gesagt, Sie wären schon genug therapiert worden und es hätte seiner Meinung nach nichts gebracht, außer Sie aufgeregt. Natürlich wollte er Ihnen – und sich selbst – weitere Aufregungen ersparen.«
Natürlich; er will nicht, dass ich mir falsche Hoffnungen mache. »Also haben Sie mich dazu überredet, mich mit Ihnen zu treffen, ohne dass er davon weiß?«
»Ja. Allerdings habe ich mich zuerst an Ben gewandt. Wir haben telefoniert. Ich habe ihn sogar um ein Treffen gebeten, weil ich ihm erläutern wollte, was ich zu bieten habe, aber er hat abgelehnt. Daraufhin habe ich Sie direkt kontaktiert.«
Erneut durchfährt mich Angst, wie aus dem Nichts. »Wie das?«, frage ich.
Er blickt nach unten in seinen Becher. »Ich habe Sie abgefangen. Ich habe gewartet, bis Sie aus dem Haus kamen, und dann habe ich mich Ihnen vorgestellt.«
»Und ich war einverstanden, mich mit Ihnen zu treffen? Einfach so?«
»Anfangs nicht. Nein. Ich musste erst Ihr Vertrauen gewinnen. Ich habe vorgeschlagen, dass Sie einmal zu mir kommen, nur für eine Sitzung. Nötigenfalls ohne Bens Wissen. Ich habe gesagt, ich würde Ihnen erklären, warum ich wollte, dass Sie mit mir arbeiten, und was ich Ihnen meiner Meinung nach anbieten konnte.«
»Und ich war einverstanden.«
Er blickt auf. »Ja«, sagt er. »Ich habe gesagt, nach der ersten Sitzung läge es allein bei Ihnen, ob Sie es Ben erzählen wollen oder nicht, aber falls Sie sich dagegen entscheiden würden, würde ich Sie anrufen, um Sie an unsere Termine zu erinnern und so weiter.«
»Und ich habe mich dagegen entschieden.«
»Ja. Richtig. Sie meinten, Sie wollten damit lieber warten, bis wir Fortschritte machen. Sie hielten es für besser so.«
»Und?«
»Und was?«
»Machen wir Fortschritte?«
Er trinkt noch einen Schluck Kaffee, stellt den Becher wieder auf den Tisch. »Ich denke, ja. Obwohl es schwierig ist, Fortschritte exakt zu messen. Aber in den letzten paar Wochen scheinen Ihnen viele Erinnerungen wieder eingefallen zu sein – etliche davon zum ersten Mal, soweit wir wissen. Und es gibt gewisse Sachverhalte, die Ihnen häufiger bewusst sind, was früher nicht der Fall war. Sie erinnern sich zum Beispiel nach dem Aufwachen gelegentlich daran, dass Sie verheiratet sind. Und –« Er stockt.
»Und?«, sage ich.
»Und, na ja, Sie werden unabhängiger, denke ich.«
»Unabhängiger?«
»Ja. Sie verlassen sich nicht mehr so stark wie früher auf Ben. Oder auf mich.«
Das ist alles, denke ich. Das sind die Fortschritte, von denen er redet. Unabhängigkeit. Vielleicht meint er damit, dass ich ohne Begleitung in Läden oder eine Bibliothek gehen kann, obwohl ich mir im Augenblick nicht mal sicher bin, ob dem so ist. Jedenfalls habe ich noch nicht so viele Fortschritte gemacht, dass ich sie stolz meinem Mann vorführen könnte. Ich weiß ja offenbar noch immer nicht jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich überhaupt einen Mann habe.
»Und das ist alles?«
»Es ist wichtig«, sagt er. »Unterschätzen Sie das nicht, Christine.«
Ich sage nichts. Ich trinke einen Schluck Kaffee und schaue mich in dem Café um. Es ist fast leer. Aus der kleinen Küche ganz hinten dringen Stimmen, dann und wann ein Brodeln, wenn das Wasser in einer Teemaschine anfängt zu kochen, der Lärm spielender Kinder in der Ferne. Kaum zu glauben, dass ich ganz in der Nähe von diesem Lokal wohne, mich aber nicht erinnern kann, je hier gewesen zu sein.
»Sie sagen, wir treffen uns seit einigen Wochen«, sage ich zu Dr. Nash. »Was haben wir die ganze Zeit gemacht?«
»Erinnern Sie sich an unsere Sitzungen? An irgendetwas daraus?«
»Nein«, sage ich. »An gar nichts. Soviel ich weiß, sehe ich Sie heute zum ersten Mal.«
»Entschuldigen Sie die Frage«, sagt er. »Wie gesagt, manchmal haben Sie Erinnerungsblitze. Anscheinend wissen Sie an manchen Tagen mehr als an anderen.«
»Ich begreife das nicht«, sage ich. »Ich erinnere mich nicht daran, Ihnen je begegnet zu sein, oder was gestern passiert ist oder vorgestern oder auch letztes Jahr. Dagegen kann ich mich an manche Dinge erinnern, die Jahre her sind. Meine Kindheit. Meine Mutter. Ich erinnere mich daran, dass ich studiert habe, so halbwegs. Mir ist schleierhaft, wie diese Erinnerungen überlebt haben können, wenn doch alles andere wie weggewischt ist.«
Während ich rede, nickt er die ganze Zeit. Ich bin sicher, dass er das alles nicht zum ersten Mal hört. Vielleicht sage ich jede Woche dasselbe. Vielleicht führen wir immer das gleiche Gespräch.
»Das Gedächtnis ist eine komplizierte Angelegenheit«, sagt er. »Menschen haben ein Kurzzeitgedächtnis, das Fakten und Informationen etwa eine Minute lang speichern kann, aber auch ein Langzeitgedächtnis. Darin können wir gewaltige Mengen Informationen speichern, und das anscheinend unbegrenzt lange. Wie wir heute wissen, werden diese beiden Funktionen offenbar von verschiedenen Teilen des Gehirns gesteuert, zwischen denen neuronale Verbindungen bestehen. Ein Teil des Gehirns scheint außerdem dafür zuständig zu sein, kurzzeitige, vorübergehende Erinnerungen im Langzeitgedächtnis zu encodieren, so dass sie sehr viel später wieder abgerufen werden können.«
Er spricht locker, schnell, als wäre er jetzt auf sicherem Boden. Ich muss auch mal so gewesen sein, vermute ich; voller Selbstvertrauen.
»Es gibt zwei Hauptformen von Amnesie«, sagt er. »Die häufigste Form ist die, dass sich die betroffene Person nicht an vergangene Ereignisse erinnern kann, wobei die jüngsten Ereignisse am stärksten betroffen sind. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat einen Motorradunfall, dann erinnert er sich nicht an den Unfall oder die Tage oder Wochen davor, aber er kann sich durchaus an alles erinnern, was beispielsweise bis zu sechs Monate vor dem Unfall passiert ist.«
Ich nicke. »Und die andere Form?«
»Die ist seltener«, sagt er. »In manchen Fällen ist es unmöglich, Erinnerungen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Menschen mit dieser Störung leben im Augenblick, können sich nur an die unmittelbare Vergangenheit erinnern, und das nur für kurze Zeit.«
Er verstummt, als warte er darauf, dass ich etwas sage. Es ist, als hätte jeder von uns beiden seinen Text, als hätten wir dieses Gespräch schon oft geprobt.
»Und ich habe beides?«, frage ich. »Verlust der Erinnerungen, die ich hatte, plus die Unfähigkeit, neue zu bilden?«
Er räuspert sich. »Leider ja. Es ist nicht häufig, aber es kommt vor. Das Ungewöhnliche an Ihrem Fall ist allerdings das Muster Ihrer Amnesie. Die meiste Zeit haben Sie keinerlei zusammenhängende Erinnerung an irgendein Ereignis nach Ihrer frühen Kindheit, aber Sie scheinen neue Erinnerungen auf eine Weise zu verarbeiten, die mir völlig unbekannt ist. Wenn ich jetzt aus dem Raum gehen und zwei Minuten später zurückkommen würde, könnten sich die meisten Menschen mit anterograder Amnesie nicht erinnern, mich je gesehen zu haben, und schon gar nicht heute. Aber Sie scheinen sich an ganze Zeitabschnitte zu erinnern – bis zu vierundzwanzig Stunden –, die Sie dann wieder verlieren. Das ist untypisch. Offen gestanden, nach allem, was wir über die Funktionsweise des Gedächtnisses zu wissen meinen, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Ich vermute, dass Sie durchaus imstande sind, Dinge vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Ich verstehe bloß nicht, warum Sie sie nicht speichern können.«
Mein Leben mag ja zersprungen sein, aber wenigstens ist es in so große Stücke zersprungen, dass ich einen Schein von Unabhängigkeit wahren kann. Vermutlich kann ich mich glücklich schätzen.
»Was hat das verursacht?«, frage ich.
Er sagt nichts. Der Raum wird ruhig. Die Luft fühlt sich leblos an und stickig. Als er antwortet, scheinen seine Worte von den Wänden widerzuhallen. »Eine Schädigung des Gedächtnisses, sowohl des Langzeit- als auch des Kurzzeitgedächtnisses, kann viele Ursachen haben«, sagt er. »Krankheit, Unfall, Drogenmissbrauch. Die genaue Art der Schädigung ist offenbar unterschiedlich, je nachdem, welcher Teil des Gehirns betroffen ist.«
»Ja«, sage ich. »Aber was hat meine verursacht?«
Er sieht mich einen Moment lang an. »Was hat Ben Ihnen erzählt?«
Ich denke an unser Gespräch im Schlafzimmer zurück. Ein Unfall, hat er gesagt. Ein schlimmer Unfall.
»Er hat mir eigentlich nichts gesagt«, antworte ich. »Zumindest nichts Genaues. Er hat nur gesagt, dass ich einen Unfall hatte.«
»Ja«, sagt er und greift nach seiner Tasche unter dem Tisch. »Ihre Amnesie wurde durch ein Trauma ausgelöst. Das ist richtig, zumindest teilweise.« Er öffnet die Tasche und nimmt ein Buch heraus. Zuerst denke ich, er will seine Notizen konsultieren, doch stattdessen schiebt er das Buch über den Tisch zu mir herüber. »Christine, ich möchte, dass Sie sich das ansehen«, sagt er. »Es wird alles erklären. Besser, als ich das kann. Vor allem, was Ihren Zustand verursacht hat. Aber auch noch andere Dinge.«
Ich nehme das Buch in die Hand. Es ist braun, in Leder gebunden, mit einem Gummiband drum herum. Ich streife das Gummiband ab und schlage das Buch blind irgendwo auf. Das Papier ist dick, schwach liniert, mit einem roten Rand, und die Seiten sind eng beschrieben. »Was ist das?«, frage ich.
»Ein Tagebuch«, sagt er. »Das Sie in den letzten Wochen geführt haben.«
Ich bin schockiert. »Ein Tagebuch?« Ich frage mich, warum er es hat.
»Ja. Sozusagen ein Protokoll von dem, woran wir in den letzten Sitzungen gearbeitet haben. Ich hatte Sie gebeten, sich Notizen zu machen. Wir haben gemeinsam versucht herauszufinden, wie Ihr Gedächtnis genau funktioniert. Ich dachte, es könnte hilfreich sein, wenn Sie eine Art Protokoll über unsere Arbeit führen.«
Ich betrachte das Buch vor mir. »Dann habe ich das geschrieben?«
»Ja. Ich hatte Sie gebeten, einfach alles aufzuschreiben, was Ihnen in den Sinn kommt. So was machen viele Amnesiekranke, aber bei den meisten ist das nicht so hilfreich, wie man meint, weil sie nur eine ganz kurze Erinnerungsspanne haben. Aber da Sie sich an manche Dinge einen ganzen Tag lang erinnern können, sprach meiner Meinung nach nichts dagegen, dass Sie sich jeden Abend ein paar Notizen machen. Ich dachte, das könnte Ihnen vielleicht helfen, von einem Tag zum nächsten einen Erinnerungsfaden zu bewahren. Außerdem bin ich der Ansicht, dass das Gedächtnis wie ein Muskel ist, der durch Training gekräftigt werden kann.«
»Und Sie haben meine Eintragungen zwischendurch gelesen?«
»Nein«, sagt er. »Sie haben das Tagebuch nur für sich allein geführt.«
»Aber wie –?«, setze ich an und sage dann: »Hat Ben mich daran erinnert, mir Notizen zu machen?«
Er schüttelt den Kopf. »Ich habe Ihnen empfohlen, die Sache geheim zu halten«, sagt er. »Sie haben das Tagebuch zu Hause versteckt. Ich habe Sie regelmäßig angerufen und Ihnen gesagt, wo es ist.«
»Jeden Tag?«
»Ja. Mehr oder weniger.«
»Nicht Ben?«
Er zögert, dann sagt er: »Nein. Ben hat es nicht gelesen.«
Ich wüsste gern, warum nicht, was für Sachen darin stehen, die ich meinem Mann vorenthalten möchte. Was für Geheimnisse mag ich haben? Geheimnisse, von denen ich selbst nichts weiß.
»Aber Sie haben es gelesen?«
»Vor ein paar Tagen haben Sie es mir dagelassen«, sagt er. »Sie haben gesagt, ich soll es lesen. Es wäre an der Zeit.«
Ich starre auf das Buch. Ich bin gespannt. Ein Tagebuch. Eine Verbindung zu einer verlorenen Vergangenheit, auch wenn sie nicht lange zurückliegt.
»Haben Sie alles gelesen?«
»Das meiste, ja«, sagt er. »Jedenfalls glaube ich, dass ich alles gelesen habe, was wichtig ist.« Er stockt, wendet den Blick ab, kratzt sich im Nacken. Verlegen, denke ich. Ich frage mich, ob er die Wahrheit sagt, was den Inhalt des Buches betrifft. Er trinkt den letzten Schluck von seinem Kaffee und sagt: »Ich habe Sie nicht genötigt, es mir zu zeigen. Ich möchte, dass Sie das wissen.«
Ich nicke und trinke schweigend meinen Kaffeebecher leer, während ich die Buchseiten durchblättere. Auf der Innenseite des Deckels steht eine Liste mit Daten. »Was ist damit?«, frage ich.
»Das sind die Tage, an denen wir uns getroffen haben«, sagt er. »Plus die Termine, die wir geplant hatten. Wir haben immer wieder neue ausgemacht. Ich habe Sie dann angerufen, um Sie daran zu erinnern, und Sie gebeten, in Ihr Tagebuch zu schauen.«
Ich denke an den gelben Zettel, der heute in meinem Notizbuch steckte. »Und heute?«
»Heute hatte ich Ihr Tagebuch«, sagt er. »Deshalb hatte ich Ihnen stattdessen einen Zettel geschrieben.«
Ich nicke und schaue den Rest des Buches durch. Es ist mit einer engen Handschrift gefüllt, die ich nicht erkenne. Seite um Seite. Die Arbeit vieler Tage.
Ich frage mich, wie ich die Zeit dafür gefunden habe, doch dann denke ich an die Tafel in der Küche, und die Antwort liegt auf der Hand. Ich hatte sonst nichts zu tun.
Ich lege es wieder auf den Tisch. Ein junger Mann in Jeans und T-Shirt kommt herein und blickt kurz zu uns herüber, ehe er etwas zu trinken bestellt und sich mit einer Zeitung an einen Tisch setzt. Er schaut nicht noch einmal hoch, um mich anzusehen, und mein zwanzigjähriges Ich ist beleidigt. Ich fühle mich unsichtbar.
»Gehen wir?«, sage ich.
Wir spazieren denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Der Himmel hat sich zugezogen, und ein dünner Nebel hängt in der Luft. Der Boden unter den Füßen fühlt sich durchweicht an; ich habe das Gefühl, über Treibsand zu gehen. Auf dem Spielplatz sehe ich ein Kinderkarussell, das langsam kreist, obwohl niemand darauf fährt.
»Treffen wir uns normalerweise nicht hier?«, frage ich, als wir die Hauptstraße erreichen. »In dem Café, meine ich.«
»Nein. Normalerweise treffen wir uns in meiner Praxis. Wir machen Übungen. Tests und so.«
»Warum sind wir dann heute hier?«
»Ich wollte Ihnen wirklich nur das Buch zurückgeben«, sagt er. »Es hat mich beunruhigt, dass Sie es nicht hatten.«
»Bin ich irgendwie darauf angewiesen?«, frage ich.
»In gewisser Weise, ja.«
Wir überqueren die Straße und nähern uns wieder dem Haus, das ich mit Ben bewohne. Ich kann Dr. Nashs Auto sehen, das noch immer an der Stelle parkt, wo er es abgestellt hat, den kleinen Garten vor unserem Fenster, den kurzen Weg und die gepflegten Blumenbeete. Noch immer kann ich nicht richtig glauben, dass das mein Zuhause ist.
»Möchten Sie mit reinkommen?«, frage ich. »Noch etwas trinken?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein. Nein danke, lieber nicht. Ich muss los. Julie und ich haben heute Abend was vor.«
Er bleibt kurz stehen und sieht mich an. Mir fällt sein Haar auf, kurz geschnitten und ordentlich gescheitelt, und dass sein Hemd senkrechte Streifen hat, die nicht zu den Querstreifen auf seinem Pullover passen. Mir wird klar, dass er nur ein paar Jahre älter ist, als ich heute Morgen beim Aufwachen zu sein glaubte. »Julie ist Ihre Frau?«
Er lächelt und schüttelt den Kopf. »Nein, meine Freundin. Genauer gesagt, meine Verlobte. Wir haben uns verlobt. Das vergesse ich immer wieder.«
Ich erwidere sein Lächeln. Das sind die Details, an die ich mich erinnern sollte, vermute ich. Die kleinen Dinge. Vielleicht habe ich solche Trivialitäten in meinem Buch aufgeschrieben, diese kleinen Häkchen, an denen sich ein ganzes Leben festmacht.
»Glückwunsch«, sage ich, und er bedankt sich.
Ich habe das Gefühl, dass ich noch mehr fragen, mehr Interesse zeigen sollte, aber das hätte wenig Sinn. Alles, was er mir erzählt, werde ich vergessen haben, wenn ich morgen aufwache. Das Heute ist alles, was ich habe. »Ich glaube, ich muss mich ohnehin sputen«, sage ich. »Wir fahren nämlich übers Wochenende weg. Ans Meer. Ich muss noch packen …«
Er lächelt. »Auf Wiedersehen, Christine«, sagt er. Er wendet sich zum Gehen, doch dann dreht er sich noch einmal um. »In Ihrem Tagebuch stehen meine Nummern«, sagt er. »Vorne drin. Rufen Sie mich an, falls Sie sich mit mir treffen möchten. Um Ihre Behandlung fortzusetzen, meine ich. Okay?«
»Falls?«, sage ich. Ich erinnere mich an die Termine, die im Tagebuch stehen und die von jetzt bis zum Ende des Jahres gehen. »Ich dachte, wir hätten weitere Sitzungen vereinbart?«
»Sie werden es verstehen, wenn Sie das Tagebuch lesen«, sagt er. »Dann ergibt alles einen Sinn. Versprochen.«
»Okay«, sage ich. Ich merke, dass ich ihm vertraue, und das macht mich froh. Froh, dass ich nicht nur auf meinen Mann bauen kann.
»Es liegt an Ihnen, Christine. Rufen Sie mich an, wann immer Sie wollen.«
»Mach ich«, sage ich, und dann winkt er, steigt in sein Auto, fährt nach einem kurzen Blick über die Schulter los und ist fort.
Ich mache mir eine Tasse Kaffee und nehme sie mit ins Wohnzimmer. Von draußen höre ich jemanden pfeifen, immer wieder unterbrochen von lauten Bohrgeräuschen und gelegentlichem meckernden Lachen, doch auch das schwächt sich zu einem leisen Hintergrundsummen ab, als ich mich in den Sessel setze. Die Sonne scheint dünn durch die Gardinen, und ich spüre ihre matte Wärme auf Armen und Oberschenkeln. Ich hole das Tagebuch aus meiner Tasche.
Ich bin nervös. Ich weiß nicht, was das Buch enthält. Welche Erschütterungen und Überraschungen. Welche Geheimnisse. Ich sehe das Album auf dem Couchtisch liegen. Darin ist eine Version meiner Vergangenheit, aber eine, die Ben ausgewählt hat. Enthält das Tagebuch eine andere? Ich schlage es auf.
Die erste Seite ist unliniert. Ich habe meinen Namen in schwarzer Tinte in die Mitte geschrieben. Christine Lucas. Es ist ein Wunder, dass ich nicht Vertraulich! darunter geschrieben habe. Oder Finger weg!.
Es ist etwas anderes hinzugefügt worden. Etwas Unerwartetes, Beängstigendes. Beängstigender als alles, was ich heute gesehen habe. Da, unter meinem Namen, stehen drei Wörter in blauer Tinte und Großbuchstaben.
VERTRAUE BEN NICHT.
Mir bleibt nichts anderes übrig, ich blättere um.
Ich beginne, meine Geschichte zu lesen.
Teil zweiDas Tagebuch der Christine Lucas
Freitag, 9. November
Ich heiße Christine Lucas. Ich bin siebenundvierzig. Ich habe Amnesie. Ich sitze hier in diesem mir fremden Bett und schreibe meine Geschichte auf, während ich ein Nachthemd trage, das der Mann unten – der sagt, dass er mein Ehemann ist, dass er Ben heißt – angeblich zu meinem sechsundvierzigsten Geburtstag für mich gekauft hat. Das Zimmer ist still, und das einzige Licht kommt von der Lampe auf dem Nachttisch – ein sanfter orangegelber Schein. Ich komme mir vor, als würde ich schwerelos in einem Tümpel aus Licht treiben.
Ich habe die Schlafzimmertür geschlossen. Ich schreibe das hier für mich allein. Heimlich. Ich kann meinen Mann unten im Wohnzimmer hören – das leise Seufzen des Sofas, wenn er sich vorbeugt oder aufsteht, ein gelegentliches Hüsteln, höflich unterdrückt –, aber ich werde dieses Tagebuch verstecken, wenn er nach oben kommt. Ich werde es unters Bett schieben oder unters Kissen. Ich möchte nicht, dass er mich darin schreiben sieht. Ich möchte ihm nicht erzählen müssen, woher ich es habe.
Ich schaue auf die Uhr auf dem Nachttisch. Es ist fast elf. Ich muss schnell schreiben. Bestimmt werde ich bald hören, wie der Fernseher ausgemacht wird, das Knarren eines Dielenbretts, wenn Ben den Raum durchquert, das Klicken eines Lichtschalters. Wird er in die Küche gehen und sich ein Glas Wasser eingießen? Oder wird er gleich hochkommen? Ich weiß es nicht. Ich kenne seine Rituale nicht. Ich kenne meine eigenen nicht.
Weil ich keine Erinnerungen habe. Laut Ben, laut dem Arzt, bei dem ich heute Nachmittag war, wird mein Gehirn diese Nacht, während ich schlafe, alles löschen, was ich heute weiß. Ich werde morgen früh so aufwachen, wie ich heute Morgen aufgewacht bin. In dem Glauben, ich wäre noch ein Kind. In dem Glauben, ich hätte noch ein ganzes Leben voller Entscheidungsmöglichkeiten vor mir.
Und dann werde ich wieder einmal feststellen, dass ich mich irre. Meine Entscheidungen sind bereits getroffen worden. Mein halbes Leben liegt hinter mir.