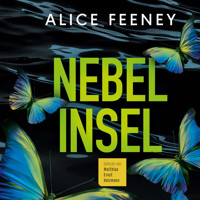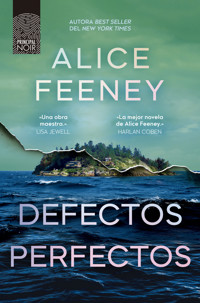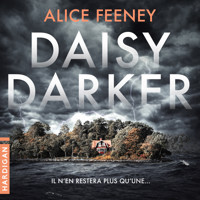9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Willkommen in Aimees Welt – einer Welt, in der alles eine Lüge zu sein scheint und es doch eine Wahrheit gibt. Ich bin Aimee Sinclair, jemand, von dem Du denkst, Du kennst ihn. Nur woher? Ich bin Schauspielerin, Ehefrau. Aber eine Mörderin? Mein Ehemann ist spurlos verschwunden, und die Polizei glaubt, ich verheimliche etwas. Glaubt, ich hätte ihn umgebracht. Obendrein scheint jemand zu wissen, woher ich komme, wer ich bin, was ich getan habe. Du lebst die Lüge, hast es immer getan, Dich immer als jemand anderes ausgegeben. Aber das ist nichts Neues, oder? Du hast schon oft gelogen. Immer. Die Lügen, die wir uns selbst auftischen, sind die gefährlichsten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alice Feeney
Ich weiß, wer du bist
Psychothriller
Über dieses Buch
Der neue Roman der New York Times- und internationalen Bestsellerautorin von «Manchmal lüge ich»
Du nennst dich Aimee Sinclair.
Du bist Schauspielerin, jeder kennt dich, niemand weiß, woher.
Doch ich weiß genau, wer du bist.
Was du getan hast.
Und ich beobachte dich.
Ich bin Aimee Sinclair, jemand, von dem du denkst, du kennst ihn. Nur woher? Ich bin Schauspielerin, Ehefrau. Aber eine Mörderin? Mein Ehemann ist spurlos verschwunden, und die Polizei glaubt, ich verheimliche etwas. Glaubt, ich hätte ihn umgebracht. Obendrein scheint jemand zu wissen, woher ich komme, wer ich bin, was ich getan habe.
«Was für eine Achterbahnfahrt, ich liebe dieses Buch und die brillanten Twists à la Hitchcock!» Sarah Michelle Gellar
Vita
Alice Feeney ist Journalistin und hat 15 Jahre als Nachrichtenredakteurin und Produzentin für BBC News gearbeitet. Sie hat in London und Sydney gelebt und sich mit ihrem Mann und ihrem Hund inzwischen in Surrey niedergelassen. Ihr Debütroman «Manchmal lüge ich» wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wird als TV-Serie von Ellen DeGeneres und Warner Bros. verfilmt, mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle.
«Eine kühne, originelle Stimme.» Clare Mackintosh
Sabine Längsfeld übersetzt bereits in zweiter Generation Literatur verschiedenster Genres aus dem Englischen in ihre Muttersprache. Zu den von ihr übertragenen Autorinnen und Autoren zählen unter anderem Anna McPartlin, Sara Gruen, Malala Yousafzai, Amitav Ghosh und Simon Beckett.
Karen Witthuhn übersetzt nach einem ersten Leben im Theater seit 2000 Theatertexte und Romane, u. a. von Simon Beckett, D. B. John, Ken Bruen, Sam Hawken, Percy Everett, Anita Nair, Alan Carter und George Pelecanos. 2015 und 2018 erhielt sie Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «I Know Who You Are» bei HQ/HarperCollins Publishers, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«I Know Who You Are» Copyright © 2019 by Diggi Books Ltd
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg,
nach der Originalausgabe von St. Martin's Press
Coverabbildung Dave Kennedy/Gallery Stock
ISBN 978-3-644-00434-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Nicht jeder möchte jemand sein. Manche wollen einfach nur jemand anderes sein.
1
LONDON, 2017
Ich bin diese Frau, die einem irgendwie bekannt vorkommt, man weiß nur nicht, woher.
Ich verdiene mein Geld mit Lügen. Das kann ich am besten: eine andere werden. Meine Augen sind das Einzige, was ich im Spiegel noch erkenne, wenn sie mir aus dem geschminkten Gesicht eines fiktiven Charakters entgegenstarren. Wieder eine neue Rolle, eine neue Geschichte, eine neue Lüge. Ich wende mich ab, bereit, sie zurückzulassen. Ich habe Feierabend, und im Vorbeigehen streift mein Blick die Aufschrift an der Garderobentür: AIMEE SINCLAIR.
Mein Name, nicht seiner. Ich habe ihn nicht abgegeben.
Vielleicht weil mir im Grunde immer klar gewesen ist, dass unsere Ehe nur so lange halten würde, bis uns das Leben in die Quere käme. Ich rufe mir in Erinnerung, dass mein Name mich nur bestimmt, wenn ich es zulasse. Er ist nichts weiter als eine Aneinanderreihung von Buchstaben; ein elterlicher Wunsch, ein Etikett, eine Lüge. Manchmal sehne ich mich danach, diese Buchstaben in etwas anderes zu verwandeln. In jemand anderes. Ein neuer Name für ein neues Ich. Das Ich, zu dem ich wurde, als niemand hinsah.
Den Namen eines Menschen zu kennen bedeutet nicht, den Menschen zu kennen.
Ich glaube, wir haben uns letzte Nacht kaputtgemacht.
Manchmal tun uns die, die uns am meisten lieben, am heftigsten weh, weil sie es können.
Er hat mir weh getan.
Wir haben die schlechte Angewohnheit entwickelt, einander zu verletzen. Um Dinge reparieren zu können, muss man sie vorher kaputt machen.
Ich habe ihm weh getan.
Ich sehe nach, ob ich daran gedacht habe, mein Buch in die Tasche zu stecken, so wie andere nach ihrem Geldbeutel oder dem Hausschlüssel sehen. Zeit ist kostbar, darf niemals verschwendet werden, und ich verbringe die Drehpausen am Set mit Lesen. Schon in meiner Kindheit habe ich am liebsten in erfundenen Wirklichkeiten gelebt, mich in die Geschichten anderer geflüchtet, die glücklicher verlaufen als meine eigene. Wir sind, was wir lesen. Als ich mir sicher bin, dass ich nichts vergessen habe, gehe ich davon, zurück zu wer und was und wo ich vorher war.
Letzte Nacht ist etwas Furchtbares passiert.
Ich habe mit Gewalt versucht, so zu tun, als wäre es nicht so, habe mit aller Macht versucht, meine Erinnerungen neu zu sortieren, aber ich höre seine hasserfüllte Stimme immer noch, spüre seine Hände um meinen Hals, sehe sein Gesicht vor mir, mit einem Ausdruck, den ich noch nicht kannte.
Ich kann es trotzdem wiedergutmachen. Ich kann uns wieder reparieren.
Die gefährlichsten Lügen sind die, die wir uns selbst erzählen.
Es war nur ein Streit. Wer wirklich liebt, der streitet auch, das ist schon immer so gewesen.
Ich laufe durch die vertrauten Flure der Pinewood Studios, lasse zwar meine Garderobe hinter mir, aber meine Gedanken und Ängste kommen mit. Meine Schritte wirken schleppend und unsicher, als wollten sie den Akt des Nachhausegehens absichtlich hinauszögern – aus Angst vor dem, was dort auf mich wartet.
Ich habe ihn geliebt, ich tue es immer noch.
Ich halte es für wichtig, das nicht zu vergessen. Wir waren nicht immer so wie heute. Das Leben formt Beziehungen um, wie das Meer den Strand umformt; es unterspült die Dünen aus Liebe und errichtet Uferbänke aus Hass. Ich habe ihm gestern Abend gesagt, dass es aus ist. Ich sagte ihm, ich wollte die Scheidung und dass ich es diesmal ernst meinte.
Habe ich nicht. Es ernst gemeint.
Ich steige in meinen Range Rover und fahre auf das ikonenhafte Studiotor zu, dem Unausweichlichen entgegen. Ich lege mich sorgsam in Falten, verstecke die Ecken und Kanten, die andere besser nicht zu sehen kriegen. Der Pförtner winkt mir zu, sein Gesicht eine freundliche Maske. Ich zwinge mich zurückzulächeln und fahre davon.
Für mich ging es bei der Schauspielerei nie darum, im Mittelpunkt zu stehen. Ich tue, was ich tue, weil ich nichts anderes kann und weil es das Einzige ist, was mich glücklich macht. Die schüchterne Schauspielerin ist für die meisten Menschen ein Oxymoron, aber auf mich trifft es tatsächlich zu. Nicht jeder möchte jemand sein. Manche wollen einfach nur jemand anderes sein. Zu spielen ist leicht, was mir schwerfällt, ist, ich zu sein. Ich muss mich vor fast jedem Interview oder Event übergeben. Sobald ich anderen Menschen als ich selbst gegenübertreten muss, werde ich körperlich krank und zum Nervenbündel. Doch wenn ich als eine andere die Bühne betrete oder vor der Kamera stehe, fühlt es sich an, als könnte ich fliegen.
Niemand versteht, wer ich wirklich bin. Nur er.
Mein Ehemann verliebte sich in die letzte Version von mir. Mein Erfolg ist noch recht frisch, und die Erfüllung meiner Träume war für ihn der Beginn seiner Albträume. Anfangs versuchte er, mich zu unterstützen, aber er wollte mich noch nie teilen. Trotzdem flickte er mich jedes Mal wieder zusammen, wenn die Angst mich zerfetzte. Was nett von ihm war, aber nicht uneigennützig. Um Befriedigung daraus zu ziehen, etwas zu reparieren, muss man es entweder eine Weile kaputt liegen lassen oder es selbst wieder kaputt machen.
Ich fahre langsam durch Londons hektische Straßen, probe stumm für das echte Leben, erhasche unerbetene, flüchtige Blicke auf mein erfundenes Selbst. Die sechsunddreißig Jahre alte Frau im Rückspiegel wirkt wütend, weil sie gezwungen ist, eine Maske zu tragen. Ich bin nicht schön, aber es heißt, ich hätte ein interessantes Gesicht. Meine Augen sind zu groß für den Rest, als hätten die Dinge, die sie gesehen haben, sie überproportional anschwellen lassen. Meine langen dunklen Haare wurden von fachkundigen Fingern geglättet, und im Augenblick bin ich dünn. Das erfordert die Rolle, die ich spiele, außerdem vergesse ich regelmäßig zu essen. Ich vergesse zu essen, weil mich eine Journalistin irgendwann als «plump, aber putzig» bezeichnet hat. Was sie über meine schauspielerische Leistung sagte, habe ich vergessen.
Die Bemerkung stammt aus einer Besprechung meiner allerersten Filmrolle im letzten Jahr – der Rolle, die mein Leben und das meines Mannes unwiderruflich veränderte. Unser Bankkonto veränderte sie auf alle Fälle, dafür rutschte unsere Liebe ins Minus. Er verübelte mir den Erfolg, und ich glaube, er musste mich kleinmachen, damit er sich selbst wieder groß fühlen konnte. Ich bin nicht mehr die, die er geheiratet hat. Ich bin jetzt mehr als sie, und ich glaube, er wollte weniger. Er ist Journalist und auf seinem Gebiet selbst erfolgreich, aber das ist nicht das Gleiche. Weil er dachte, er würde mich verlieren, fing er an, mich festzuhalten – so fest, dass es weh tat.
Ich glaube, einem Teil von mir gefiel das.
Ich parke am Straßenrand und lasse mich von meinen Füßen den Gehweg durch den Vorgarten tragen. Ich habe das Haus in Notting Hill gekauft, weil ich dachte, es könnte unsere Beziehung kitten, während wir weiter an der Refinanzierung unserer Ehe arbeiteten. Doch Geld ist nur ein dürftiges Pflaster, es heilt weder gebrochene Herzen noch gebrochene Versprechen. Noch nie zuvor habe ich mich von meinen falschen Entscheidungen so gefangen gefühlt. Ich habe mir mein eigenes Gefängnis erbaut, wie Menschen es oft tun, mit dicken Mauern aus Schuldgefühlen und Verpflichtungen. Mauern, die wirkten, als hätten sie keine Türen, dabei war der Weg in die Freiheit immer da. Ich habe ihn nur nicht gesehen.
Ich schließe die Haustür auf und schalte in jedem einzelnen kalten, dunklen, verlassenen Zimmer das Licht an.
«Ben», rufe ich und ziehe den Mantel aus.
Sogar meine Stimme klingt falsch, als sie seinen Namen ruft: gekünstelt, fremd.
«Ich bin wieder zu Hause», spreche ich in den nächsten leeren Raum hinein. Das hier als mein Zuhause zu bezeichnen klingt auch falsch; es hat sich nie so angefühlt. Kein Vogel sucht sich den eigenen Käfig aus.
Als ich meinen Mann unten nirgends finden kann, gehe ich nach oben, jeder einzelne Schritt bleischwer von Furcht und Zweifel. Seit ich wieder in der Kulisse unserer Ehe stehe, werden die Erinnerungen an letzte Nacht ein bisschen zu laut. Ich rufe erneut nach ihm, er antwortet noch immer nicht. Nachdem ich in jedem Zimmer nachgesehen habe, gehe ich zurück in die Küche und entdecke erst jetzt den erlesenen Blumenstrauß auf dem Tisch. Ich mustere die kleine Karte, die zwischen den Blüten steckt. Es steht nur ein Wort darauf:
Sorry.
Das ist leichter gesagt als gefühlt. Und noch leichter geschrieben.
Ich will, was zwischen uns passiert ist, ausradieren und zurück auf Los gehen. Ich will vergessen, was er mir angetan hat und zu was er mich getrieben hat. Ich will von vorne anfangen, aber uns ist schon längst die Zeit davongelaufen, weit bevor wir anfingen, voreinander davonzurennen. Vielleicht wäre alles anders geworden, wenn ich die Kinder hätte kriegen dürfen, die ich so dringend lieben wollte.
Ich verfolge meine Schritte zurück bis ins Wohnzimmer und starre den Couchtisch an. Da liegen Bens Sachen: Brieftasche, Hausschlüssel, Telefon. Ohne Telefon geht Ben nirgendwohin. Ich hebe es auf, vorsichtig, als könnte es jeden Moment explodieren oder sich zwischen meinen Fingern in Luft auflösen. Der Bildschirm erwacht zum Leben und zeigt den verpassten Anruf einer mir unbekannten Nummer. Ich möchte mehr sehen, aber als ich noch mal auf den Knopf drücke, will das Telefon Bens PIN haben. Ich versuche es ein paarmal, bis es mich endgültig aussperrt.
Ich suche noch einmal das ganze Haus nach ihm ab, aber er ist nicht da. Er versteckt sich nicht. Das ist kein Spiel.
In der Diele hängt der Mantel, den er immer trägt, neben der Haustür stehen seine Straßenschuhe. Ich rufe ein allerletztes Mal seinen Namen, so laut, dass die Nachbarn auf der anderen Seite der Wand mich mit Sicherheit hören können, aber ich bekomme noch immer keine Antwort. Vielleicht ist er nur kurz auf einen Sprung vor die Tür.
Ohne Brieftasche, Hausschlüssel, Telefon, Mantel, Schuhe?
Leugnen ist die destruktivste Form von Selbstschädigung.
Eine Reihe von Wörtern wiederholt sich flüsternd in meinen Ohren:
Verschwunden. Geflohen. Abgereist. Gegangen. Vermisst. Verschollen.
Das Wortrad verliert an Schwung und kommt auf dem passendsten Ausdruck zum Stehen. Schlicht und ohne Aufhebens rutscht es an seinen Platz wie das Stück eines Puzzles, von dem ich nicht wusste, dass ich es lösen muss.
Mein Mann ist weg.
2
Wo andere Menschen wohl hingehen, wenn sie nachts das Licht ausmachen?
Driften alle in die Welt der Träume ab? Oder gibt es ein paar andere wie mich, die tief in sich selbst herumstreifen, im Dunkeln, Kalten, die in den Schatten ihrer finstersten Gedanken und Ängste herumsuchen, den Dreck von Erinnerungen kratzen, die sie am liebsten endlich vergessen würden? Und dabei hoffen, dass niemand sehen kann, wohin sie hinabgesunken sind?
Als der Wecker den Wettlauf um den Schlaf gewinnt, stehe ich auf, gehe ins Bad, ziehe mich an. Tue all die Dinge, die ich normalerweise auch tue, als wäre heute ein ganz normaler Tag. Nur dass es mir nicht gelingt, sie in ihrer normalen Geschwindigkeit zu tun. Jeder Handgriff, jeder Gedanke vollzieht sich quälend langsam. Als wollte die Nacht mich zurückhalten, mich vor dem kommenden Tag bewahren.
Bevor ich ins Bett ging, hatte ich die Polizei angerufen.
Ich war mir nicht sicher, aber offensichtlich muss man keine vierundzwanzig Stunden mehr abwarten, ehe man die Polizei informiert, weil jemand verschwunden ist. Das klingt nach einem Zaubertrick, einer Showeinlage, dabei bin ich hier vom Fach, nicht mein Mann. Die fremde Stimme am Telefon klang beruhigend, im Gegensatz zu ihren Worten. Insbesondere das eine Wort, das der Mann immer wieder in mein Ohr zischte: Vermisst.Vermisste Person. Vermisster Ehemann. Missende Erinnerungen.
Ich weiß noch ganz genau, welchen Ausdruck mein Mann auf dem Gesicht trug, als ich ihn das letzte Mal sah, aber alles danach ist verschwommen. Nicht weil ich vergesslich wäre oder Alkoholikerin, sondern deswegen, was dann passierte. Ich schließe die Augen und sehe ihn vor mir, sein hassverzerrtes Gesicht. Ich blinzle die Vorstellung weg, als wäre sie ein Körnchen Sand, ein klitzekleines Ärgernis, welches das Bild, das ich von uns habe, stört.
Was haben wir getan? Was habe ich getan? Warum hat er mich dazu gebracht?
Der freundliche Polizist, zu dem ich schließlich durchgestellt wurde, notierte sich meine Angaben und sagte, es würde sich jemand melden. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen.
Er hätte genauso gut sagen können, ich solle nicht atmen.
Ich weiß nicht, was jetzt passiert, und das gefällt mir nicht. Ich war noch nie ein Fan von Improvisation, ich folge lieber einem Drehbuch, mag Pläne und feste Handlungsabläufe. Ich erwarte immer noch, dass Ben jeden Moment zur Tür reinkommt, dass er mir zur Erklärung eine seiner witzigen, charmanten Geschichten serviert, dass er uns wieder heile küsst. Doch er tut es nicht. Er tut gar nichts. Ben ist weg.
Ich wünschte, ich könnte jemanden anrufen, mit jemandem sprechen, aber es gibt niemanden.
Nachdem wir uns kennenlernten, gestaltete mein Mann Stück für Stück mein Leben um, machte meine Freunde schlecht und untergrub mein Vertrauen in sie, bis schließlich nur noch wir zwei übrig waren. Er wurde mein Mond, umkreiste mich fortwährend, kontrollierte meine Springfluten aus Selbstzweifeln, sorgte ab und zu sogar für eine totale Sonnenfinsternis und ließ mich im Dunkeln zurück, wo nur noch Angst herrschte und ich nicht sehen konnte, was wirklich geschah.
Oder so tat, als sähe ich es nicht.
Die Bande einer Liebe wie unserer verknoten sich zu einem Knäuel, das sich kaum noch entwirren lässt. Hätten Leute die Wahrheit gekannt, sie hätten mich gefragt, weshalb ich bei ihm bleibe, und ich hätte ihnen die Wahrheit gesagt: Ich liebe uns mehr, als ich ihn hasse, und er ist der einzige Mann, von dem ich mir jemals vorstellen konnte, ein Kind zu bekommen. Trotz allem, was er tat, um mir weh zu tun, war das immer noch mein einziger Wunsch: ein Kind von ihm und die Chance, noch einmal von vorne anzufangen.
Eine nagelneue Version von uns.
Mir zu verwehren, Mutter zu werden, war grausam. Zu glauben, ich würde seine Entscheidung einfach akzeptieren, war dumm. Aber ich bin gut im Verstellen. Ich habe es zu meinem Beruf gemacht. Die Risse zu überkleben lässt sie nicht verschwinden, aber das Leben ist trotzdem hübscher so.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich versuche, weiterzumachen wie immer, aber ich habe Mühe, mich zu erinnern, wie das geht.
Seit zehn Jahren laufe ich fast jeden Tag. Es gehört zu dem wenigen in dem schmalen Ordner von Dingen, die ich gut zu können glaube, außerdem macht es mir Spaß. Als absolutes Gewohnheitstier laufe ich jeden Morgen dieselbe Strecke. Ich zwinge mich in die Laufschuhe, versuche mich mit zitternden Fingern zu erinnern, wie man Schnürsenkel bindet, die ich schon tausendmal gebunden habe. Ich sage mir, dass niemandem damit gedient ist, nackte Wände anzustarren und ihn das auch nicht zurückbringt.
Meine Füße finden den vertrauten Rhythmus. Schnell, aber gleichmäßig. Ich höre Musik, um den Soundtrack der Stadt zu übertönen. Der Adrenalinschub setzt ein und dämpft den Schmerz, und ich treibe mich noch etwas weiter an. Ich renne an dem Pub vorbei, wo Ben und ich früher freitags was trinken waren, bevor wir verlernten, miteinander Zeit zu verbringen. Dann laufe ich an den Wohntürmen und den Millionärsspielplätzen aus Luxusreihenhäusern in der benachbarten Straße vorbei. Habenichts und Habeviel ganz nah beieinander.
In eine teure Wohngegend in West London zu ziehen war Bens Idee. Ich war in L.A., als wir das Haus kauften. Die Angst flüsterte mir ein, dass es der richtige Schritt sei. Ich hatte das Haus, bevor es uns gehörte, kein einziges Mal betreten. Als es schließlich so weit war, hatte es so gut wie nichts mehr mit den Fotos zu tun, die ich online gesehen hatte. Ben hatte unser neues Heim allein umgestaltet: neue Einbauten und neue Möbel für das brandneue Wir, von dem wir glaubten, es sein zu können und zu müssen.
Als ich um die Ecke jogge, fällt mein Blick unwillkürlich auf die Buchhandlung. Ich versuche, nicht hinzusehen, aber es ist wie bei einem Verkehrsunfall, ich kann nicht anders. Er wusste von meiner Liebe zu Büchern und hatte diesen Ort deshalb als Treffpunkt für unser allererstes Date ausgewählt. Ich war an dem Abend ein bisschen zu früh dran, erwartungsvoll und nervös, und stöberte in den Regalen. Als meine Verabredung fünfzehn Minuten später immer noch nicht aufgetaucht war, schoss mein Nervositätslevel an die Decke.
«Verzeihung, sind Sie Aimee?», fragte ein älterer Herr mit freundlichem Lächeln.
Mir war wirr und ein bisschen übel; er hatte nichts mit dem attraktiven jungen Mann von dem Profilbild auf der Datingseite gemeinsam. Ich erwog, aus dem Laden zu fliehen.
«Vorhin kam ein Kunde herein. Er kaufte dies hier und bat mich, es Ihnen zu geben. Er meinte, es sei ein Hinweis.» Der Mann strahlte, als hätte er seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt. Dann streckte er mir ein ordentlich in braunes Packpapier gewickeltes Päckchen hin. Die Situation verlor sofort die Anspannung, als mir klarwurde, dass er der Buchhändler war und nicht mein Date. Ich bedankte mich und nahm das Geschenk entgegen. In der Verpackung lag eins der Lieblingsbücher aus meiner Kindheit: Der geheime Garten. Es dauerte eine Weile, bis der Groschen fiel, doch dann fiel mir ein, dass der Blumenhändler an der Ecke genauso hieß.
Die Frau in dem Geschäft fing an zu grinsen, sobald ich begleitet vom Bimmeln der kleinen Glocke über der Tür den Laden betrat.
«Aimee?»
Als ich nickte, überreichte sie mir einen weißen Rosenstrauß. Zwischen den Blumen steckte eine Karte:
Weiße Rosen, die dir sagen
Verzeih, dass ich nicht hier sein kann
Ich freu mich schon seit Tagen
Und hoffe sehr, ich bin dein Mann
Ich las es dreimal hintereinander, als müsste ich mir die Worte übersetzen, dann fiel mir auf, dass die Floristin mich immer noch angrinste. Die Blicke anderer Menschen haben mich schon immer nervös gemacht.
«Er sagte, er würde in Ihrem Lieblingsrestaurant auf Sie warten.»
Ich bedankte mich und ging. Wir hatten kein Lieblingsrestaurant, wir waren noch nie gemeinsam aus gewesen, also spazierte ich mit meinem Buch und den Blumen die Einkaufsstraße entlang und genoss das Spiel. Ich rekapitulierte im Geiste unseren E-Mail-Verkehr und erinnerte mich an eine Unterhaltung über Essen. Seine Vorlieben waren alle so raffiniert gewesen, meine eher weniger. Ich hatte es bereut, ihm meine Lieblingsspeise verraten zu haben, und mich für meine Herkunft geschämt.
Der Mann hinter dem Tresen in dem Fish-And-Chips-Shop lächelte. Damals war ich Stammkundin.
«Salz und Essig?»
«Ja, bitte.»
Er schaufelte ein paar Pommes frites in eine Papiertüte und reichte sie mir zusammen mit der Kinokarte für eine Vorstellung etwas später am selben Abend. Die Pommes waren zu heiß und ich zu nervös, um sie zu essen, während ich die Straße entlangeilte. Doch als ich Ben vor dem Kino stehen sah, löste sämtliche Angst sich in Luft auf.
Ich erinnere mich an unseren ersten Kuss.
Es fühlte sich so richtig an. Zwischen uns existierte etwas, das ich weder begreifen noch erklären konnte, wir ergänzten uns, als wären wir füreinander gemacht. Die Erinnerung daran, wer wir damals waren, bringt mich zum Lächeln. Diese Version von uns war gut. Dann stolpere ich auf dem Gehsteig vor dem Kino und lande in der Gegenwart. Die Türen sind verriegelt. Die Lichter sind aus. Und Ben ist weg.
Ich laufe etwas schneller.
Ich passiere einen gemeinnützigen Secondhandladen und frage mich, ob die Klamotten in den Fenstern aus Großzügigkeit oder aus schlechtem Gewissen gespendet wurden. Ich laufe an dem Mann vorbei, der mit seinem Besen den Müll anderer Leute wegfegt. Dann an dem italienischen Lokal, dessen Kellnerin mich erkannt hatte, als wir das letzte Mal dort aßen. Ich bin seitdem nicht wieder dort gewesen.
Sobald Fremde mich erkennen, werde ich von einer einzigartigen Art von Angst gelähmt. Ich lächle verkrampft, versuche, etwas Nettes zu sagen und fliehe, so schnell ich kann. Zum Glück passiert mir das nicht allzu oft. Ich bin kein A-Promi. Noch nicht. Irgendwo zwischen B und C wahrscheinlich, so ähnlich wie meine Körbchengröße. Die Version von mir, die ich in der Öffentlichkeit zur Schau stelle, ist viel attraktiver als mein echtes Ich. Sie ist maßgeschneidert, eine Stufe über meinem eigenen Standard – den darf niemand sehen.
Ich frage mich, wann seine Liebe zu mir zur Neige ging.
Ich nehme die Abkürzung über den Friedhof, und der Anblick eines Kindergrabs erfüllt mich mit Trauer und lenkt meine Gedanken darüber, wer wir waren, dahin, wer wir hätten sein können, wenn das Leben sich anders entwickelt hätte. Ich versuche, mich an die glücklichen Erinnerungen zu halten, tue so, als gäbe es mehr, als es tatsächlich sind. Wir sind alle darauf programmiert, unsere Vergangenheit umzuschreiben, um uns in der Gegenwart zu beschützen.
Was mache ich hier?
Mein Ehemann ist verschwunden. Ich müsste zu Hause sein, weinen, die Krankenhäuser abtelefonieren, irgendetwas tun. Die Erinnerung unterbricht meine Gedanken, aber nicht meine Schritte, und ich laufe weiter. Erst am Coffeeshop bleibe ich stehen, ausgelaugt von meinen schlechten Angewohnheiten: Schlaflosigkeit und vor Problemen davonrennen.
Es herrscht bereits Hochbetrieb, lauter überarbeitete, unterbezahlte Londoner mit Schlaf und Missmut in den Augen auf der Suche nach ihrem Morgenkick. Als ich an der Reihe bin, bestelle ich wie gewohnt meinen Caffè Latte und bewege mich weiter in Richtung Kasse. Ich bezahle kontaktlos und ziehe mich wieder in mich selbst zurück, doch dann spricht die ernste Kassiererin mich an. Die blonden Haare hängen in zwei ungleichen Zöpfen an ihrem langen Gesicht herunter, und sie trägt ihr Stirnrunzeln wie ein Tattoo.
«Die Karte ist ungültig.»
Ich reagiere nicht.
Sie sieht mich an, als wäre ich womöglich gemeingefährlich dumm. «Haben Sie eine andere Karte?»
Sie spricht betont langsam und ausgesprochen laut, als hätte die Situation ihre Geduld und Freundlichkeit bereits über die Maßen strapaziert. Ich spüre, wie sich andere Augenpaare im Laden anschließen, zusammenströmen, auf mir landen.
«Das sind zwei Pfund vierzig. Das liegt mit Sicherheit an Ihrem Gerät. Bitte versuchen Sie es noch einmal.» Der erbärmliche Klang der Stimme, die aus meinem Mund kommt, erschreckt mich.
Sie seufzt, als würde sie mir einen Riesengefallen tun, mir zuliebe ein unglaubliches, persönliches Opfer bringen, ehe sie mit ihren abgekauten Fingernägeln auf die Kasse eintippt.
Ich halte ihr meine Bankkarte hin, in vollem Bewusstsein, dass meine Hand zittert und jeder es sehen kann.
Genervt schüttelt sie den Kopf. «Karte abgelehnt. Können Sie jetzt anders bezahlen oder nicht?»
Nein.
Ich bringe einen Schritt Abstand zwischen mich und meinen unberührten Kaffee, drehe mich um und verlasse ohne ein weiteres Wort den Coffeeshop. Die Blicke der Menschen folgen mir nach, ihr Urteil im Schlepptau.
Ignoranz ist kein Segen, Ignoranz ist auf einen späteren Zeitpunkt verschobene Angst.
Bei der Bank mache ich wieder halt, füttere den Geldautomaten mit meiner Karte, tippe die Geheimzahl ein und fordere einen kleinen Geldbetrag an. Ich muss die unerwarteten, unvertrauten Worte auf dem Bildschirm zweimal lesen:
AUSZAHLUNG NICHT MÖGLICH
Der Automat spuckt mit elektronischer Empörung meine Karte aus.
Manchmal tun wir, als würden wir die Dinge nicht verstehen, obwohl wir es tun.
Stattdessen mache ich, was ich am besten kann: Rennen. Den ganzen Weg zurück nach Hause, das nie ein Zuhause für mich war.
Sobald die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist, zerre ich das Telefon heraus und wähle die Nummer auf der Rückseite meiner Bankkarte. Als könnte dieses Gespräch nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Angst, nicht Erschöpfung, hält meinen Atem in Schach, und er entkommt meinem Mund in einer Folge spontaner Stöße und entstellt meine Stimme. Die Sicherheitsfragen sind eine Tortur, aber irgendwann stellt die Frau in einem weit entfernten Callcenter mir die Frage, auf die ich gewartet habe.
«Guten Morgen, Mrs. Sinclair. Sie haben sich ausreichend ausgewiesen. Was kann ich für Sie tun?»
Endlich.
Ich höre zu, während eine wildfremde Frau mir in unbeteiligtem Tonfall erzählt, mein Bankkonto sei gestern aufgelöst worden. Es waren über zehntausend Pfund auf dem Konto – das Konto, das ich widerstrebend auf unser beider Namen eröffnet hatte, nachdem Ben mir mangelndes Vertrauen vorgeworfen hatte. Vielleicht zu Recht, wie sich gerade herausstellt. Glücklicherweise habe ich den Großteil meiner Gagen auf Konten gehortet, auf die er keinen Zugriff hat.
Ich starre Bens Sachen an, die immer noch auf dem Couchtisch liegen, und klemme mir das Telefon zwischen Schulter und Ohr. Der Gedanke, seine Brieftasche zu durchwühlen, fühlt sich übergriffig an – diese Sorte Ehefrau bin ich nicht –, aber ich nehme sie trotzdem vom Tisch. Ich spähe hinein, als wären die verschwundenen zehntausend Pfund zwischen den Lederfalten versteckt. Sind sie nicht. Alles, was ich finde, sind ein zerknitterter Fünfer, ein paar Kreditkarten, von denen ich nichts wusste, und zwei ordentlich gefaltete Kassenzettel. Der erste stammt aus dem Restaurant, in dem wir aßen, als ich ihn das letzte Mal sah, der zweite von der Tankstelle. Alles ganz normal. Ich gehe zum Fenster und ziehe die Gardine ein Stückchen beiseite, gerade so weit, um Bens Wagen auf dem üblichen Parkplatz stehen zu sehen. Ich lasse die Gardine zurückgleiten und lege die Brieftasche wieder auf den Tisch, exakt an ihren alten Platz. Eine Ehe, in der die Zuneigung verhungert ist, hinterlässt eine ausgezehrte Liebe; eine Liebe, die morsch ist, leicht zu biegen und zu brechen. Aber wenn er vorhatte, mich zu verlassen und mein Geld zu stehlen, warum hat er dann seine Sachen nicht mitgenommen? Alles, was ihm gehört, ist noch hier.
Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
«Mrs. Sinclair, kann ich im Augenblick sonst noch etwas für Sie tun?» Die Stimme am Telefon unterbricht meine wirren Gedanken.
«Nein. Doch, ja. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wann genau mein Mann unser gemeinsames Konto aufgelöst hat?»
«Die letzte Abhebung erfolgte um siebzehn Uhr dreiundzwanzig in der Filiale.» Ich versuche, mich an gestern zu erinnern – es wirkt so weit weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich spätestens um fünf Uhr vom Dreh zurück war, das heißt, ich war hier, als er es getan hat. «Das ist seltsam …», sagt sie.
«Was denn?»
Sie zögert, ehe sie antwortet.
«Ihr Mann hat weder das Geld abgehoben noch das Konto aufgelöst.»
Ich bin plötzlich hellwach.
«Wer dann?»
Es folgt wieder eine lange Pause.
«Also, Mrs. Sinclair, unseren Unterlagen zufolge waren Sie das selbst.»
3
«Mrs. Sinclair?» Das Callcenter klingt unendlich weit weg, und ich kann nicht antworten. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich kann die Zeit nicht mehr greifen, habe das Gefühl, ungebremst einen Berg hinabzukullern.
Ich wüsste doch, wenn ich zur Bank gegangen wäre, um unser Konto zu schließen.
Als es an der Haustür klopft, lege ich auf und renne los, um aufzumachen. Ich bin mir sicher, dass direkt dahinter Ben und eine logische Erklärung auf mich warten.
Ich liege falsch.
Auf meiner Türschwelle stehen zwei Leute, ein Mann mittleren Alters und eine junge Frau, in billigen Anzügen. Er sieht aus wie ein Typ mit zwielichtigen Freunden und sie wie ein Teenager, der auf erwachsen macht.
«Mrs. Sinclair?», sagt sie und umhüllt meinen Namen mit ihrem schottischen Akzent.
«Ja?» Ich frage mich, ob sie vielleicht Vertreter sind, für Doppelverglasungen oder Gott oder, noch schlimmer, vielleicht Journalisten.
«Ich bin Detective Inspector Croft, und das hier ist Detective Sergeant Wakely. Sie haben uns wegen Ihres Mannes angerufen», sagt sie.
Detective? Sie sieht aus, als würde sie noch die Schulbank drücken.
«Ja, stimmt, bitte kommen Sie rein», antworte ich und habe ihre Namen schon wieder vergessen. In meinem Kopf herrscht inzwischen ein Höllenlärm.
«Danke sehr. Können wir uns irgendwo setzen?», fragt sie, und ich führe sie ins Wohnzimmer.
Ihr zierlicher Körper ist in einen nichtssagenden schwarzen Hosenanzug mit weißer Bluse verpackt. Die Kombination ähnelt einer Schuluniform. Ihr Gesicht ist reizlos, aber hübsch und ohne jede Spur Make-up. Ihr schulterlanges mausbraunes Haar ist so glatt, als hätte sie es gebügelt wie ihre Bluse. Alles an ihr ist gepflegt und auffallend adrett. Sicher ist sie ganz neu in dem Job. Vielleicht ist er ihr Ausbilder. Ich hatte keine Detectives auf meiner Türschwelle erwartet: einen uniformierten Polizisten vielleicht, aber nicht so was. Ich frage mich, weshalb ich eine Sonderbehandlung bekomme, und zucke vor den möglichen Antworten zurück, die sich in meinem Kopf aufreihen.
«Also, Ihr Mann ist verschwunden», souffliert sie mir, nachdem ich ihnen gegenüber Platz genommen habe.
«Ja.»
Sie starrt mich an, als würde sie auf mehr warten. Ich sehe ihn an, dann wieder sie, aber er scheint kein großer Redner zu sein, und ihr Gesichtsausdruck bleibt unverändert.
«Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie das hier funktioniert.» Ich bin jetzt schon verwirrt.
«Wie wäre es, wenn Sie uns als Erstes einfach sagen, wann Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen haben?»
«Also …» Ich zögere, um kurz nachzudenken.
Ich erinnere mich an Gebrüll, an seine Hände um meine Kehle. Ich erinnere mich daran, was er gesagt und was er getan hat. Ich sehe sie Blicke wechseln, dann fällt mir ein, dass ich die Frage beantworten muss.
«Entschuldigung. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe ihn vorgestern Abend zum letzten Mal gesehen. Und da ist noch etwas, das ich Ihnen sagen sollte …»
Sie beugt sich auf ihrem Sessel vor.
«Jemand hat unser Bankkonto leer geräumt.»
«Ihr Mann?», fragt sie.
«Nein. Jemand … anderes.»
Auf der eben noch glatten Stirn erscheinen Falten. «War es viel Geld?»
«Etwa zehntausend Pfund.»
Sie zieht eine sorgsam gezupfte Augenbraue hoch. «Ich würde sagen, das ist viel.»
«Ich sollte Ihnen wohl außerdem sagen, dass ich vor ein paar Jahren gestalkt worden bin. Deshalb sind wir hierhergezogen. Sie müssten eine Akte darüber haben, wir haben damals Anzeige erstattet.»
«Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang besteht, aber wir sehen uns das auf alle Fälle an.» Es kommt mir seltsam vor, dass sie etwas, das wichtig sein könnte, einfach so abtut. Sie lehnt sich wieder zurück, das Stirnrunzeln immer noch unverrückt an seinem Platz. «Als Sie gestern Abend angerufen haben, haben Sie dem Beamten gesagt, sämtliche persönlichen Gegenstände Ihres Mannes seien noch hier. Stimmt das? Sein Telefon, Schlüssel und Brieftasche, sogar seine Schuhe?» Ich nicke. «Dürfen wir uns mal umsehen?»
«Natürlich, tun Sie, was nötig ist.»
Ich folge ihnen durchs Haus, unsicher, ob ich soll oder nicht. Sie unterhalten sich nicht, aber ich kriege den stummen Dialog mit, der sich zwischen ihren Blicken abspielt, während sie ein Zimmer nach dem anderen betreten. Jeder einzelne Raum steckt voller Erinnerungen an Ben. Einige davon würde ich lieber vergessen.
Ich versuche, den exakten Augenblick festzumachen, an dem das zwischen uns anfing, sich aufzulösen, und stelle fest, dass es schon vorher war, ehe ich meine erste Spielfilmrolle bekam und nach L.A. ging. Ich war ein paar Tage zum Drehen in Liverpool gewesen, eine kleine Nebenrolle in einem BBC-Drama, nichts Besonderes. Ich war furchtbar müde, doch Ben bestand darauf, essen zu gehen, und setzte sein warnendes Gesicht auf, als ich sagte, mir sei nicht danach. Als ich mich fertig machte, fiel mir ein Ohrring herunter, und der Verschluss verschwand unter unserem Bett. Dieses winzige Stückchen Silber war der Auslöser für den Schmetterlingseffekt, der unsere Ehe endgültig in die falsche Richtung lenkte. Ich fand ihn nie wieder. Stattdessen fand ich etwas anderes: einen roten Lippenstift, der mir nicht gehörte. Ich war nicht völlig überrascht – Ben ist ein gut aussehender Mann, und ich habe bemerkt, wie andere Frauen ihn anschauen.
Ich habe meinen Fund nie erwähnt. Ich sagte nie auch nur ein einziges Wort. Ich traute mich nicht.
Die Frau sieht sich lange in unserem Schlafzimmer um, und es fühlt sich an, als würde meine Privatsphäre aufgeribbelt wie ein alter Pullover. Ich habe als Kind gelernt, der Polizei nicht zu vertrauen, und das ist bis heute so geblieben.
«Was sagten Sie, wann genau haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen?», will sie wissen.
Als er durchdrehte und sich in einen Fremden verwandelte.
«Wir haben in dem indischen Lokal auf der Hauptstraße zu Abend gegessen. Ich ging ein wenig früher als er … ich fühlte mich nicht wohl.»
«Haben Sie ihn gesehen, als er nach Hause kam?»
Ja.
«Nein, ich musste am nächsten Morgen früh raus. Als er wiederkam, war ich schon im Bett.» Sie weiß, dass ich lüge. Ich weiß nicht mal genau, warum ich es tue, eine Mischung aus Scham und Reue vielleicht. Aber Lügen kann man nicht zurücknehmen.
«Schlafen Sie denn nicht im selben Zimmer?», fragt sie.
Ich weiß nicht, weshalb das relevant sein sollte. «Nicht immer. Wir haben beide ziemlich vollgestopfte Terminkalender. Er ist Journalist, und ich bin –»
«Aber Sie haben ihn an dem Abend gehört, als er nach Hause kam.»
Gehört. Gerochen. Gespürt.
«Ja.»
Sie scheint etwas hinter der Tür entdeckt zu haben und zieht ein Paar blaue Latexhandschuhe aus der Hosentasche. «Und in diesem Zimmer schlafen Sie?»
«Meistens schlafen wir beide hier, aber letzte Nacht nicht.»
«Schläfst du je im Gästezimmer, Wakely?», fragt sie ihren stummen Begleiter.
«Ist schon mal vorgekommen, nach einem Streit, als wir noch genug Zeit und Energie hatten, um zu streiten. Aber inzwischen gibt es bei uns kein Gästezimmer mehr, die sind alle mit hormongebeutelten Teenagern belegt.»
Er spricht.
«Gibt es einen Grund, weshalb Sie einen Riegel an der Schlafzimmertür haben, Mrs. Sinclair?», will sie wissen.
Ich weiß nicht gleich, was ich sagen soll.
«Ich habe Ihnen schon erzählt, dass ich gestalkt wurde. Danach habe ich angefangen, meine Sicherheit ziemlich ernst zu nehmen.»
«Gibt es einen Grund, weshalb der Riegel kaputt ist?» Sie lässt die Tür zuschwingen und präsentiert die zerbrochene Halterung und das gesplitterte Holz.
Ja.
Meine Wangen brennen. «Den musste mein Mann aufbrechen, weil er klemmte. Ist schon eine Weile her.»
Ihr Blick geht zurück zur Tür, und sie nickt langsam, als würde die Bewegung sie Mühe kosten.
«Haben Sie einen Dachboden?»
«Ja.»
«Einen Keller?»
«Nein. Möchten Sie den Dachboden sehen?»
«Diesmal nicht.»
Diesmal? Wie viele Male wird es denn geben?
Ich folge ihnen zurück nach unten, und der Rundgang durchs Haus endet in der Küche.
«Hübsche Blumen.» Sie mustert den teuren Strauß auf dem Tisch und liest die Karte. «Wofür hat er sich entschuldigt?»
«Ich weiß es nicht genau. Ich hatte keine Gelegenheit mehr, ihn zu fragen.»
Ihr Gesicht verrät nicht, was sie denkt.
«Toller Garten.» Sie schaut durch die Glasschiebetüren hinaus. Der gepflegte Rasen trägt noch die Streifen von Bens letzter Mahd, und das Terrassendeck aus Hartholz glitzert in der Morgensonne.
«Danke sehr.»
«Sie haben ein hübsches Haus. Es wirkt wie eine Musterwohnung oder etwas aus einer Einrichtungszeitschrift. Wie ist das Wort? Minimalistisch. Genau. Keine Familienfotos, keine Bücher, kein Krimskrams …»
«Wir haben noch nicht alles ausgepackt.»
«Gerade erst eingezogen?»
«Vor etwa einem Jahr.» Jetzt sehen mich beide an. «Ich bin beruflich viel unterwegs. Ich bin Schauspielerin.»
«Oh, keine Sorge, Mrs. Sinclair, ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Sie letztes Jahr in dieser Fernsehserie gesehen, Sie haben eine Polizistin gespielt. Es hat mir … gefallen.»
Ihr schiefes Lächeln verblasst und gibt mir das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich starre zurück. Mir ist noch unwohler als eben schon, und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich reagieren soll.
«Haben Sie ein aktuelles Foto von Ihrem Mann, das wir mitnehmen können?», fragt sie.
«Ja, natürlich.» Ich gehe ins Wohnzimmer an den Kamin, doch da ist nichts. Ich sehe mich im Zimmer um, registriere die nackten Wände, die leeren Regale, und mir wird klar, dass es kein einziges Foto von ihm gibt oder von mir oder uns. Hier stand mal ein gerahmtes Hochzeitsfoto. Ich weiß nicht, wo es hingeraten ist. Unser großer Tag war eher klein – nur wir zwei. Und die Tage wurden in der Folge nur immer kleiner, bis irgendwann kein Raum mehr für uns übrig blieb. «Ich habe vielleicht eins auf meinem Telefon. Könnte ich Ihnen das auch mailen?»
«Per Mail ist okay.» Wie ein Ausschlag breitet sich das falsche Lächeln wieder auf ihrem Gesicht aus.
Ich greife zum Telefon und fange an, durch meine Fotos zu scrollen. Da sind jede Menge Bilder von den Leuten am Set, viele Fotos von Jack – meinem Filmpartner –, ein paar von mir, aber kein einziges von Ben. Ich merke, dass meine Hände zittern, und als ich aufblicke, sehe ich, dass sie es auch bemerkt hat.
«Besitzt Ihr Mann einen Reisepass?»
Natürlich besitzt er einen Pass. Jeder Mensch hat einen Pass.
Ich eile zum Sideboard, wo wir unsere Pässe verwahren, aber er ist nicht da. Meiner auch nicht. Ich fange an, Dinge aus der Schublade zu räumen, aber sie unterbricht mich.
«Keine Sorge, ich bezweifle, dass Ihr Mann das Land verlassen hat. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, glaube ich nicht, dass er besonders weit weg ist.»
«Wie kommen Sie darauf?»
Sie antwortet nicht.
«DI Croft hat jeden einzelnen Fall gelöst, der ihr zugewiesen wurde, seit sie zur Truppe gekommen ist», sagt der Mann wie ein stolzer Vater. «Sie sind in sicheren Händen.»
Ich fühle mich aber nicht sicher. Ich habe Angst.
«Was dagegen, wenn wir die Sachen mitnehmen?» Sie lässt Bens Telefon und die Brieftasche in einen durchsichtigen Plastikbeutel gleiten, ohne meine Antwort abzuwarten. «Keine Sorge, das mit dem Foto ist jetzt nicht wichtig. Wir nehmen es das nächste Mal mit.» Sie zieht die blauen Gummihandschuhe aus und geht hinaus in die Diele.
«Das nächste Mal?»
Sie ignoriert mich schon wieder. «Wir melden uns», sagt er, dann gehen sie davon.
Ich sinke zu Boden, sobald die Haustür hinter ihnen ins Schloss fällt. Ich habe das Gefühl, sie hätten mir die ganze Zeit stumme Vorwürfe gemacht, aber ich weiß nicht, weswegen. Glauben sie, ich habe meinen Mann ermordet und unter den Dielen versteckt? Ich verspüre den Drang, die Haustür aufzureißen, sie zurückzurufen und mich zu verteidigen, ihnen zu sagen, dass ich niemanden getötet habe.
Aber ich tue es nicht.
Denn es ist nicht wahr.
Ich habe getötet.
4
GALWAY, 1987
Ich war verloren, ehe ich überhaupt geboren war.
An dem Tag, als ich zur Welt kam, starb meine Mum, und das verzieh er mir nie.
Ich war schuld. Ich war überfällig, und dann drehte ich mich auch noch in die falsche Richtung. Auch heute noch verliere ich oft die Orientierung.
Als ich in ihrem Bauch feststeckte und nicht aus ihr herauswollte – auch wenn ich nicht weiß, warum –, sagte der Arzt zu meinem Dad, er muss sich für eine von uns entscheiden, weil er uns nicht beide retten kann. Dad entschied sich für sie, aber er kriegte nicht, was er wollte. Stattdessen kriegte er mich, und das machte ihn sehr lange traurig und wütend.
Diese Geschichte hat mir mein Bruder erzählt. Immer, immer wieder.
Er ist viel älter als ich, und er weiß Sachen, die ich nicht weiß.
Er sagt, ich habe sie getötet.
Seitdem gebe ich mir immer große Mühe, nur ja nichts zu töten. Ich steige über Ameisen, tue so, als würde ich Spinnen nicht sehen, und wenn mein Bruder mich mit zum Fischen nimmt, leere ich das Netz zurück ins Meer. Er sagt, bevor ich ihm das Herz gebrochen habe, war unser Dad ein netter Mann.
Ich kann sie hören, sie sind draußen im Schuppen.
Ich weiß, dass ich nicht lauschen darf, aber ich will wissen, was sie machen.
Sie machen ganz viele Sachen ohne mich. Manchmal schaue ich heimlich zu.
Ich stelle mich auf den alten Baumstumpf, den wir zum Holzhacken benutzen, und spähe durch das kleine Loch in der Schuppenwand. Das Erste, was mein rechtes Auge sieht, ist das Huhn, das weiße, wir nennen es Diana. In England gibt es eine Prinzessin, die so heißt – wir haben das Huhn nach ihr benannt. Dads riesige Faust schließt sich um den Hühnerhals, und die Füße sind mit einem schwarzen Strick zusammengebunden. Dad hält das Huhn kopfüber, und es hängt ganz still, nur die kleinen schwarzen Augen nicht. Sie schauen genau zu mir hin, und ich glaube, das Huhn weiß, dass ich etwas sehe, das ich nicht sehen soll.
Mein Bruder hält eine Axt.
Er weint.
Ich habe meinen Bruder noch nie weinen sehen. Ich habe ihn schon öfter durch die Zimmerwand gehört, wenn Dad seinen Gürtel benutzt, aber jetzt sehe ich zum ersten Mal seine Tränen. Sein fünfzehn Jahre altes Gesicht ist rot und fleckig, und seine Hände zittern.
Der erste Axthieb trifft nicht gut.
Das Huhn flattert wild mit den Flügeln, zappelt wie eine verrückte Hexe, Blut spritzt ihm aus dem Hals. Dad schlägt meinen Bruder auf den Kopf und zwingt ihn, die Axt noch einmal zu schwingen. Das Hühnerkreischen und das Weinen meines Bruders vermischen sich in meinen Ohren zu einem einzigen großen Radau. Mein Bruder holt aus und schlägt daneben, Dad haut ihn noch einmal, so fest, dass er auf die Knie kippt, und das Hühnerblut spritzt ihre dreckigen weißen T-Shirts voll. Mein Bruder schlägt zum dritten Mal zu, der Hühnerkopf fällt auf den Boden, aber die Flügel flattern weiter. Blutrote Federn, die mal weiß waren.
Als Dad weg ist, schleiche ich mich in den Schuppen und setze mich neben meinen Bruder. Er weint immer noch, und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, lasse ich nur meine Hand in seine gleiten. Ich betrachte die Form, die unsere Finger zusammen ergeben – Puzzleteile, die eigentlich nicht ineinander passen dürften und es trotzdem tun. Meine Hände sind klein und rosa und weich, seine Hände sind groß und rau und dreckig.
«Was willst du?» Er reißt seine Hand weg und wischt sich damit das Gesicht ab. Auf seiner Wange bleibt ein blutiger Strich zurück.
Ich will nur bei ihm sein, aber er will eine Antwort, also denke ich mir was aus. Ich weiß jetzt schon, dass es die falsche Antwort ist.
«Ich wollte fragen, ob du mit mir in die Stadt gehst, damit ich dir die roten Schuhe noch mal zeigen kann, die ich mir zum Geburtstag wünsche.» Nächste Woche werde ich sechs. Dad hat gesagt, wenn ich brav bin, bekomme ich dieses Jahr ein Geschenk. Ich war nicht böse, und ich glaube, das ist dasselbe.
Mein Bruder lacht – nicht sein richtiges Lachen, sondern das gemeine. «Checkst du’s nicht? Wir können uns keine neuen Schuhe leisten, wir können ja kaum was zu essen kaufen!» Er packt mich an den Schultern und schüttelt mich ein bisschen, so wie Dad ihn schüttelt, wenn er böse ist. «Leute wie wir tragen keine roten scheiß Schuhe, Leute wie wir werden im Dreck geboren und verrecken im Dreck. Und jetzt verpiss dich und lass mich in Ruhe!»
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist komisch, und mein Mund hat vergessen, wie man Worte macht.
So hat mein Bruder noch nie mit mir geredet. Die Tränen versuchen, aus meinen Augen rauszutröpfeln, aber ich lasse sie nicht. Ich versuche, meine Hand wieder in seine zu schieben. Ich will nur, dass er sie hält. Er schubst mich weg, so fest, dass ich rückwärts umkippe und mir den Kopf am Hackklotz anstoße. Hühnerblut und Innereien bleiben an meinen langen schwarzen Locken kleben.
«Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen, sonst schlag ich deinen miesen Schädel auch noch runter!», sagt er und schwingt die Axt.
Ich renne und renne und renne.
5
LONDON, 2017
Ich renne vom Parkplatz zum Hauptgebäude der Pinewood Studios. Ich komme nie zu spät, aber der unvorhergesehene Polizeibesuch heute Morgen hat mich völlig aus dem Konzept gebracht.
Mein Mann ist verschwunden, genau wie zehntausend Pfund von meinem Geld.
Ich kann dieses Puzzle nicht lösen, denn egal, wie ich die Teile ineinanderfüge, es fehlen immer noch zu viele, um das ganze Bild zu sehen. Ich muss mich noch ein bisschen zusammenreißen. Der Film ist fast abgedreht, es fehlen nur noch drei Szenen. Während ich durch die Flure zu meiner Garderobe eile, schiebe ich meine persönlichen Probleme weit weg. Als ich, noch immer in Gedanken, um die letzte Ecke biege, laufe ich Jack in die Arme.
«Wo bist du gewesen?», fragt er. «Alle warten auf dich.»
Ich senke den Blick auf seine Hand, die meinen Ärmel gepackt hält, und er lässt los. Seine dunklen Augen sehen direkt in mich hinein. Ich wünschte, sie täten es nicht, denn so ist es mir fast unmöglich, ihn anzulügen, und manchmal darf ich nicht die Wahrheit sagen; das verbietet mir mein Misstrauen gegenüber anderen Menschen.
Wenn man allerdings so lange mit jemandem zusammenarbeitet, wenn man sich dabei so nahekommt, ist es manchmal schwer, sein wahres Ich vollkommen zu verbergen.
Jack Anderson weiß, wie attraktiv er ist. Sein Gesicht hat ihm ein kleines Vermögen eingebracht, und das mit mehr Berechtigung als sein eher schwankendes schauspielerisches Talent. Sein Aufzug aus Chinos und Slim-Fit-Hemden betont seine muskulöse Statur. Er trägt sein Lächeln wie einen Hauptgewinn und seine Bartstoppeln wie eine Maske. Er ist ein bisschen älter als ich, aber die grauen Strähnen in seinen braunen Haaren lassen ihn nur noch attraktiver wirken.
Mir ist bewusst, dass zwischen uns etwas ist. Und mir ist bewusst, dass es ihm genauso geht.
«Tut mir leid», sage ich.
«Erzähl das dem Team, nicht mir. Nur weil du schön bist, heißt das nicht, dass automatisch die ganze Welt auf dich wartet.»
«Sag das nicht.» Ich werfe einen Blick über die Schulter.
«Was, dass du schön bist? Wieso nicht? Es ist die Wahrheit. Du bist die Einzige, die das nicht sieht, und das macht dich nur noch hinreißender.» Er kommt näher. Zu nah. Ich mache einen winzigen Schritt zurück.
«Ben ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen», flüstere ich.
«Und?»
Ich mache ein finsteres Gesicht, und seine Züge arrangieren sich neu und spiegeln die Besorgnis wider, welche die meisten Menschen unter diesen Umständen zur Schau stellen würden. Er senkt die Stimme. «Weiß er von uns?»
Ich starre in sein plötzlich todernstes Gesicht. Dann breiten sich die Fältchen um seine Augenwinkel zu einem Fächer, und er lacht mich an. «Ach, übrigens, in deiner Garderobe wartet eine Journalistin auf dich.»
«Was?» Er hätte ebenso gut Meuchelmörderin sagen können.
«Offenbar hat dein Agent das Interview arrangiert, sie will ausschließlich mit dir sprechen. Nicht, dass ich eifersüchtig wäre …»
«Davon weiß ich nichts –»
«Ja, klar. Mach dir keine Sorgen, mein verletztes Ego wird sich wieder erholen, das tut es immer. Sie wartet seit zwanzig Minuten dadrin. Ich habe keine Lust auf einen Verriss, nur weil du nicht in der Lage bist, dir den Wecker zu stellen. Es wäre also gut, wenn du ein wenig tout suite machen könntest.» Jack baut gern wahllos französische Wörter in seine Sätze ein. Ich habe nie verstanden, warum. Er ist kein Franzose.
Jack wendet sich ab und geht davon, und ich frage mich, was genau an ihm ich so attraktiv finde. Manchmal habe ich den Verdacht, ich will grundsätzlich immer das, was ich glaube, nicht haben zu können.
Ich weiß wirklich nichts von einem Interview, und wenn, hätte ich niemals eingewilligt, heute eins zu geben. Ich hasse Interviews, ich hasse Journalisten. Sie sind alle gleich: Sie versuchen, Geheimnisse ans Licht zu zerren, die sie nichts angehen. Das gilt auch für meinen Mann. Ben arbeitet bei TBN im Hintergrund als News Producer. Ich weiß, dass er in Kriegsgebieten unterwegs war, ehe wir uns kennenlernten. Sein Name tauchte in den Online-Artikeln einiger Korrespondenten auf, für die er arbeitete. Was er inzwischen genau macht, weiß ich nicht. Er will nicht darüber sprechen.
Als wir uns kennenlernten, fand ich ihn romantisch und charmant. Sein irischer Akzent erinnerte mich an meine Kindheit und schuf eine Vertrautheit, in die ich mich am liebsten hineinverkrochen hätte. Immer wenn ich glaube, es könnte zu Ende sein, denke ich an unseren Anfang zurück. Wir haben zu schnell geheiratet und zu langsam geliebt, aber eine Zeitlang waren wir glücklich, und ich dachte, wir hätten dieselben Ziele. Manchmal frage ich mich, ob die Gräuel, die er durch seinen Job gesehen hat, ihn verändert haben, denn Ben hat absolut nichts mit den Journalisten gemeinsam, mit denen ich beruflich zu tun habe.
Ich kenne inzwischen viele Klatsch- und Showbiz-Reporter; bei den Pressekonferenzen, Premieren und Partys tauchen immer wieder dieselben Gesichter auf. Ich frage mich, ob sie eine ist, die ich mag, jemand, die sich schon mal nett zu meiner Arbeit geäußert hat, die ich bereits kenne. Dann wäre es vielleicht okay. Bei jemandem, den ich noch nicht kenne, fangen meine Hände an zu zittern, mir bricht der Schweiß aus, ich bekomme weiche Knie, und sobald mein unbekanntes Gegenüber meinen Horror wittert, verliere ich die Fähigkeit, in ganzen Sätzen zu sprechen. Wüsste mein Agent, wie sehr ich unter solchen Situationen leide, er würde sie mir ersparen. Es ist, als würden Eltern ein ängstliches Kind ins tiefe Becken stoßen und sich einbilden, es würde schwimmen, statt unterzugehen. Eines Tages werde ich ertrinken, so viel steht fest.
Ich schreibe meinem Agenten eine Nachricht. Es sieht Tony nicht ähnlich, etwas zu arrangieren, ohne mir Bescheid zu sagen. Kann sein, dass andere Schauspielerinnen beleidigt mit ihren Bauklötzchen um sich werfen, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht – das habe ich schon live erlebt –, aber so bin ich nicht und werde hoffentlich auch nie so werden. Ich weiß, welches Glück ich habe. Es gibt tausend Leute, die nur zu gerne in meiner Haut stecken würden und denen sie viel besser zu Gesicht stünde als mir. Dieses Spiellevel ist immer noch ziemlich neu für mich, und ich habe zu viel zu verlieren. Ich kann nicht noch mal bei null anfangen. Dafür habe ich zu hart gearbeitet, und es hat zu lange gedauert, an diesen Punkt zu kommen.
Ich checke mein Telefon. Tony antwortet nicht, aber ich kann die Journalistin nicht länger warten lassen. Ich klebe mir das Lächeln ins Gesicht, das ich für andere perfektioniert habe, dann öffne ich die Tür, auf der mein Name steht, und sehe eine andere Frau in meinem Sessel sitzen, als würde sie hierhergehören.
Tut sie nicht.
«Es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie habe warten lassen, wie schön, Sie zu sehen!», lüge ich, strecke meine Hand aus und versuche, dabei nicht zu zittern.
Jennifer Jones lächelt mich an, als wären wir alte Freundinnen. Sind wir nicht. Sie gehört zu den Journalistinnen, die ich verabscheue. Sie hat schon schrecklich unfreundlich über mich geschrieben, aus Gründen, die ich nie verstehen werde. Sie ist das Miststück, das mich «plump, aber putzig» nannte, als letztes Jahr mein erster Film rauskam. Im Gegenzug nenne ich sie Schnabelfresse, aber nur in der Intimsphäre meiner Gedanken. Alles an ihr ist zu klein, vor allem ihr Horizont. Sie springt auf, flattert um mich herum wie ein Spatz auf Speed, dann greift sie mit ihrer winzigen, eiskalten Vogelklaue nach meiner Hand und schüttelt sie ekstatisch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie bei unserer letzten Begegnung auch nur einen Schnipsel meines Films gesehen hatte. Sie gehört zu den Journalisten, die glauben, weil sie Celebrities interviewen, würden sie auch dazugehören. Tut sie nicht.
Schnabelfresse ist mittelalt und kleidet sich, wie ihre Tochter es tun würde, vorausgesetzt, sie hätte ihre Karriere lange genug unterbrochen, um eine zu bekommen. Ihr gepflegter Haarschnitt war vor zehn Jahren fast der letzte Schrei, ihre Wangen sind zu rosarot und ihre Zähne unnatürlich weiß. Sie gehört zu den Menschen, deren Schicksal bereits feststeht, und es wird ihr nie gelingen, es zu verändern, egal wie sehr sie es versucht. Nach allem, was ich online über sie gelesen habe, wollte sie selbst Schauspielerin werden. Vielleicht hasst sie mich deshalb so. Ich sehe ihren Hackschnabel zucken und spucken, während sie mir ihre geheuchelten Komplimente entgegenkrächzt. Unterdessen rasen meine Gedanken im Galopp, versuchen die Verbalgranaten vorauszuahnen, die sie mir gleich entgegenschleudern wird.
«Mein Agent hat gar kein Interview erwähnt …»
«Ach so? Na ja, wenn Sie nicht wollen? Es ist auch nur was ganz Kleines, für die TBN-Website, keine Kameras, nur ich altes Lieschen. Sie müssen sich also keine Sorgen wegen Ihrer Frisur machen oder wie Sie gerade aussehen …»
Miststück.
Sie zwinkert und sieht dabei kurz aus, als hätte sie einen Schlaganfall erlitten.
«Ich komme gern ein andermal wieder …»
Ich ringe mir im Gegenzug noch ein Lächeln ab und setze mich ihr gegenüber, die Hände fest auf dem Schoß verknotet, um sie vom Zittern abzuhalten. Mein Agent muss dies für eine gute Idee gehalten haben, sonst hätte er nicht eingewilligt. «Schießen Sie los», sage ich. Und fühle mich, als würde ich wirklich jeden Moment erschossen werden.