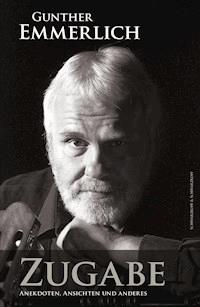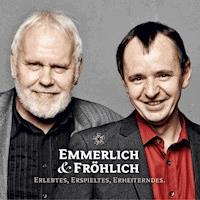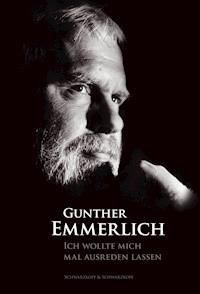
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
In seiner Autobiographie Ich wollte mich mal ausreden lassen zeigt sich der Sänger und Moderator gewohnt redegewandt und humorvoll. Liebevoll, aber nicht unkritisch erinnert er sich an seine Kindheit in Eisenberg in der Nachkriegszeit, wo die Familie auf engstem Raum lebte, und an seine Jugend in der DDR, wo er erste Erfolge auf der Bühne und im Fernsehen verbuchen konnte. Emmerlich erzählt von seiner Studentenzeit in Weimar, von Urlauben in der Künstlerkolonie Ahrenshoop und davon, wie er seine Frau kennenlernte. Aber er schildert auch den Alltag in der DDR und die Schwierigkeiten, denen jemand ausgesetzt war, der im Rampenlicht stand und den Funktionären nicht nach dem Mund redete. Auch die Gegenwart kommt nicht zu kurz: Emmerlich bewältigt den Spagat zwischen dem aufregenden Leben als freischaffender Künstler und der Familie scheinbar mühelos und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Die liebevollen Erinnerungen und Anekdoten geben einen Einblick in das Leben des Vollblutsängers Emmerlich zwischen Bühne und Familie. Gleichzeitig sind sie ein Stück Zeitgeschichte und eine kritische Auseinandersetzung mit Ost und West.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Ähnliche
Gunther Emmerlich
ICH WOLLTE MICH MAL AUSREDEN LASSEN
Schwarzkopf & Schwarzkopf
Für meine Enkelin Antonia-Luise
»Herr Eeemmerlisch, darf ich Sie mal unterbrechen …?«
Von Wolfgang Stumph
Ich werde mich kurz fassen, denn Sie fordern ja im Titel Ihres Buches, dass Sie sich mal ausreden lassen wollen, und das kann bei Ihnen bekanntlich dauern.
Ich kenne das von unseren gemeinsamen Skatabenden. Obwohl Sie wissen, dass Sie einen Grand Hand spielen werden, fangen sie genüsslich bei 18, 20, 22 … über alle Stationen an zu reizen, bis zur Ansage »Grand Hand«. Und das hat für alle Beteiligten seinen Reiz. Im vorliegenden Fall immerhin über 200 Seiten lang. Bei ihren an Ephraim Kishon und Hansgeorg Stengel erinnernden doppeldeutigen Wortspielen muss man die Eindeutigkeit selbst zu Ende denken. Man merkt beim Lesen Ihres Buches, dass Sie sich nichts vorschreiben lassen, im Leben nicht und auf dem Blatt Papier auch nicht. Sie brauchen keinen Ghostwriter für Ihre Gedanken. Wo Emmerlich draufsteht, steckt auch Emmerlich drin.
Herr Eeemmerlisch, beim Lesen Ihres Buches kann ich Sie förmlich hören. Es ist eine große Freude beim Lesen, wenn man Sie kennt, und wenn man Sie nicht kennt, will man Sie kennenlernen, wenn man Ihr Buch liest. Ich habe das Vergnügen, Sie schon weit über zwei Jahrzehnte zu kennen. Von vielen Fernsehsendungen, von Skat und Tischtennis, von wunderbaren gemeinsamen Abenden und wundersamen Ereignissen.
Sie sind mir schon Anfang der achtziger Jahre aufgefallen, zuerst in Aufführungen am Staatstheater Dresden und später an der Semperoper. (Für den Leser in den »gebrauchten« Bundesländern zur zeitlichen Orientierung: Die Semperoper wurde bereits 1985 wiedereröffnet.) Aber auch auf den Kleinkunstbühnen waren Sie nicht nur durch Ihre Größe auffällig geworden. Sie waren einfach nicht zu überhören, und das nicht nur wegen Ihrer sonoren und kräftigen Stimme, sondern auch wegen der leisen und kritischen Töne. Folglich mussten sich unsere Wege kreuzen. Bevor ich Gast in Ihren TV-Sendungen wurde, waren Sie öfter mein Gast als Talk-Partner im »Dresdner Stammtisch«. Legendär waren Ihre Auftritte beim Liederabend 1989 unter Wolfgang Engel am Schauspielhaus. Sie haben als Sänger neben den Mimen geglänzt. Weil Sie etwas zu sagen hatten.
Wir standen im November 1989 in der »Showkolade« gemeinsam auf der Bühne der Semperoper. Ich mit Krücken, denn ich hatte gerade eine Meniskusoperation hinter mir. Viele dachten, das wären nur Requisiten, um den Gag auf Ihre Frage loszulassen: »Mein Fan Stumpi, was ist denn passiert?« – »Herr Eeemmerlisch, ich hab mich auf die führenden Genossen gestützt und da bin ich auf die Schnauze geflogen.« Wir haben im Dezember 1990 im Meininger Theater mit der letzten »Showkolade« eine spannende gemeinsame künstlerische Arbeit im DDR-Fernsehen beendet. Mit sächsisch-thüringischer Schlitzohrigkeit balancierten wir vor der Wende gemeinsam auf dem Grad möglicher Satire im DFF. Manchmal ging’s auch darüber hinaus, dann wurde unser Beitrag geschnitten. Das war spannend und hat bei allem Ärger auch einen Riesenspaß gemacht.
Herr Eeemmerlisch, wir haben bei aller Unterschiedlichkeit – auch in unserer Konfektionsgröße – so viel Gemeinsames, dass wir uns in unserer Freundschaft nie ein X für ein U vormachen brauchten. Unsere Streitkultur ist demokratischer und dem Problem zugewandter als bei Politikern in den meisten TV-Talkshows. Wir lassen uns nicht nur ausreden, sondern auch zu Ende denken und können einander zuhören. Nur in einem gleichen wir den Politikern: Auf der öffentlichen Bühne siezen wir uns, im privaten Umfeld duzen wir uns. Stimmt’s, Herr Eeemmerlisch, oder etwa nicht, Gunther?
Und E und U haben wir weder im Leben noch in der Kunst getrennt. Unsere Unterhaltungen waren ernst bei allem Spaß, den wir gemeinsam hatten und weiter haben werden, und dies bei Weib, Wein und Gesang. Leider sind Sie musikalischer als ich. Na ja, Sie wissen ja: Ganz schön wird’s nie.
Jetzt sind Sie bei all Ihrer Vielseitigkeit auch noch unter die Buchmacher, Entschuldigung, Büchermacher gegangen. Sie sind doch schon der beste Sänger unter den Moderatoren und der beste Moderator unter den Sängern.
Machen Sie nur weiter so!
Das ist jetzt keine Drohung, eher ein Wunsch –
von
Ihrem Fan Stumpi
und Deinem Wolfgang
1
Von vorn
Wenn man, wie ich, in Ostthüringen geboren wurde und es einen irgendwann zum Theater zieht, muss man eine andere Sprache lernen. Hochdeutsch war die zweite Sprache, die ich lernen musste, denn der dortige Dialekt hat sich an unseren Theatern nicht durchgesetzt. Aus erklärbaren Gründen mangelte es sogar am Versuch. Das lässt den Umkehrschluss zu, dass hier mit Worten nicht viel Theater gemacht wird. Der Umgangston ist ehrlich und entwaffnend, denn es kann sich keiner hinter einem charmanten Wohlklang oder einer einschmeichelnden Sprachmelodie verstecken. Der Angesprochene weiß, woran er ist, im Guten wie im Bösen. Wer aus diesem Holz geschnitzt ist, kann im Holzland, so nennt man diese Gegend, gut damit leben.
Andere müssen es lernen oder sie haben es dort schwer. Das heißt nicht etwa, dass man Fremden gegenüber nicht offen wäre, aber wenn hier einer mit gekünstelter und hohler Sprache versucht, Theater zu machen (das ist auch am Theater schlecht), sagen sie: »Das sull wu was heeße.« Und das heißt dann: Dem glauben wir nicht. Im schönen Tautenhain habe ich, Anfang der sechziger Jahre, die kürzeste Rede eines Bürgermeisters zum 1. Mai gehört. Er sagte: »Dr erschte Mä is unse, unse is der erschte Mä, in däm Sinne ’n scheen Daach!« Und das war’s. Das anschließende Fest war ohnehin schöner, als es jede Rede hätte sein können, vor allem jede längere.
Die Gegend, in der die Menschen hier leben, ist sehr abwechslungsreich. Eigentlich beinhaltet das Wort »lieblich« alles, um sie zu beschreiben. Der Dialekt ist es nicht.
Berge und Wälder, Bäche, Teiche und Seen, herrliche Täler mit romantischen Mühlen, die nun als Gaststätten dem Wanderer verlorene Pfunde aufs Köstlichste zurückgeben. Es war sicher nie eine reiche Gegend, aber schöne Bürgerhäuser, Kirchen, Rathäuser und Schlösser zeugen vom Fleiß und Einfallsreichtum der Leute. Natürlich sind die Berge und Täler nicht so gewaltig wie in den Alpen, die Schlösser nicht so prachtvoll wie in Potsdam und der Rhein heißt hier Malzbach. Aber die von bescheidener Schönheit und von vielen kleinen Edelsteinen geprägte Landschaft und Architektur haben auch die Holzländer geformt. Viele Erinnerungen habe ich als leichtes Gepäck immer bei mir. Nicht nur gute, denn die verbindet der Mensch mit zählbar wenigen Plätzen.
Eisenberg heißt der Ort, in dem ich geboren wurde. Er liegt auf einem Berg, ob dort jemals Eisen gefunden wurde, ist unklar. Sein Bekanntheitsgrad hält sich in Grenzen, obwohl er eine eigene Autobahnabfahrt hat. Auch eine Zufahrt. Das kleinere, acht Kilometer entfernte Hermsdorf ist bekannter. Wohl auch wegen des Hermsdorfer Kreuzes, des ersten Autobahnkreuzes Deutschlands. In meiner Kindheit gab es eine Mutprobe: Die acht Kilometer auf der Autobahn hin und zurück mit dem Fahrrad fahren. Wer das heute Undenkbare wagte, bekam das Hermsdorfer Kreuz erster Klasse. Das waren dreiteilige Eicheln ohne Laub. Holzgewehre und Holzpistolen hatten wir auch. Eisenberg liegt im Holzland. Die kindlichen Nachahmer sind unschuldig. Die erwachsenen Vorbilder nicht. Dass es mein Vater nur bis zum Obergefreiten gebracht hatte, erfüllt mich mit nicht geringem Stolz. Sein Ehrgeiz lag auf anderen Gebieten. Er trieb viel Sport und freute sich darauf, bald Chef des väterlichen Unternehmens zu werden. Dass er ein netter Kerl war, sagte mir nicht nur meine Mutter. Ich war gar nicht bei der Armee, bin mit Geschick und Glück mit zwei mal sechs Wochen GST-Lager davongekommen. Im Frieden ist es allerdings leichter, ein Pazifist zu sein. 1941 hätten sie sogar Felix Krull eingezogen – die Hochstapler.
Zwischen München und Berlin ist Eisenberg die einzige Stadt, die man in ihrer Gänze von der A 9 aus sieht. Wenn das kein Superlativ ist. Sie war sogar mal Residenzstadt. Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha und Altenburg hatte sieben Söhne. Sein Sohn Christian residierte hier Ende des 17. bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Herzogtum Sachsen-Eisenberg war die offizielle Bezeichnung. Meine kleine Stadt liegt in Thüringen. Das ist so irreführend wie die Fußballmannschaft Preußen Münster. Münster liegt bekanntlich in Westfalen. (Mit einer diesbezüglichen Erklärung werde ich an anderer Stelle die Geschichtskundigen langweilen.) In Christians Schloss sitzt heute der Landrat des Saale-Holzland-Kreises. Wir wollen hoffen, dass er nicht nur da sitzt. In direkter Nachbarschaft steht eine der schönsten barocken Schlosskirchen Mitteldeutschlands. 1692 von italienischen Baumeistern erbaut. Zur Dreihundertjahrfeier in der gerade renovierten Kirche habe ich eine dreihundert Jahre alte Arie gesungen. Die drei apokalyptischen Reiter auf dem berühmten Deckengemälde, deren Ritt sich keiner entziehen kann, egal wo er in dieser Kirche steht, muteten an diesem Tag wie Polospieler an, denen ein guter Schlag gelungen ist. Vielleicht freuen sich an solchen Tagen sogar die Finsterlinge. Wenn diese Kirche voll ist, verschmelzen die barocken Putten mit den Menschen. Eisenberg müsste berühmter sein. Im Gegensatz zu manch anderem Ismus richtet Lokalpatriotismus keinen Schaden an. Es sei denn, Dummheit treibt ihn auf die Spitze.
Herzog Christian hat über seine Verhältnisse gelebt. Sicher falsch, aber immerhin hat er uns einiges hinterlassen, an dem wir heute noch unsere Freude haben. Wenn die Kirche damals je voll war – es war eine Schlosskirche –, hat man bestimmt die Putten von den Menschen gut unterscheiden können. Putten sind wohlgenährt. In der »Zauberflöte« wird erfreulicherweise nie über Geld gesprochen, auch nicht gesungen. Sarastro ist nicht weise, weil er Geld hat, er regiert sein Reich so klug, dass Geld der Weisheit nicht im Wege steht. Der Einzelne kann arm sein und weise werden, oder weise sein und arm werden. Hat der Mensch Verantwortung für andere, muss er all seine Weisheit zusammennehmen, damit die nicht arm bleiben oder arm werden. Geld auskömmlich, Weisheit reichlich. Sarastro hat das in seinem Reich geschafft, Christian in Sachsen-Eisenberg nicht. Er ist leider kein Einzelfall. August der Starke gab bei klammer Kasse den Befehl, Gold herstellen zu lassen, was natürlich unnatürlich nicht gelang. Der beauftragte Apotheker Böttger hat bei diesen Versuchen wenigstens das Porzellan erfunden. Christian ließ seine goldverheißenden Apotheker und Laienchemiker tun und machen, dass es nur so rumste und krachte. Es war auch keine goldige Idee von ihm, bei diesen Experimenten immer zugegen sein zu wollen. Dabei entstandene giftige Dämpfe machten ihm den Garaus. Über das Schicksal der Apotheker und Laienchemiker ist nichts überliefert. Falls der heutige Landrat Ähnliches vorhat – Vorsicht!
Die Schlosskirche ist schön. Das herrliche Renaissance-Rathaus haben Bürger mit Geschmack gebaut, die redlich ihrem Handwerk nachgingen und eines natürlichen Todes gestorben sind. Auch ihre bescheidenen Häuser am Markt und auf dem Steinweg sind schön. Die Schlosskirche ist schöner. Sie kostete auch mehr Geld und Christian das Leben. In der evangelischen Stadtkirche aus gotischer Zeit wurde ich getauft und konfirmiert, mit Erfolg. Ich bin ein gläubiger Christ. Selbst gutgläubig war ich eine anständige Zeit. Martin Luther hat in St. Petri mal eine Predigt gehört. Er fand sie nicht gut. Die Gedanken der Reformation schienen ihm noch nicht ganz angekommen. Was die Durchsetzung von Reformationen anbelangt, können wir ja auch heute durchaus nicht nur ein evangelisches Lied singen.
Warum das Holzland Holzland heißt, bedarf keiner Erklärung. Warum diese Stadt im Holzland Eisenberg heißt, konnte mir bisher keiner schlüssig erläutern. Die Fußballmannschaft hieß früher Stahl Eisenberg. Das ist derselbe Blödsinn wie eine goldige Silberlocke. Zu dieser Zeit hieß das Kino Karl-Marx-Lichtspiele. Das erste Spaßbad Ernstbad. Alles schwer zu vermitteln. Dass die Stasi ihren Sitz auf der Hohen Straße hatte, ist nachvollziehbar. Auch, dass ich in die Ostschule gegangen bin. Im ebenfalls ostthüringischen Jena gab’s allerdings auch eine Westschule. Schokolade hieß Vitalade, weitestgehend kakaofrei, Blech Bagalit, Leder Igilit, die Milch war mager und Wilhelm Pieck fett. Da kenne sich einer aus. Aber es gibt ja auch den Süden von Ostwestfalen. Das Leben birgt Rätsel, deren Lösung oft nicht schlauer macht. Wissender vielleicht. Zu viel Wissen nimmt dem Sänger Lust und Gabe. Singen ist auch Naivität, da muss jeder selbst entscheiden, wie viel Wissen sie verträgt. Dumme Sänger haben es oft leichter. Angenehm Eigenes sollte der Sänger haben und eine partienadäquate Ausstrahlung. Der den Tannhäuser singt, muss aber nicht im Hörselberg gewesen sein. Das schadet der Naivität und dem Kostüm.
Solche Gedanken habe ich mir als Kind und junger Mann in Ostthüringen noch nicht gemacht. Obwohl der Hörselberg in Thüringen liegt. Auf so was kommt der Mensch erst über den zweiten Bildungsweg. In Eisenberg habe ich alles das erste Mal gemacht. Schule, auch geschwänzt, rote Birne, Hunger auf alles, manchmal nur Hunger, erstes Verletztsein, auch verletzen, klauen und helfen, sogar mit Geklautem helfen, Arm gebrochen, Herz auch – Arm heilte schneller, erster Kuss und mehr. Sabine sah sogar im FDJ-Hemd betörend aus. Als sie es auszog, fehlte mir nichts. Abwaschen, bohnern, Treppe wischen – erst kehren –, Straße kehren, Mandelentzündungen und Kampflieder singen. Blaue Wimpel im Sommerwind, dabei Rüben verziehen und Kartoffeln lesen. Lange Strümpfe und Leibchen mit Strumpfhaltern, dazu kurze Hosen aus Zellwolle, das hat mich nicht gejuckt, aber gekratzt hat’s. Die langen Hosen waren von meiner älteren Schwester. An der Seite zum Knöpfen, vorne zu. Auftragen nannte man das. Es gab für all das so nette Begriffe. Pubertät ist ohnehin schwerer als Fakultät – und dann noch solche Hosen.
Rinder waren noch nicht wahnsinnig, aber sie bekamen Grippe, weil ihre Ställe offen waren. Es zog. Die Grenzen waren dichter.
Beim Heidelbeersuchen bin ich eingeschlafen. Am nächsten Morgen lag ich umringt von Steinpilzen. Manchmal war ich ein Glückspilz. Ludwig Richter hätte mich so gemalt. Womacka vermutlich auch. Aber nur in seiner verhübschenden Phase, dann aber mit Pionierhalstuch, und die Steinpilze wären Rotkappen gewesen. Walderdbeeren waren das Größte, süß, würzig, aber klein. Da gab’s eine Stelle, oberhalb der Pfarrmühle, ich glaube, die kannte nur ich. Die Walderdbeeren waren hinter Dickicht versteckt und wuchsen nur für mich. Pilze, Heidelbeeren und Holz habe ich nach Hause gebracht. Die Walderdbeeren nicht. Diesen appetitlichen Egoismus empfinde ich heute noch, wenn ich allein besonders gut essen gehe.
In Eisenberg habe ich auch das erste Mal den Weihnachtsmann gespielt. Eine Rolle, mit der ich seither immer wieder gern besetzt werde. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Voriges Weihnachten war ich eine Fehlbesetzung. Meine Enkelin Antonia-Luise hat mich erkannt. Für’s nächste Mal bin ich innerfamiliär nicht mehr vorgesehen.
Als ich 18 Jahre alt war, wurde der für Alexander vorgesehene Weihnachtsmann krank. Der Sohn meiner Schwester war reichlich vier Jahre alt und auf das Erscheinen des alten Herrn so gründlich vorbereitet worden, dass ich als Notnagel einspringen musste. Zum ungeeigneten Alter fehlte auch noch die passende Kleidung. Der erkrankte, pädagogisch wertvolle Geschenkeüberbringer war klein und dick. Damals war ich schon groß und – man will’s nicht glauben – schlank. Die Absage war so kurzfristig, dass kurzer Prozess gemacht werden musste, wie sich meine Schwester immer auszudrücken pflegte, wenn Eile geboten war. Den pelzgefütterten Ledermantel meines Schwagers zog ich verkehrt herum an, die Augenbrauen wurden mit Ruß balkenförmig bemalt, den damals noch nicht vorhandenen Bart bildete ein grauer Topflappen, der über’m Mund aufgeschnitten wurde. Die erzieherischen Hinweise, derer ich selbst noch bedurfte, sollten ja zu verstehen sein. Eine Fellmütze, wie sie Breshnew bei der Parade anlässlich der Oktoberrevolution immer im November trug, krönte den Ersatzweihnachtsmann. Ich sah viel zu furchtbar aus für den lieben kleinen Jungen. Ich erinnerte an einen runtergekommenen Weißgardisten, die Stiefel vom Schwager waren allerdings neu.
Unehrgeizig kann man meine Schwester nicht nennen. Und so hatte sie schon im Herbst damit begonnen, dem kleinen Alexander allerlei Gedichte und Lieder der Weihnachtszeit beizubringen. Sie begann damit, als die Äpfel für den Adventsteller noch am Baum hingen. Der Kleine war gründlich und passend vorbereitet, ich sah unpassend und gründlich daneben aus. Klein Alexander sah mich, vergaß im Moment das reichlich vorhandene Repertoire fürs heilige Fest und sang: »Kommt ein Vogel geflogen« – es war schwer, Weihnachten wiederherzustellen. Die Geschenke lenkten von mir ab und auch die pädagogischen Ratschläge gingen spielend unter – Hosianna!
Elf Jahre davor, ich war bereits sieben, gab ich immer noch vor, an den Weihnachtsmann zu glauben, obwohl ich den Mummenschanz längst durchschaut hatte. Mich quälte die Befürchtung, dass ich sonst leer ausgehen würde. Mein Weihnachtsmann hieß Franz und war ein Vertriebener aus dem Sudetenland. Ich hatte ihn am typischen Sudeten-»R« erkannt. Drei Jahre noch habe ich mich dumm gestellt. Antonia-Luise, meine Enkelin, war ehrlicher. Es sind auch andere Zeiten.
Im Dezember 1953 hat der Handelsorganisationskreisbetrieb Eisenberg (HO) in den Karl-Marx-Lichtspielen eine Weihnachtsmodenschau veranstaltet. Meine Schwester Ursula war eine der Mannequins. Die Bühne der Karl-Marx-Lichtspiele wurde vorweihnachtlich durch sieben spielende Zwerge belebt. Ein Zwerg wurde krank. Ich war zwar erst neun, aber schon größer als der größte Zwerg, den die Welt je gesehen hat. Meine Schwester machte kurzen Prozess und besetzte mich. Der Plakatmaler der HO war der künstlerische Leiter der Modenschau. Er verfügte, dass ich am Spiel der Zwerge nur liegend teilnehmen durfte. Es gab zwei Veranstaltungen, wenn ich mich aufgerichtet hätte, wäre ich bei der zweiten Ausgabe nicht mehr dabei gewesen, so die Drohung des Plakatmalers. Mein Zwergenehrgeiz reichte aus und so war ich beim zweiten Mal wieder dabei. Künstlerischer Ehrgeiz muss angeboren sein.
Vielleicht sind meine beruflichen Erfolge überschaubar, die Misserfolge auch. Der Ruhm der Sänger und Moderatoren ist ohnehin zeitlich begrenzt. Das Unrühmliche auch. Aber für einen, der als Zwerg (liegend) begonnen hat, bin ich ganz zufrieden, manchmal sogar glücklich, dankbar allemal.
Heimat ist dort, wo der Mensch alles, fast alles, das erste Mal getan, empfunden und erduldet hat. Es sind wie so oft die ganz kleinen Dinge, die bleiben, weil sie berührten. Aus einem schlichten Glaskrug meines Vaters trinke ich heute noch mein Feierabendbier. Aus einem Tonfass auf unserem Balkon wachsen Blumen. Das Fass diente vor hundert Jahren meinem Großvater zur Zubereitung von Senfgurken. Verblichene Bilder sowieso und die Feldpost meines Vaters, in der die einzigen Worte stehen, die er je an mich gerichtet hat. Mehr hat der Krieg nicht zugelassen.
Meine Schwester wohnt immer noch sesshaft in Großvaters Haus. Sie hat zunehmend Schwierigkeiten, die Wohnungen zu vermieten. Meine kleine Stadt wird merklich kleiner. Auch ich fahre an Eisenberg auf der Autobahn öfter vorbei, als ich dort bin. Als Reisebass ist das so. Wenn ich mit schlechtem Gewissen und guten Erinnerungen in beruflicher Eile vorbeifahre, rufe ich jedes Mal meine Schwester an. Das haben wir so verabredet. Ich rufe sehr oft an.
Eigentlich sollte diese Geschichte hier enden, aber vor wenigen Tagen ist mir im Holzland eine Freude zuteil geworden, die ich zum Ausgang des Eingangs hinzufügen möchte. Es fand ein Benefizkonzert für die Musikschule des Saale-Holzland-Kreises in Stadtroda statt. Zwanzig Kilometer von Eisenberg entfernt. Der Landrat, der offenbar doch nicht nur im Schloss von Christian dem Goldigen sitzt, hatte mich gebeten, dabei zu sein. Mein Pianist war schnell überzeugt mitzukommen. Die Musikschüler gaben ihr Bestes vor ausverkauftem Hause und das war mehr als beachtlich. Ich wollte dem nicht nachstehen und so gaben auch die Sponsoren und privaten Spender ihr Bestes: Geld. Während des Programms kam ein sympathisch zurückhaltend junger Mann mit einer Tüte auf mich zu. Er sagte: »Das soll ich Ihnen von meinem Großvater geben, Sie wüssten dann schon Bescheid.« Mit Dank und Überraschung nahm ich die Tüte, öffnete sie und sah drei lange Brötchen mit Salz und Kümmel bestreut. Das Langzeitgedächtnis führt manchmal dazu, dass der Mensch nachtragend ist. Hin und wieder dient es aber auch der unverhofften Freude. Der Ostschule gegenüber, in die ich vor fünfzig Jahren ging, befindet sich der Laden des Bäckermeisters Eckardt. Ein solches Brötchen mit Salz und Kümmel habe ich mir damals jeden Tag in der großen Pause gekauft. Dass dies der alte Bäcker noch wusste, hat mich gerührt. Dass ich es noch wusste, hat seinen Enkel verblüfft. Die Probe aufs Exempel stand auf der Tüte: »Bäckerei Eckardt Eisenberg/Th. Schloßgasse«. Ein Brötchen habe ich gleich, die anderen nach dem Konzert gegessen. Knusprig, würzig und unaufgeblasen wie vor fünfzig Jahren. Dem Bäcker sei Dank. Das nächste Mal fahre ich an Eisenberg nicht nur vorbei.
2
Das Guntherle
Als ich klein war, hatte es meine Mutter schwer mit mir. Eigentlich schon bevor ich auf die Welt kam. Es war auch später nicht leicht mit mir. Geboren am 18. September 1944. Hätte ich gewusst, dass die Nazis noch an der Macht sind, keine zehn Pferde hätten mich auf die Welt gebracht. Man weiß nichts von der Welt, bevor man sie betritt. Gut, dass es Instinkte gibt. Und so habe ich an der großen Brust meiner Mutter die Grundlage für einen gesunden Appetit bekommen, der mich nie mehr verlassen sollte. Dass ich dennoch in eine Zeit hineingeboren wurde, die nicht leicht war, wissen nicht nur die Historiker. Die ersten zwei bis drei Jahre im Leben eines Menschen sind in der Erinnerung eine dunkle Zeit. Da mein Großvater Ernst Emmerlich starb, als ich nicht ganz vier war, bin ich mir dieser ersten Erinnerung sicher. Er war Kaufmann und hatte wie alle Kaufleute weniger mit Kaufen als mit Verkaufen zu tun. Jedenfalls war er aus Geschäftsgründen ständig in Eile. Sein Geschäft nannte man Kolonialwarenladen, obwohl Deutschland schon lange keine Kolonien mehr besaß. Lebensmittelgeschäft oder Kaufhalle würde man heute sagen. Erdnüsse nannten sie Kameruner, in Anlehnung an die einstige Kolonie Kamerun. Letztlich ein lächerlicher Versuch, einen Hauch Kolonialmacht hinüberzuretten. Mittlerweile hatte ja Deutschland noch mehr verloren als die Kolonien.
Vor allem das gute Gewissen.
Darunter leiden wir noch heute. Die Kameruner heißen wieder Erdnüsse. Wenn heute einer von Kamerunern spricht, meint er Fußballer.
Es gab alles Essbare im Laden meines Großvaters und danach roch er auch. Selbst gerösteter Kaffee, Zimt, Vanillepulver und Spreewälder Gurken. Spreewälder Gurken gab es immer, natürlich in Fässern. Es gibt Leute, die diese würzigen Dinger gern mit der DDR in Verbindung bringen. Es sind entweder ahnungslose oder vergessliche Zeitgenossen. Wie schon gesagt, die gab es immer. Nur in der DDR waren sie nicht immer vorrätig. In Supermärkten im Westen gab’s die immer.
Großvater war klein und ehrgeizig. Mir gegenüber zeigte er sich großzügig und liebevoll. Er hatte vier Söhne. Drei starben als junge Männer, vom vierten, meinem Vater, hatten sie die letzte Feldpost Anfang 1945 erhalten. Mich nannte der Großvater Stammhalter und las mir jeden Wunsch von den Augen ab. Mit Drops und Brausepulver wurde ich reichlich versorgt, vor allem aber mit Brotkanten. Noch heute lasse ich alles stehen, wenn ein frisches Brot im Hause ist. Einen dicken Kanten abschneiden, gute Butter und Salz drauf und fertig ist mein Leibgericht. Großvater hat diese Leidenschaft als Erster entdeckt, was zur Folge hatte, dass alle Brote im Hause Emmerlich vorn und hinten angeschnitten waren. Das war dann jedes Mal der Anfang vom Ende eines frischen Brotes. Mit einem Satz: Es trocknete aus. Dem Unverständnis der Familie begegnete Großvater mit den Worten: »Wenn’s doch dem Stammhalter schmeckt.«
Der »Stammhalter« saß auf dem Boden in der Ecke und ließ es sich gut gehen. Die Hektik im Laden störte mich nicht. Unser Nachbar war der Bäcker Kristen. Die Gerüche aus der Backstube, vermengt mit den Kolonialwaren des Großvaters, habe ich in angenehmer Erinnerung. In manchen Markthallen bekommt man das mitunter heute noch geboten.
Irgendwann im Laufe des Jahres 1947 war Großvater nicht mehr da. Meine Mutter sagte, er sei im Himmel. Ob es ihm dort gut gehe und ob er uns denn mal besuche, wollte ich wissen. »Na klar«, sagte meine Mutter und schnitt mir vom frischen Vierpfundbrot den zweiten Kanten ab.
Mein Geburtshaus im ostthüringischen Eisenberg hat Großvater 1912 bauen lassen. An der Haustür sind zwei »E« angebracht: Ernst Emmerlich. Es wollen eben auch Kolonialwarenhändler, die mit leicht verderblicher Ware zu tun haben, etwas für die Ewigkeit hinterlassen. Die beiden »E« sind erhaben auf der Tür und man kann sie heute noch sehen. Aber man übersieht sie und wenn sie einer sieht, weiß er nicht, was sie bedeuten. Dass Großvater mir, obwohl immer in Eile, freundlich mit seinen kleingeldgeschwärzten Fingern durch die Haare fuhr und die Sache mit den Kanten habe ich nie vergessen. Der Verlust eines Menschen schmerzt einen Dreijährigen weniger, zumal, wenn andere die Lücke mit Liebe füllen.
Großvater Ernst ging es im Himmel offenbar so gut, dass er uns nicht mehr besuchte. Dafür kamen jetzt die Großeltern mütterlicherseits, Richard und Luise, zu uns. Weiterhin Familie Runge aus dem Sudetenland, Frau Sterz aus Schlesien und der Zahnarzt Doktor Kaebitz mit Frau und zwei Söhnen, ebenfalls aus Schlesien. Die Invasion der Vertriebenen hatte für einen kleinen Jungen durchaus etwas Bereicherndes. Das damit verbundene Elend ist für Dreijährige lediglich eine Randerscheinung, wenn überhaupt. Meine acht Jahre ältere Schwester hat da sicherlich mehr mitbekommen, kümmerte sich aber auch sehr intensiv um ihre Zöpfe und das Poesiealbum.
Runges sprachen ein lustiges »R«. Eben das »R« des Sudetenlandes, das auch in der Oberlausitz, in Teilen des Thüringer Waldes und des Westerwaldes gesprochen wird. Völlig neue Wörter habe ich gelernt. Apernmauke und Hietrogbradl, mit diesem fast amerikanisch anmutenden »R«. Sprachforscher wissen vermutlich, wann dieses komische »R« auf Wanderschaft gegangen ist. Vielleicht ist es auch Zufall. Das erste heißt Kartoffelmus und das zweite Tablett. Apernmauke und Hietrogbradl. Vieles, was ich schon hätte verstehen können, habe ich nicht verstanden. Aber es klang alles lustig, zumal Franz und Minke, eigentlich Maria, fröhliche Menschen waren. Franz war Kutscher und Minke Reinemachfrau. Sie hatten ein gutes Herz, aber schlechte Zähne. Die Brotrinden, die sie nicht mehr kauen konnten, bekam ich. Den Kanten sowieso. Schon deswegen mochte ich sie. Außerdem nahm mich Franz oft auf dem Kutschbock seines Pferdefuhrwerkes mit. Seine Pferde hießen Max und Prinz. Sie gehörten ihm nicht, aber sie hörten auf ihn. Den Besitzer behandelten sie wie einen Fremden. Zum Motorrad, das er nicht besaß, sagte er Manntorat, mit diesem komischen »R«. Wahrscheinlich konnte er sich nicht vorstellen, dass darauf eine Frau fährt, schon gar nicht seine Minke. Minke hatte einen Hintern fast wie Prinz, aber deutlich dicker als Max, der war der Schlankere von beiden. Die Peitsche benutzte Franz nur als akustisches Signal für die Pferde, ansonsten sprach er mit ihnen oder gab den beiden einen Klaps auf den Hintern. Bei Minke verfuhr er ähnlich, was ihr nicht missfiel. Wenn ich dabei war, bekam Minke immer einen roten Kopf und sagte: »Runge Franz«. Und ich wusste nicht, was es zu bedeuten hatte.
Dass Runges den Teil unserer Wohnung bewohnten, in dem ursprünglich unser Bad war, hat meine Mutter mehr gestört als mich. Waschen ist für Kinder ein notwendiges Übel. Eigentlich nur Übel.
Abends bekamen sie oft Besuch von Landsleuten. Die ersten zwei Stunden war es immer sehr ernst. Sie sprachen von zu Hause, dann wurde süßer Likör getrunken, Halb und Halb, Kirschlikör, Pfefferminzlikör und Ähnliches. Dann wurde es laut und lustig. Sie sangen derb oder leise, wie es die Lieder hergaben. Auch Teile aus der »Fledermaus« waren dabei: »Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.« Die Traurigkeit, aber auch die Sinnfälligkeit dieser Textzeilen haben sich mir erst viel später erschlossen. Auch Schuld und Sühne am verschuldeten Krieg werden nicht gerecht verteilt. Sieger sind keine Seelsorger.
Frau Sterz aus Glogau in Schlesien war eine sehr eigenständige Frau. Ihren Mann und den Sohn hat sie im Krieg verloren. Eine merkwürdige Formulierung, aber so sprach man damals. Als hätte irgendjemand irgendetwas in diesem Krieg gewonnen. Ihre Tochter, bei Kriegsende schon eine erwachsene Frau, vertrieb es nach Westdeutschland. Auch sie war sehr eigenständig. Ihre Mutter besuchte sie nur einmal im Jahr. Pakete kamen öfter. Ihr Aufenthalt in Eisenberg war jeweils zu kurz, um zu wissen, was dort fehlt. Sie schickte ihrer Mutter Kopftücher, Grieß, Mehl und Äpfel. Dadurch rochen ihre Pakete auch nicht wie Westpakete, eher wie eine Sendung aus Glogau. Aber da war ja gar niemand mehr von der Familie Sterz. Ihr Wasser holte Frau Sterz in unserer Küche, denn das Zimmer unserer Wohnung, das sie jetzt bewohnte, hatte keinen Anschluss. Ob Schlesier generell weniger redeten als Sudetendeutsche, weiß ich nicht. Frau Sterz jedenfalls redete weniger als die Mecklenburger. Von den Äpfeln aus den Westpaketen ihrer Tochter hat sie mir manchmal einen gegeben, beim Wasserholen in der Küche. Zum Apfel hinzu gab es immer noch einen Satz von ihr: »Iss ihn mit Verstand, der ist aus dem Westen.« Ich fürchte, das hat sie ernst gemeint.
Sie arbeitete als Hilfskraft in der Eisenberger Wurstfabrik. Der Kenner weiß, dass Eisenberger Wurst immer schon etwas Besonderes war. Ein kleines kostenloses Deputat bekamen auch die Hilfskräfte monatlich mit nach Haus. Größere Mengen brachte sie wöchentlich mit – auch kostenlos. Mein erster Eindruck von »Volkseigentum«. Frau Sterz war redlich und unredlich mit Wurst versorgt, eben eigenständig. Mir hin und wieder eine Scheibe zu geben war für sie nicht der Rede wert. Und so sagte sie auch nichts. Die konnte ich also ohne Verstand essen.
Zu anderen Schlesiern in Eisenberg hatte sie wenig Kontakt. Sie hätten sich bestimmt gern eine Scheibe bei ihr abgeschnitten – von der Wurst –, aber so viel war nun auch wieder nicht da.
Als ich 1950 in die Schule kam, schenkte sie mir ein Wurstpaket, das redliche, monatliche. Und einen Apfel. Der Apfel sah genauso aus wie die Äpfel aus den Westpaketen, da sie aber nichts dazu sagte, war er vermutlich aus der HO.
Frau Sterz hieß Martha und hatte die Ausstrahlung einer romanischen Marienfigur. Ruhe und in sich und bei den Emmerlichs wohnend. Kein böses Wort und wenig andere habe ich je von ihr gehört. Kinder können mit so viel Ruhe nicht viel anfangen. Es waren aber wurstarme Zeiten, deswegen mochte ich sie trotzdem. Sie hatte keine Feinde, war aber ansonsten eigenständig.
Familie Kaebitz wohnte in unserem Wohnzimmer. Die beiden Söhne, annähernd in meinem Alter, waren mir willkommene Spielkameraden, Radaubrüder, Lärmmacher – kurz Interessenvertreter.
Kinder verlieren nicht den Anspruch auf mittlerweile vermietete Wohnräume. Beim Versteckspiel mit den Zahnarztsöhnen brauchten die beiden sehr lange, um mich hinter dem Badeofen bei Runges oder unter dem Bett von Frau Sterz zu finden. Dort vermuteten sie mich nicht. Bei der nächsten Runde hat Jörg, der wohlerzogene Kaebitz, bei Frau Sterz angeklopft. Nach einer Weile sagt sie: »Herein«. Jörg guckte unter ihr Bett, aber dort war’s inzwischen sauber und ich stand mit diesen Staubflocken an der Hose und am Pullover in Marthas Schrank. Frau Sterz sagte wie immer nichts und das war hier goldrichtig. In ihrem Schrank roch es verführerisch nach Wurstfabrik. Da ich hier nicht entdeckt wurde, konnte ich das eine Weile genießen.
Das Wohnzimmer, in dem meine neuen Freunde wohnten, wurde durch Paravents dreigeteilt, eine vorher ungeahnte Möglichkeit, über diese provisorischen Wände Volleyball zu spielen. Auch Kissenschlachten mit und ohne Paravent waren ein herrlicher Zeitvertreib. Kissenschlachten über Paravents gefährden allerdings die Treffsicherheit. Das japanische Teeservice von Doktor Kaebitz hatte die Flucht aus Schlesien überstanden, nicht aber unsere Kissenschlachten. Eine Weile fand das alles die Nachkriegsgroßfamilie wider Willen ganz niedlich, aber jetzt wurden uns Grenzen gesetzt. Der Bogen war überspannt, als wir in dieser Wohnung mit vier Parteien auch noch Hasch-mich spielten, Stehlampen umfielen, Stühle barsten und Türklinken aus der Halterung gerissen wurden – da schwieg nur noch Frau Sterz.
Mittlerweile hatte man die DDR gegründet, es ist der reine Zufall, dass mit der neuen Ordnung auch uns ein neuer Spielplatz zugewiesen wurde: der Platz der Republik. Ein großer Platz mit Springbrunnen, neuen Fahnen und Transparenten, Riesenflächen zum Kreiseln und Hasch-mich-Spielen. Nur verstecken konnten wir uns nicht mehr so gut. Und es roch nirgendwo nach Wurstfabrik auf dem Platz der Republik. Aber neue Freunde gab es hier: Wurschtel, Voller und Petschi. Nur Voller war Eisenberger, Wurschtel und Petschi waren willkommene Vertriebene.
Der Platz hatte vorher Adolf-Hitler-Platz geheißen und davor Schützenplatz. So heißt er jetzt wieder, obwohl es den Schützenverein und das dazugehörige Schützenhaus nicht mehr gibt. In unserem Haus am Platz wohnten früher drei Parteien. Nach dem Krieg waren es mit einem Mal sechzehn. Da wird’s eng. Aber wir hatten ja jetzt den Platz der Republik.
Die Eltern meiner Mutter, Luise und Richard, wohnten im dritten Stock. Luise war großmütterlich, aber Richard mochte keine lauten Menschen und schon gar keine lauten Kinder. Leise Kinder gibt es nicht. Dabei war er mal Offizier beim Kaiser gewesen und später Gendarm. Da geht’s ja auch laut zu, aber vielleicht hatte er mit dem Lauten abgeschlossen. Immerhin hat er mir Sechsundsechzig und Skat beigebracht. Nicht nur die Pfeife, die er ständig qualmte, zog seine Mundwinkel nach unten. Oma Luise war lieb. Das hatte sie meiner Mutter vererbt. Obwohl ich kein Edelknabe war – die Leute sagten: »Dem fehlt der Vater!« –, nahm mich Mutter immer in Schutz und las mir jeden Wunsch von den Augen ab. Bald aber konnte sie meine Wünsche nicht mehr erfüllen. Solange ich denken kann, war sie krank. Sie hatte eine schleichende, todbringende Krankheit. Sie konnte das Geschäft nicht halten, es wurde von der sozialistischen Handelsorganisation mit geschmatzten Händen und kläglichen Bedingungen übernommen. Feindliche Übernahme nennt man so was heute. Sie war zu krank und zu stolz, um als Verkäuferin der HO in Großvaters Geschäft im Haus am Platz der Republik zu arbeiten.
»Wenn ich groß bin, werde ich Kaufmann« – den kleinen Kinderkaufmannsladen hatte ich schon – »und dann kaufe ich den Laden wieder zurück!«, sagte ich. Meine Mutter sah mich milde lächelnd und mit einem kaum vernehmbaren Kopfschütteln an und sagte: »Bestimmt machst du das.« Es lagen Güte und Hoffnungslosigkeit auf ihrem Gesicht. Vielleicht ahnte sie, dass für solche Kinderträume im Sozialismus kein Platz war.