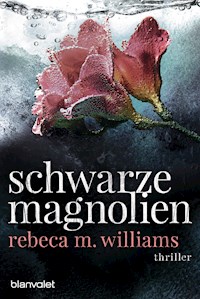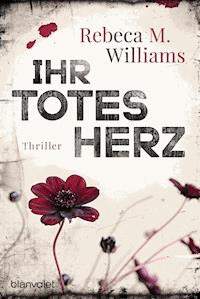
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du wachst neben einem Toten auf und kannst dich an nichts erinnern … Bist du die Mörderin?
Es war einer dieser Albträume, aus denen man panisch aufwacht, um erleichtert festzustellen, dass man sicher im eigenen Bett liegt. Doch etwas stimmt nicht. Ihr Körper ist blutverschmiert. Jessie weiß weder, wo sie ist, noch was passiert ist. Für sie ein furchtbares Déjà-Vu: Vor 20 Jahren wurden sie und ihre Schwester Fran von vier Männern überfallen. Nach einem heftigen Schlag auf den Kopf verlor Jessie das Bewusstsein und ihr Gedächtnis. Nun scheint die Vergangenheit sich zu wiederholen – doch diesmal liegt ein paar Meter weiter die Leiche eines fremden Mannes ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Jessie wacht im Morgengrauen nackt und mit einem Filmriss in den Sümpfen von Louisiana auf. Als sie auf der Suche nach ihrer Kleidung umherirrt, stößt sie auf die brutal zugerichtete Leiche eines Mannes. Sie kennt ihn nicht, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie selbst die Mörderin ist. Wie betäubt trampt sie zurück nach New Orleans, versucht, die vergangene Nacht und ihre Spuren wegzuwaschen. Doch Jessie ahnt nicht, dass der wahre Albtraum noch vor ihr liegt – und dass ein lange vergrabenes Trauma aus ihrer Vergangenheit mit aller Gewalt zurück an die Oberfläche drängt …
Die Autorin
Rebeca M. Williams ist das Pseudonym einer erfolgreichen Romanautorin, die neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit viele Jahre lang als Juristin gearbeitet hat. Mit ihren Thrillern Schwarze Magnolien und Ihr totes Herz erschließt sie eine neue Erzählwelt voller gefährlicher Machenschaften und menschlicher Abgründe. Rebeca M. Williams lebt in der Nähe von Frankfurt.Besuchen Sie uns auch auf www.blanvalet.de, www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Rebeca M. Williams
IHR TOTES HERZ
Thriller
1. KAPITEL
Das hier war nicht real. Es war einer von diesen Albträumen, aus denen man schweißgebadet und nach Luft schnappend aufwacht und eine Weile orientierungslos blinzeln muss, bis man erleichtert feststellt, dass man in seinem Bett liegt und nichts zu befürchten hat. Man atmet tief durch und starrt eine Zeitlang an die Zimmerdecke, während der jagende Puls sich wieder normalisiert. Man merkt im Dämmerlicht des aufziehenden Morgens, dass alles nur ein Traum war. Anschließend schläft man entweder wieder ein oder steht auf, weil der Wecker sowieso bald klingelt und weil man auf den Schreck dringend eine Tasse Kaffee benötigt.
Aber Jessie sah keine Zimmerdecke. Über ihr breitete eine Platane ihr verkrüppeltes Geäst aus. Dazwischen waren Fetzen eines bleichen Himmels zu sehen, mit einer Andeutung von Rosa am unteren Rand. Sie lag nicht in ihrem Bett, sondern an einer Uferböschung. Ihre Füße hingen im Wasser.
Reflexartig zog sie die Beine an und setzte sich auf. Zu schnell, wie sie sofort merkte. Stechender Schmerz schoss ihr in die Schläfen. Ihre Beine und ihr Rücken protestierten, alles tat weh wie bei einem höllischen Muskelkater. Zwischen ihren Schenkeln fühlte es sich wund an, wie nach …
Nein. Doch dann sah sie hin und erkannte die blauen Flecken und Spuren von Blut. Gleichzeitig begriff sie, dass sie nackt war. Ihr Körper trug noch weitere Spuren von Gewalt. An ihrer rechten Brust sah sie bläulich unterlaufene Bissspuren. Um ihre Handgelenke zogen sich rötliche Fesselmale. An den Fingern klebte eine braunrote getrocknete Substanz – Blut. Es sah aus, als hätte sie in Schlachtabfällen gewühlt. Um einen ihrer Füße war ein Strick geknotet, dessen loses Ende wie eine leblose Schlange neben ihrem Bein lag.
Sie wandte den Kopf zur Seite und erbrach alles, was sie im Magen hatte. Viel war es nicht, hauptsächlich gallebittere Flüssigkeit. Wann hatte sie das letzte Mal etwas gegessen? Gestern Abend auf der Party, und zwar eines von diesen bunt belegten Kanapees, fiel ihr ein. Aber was war danach passiert? In ihrem Kopf tat sich ein schwarzes Loch auf. Sie konnte sich nicht erinnern.
Nein, dachte sie. Nein, nein, nein. Es war nicht möglich. Es musste ein Albtraum sein. Einer von denen, die eigentlich schon vor langer Zeit aufgehört hatten.
Sie drückte die angezogenen Beine fest zusammen, fing an zu weinen und sah sich gleichzeitig gehetzt um. Sumpfiges Wasser, Mangrovenwälder, grün überwuchertes Gelände. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, aber es musste irgendwo draußen in den Bayous sein. Am gegenüberliegenden Ufer des Wasserlaufs drängten sich Sumpfzypressen aus dem Mangrovendickicht, und das erste Tageslicht wurde von sachte dahintreibendem Nebel getrübt.
Es musste früher Morgen sein. Taumelnd stand sie auf. Ihr Körper schmerzte noch heftiger, sie musste sich erneut übergeben, doch es endete nur noch in einem trockenen Würgen. Sie stolperte durchs Gebüsch und kämpfte sich seitlich die Uferböschung hinauf. Irgendwo lag vielleicht ihre Kleidung. Ihre Schuhe, die Handtasche mitsamt Handy … Sie musste die Polizei anrufen.
Schilf und scharfkantiges Geröll befanden sich unter ihren Füßen. Jessie merkte, wie die Haut ihrer Fußsohlen aufriss. Dann trat sie auf etwas, an dem sie sich richtig verletzte. Es tat so weh, dass sie aufschrie. Eine Mokassinschlange, schoss es ihr durch den Kopf. Hier draußen in den Sümpfen gab es genug von den Biestern, die Menschen töten konnten – jedenfalls die, die so unvorsichtig waren, ohne Schuhe und ohne Kleidung durchs Schilf zu stolpern. Mit angehaltenem Atem verharrte sie und lauschte auf ein Rascheln, ein verräterisches Davongleiten zu ihren Füßen, und zugleich wartete sie auf die betäubende Wirkung des Gifts. Doch sie war nicht von einer Schlange gebissen worden. Als sie sich bückte, um ihre verletzte Ferse zu untersuchen, sah sie das Messer, dessen Schneide sich in ihren Fuß gegraben hatte. Unwillkürlich hob sie es auf. Es war ein breites Bowiemesser, eins von der Sorte, wie sie die Fallensteller der Gegend verwendeten, um kleinere Tiere zu schlachten und abzuhäuten. An der Schneide war eingetrocknetes Blut zu sehen, aber auch glänzende frische Blutstropfen – von der Verletzung, die sie sich zugefügt hatte. Hastig ließ sie das Messer wieder fallen.
Der Schnitt an ihrem Fuß war nicht tief, blutete aber heftig und tat beim Weitergehen so weh, dass sie sich auf die Lippe beißen musste, um nicht laut zu stöhnen. Mühsam humpelte sie vorwärts, und als sie nach einigen Schritten einen ihrer Schuhe und gleich darauf den zweiten fand, schossen ihr Tränen der Erleichterung in die Augen. Sie hob sie auf und sah sich suchend um, bis sie zwischen Schilfhalmen und einem Teppich aus blauen Glockenblumen weitere Teile ihrer Kleidung entdeckte. Rock und Bluse, der BH. Der Rock war aus luftigem Flatterstoff, die Bluse ein dünnes weißes Seidenfähnchen. Sie erinnerte sich, dass sie beides erst nach Feierabend angezogen hatte. Helen und sie waren zusammen mit zig anderen Leuten aus der Gegend auf dieser Party gewesen, einer Einweihungsfeier für einen neuen Laden. Irgendwann hatte sie Helen aus den Augen verloren, weil es dort so voll gewesen war. Ein paar Typen hatten sie angegraben, das Übliche, Jessie hatte sie jedoch ignoriert, abgesehen von belanglosem Smalltalk und einem gemeinsamen Drink. Sie hatte vor zwei Monaten mit Bert Schluss gemacht, aber das hieß nicht, dass sie sich gleich in das nächste Abenteuer stürzen wollte. Dafür war die Trennung zu frisch.
Sie hob den Rock auf und streifte ihn eilig über. Der Reißverschluss war eingerissen, er ließ sich nur zum Teil schließen. Doch er hielt, das war die Hauptsache. Der BH war intakt, aber sie brauchte eine Weile, um ihn zu schließen, weil ihre Finger so zitterten und weil ihr beim Anblick ihrer blutverkrusteten Finger erneut die Tränen kamen. Mit der Bluse – das Ding war angesichts des vielen eingetrockneten Bluts auf ihren Händen noch erstaunlich weiß und fleckenlos – hatte sie weniger Schwierigkeiten, Jessie konnte sie sich einfach über den Kopf streifen.
Sie bewegte sich wie ein Roboter. In ihrem Inneren war nichts als Panik. Sie spürte die kalte alte Angst von damals, als sie … Stopp. Sie verbot sich, daran zu denken. Es war diesmal ganz anders. Sie hatte keine Amnesie. Der Filmriss kam vom Alkohol, musste davon kommen. Sie hatte gestern Abend zu viele Drinks gehabt, und dann … Sie hatte keine Ahnung, was dann passiert war. Gott im Himmel, sie wusste es einfach nicht mehr!
Mit mechanischen Bewegungen streifte sie trotz ihres blutenden Fußes die Riemchensandaletten über, ehe sie weiterstolperte, um nach ihren übrigen Sachen zu suchen. Ihre Handtasche lag hinter einer von spanischem Moos überwucherten alten Eiche. Jessie hob sie auf und wühlte fieberhaft nach dem Handy. Wie immer war die Tasche vollgepackt, und sie musste graben und schieben und zerren, bis sie das Smartphone endlich fand. Ein Laut der Enttäuschung entwich ihr, als sie sah, dass der Akku leer war. Dumpf entsann sie sich, dass der Ladestand schon im roten Bereich gewesen war, als sie zu der Party ging. Ein Versäumnis, das sich jetzt rächte. Immerhin schien nichts vom Inhalt der Tasche zu fehlen. Ihre Brieftasche war da, nebst allen Kreditkarten, Kleingeld, sogar die Hundertdollarnote, die sie immer als Bargeldreserve für unterwegs dabeihatte.
Jessie wollte nur noch nach Hause. Irgendwo in der Nähe musste es eine Straße geben und damit einen Weg, der aus dieser Wildnis herausführte. Sie war sicher, dass sie vorhin, als sie sich auf den vermeintlichen Schlangenbiss konzentrierte, in der Ferne das Brummen eines Trucks gehört hatte.
Sie stolperte weiter. Die blutende Ferse rutschte in der Sandalette hin und her, und der unebene Boden erschwerte das Gehen zusätzlich.
Sie umrundete einige der hohen, alten Bäume, zwischen denen sich immer mehr von dem bleichen, frühen Licht sammelte, das dem Sonnenaufgang vorausging. Es war vielleicht fünf oder halb sechs und noch beinahe kühl, aber die schwere, feuchte Hitze des Tages würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Und dann sah sie den reglosen Körper. Er lag am Rand einer schmalen Lichtung zwischen den Mangroven in Ufernähe und den moosüberwucherten Eichen, die das Gelände überschatteten, als wollten sie einen Hauch der vergangenen Nacht dort festhalten. Doch auch das gnädige Dämmerlicht konnte das Grauen dieses Anblicks nicht verhüllen. Der Mann lag rücklings mit beinahe ordentlich ausgestreckten Gliedern da. Er war völlig nackt und ohne jede Frage tot. Jessie hätte die Augen schließen oder sich umdrehen und wegrennen können, doch sie war zu beidem nicht imstande. Eine morbide, mit Angst gepaarte Neugier zwang sie, auf den Toten zuzugehen und ihn zu betrachten. Sie kannte den Mann nicht, was sie auf unbestimmte Weise erleichterte. Ganz sicher hatte sie ihn nicht auf der Party gesehen, jedenfalls nicht während der Zeit, an die sie sich erinnerte.
Ein Weißer, vielleicht Mitte vierzig, dunkle Haare, schlank. Seine Augen starrten blicklos in das Geäst der Bäume. Als er noch gelebt hatte, musste er recht gut ausgesehen haben. Jetzt nicht mehr. Jemand hatte ihn verstümmelt, ihn entmannt. Glied und Hoden waren vollständig vom Körper abgetrennt. Ob er daran gestorben war oder an dem Schnitt, der sich als tiefe rotbraune Furche quer über seine Kehle zog, konnte Jessie nicht sagen, aber vermutlich hatte er noch gelebt, als man ihm das antat. Irgendwo hatte Jessie mal gelesen, dass Wunden, die postmortal zugefügt wurden, nicht mehr richtig bluteten. Der Mann hatte geblutet, und zwar heftig.
Jessie wusste instinktiv, dass das Bowiemesser die Tatwaffe war. Aus unerfindlichen Gründen wusste sie zudem, dass er gestorben war, weil er ihr Gewalt angetan hatte, auch wenn sie sich nicht daran erinnern konnte. So wie sie es schon einmal vergessen hatte, damals, als ihr Leben sich über Nacht in einen Scherbenhaufen verwandelt hatte.
Mit einem Schlag wurde ihr bewusst, dass der Grund ihres Vergessens vielleicht nicht nur mit dem zu tun hatte, was ihr in der vergangenen Nacht widerfahren war, sondern auch mit dem, was sie möglicherweise getan hatte.
Die Erkenntnis schnürte ihr die Luft ab. Das Wort möglicherweise traf es nicht. Wahrscheinlich passte besser. Das Messer, das auf halber Strecke zwischen dem Toten und der Stelle gelegen hatte, an der sie aufgewacht war … Das viele Blut an ihren Händen …
Hektisch stolperte sie zurück zum Wasserlauf. Sie kniete sich ans Ufer und wusch sich in dem brackigen Wasser die Hände. Rieb verbissen die Finger ab, bis keine Blutspuren mehr zu sehen waren. Dabei ging ihr durch den Kopf, dass es bestimmt nicht mehr lange dauern würde, bis die ersten Alligatoren auftauchten. Sie lauerten hier in der Gegend überall, eigentlich war es ein Wunder, dass sie nicht schon in der Nacht gekommen waren und ihr die Füße abgebissen hatten. Die bloße Vorstellung brachte Jessie erneut zum Würgen. Mühsam stand sie wieder auf, den pochenden Schmerz in ihrer Ferse ignorierend. Auch das Brennen im Intimbereich blendete sie beharrlich aus. Es tat schon längst nicht mehr so weh wie zu Anfang. Sie würde es überstehen, schließlich hatte sie es damals auch geschafft.
Nicht nur die Schmerzen ließen nach. Auch ihre Gedanken verloren an Schärfe, sie wusste nur noch, dass sie hier wegwollte. Ihr war schlecht, sie fühlte sich schwindlig und schwach, ihr ganzer Körper zitterte haltlos, sie konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Aber sie würde nach Hause finden. Ihre Handtasche umklammernd, stakste sie durch Röhricht und Gestrüpp und suchte im Licht der aufgehenden Sonne nach der Straße. Irgendwo hier in der Nähe fuhren Autos vorbei, so viel war sicher, denn gerade eben hatte sie schon wieder ein Motorgeräusch gehört. Wenigstens das wusste sie genau.
Und noch etwas wusste sie: Der Kerl hatte seinen Teil gekriegt. Er hatte bekommen, was er verdiente.
Jessie marschierte eine Weile die staubige Straße entlang, ohne jedes Gefühl für Raum und Zeit. Ihr Kopf fühlte sich an wie ein Ballon, gefüllt mit dumpfer Leere, frei von allen störenden Gedanken. Sie war nur noch von dem Ziel beseelt weiterzugehen, bis jemand sie mitnahm.
Als sie den näher kommenden Truck hinter sich hörte, schaffte sie es gerade noch, den Arm auszustrecken und mit hochgerecktem Daumen auf sich aufmerksam zu machen. Der große Laster bremste und hielt ein Stück weit voraus, sie hatte den Eindruck, ewig laufen zu müssen, bis sie endlich die Fahrerkabine erreicht hatte und einsteigen konnte.
»Wo soll’s hingehen, Miss?« Der Mann hinterm Steuer beendete ein Handytelefonat, dann musterte er sie abwägend. Sie sah aus den Augenwinkeln, dass er jung war und ihre Reize durchaus wahrnahm. Ihre langen gebräunten Beine, die halb transparente Bluse, unter der ihr hautfarbener BH die Konturen ihrer vollen Brüste betonte, ihre geschwungenen Hüften, ihr lockiges langes Haar. Bert pflegte zu sagen, sie verkörpere auf geradezu unanständige Weise den erotischen Traum junger Kerle von der erfahrenen Frau. Elegant, sexy, überlegen – und immer knapp außer Reichweite.
»Nach Hause«, murmelte sie.
»Wo ist das, Miss? Ich fahr nach N’awlins.«
»Da will ich auch hin.«
»Hatten Sie einen Unfall, Miss?« Seine Stimme klang mit einem Mal besorgt. »Ihr Fuß ist ganz blutig. Und ihre Beine haben auch was abgekriegt, glaube ich. Soll ich Sie nicht besser bei einem Arzt abladen?«
»Nein, das ist nicht nötig, es ist alles in Ordnung.« Jessie zog unwillkürlich die Manschetten der Bluse tiefer über ihre Handgelenke, damit er die verfärbten Fesselmale nicht auch noch sah. »Ich hatte etwas Stress mit meinem Mann. Wir hatten einen schlimmen Streit, ich wollte aussteigen, er ließ mich im Morgengrauen raus und brauste davon. Das mit dem Fuß war Pech. Ich hatte mir eine Blase gelaufen und wollte für eine Weile die Schuhe ausziehen. War eine ganz blöde Idee. Bin in eine Glasscherbe getreten. Und hingefallen, daher die Schrammen.« Sie brachte die Lüge auf eine Weise vor, als täte sie den ganzen Tag nichts anderes, als sich plausible Ausreden auszudenken.
»Ich hätte ja jemanden angerufen, aber leider war bei meinem Handy der Akku leer.« Das war das Clevere am Lügen – man musste ein Stück Wahrheit einflechten. Laut Bert förderte das die Glaubwürdigkeit. Er musste es wissen, schließlich hatte er jeden Tag mit notorischen Schwindlern und Betrügern zu tun. Als Strafverteidiger war er mit allen Wassern gewaschen und konnte sich seine Mandanten schon seit Langem aussuchen. Aber auch reiche Leute mit scheinbar weißer Weste begingen schmutzige Morde. Oder brachten andere auf verbrecherische Weise um ihr Geld. Bert paukte sie trotzdem regelmäßig raus oder sorgte wenigstens für milde Strafen.
Ein neuer Gedanke fand den Weg in die dumpfe Leere in ihrem Kopf: Ob er auch ihr helfen würde, wenn sie nicht gut genug log?
Sie starrte aus dem Fenster des Lkw und hatte keine Ahnung, wo sie war. Auf jeden Fall im Cajun Country, aber wo genau? Sie sollte den Trucker danach fragen. Aber auch dazu fehlte ihr die Kraft. Dann sah sie das Straßenschild. Thibodaux. Fünfundsiebzig Meilen bis New Orleans. Wie zum Teufel war sie in diese Gegend gekommen? Jessie ließ die Lider über die brennenden Augen sinken und wünschte sich verzweifelt ihre Erinnerungen zurück.
»Schlafen Sie ruhig ein bisschen«, sagte der junge Trucker. »Wir brauchen noch ’ne ganze Weile. Sie sehen wirklich fertig aus. Ihr Mann ist ein echtes Arschloch. Sorry, aber das muss ich jetzt mal so sagen. Eine Weltklasse-Lady wie Sie mitten in der Wildnis rauszuwerfen – das ist mies. Jemand sollte ihm Manieren beibringen.«
Sicher erwartete er eine dankbare Reaktion auf seine mitfühlenden Äußerungen, aber Jessie brachte nur ein schwaches Nicken zustande. Müdigkeit senkte sich auf sie wie ein dichtgewebtes Tuch. Sie wollte nicht einschlafen, nicht allein neben einem fremden Mann in einem Truck. Aber wenigstens etwas ausruhen. Nicht mehr denken. Nicht an den kastrierten Toten am Bayou. Nicht an die Nacht vor zwanzig Jahren. Nicht an die Zeit danach.
Nicht an morgen.
Irgendwann musste sie doch eingedöst sein, denn sie wachte an einer Tankstelle an der Interstate auf, nur noch ein paar Kilometer von New Orleans entfernt. Der Trucker stand draußen an der Zapfsäule und unterhielt sich mit einem anderen Fahrer. Jessie stieg aus und ging steifbeinig in Richtung Kassenhaus. Der Trucker folgte ihr.
»Alles in Ordnung, Miss?«
Jessie erwachte für einen Moment aus ihrer Benommenheit. »Ja, alles bestens. Vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben.« Sie holte ihre Brieftasche heraus und gab dem Trucker die Hundertdollarnote. »Für Ihre nette Hilfe«, murmelte sie.
»Wow.« Der junge Mann betrachtete das Geld unschlüssig, offenbar hin und her gerissen zwischen seinem männlichen Stolz und der Erkenntnis, dass hundert Dollar zu viel Geld waren, als dass er sie einfach lässig zurückweisen sollte. Am Ende steckte er den Geldschein ein und bedachte Jessie mit einem zögerlichen, dankbaren Lächeln. »Hab ich gern gemacht, Miss. Wenn Sie mal Hilfe brauchen – ich meine, wegen dieses Kerls, der so unverschämt war, Sie da draußen auf die Straße zu setzen –, melden Sie sich einfach bei mir. Hier ist meine Visitenkarte.«
Bevor sie Einwände erheben konnte, zog er ein zerdrücktes Pappkärtchen aus der Hosentasche und überreichte es ihr.
Jessie versenkte es in ihrer Handtasche. »Vielleicht komme ich mal darauf zurück«, sagte sie, ehe sie sich mit einem Nicken von ihm verabschiedete und in Richtung Kassenhaus weiterging. Dort ließ sie sich von einem der Angestellten ein Taxi rufen.
Die neugierigen Blicke des Taxifahrers, dem ihre zerkratzten Beine und der blutige Fuß ebenso auffielen wie dem Trucker, ignorierte sie schweigend. Sie ließ sich nicht direkt bis vor die Haustür bringen, sondern stieg bereits zwei Blocks vorher aus, an einem Geldautomaten, wo sie ihre Bargeldbestände auffrischte, um den Taxifahrer bezahlen zu können. Das letzte Stück zu ihrem Antiquitätengeschäft, über dem sich auch ihre Wohnung befand, legte sie zu Fuß zurück, den Blick zu Boden gerichtet. Es war ein Sonntag, die Stadt war voller Touristen, doch Jessie bewegte sich wie durch einen Tunnel, sie blickte kein einziges Mal auf. Den Hausschlüssel hatte sie bereits aus der Tasche genommen. Sie öffnete das Rollgitter vor der Ladentür, schloss die Tür auf und versperrte sie sofort wieder hinter sich.
Mit raschen Schritten durchquerte sie den Verkaufsraum und ging durch das angrenzende Büro in den dahinterliegenden Flur. Dort führte eine schmale Treppe nach oben zu ihrer Wohnung. Minou kam von irgendwoher und strich ihr um die Beine. Jessie bückte sich mechanisch, um ihre Katze zu streicheln, doch sie empfand nichts dabei. Sonst breitete sich immer ein Gefühl des Wohlbehagens in ihr aus, wenn sie nach Hause kam und Minou begrüßte. Sie mochte auch das anheimelnde Ambiente ihrer Wohnung, ein Schmuckkästchen voller zierlicher französischer Antiquitäten, venezianischem Glas und Brüsseler Spitze. Diesmal gab es kein Gefühl des Heimkommens. Da war nur diese Starre. Eine seltsame Mischung aus Apathie und Anspannung, das einzige Bollwerk gegen die darunter lauernde Angst.
Jessie ließ die Tasche fallen und ging in die Küche, wo sie für Minou ein Futterschälchen füllte. Anschließend suchte sie im Medikamentenschrank im Badezimmer die Beruhigungstabletten, von denen sie zwei mit reichlich Mineralwasser aus dem Kühlschrank herunterspülte. Sie trank von dem kalten Wasser, so viel sie konnte, denn sie merkte, wie ausgetrocknet ihr Körper war. Dann riss sie sich die Kleidung vom Leib und stopfte sie in den Mülleimer, ehe sie unter die Dusche ging. Das Wasser stellte sie so heiß, wie sie es eben noch aushalten konnte, und als sie dachte, jetzt sei es genug, drehte sie den Temperaturregler noch etwas höher. Sie blieb Ewigkeiten unter dem heißen Wasserstrahl stehen und schrubbte ihren Körper mit Wurzelbürste, Schwamm und Unmengen flüssiger Seife ab, bis ihre Haut die Farbe eines gesottenen Hummers angenommen hatte. Danach wickelte sie sich ein Handtuch um den Kopf, hüllte sich in ihren Bademantel und ging mit unsicheren Schritten ins Schlafzimmer. Die Tabletten entfalteten bereits ihre betäubende Wirkung. Jessie schaffte es gerade noch, unter die Decke zu kriechen. Nur Augenblicke später war sie eingeschlafen.
Irgendwann wachte sie vom beharrlichen Klingeln des Telefons auf. Sie tastete auf dem Nachttisch nach ihrem Handy, ehe ihr klar wurde, dass es nicht dort lag. Das Klingeln kam vom Festnetzgerät. Ihr Smartphone war noch in der Handtasche, sie hatte vergessen, es aufzuladen, bevor sie zu Bett gegangen war.
Mit einem Schlag war alles wieder da. Das Erwachen am Wasserlauf. Die Leiche auf der Lichtung. Die Spuren an ihrem Körper. Das Messer. Ihre von getrocknetem Blut überzogenen Hände …
Nur die Nacht ließ sich nicht abrufen. Alle Ereignisse, die zu dem geführt hatten, was sie am frühen Morgen erlebt und gesehen hatte, waren wie ausgelöscht. Die letzten Bilder, die in ihrem Gedächtnis abgespeichert waren, stammten von der Party am vergangenen Abend. Helen, die gerade irgendwo im Gewühl der anderen Gäste verschwand. Ein Kellner, der Getränke herumreichte. Lachende Paare, die sich auf der Dachterrasse nebenan umarmten. Der Geruch von Jambalaya, das auf dem Buffet vor sich hin schmorte. Das Champagnerglas in ihrer Hand. Männer, die sie umschwirrten und mit ihr ins Gespräch kommen wollten. Ein Urologe aus Iberia. Ein Broker aus Minnesota, der geschäftlich für ein paar Tage in der Stadt zu tun hatte. Ein IT-Experte, der Kurse am College gab. Sie hatte sich von keinem der Typen den Nachnamen gemerkt.
Irgendwann war sie zur Toilette gegangen, dessen entsann sie sich noch. Doch sie wusste nicht mehr, ob sie dort angekommen war. An dieser Stelle rissen ihre Erinnerungen ab. Bis zu dem Moment, als sie am Ufer des Wasserlaufs in den Bayous aufgewacht war.
Das Telefonklingeln hatte aufgehört. Jessie ging in die Diele, wo der Apparat in der Ladeschale steckte, und sah nach, wer angerufen hatte. Auf dem Display stand Berts Handynummer. Es war fast vier Uhr nachmittags. Sie hatte acht Stunden geschlafen.
Jessie atmete durch, dann drückte sie die Taste für einen Rückruf. Er meldete sich sofort.
»Jessie? Ich bin in San Francisco bei einem Meeting und versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Hast du dein Handy nicht an? Oder willst du bloß nicht mit mir reden?«
Sie konnte nicht sprechen. Es war plötzlich, als sei sie aus vollem Lauf gegen eine unsichtbare Mauer geprallt. Der Schock über das, was ihr zugestoßen war, traf sie mit der Wucht eines gigantischen Hammers. Sie sackte in die Knie, weil sämtliche Kraft so unvermittelt aus ihrem Körper wich, dass sie sich nicht mehr aufrecht halten konnte. Ihre Hände sanken hinab, sie konnte kaum noch das Telefon festhalten. Und als sie spürte, dass sich in ihrem Inneren ein Schrei zusammenballte und hinauswollte, presste sie die Faust vor den Mund, um zu verhindern, dass sie in ein animalisch klingendes Brüllen ausbrach.
Der Schock, dachte sie. Das ist der Schock. Einer von denen, die erst später zuschlugen. Hatte sie nicht mal irgendwo etwas über einen Mann gelesen, der bei einem Bootsunglück seine Frau und seine beiden kleinen Kinder verlor? Sie waren alle vor seinen Augen ertrunken, nur er hatte sich an Land retten können. Danach war er stundenlang mit dem Wagen nach Hause gefahren, hatte sich umgezogen und den Rasen gemäht, und erst als ihn ein Nachbar ansprach und fragte, ob alles in Ordnung sei, war er völlig ausgerastet vor Leid und Entsetzen und hatte die ganze Nachbarschaft zusammengebrüllt.
Jessie schrie nicht, die Faust vor ihrem Mund dämpfte das Geräusch zu einem Stöhnen, es klang wie das Ächzen eines sterbenden Tiers.
Bert rief irgendwas ins Telefon, und sie hob das Gerät wieder ans Ohr.
»Jessie?« Seine Stimme drang scharf aus der Leitung. »Was ist los? Was hast du?«
Das Stöhnen verwandelte sich in ein Schluchzen. Sie konnte es nicht unterdrücken. Und gleich darauf weinte sie hemmungslos und laut vor sich hin.
»Jessie!«, schrie Bert. »Antworte mir, sonst wähle ich den Notruf!«
Sie schluchzte weiter, schaffte es aber irgendwie, zwischendurch ein paar Satzfetzen hervorzustammeln. »War in den Bayous … Kann mich nicht erinnern … Jemand hat … Ich wurde vergewaltigt. Da lag ein toter Mann … Und das Messer … meine Hände waren ganz blutig und –«
»Jessie«, unterbrach Bert sie beschwörend. »Beruhige dich. Ich komme, so schnell ich kann, ich lasse hier alles stehen und liegen und fahre sofort zum Flughafen. Aber ich muss jetzt erfahren, was los ist. Erzähl mir alles der Reihe nach. Es ist wichtig, verstehst du?«
Er redete auf sie ein, während sie weiterweinte, doch irgendwann drang er zu ihr durch und brachte sie dazu, sich zu beruhigen. Sie riss sich zusammen und erzählte ihm alles. Zwischendurch hörte Jessie durch die Leitung das Zuklappen einer Autotür und wie Bert einen Fahrer anwies, ihn zum Flughafen zu bringen. Er hielt Wort und war schon auf dem Weg zu ihr.
Die ganze Zeit über stellte er ihr Fragen und zwang sie, das Geschehen von verschiedenen Blickwinkeln aus zu beleuchten, als sei nicht nur sie allein an jenem schrecklichen Ort zugegen gewesen, sondern auch er selbst, der mit professionellem Blick Details wahrnahm – lauter Einzelheiten, die ihr Verstand zwar möglicherweise aufgenommen und gespeichert, aber nicht so weit verarbeitet hatte, dass sie ohne seine Hilfe darauf zugreifen konnte. Unter seiner Anleitung fühlte sie sich wie ein Rekorder, und er war derjenige, der an den richtigen Stellen den Abspielknopf drückte.
Wieder und wieder ließ er sich sämtliche Einzelheiten berichten, vor allem die Sache mit dem Messer schien ihn zu beschäftigen. Er wollte wissen, wie es ausgesehen hatte. Wie sie es angefasst hatte. Und dann die Leiche. Er fragte nach allen nur erdenklichen Details, doch es fiel ihr schwer, über den Toten zu reden. Sein Aussehen, seine Wunden, seine Haltung … Bert ließ nicht locker. Sie musste ihm erzählen, wo ihre Sachen gelegen hatten, wie sie sich angezogen hatte und zur Straße gegangen war, wie der Truck ausgesehen hatte und der darin sitzende Fahrer. Worüber sie mit ihm geredet hatte, am besten jedes einzelne Wort. Jessie fühlte sich fast wie bei einem Verhör.
»Muss ich davon ausgehen, dass ich den Mann umgebracht habe?«, fragte sie mit schwankender Stimme. »O Gott, Bert! Was soll ich denn jetzt bloß tun?«
»Das erkläre ich dir gleich ganz genau. Wichtig ist jetzt nur, dass du die Nerven bewahrst und einen Schritt nach dem anderen machst. Und zwar exakt so, wie ich es dir sage.«
»Heißt das, du hilfst mir?«
»Himmel noch mal, Jessie! Wie kannst du das fragen?«
»Ich weiß nicht. Wir sind aktuell nicht mehr zusammen, oder?« Ein misstönendes Lachen entfuhr ihr. »Wieder einmal.« Erschöpft fügte sie hinzu: »Wieso wolltest du mich überhaupt so dringend sprechen?«
»Meine Mutter ist gestorben«, sagte Bert. Seine Stimme klang müde und bedrückt. »Ich dachte, du möchtest vielleicht mit zur Beerdigung gehen. Sie hat dich sehr gemocht.«
Jessie war bestürzt. »Ach je, Bert, das tut mir so leid! Es muss schrecklich für dich sein.«
»Ja, es ist schlimm. Andererseits wussten wir doch schon länger, dass es nur noch eine Frage der Zeit war.«
Seine Mutter hatte an Krebs gelitten, die Ärzte hatten die Familie darauf vorbereitet, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte, und Jessie war seit Monaten darüber informiert. Trotzdem war es ein Schock für sie. Sie hatte Agatha Molineux sehr gern gehabt, und sie hätte ihr so sehr gewünscht, dass sie die Krankheit besiegen konnte! Berts Mutter war erst Mitte sechzig gewesen, das war kein Alter zum Sterben.
»Wann ist die Beisetzung?«
»Übermorgen um elf auf dem Saint Louis Cemetary.«
»Ich komme natürlich hin«, sagte sie.
»Das besprechen wir, wenn ich da bin. Lass uns jetzt darüber reden, was du als Nächstes tun musst. Das Wichtigste ist, dass du sofort zu einer ärztlichen Untersuchung gehst.«
»Ich habe geduscht«, sagte Jessie beklommen. »Das war ein Fehler, oder? Ich war … nicht richtig bei mir.«
»Niemand macht dir einen Vorwurf«, beruhigte Bert sie. »DNA-Spuren sind wichtig, aber für die Feststellung einer Vergewaltigung nicht allein entscheidend.«
»Ich habe Prellungen und Abschürfungen im Intimbereich. Das reicht doch sicher, oder?«
Bert holte scharf Luft. »Verflucht, Jessie! Was hat dieses Schwein dir angetan?«
»Ich weiß nicht«, sagte sie hilflos. »Ich kann mich an nichts erinnern. Im Moment frage ich mich eher, was ich ihm angetan habe.«
»Damit sind wir schon beim Thema«, erwiderte Bert bemüht sachlich. »Es geht bei der Untersuchung nicht nur um deine Verletzungen oder um DNA-Spuren an deinem Körper. Sondern auch um deinen Erinnerungsverlust.«
Sie war verwirrt. »Wie meinst du das? Ich habe einen Filmriss. So wie früher. Es war … ein Rückfall.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein? Vielleicht war es diesmal ganz anders. Ist dir noch nicht in den Sinn gekommen, dass dir womöglich eine Partydroge verpasst wurde? Zum Beispiel K.-o.-Tropfen?«
Tatsächlich hatte sie bisher keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Sie hatte einfach angenommen – nein, sie war mit tiefer Überzeugung davon ausgegangen –, dass ihr dasselbe passiert war wie vor zwanzig Jahren. Psychogener Gedächtnisverlust infolge einer Vergewaltigung. Diese Diagnose war etwas, das sie niemals hätte vergessen können, denn die nach jenem furchtbaren Ereignis immer wiederkehrenden Gedächtnislücken waren damals ein Jahr lang bitterer Bestandteil ihres Lebens gewesen. Doch bereits in dem Augenblick, als Bert das Wort Partydroge ausgesprochen hatte, fing ihr Verstand an, sich an diese Alternative zu klammern wie an einen rettenden Strohhalm.
»Wenn es so wäre – dann kann ich den Mann nicht umgebracht haben, oder?«, fragte sie aufgeregt.
»Nein, ganz sicher nicht. Allein schon aus dem Grund musst du schleunigst zu der Untersuchung. Manche Substanzen sind länger nachweisbar als andere, aber in allen Fällen kommt es auf Schnelligkeit an.«
Jessie hatte bereits begonnen, sich frische Sachen zum Anziehen zusammenzusuchen. Wenn man ihr K.-o.-Tropfen verabreicht hatte, gab es für alles eine plausible Erklärung! Jemand hatte ihr etwas ins Glas getan und sie in einen Wagen verfrachtet, um sie irgendwo fernab vom nächsten Ort ungestört vergewaltigen zu können. Vielleicht war sogar geplant gewesen, sie umzubringen. Es mussten mindestens zwei Leute gewesen sein, der Typ im Sumpf und noch jemand – der Mörder, der dann den anderen umgebracht hatte. Die Frage, wie das Blut an ihre Hände gelangt war, musste zunächst zurückgestellt werden. Das würde sich bestimmt alles noch aufklären.
Entscheidend an der ganzen Sache war, dass ihr nicht wieder dasselbe passiert war wie damals. Sie hatte noch die Kontrolle über ihr Erinnerungsvermögen. Ihr Leben würde nicht erneut kaputtgehen. Nicht so wie vor zwanzig Jahren.
Mit fieberhafter Eile begann sie, sich anzuziehen. Das Telefon legte sie aufs Bett, stellte es aber auf laut, um weiter mit Bert sprechen zu können.
»Jessie«, sagte Bert. »Bist du noch dran?«
»Ja. Ich will gleich los. Zu der Untersuchung.«
»Geh nicht zu irgendeinem Arzt, sondern in eine gynäkologische Klinik, die sind besser ausgestattet und wissen, worauf es ankommt. Die haben häufiger solche Fälle. Falls es um irgendwelche Aussagen vor der Polizei geht, verweist du darauf, dass du nichts ohne deinen Anwalt sagen wirst. Ganz egal, mit wem du sprichst – du machst keine Aussagen, ehe ich nicht da bin.«
Er erklärte ihr eingehend, worauf es bei den anstehenden Aussagen ankam, und sie hörte ihm aufmerksam zu, während sie sich fertig ankleidete. Beim Anziehen der Schuhe schmerzte die verletzte Ferse. Jessie biss sich auf die Unterlippe und nahm das Telefon mit ins Bad, um sich ein Pflaster zu holen.
»Ach, und Jessie …«
»Ja?«
»Du schaffst das. Wir schaffen das.«
Es klang zuversichtlich, doch Jessie kannte ihn lange und hörte die Zwischentöne heraus. Er war besorgt. Sie schnappte sich ihre Handtasche und verließ die Wohnung.
2. KAPITEL
Ihr Haus war ein schmaler, zweigeschossiger Bau am Rand des Vieux Carré. Jessie hatte es vor drei Jahren gekauft und aufwendig sanieren lassen. Dabei hatte sie darauf geachtet, den ursprünglichen, nostalgischen Charme des Gebäudes zu bewahren. Die Investition hatte sich gelohnt, und dank der guten Lauflage in diesem Bereich der Canal Street florierte Jessies Antiquitätenladen bestens, er wurde sogar mittlerweile in diversen Touristenführern als Geheimtipp angegeben. Die Entscheidung, nach all den Jahren wieder nach New Orleans zu ziehen, war goldrichtig gewesen. Sie hatte sich ein wirklich gutes Leben aufgebaut. Genauer gesagt: Es war gut gewesen, bis letzte Nacht. Momentan ging offenbar wieder alles den Bach runter.
Sie stieg in ihren Wagen, der im Innenhof parkte. Als sie den Motor anließ, fiel ihr ein, dass ihr Handy immer noch nicht aufgeladen war. Sie hängte es an das USB-Kabel im Auto, und innerhalb von Sekunden wurden alle zwischenzeitlich aufgelaufenen Nachrichten sichtbar. Diverse Anrufe in Abwesenheit, davon mehrere von Bert. Eine Textnachricht von ihrer Mutter. Vergiss Dads Geburtstag übernächsten Sonntag nicht! Wir rechnen fest mit dir! Ein Anruf von Helen, gefolgt von einer Nachricht, die knapp drei Stunden alt war. Wo zum Teufel bist du? Stehe bei dir vorm Haus. Oben ist Licht. Warum machst du nicht auf? Mit welchem Kerl bist du versackt?Ist er so gut, dass du nicht mehr aus dem Bett kommst?Ruf mich sofort an! Sonst melde ich dich als vermisst!
Das war typisch Helen. Man wusste nie recht, ob sie scherzte oder es ernst meinte. In diesem Fall war es durchaus möglich, dass sie tat, was sie angekündigt hatte. Jessie drückte die Anruftaste. Helen meldete sich sofort.
»Jessie! Endlich! Was soll der Mist? Wieso lässt du mich hängen, ohne dich zu melden? Wir waren zum Mittagessen verabredet, schon vergessen?«
»Mein Handy war aus. Und die Türklingel auch.«
»Sag bloß.« Es klang halb sarkastisch, halb vorwurfsvoll, aber Jessie hörte auch den besorgten Unterton heraus.
»Ich habe geschlafen. Mir war nicht gut.«
»Das klingt so … Jessie, was ist los?«
»Nichts. Ich …« Jessie schluckte heftig, denn eine harte Faust schien ihr die Kehle zusammenzudrücken. Helen war seit der Schule ihre beste Freundin, aber aus unerfindlichen Gründen widerstrebte es Jessie, sie in diese Sache hineinzuziehen. Vielleicht hing es damit zusammen, dass Helen zu den wenigen Menschen gehörte, die die grauenhafte Zeit damals miterlebt hatten. Es hatte ihr schrecklich nachgehangen. So sehr, dass es ihr Leben fast auf dieselbe Weise kaputtgemacht hatte wie das von Jessie und Fran.
»Jessie, ich will sofort wissen, was passiert ist. Es ist doch was passiert, oder?«
Wie schon vorhin beim Telefonat mit Bert wurde Jessie von den Bildern des frühen Morgens überwältigt. Sie fing an zu weinen.
»Es war … Ich wurde … so wie damals …«, stieß sie stammelnd hervor.
»Jessie!« Helens Stimme überschlug sich. »O mein Gott. Du wurdest vergewaltigt.«
Jessie konnte nicht antworten, aber das war auch nicht nötig. Helen hatte ihre letzte Bemerkung nicht als Frage, sondern als Feststellung formuliert.
»Bleib, wo du bist. Ich komme sofort zu dir.«
»Nein«, schluchzte Jessie. »Ich fahre in die Klinik. Bert sagt, ich muss mich untersuchen lassen, das ist wichtig!«
»Meine Güte, das geht doch auch morgen noch. Du musst dich erst mal beruhigen und dich trösten lassen!«
»Nein! Mein Blut und mein Urin müssen so schnell wie möglich ins Labor.«
»Wenn der Kerl dich mit irgendwas Ansteckendem infiziert hat, wird man es jetzt garantiert noch nicht feststellen können. Welches Schwein war das überhaupt? Der geschniegelte Lackaffe, mit dem du auf der Dachterrasse Sazerac getrunken hast? Meine Güte, ich könnte ihn … Hast du ihn mit nach Hause genommen? Ist er da über dich hergefallen?«
»Helen, ich bin in den Swamps aufgewacht. Direkt am Bayou, mit den Füßen im Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin.« Weinend fügte sie hinzu: »Ich kann mich an nichts erinnern! Die letzte Nacht ist komplett weg. Ich habe alles vergessen. Vergessen, verstehst du?«
»Du meinst, es ist … es ist genau wie damals?«
»Ich hoffe nicht«, antwortete Jessie verzweifelt. »Deshalb will ich ja in die Klinik. Bert meinte, es könnten K.-o.-Tropfen gewesen sein, von denen ich bewusstlos geworden bin. Das ist meine letzte Hoffnung. Sonst hätte ich … sonst wäre ich …« Sie brach ab, außerstande, den Satz zu vollenden.
»Sonst wärst du was?«, fragte Helen eindringlich. »Jessie, sag es mir!«
Jessie tat einen zitternden Atemzug und unterdrückte ein weiteres Aufschluchzen. »Sonst wäre ich wahrscheinlich eine Mörderin. Nicht weit von der Stelle entfernt, an der ich aufgewacht bin, habe ich die Leiche eines Mannes gefunden. Er war schrecklich verstümmelt. In der Nähe lag ein Messer. Und meine Hände waren voller Blut!«
Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. Dann sagte Helen mit entschlossener Stimme: »Ich fahre sofort los. Zu welcher Klinik willst du? Wir treffen uns dort.«
Helens Wohnung in der Cleary Avenue lag nur ein paar Querstraßen von dem Krankenhaus entfernt. Sie war schon da, als Jessie in der gynäkologischen Notaufnahme des Hospitals eintraf.
»Mein Gott, Jessie!« Helens Umarmung fiel vorsichtig aus, als befürchtete sie, Jessie verletzen zu können, wenn sie zu fest zudrückte. Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete Jessie forschend.
»Wie geht es dir?«
Jessie schüttelte nur stumm den Kopf. Wie sollte es ihr schon gehen?
»Und du kannst dich wirklich an gar nichts erinnern? Was ist das Letzte, das du noch weißt?«
»Ich wollte zur Toilette, weil mir nicht gut war. Irgendwo auf dem Gang ist der Film gerissen, glaube ich.«
»Und ich hatte mich noch gewundert, wieso du auf einmal weg warst.« Helen schüttelte grimmig den Kopf. »Ich dachte echt, du bist mit einem dieser Typen losgezogen, die ständig um dich rum waren. Na ja, vermutlich war es wohl auch so. Nur dass du davon nichts mitgekriegt hast. Wie denn auch, wenn du K.-o.-Tropfen intus hattest.« Sie hielt inne, ihr Gesichtsausdruck wurde beklommen. »Hätte ich doch bloß besser auf dich aufgepasst!«
Jessie merkte, welche Richtung das Gespräch nahm. »Hör bitte auf damit. Du hast wirklich keine Schuld daran!«
Damals nicht und heute nicht, lautete der unausgesprochene Zusatz zu dieser Bemerkung. Helen hatte sich seinerzeit sehr lange mit Schuldgefühlen herumgeschlagen. Vermutlich tat sie es heute noch manchmal. Sie war die Einzige von ihnen dreien gewesen, die damals heil davongekommen war, aus dem so schlichten wie profanen Grund, dass sie schneller gewesen war als Jessie und Fran. Sie war den vier Kerlen einfach davongerannt, obwohl zwei von denen versucht hatten, sie noch zu schnappen. Schmal, sehnig und hochgewachsen, war Helen damals ein herausragendes Sprinttalent gewesen. Sie hätte damit sicher auch außerhalb des Schulsports Karriere machen können, wenn ihre Mutter sie gelassen hätte.
»Warte«, sagte Helen auf dem Weg zur Patientenaufnahme. Sie hielt Jessie an der Schulter fest und sprach leise, damit niemand vom Klinikpersonal sie verstehen konnte. »Wäre es nicht vielleicht besser, die ganze Sache unter den Tisch fallen zu lassen? Ich meine, nur für den Fall, dass keine K.-o.-Droge im Spiel war, sondern dass du den Typen wirklich umgebracht hast … Wenn er da draußen in den Sümpfen liegt, wird er sicher bald von Alligatoren gefressen. Niemand wird rausfinden, was passiert ist. Niemand kann dir was anhängen.«
»Die Idee hatte ich auch schon, aber so kann ich es nicht machen.« Jessie fasste zusammen, was Bert ihr dazu erklärt hatte. »Irgendwer wird den Mann vermissen. Es wird Suchmeldungen mit Fotos geben. Wenn er auf der Party war, hat ihn vielleicht jemand mit mir gesehen. Und falls seine Leiche dann doch entdeckt wird, wäre ich erst recht dran, weil es an dem Toten womöglich DNA von mir gibt. Also werde ich einfach die Wahrheit sagen. Dass ich vergewaltigt wurde und dann die Leiche gefunden habe, mich aber an nichts mehr erinnern kann.«
Helen nickte langsam. »Weil dir jemand K.-o.-Tropfen verpasst hat.«
»Ganz genau.«
Jessie erledigte die vorgeschriebenen Formalitäten bei der Aufnahme und war erleichtert, dass sie sofort an die Reihe kam, obwohl einige Leute bereits länger auf ihre Behandlung warteten.
»Soll ich mit reingehen?«, fragte Helen, als die Krankenschwester Jessie ins Untersuchungszimmer bat.
»Nein, nicht nötig«, sagte Jessie. Sie hatte den Eindruck, dass Helen über die Antwort erleichtert war. Sie und Helen waren einander seit früher Jugend vertraut, doch über wirklich intime Dinge hatten sie sich selten ausgetauscht. Nicht, weil sie besonders prüde gewesen wären, sondern weil Jessie in diesen Fragen Helen gegenüber ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Zurückhaltung empfand. Sie hatten beide dieselbe katholische Mädchenschule und unzählige gemeinsame Sonntagsgottesdienste besucht, doch während Jessies Eltern in Glaubensfragen seit jeher ein zwar konservatives, aber nicht übersteigert frommes Weltbild gepflegt hatten, war Helens Mutter von einem anderen Kaliber gewesen. Als Jessie das erste Mal bei Helen zu Hause war, hatte sie begriffen, wieso Helens Röcke immer fünf Zentimeter länger waren als die der anderen Mädchen und warum sie vor dem Heimweg stets rasch in der Schultoilette verschwand, um sich abzuschminken. Bei Helens Mutter hatten überall Kruzifixe über kleinen Weihwasserbecken gehangen. In dem altmodisch eingerichteten und mit Nippes überladenen Wohnzimmer gab es sogar einen kleinen Marienaltar nebst Betbänkchen, und einmal, als Jessie und Helen für eine Klassenarbeit lernen wollten, empfahl Helens Mutter ihnen, zur Kräftigung ihrer Konzentration ein gemeinsames Rosenkranzgebet zu sprechen. Helen war das alles ein bisschen peinlich gewesen, aber ihren Glauben hatte sie nie infrage stellt. In der Schule war sie allerdings immer bemüht gewesen, sich dem Benehmen der anderen anzupassen. Sie hatte mitgelacht und mitgetuschelt, wenn in ihrer Mädchenclique freizügig über Sex und heiße Jungs geredet wurde, aber Jessie hatte immer das Gefühl gehabt, dass Helen nicht ganz so viel Spaß daran hatte wie sie und die anderen. Erst als Helens Mutter kurz vor dem neunzehnten Geburtstag ihrer Tochter starb – ihren Vater hatte Helen nie kennengelernt, er war bei einem Unfall ums Leben gekommen, als sie noch ein Baby war –, hatte sie ihr Leben umgekrempelt und sich ein Umfeld geschaffen, in dem Rosenkränze und Kruzifixe nur noch marginal vorkamen. Sie hatte ihr Elternhaus verkauft und mit dem Geld das College und ihr Studium finanziert. Heute war sie eine erfolgreiche Architektin mit einem randvollen Terminkalender, in dem die Zeit für private Vergnügungen knapp bemessen war. Sie trug elegante, figurbetonte Schneiderkostüme und klassische Pumps, und mit ihrer kühlen, beinahe aristokratischen Eleganz wirkte sie manchmal etwas unnahbar.
Als Jessie vor drei Jahren von Europa zurück nach New Orleans gezogen war, hatten sie ihre Jugendfreundschaft wieder aufgenommen und vertieft. Sie gingen beide gern aus, verkehrten im selben Freundeskreis, trieben zusammen Sport und sahen sich ab und zu gemeinsam im Kino neue Filme an. In den beiden letzten Monaten hatten sie sich häufiger getroffen, denn seit der Trennung von Bert hatte Jessie wieder mehr Zeit für Mädelsabende.
Eine bessere Freundin als Helen hatte Jessie nie gehabt. Sie war einfach zu oft umgezogen, getrieben von den Ereignissen vor zwanzig Jahren, die es ihr schwermachten, irgendwo richtig zur Ruhe zu kommen und tiefere Freundschaften zu knüpfen. Zunächst Rom, dann Brüssel, schließlich Genf und am Ende Paris – erst, als sie nach all den Jahren wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrte, hatte sie das Gefühl gehabt, endlich dauerhaften Frieden und ein endgültiges Zuhause finden zu können.
Jessie pinkelte auf Anweisung der Krankenschwester in den bereitgestellten Urinbecher, dann zog sie sich in einer der Umkleidekabinen aus und legte das obligatorische Untersuchungshemd an. Hier in der Ambulanz der Klinik sah es nicht anders aus als bei ihrem Frauenarzt – eine Menge Technik, blitzender Edelstahl, unangenehm helle Beleuchtung. Sie wünschte, alles schon hinter sich zu haben. Ihr Unbehagen verstärkte sich, als der Arzt den Untersuchungsraum betrat.
Sie konnte nur noch daran denken, was sie damals durchgemacht hatte. Die Spurensicherung hätte seinerzeit nicht eindeutiger ausfallen können. Verletzungen im Genitalbereich, jede Menge DNA – es war alles da gewesen, um die Kerle für Jahre hinter Gitter zu bringen. So man sie je geschnappt hätte.
Der Arzt, ein älterer Gynäkologe namens O’Donnell, nahm ihr Blut ab und erläuterte ihr im Beisein der Krankenschwester so sanft wie möglich die weitere Vorgehensweise. Er erklärte ihr, dass die in solchen Fällen von der Klinik eingeschaltete Polizei schnellstmöglich Ermittlungen aufnehmen würde, wofür er einen ärztlichen Bericht zu verfassen hätte. Dass hier im Krankenhaus eine speziell geschulte psychologische Fachkraft für Gespräche bereitstünde. Und dass Jessie jederzeit mit weiteren Fragen vertrauensvoll auf das Ärzteteam zukommen konnte.
Als Dr. O’Donnell schließlich mit der Untersuchung begann, verkrampfte Jessie sich, denn es war schmerzhafter als erwartet. Da unten musste tatsächlich einiges in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Sie konnte – wieder einmal – nur von Glück sagen, dass sie nichts davon bewusst mitbekommen hatte. Allerdings war es schon schlimm genug, hinterher festzustellen, was einem zugestoßen war. Nicht zum ersten Mal schoss ihr durch den Kopf, wie sehr der Kerl in den Sümpfen seinen Tod verdient hatte. Doch als sie sich dabei notgedrungen klarmachte, dass sie ihn womöglich eigenhändig verstümmelt und getötet hatte, wich ihr Hass auf den Mann wieder der beklemmenden Angst, die sie seit der Entdeckung seines Leichnams umtrieb.
»Besteht die Befürchtung einer ungewollten Schwangerschaft?«, fragte der Arzt.
»Nein, ich nehme die Pille.« Immerhin eine Sache, um die sie sich keine Sorgen machen musste.
»Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man in meinem Blut noch Reste einer K.-o.-Droge nachweisen kann?«, erkundigte sie sich mit erzwungener Sachlichkeit bei dem Arzt.
»Die Laborergebnisse gibt es frühestens morgen«, sagte Dr. O’Donnell. »Achtung, jetzt wird es etwas kühl. Ich untersuche Sie nun mit dem Speculum.«
Jessie zuckte zusammen. Es war wirklich kühl. Sie wusste es immer schon vorher, denn die Ärzte sagten es jedes Mal, aber das änderte nichts an dem unangenehmen Gefühl.
»Das war nicht meine Frage«, entgegnete sie. »Ich wollte wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass Rückstände von so einer Droge bei mir gefunden werden.«
Er schien ihre Anspannung zu spüren, denn Jessie hatte den Eindruck, dass er kurz nach einer diplomatischeren Antwort suchte, doch dann schüttelte er den Kopf. »Nicht sehr wahrscheinlich«, gab er zu. »Die Mittel, mit denen wir in vergleichbaren Fällen zu tun haben, sind meist schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar.« Er hielt inne. »Achtung, jetzt drückt es etwas. Ich nehme einen Abstrich.« Er legte den Tupfer in eine Schale, ehe er sich ihr wieder zuwandte. »Allerdings gibt es in Ihrem Fall an dem körperlichen Befund gar keinen Zweifel. Hämatome, einige Einrisse, Spuren von Prellungen. Sie haben das sicher schon selbst festgestellt. Es lässt sich jedoch schwer voraussagen, ob noch DNA des Täters zu ermitteln ist. Sie haben sehr gründlich geduscht, oder?«
Sie nickte stumm.
Dr. O’Donnell musterte sie mitfühlend. »Ich werde jetzt zu Dokumentationszwecken einige Fotos machen.«
Während er die Verletzungen an ihrem Körper fotografierte, diktierte er den Befund in ein mitlaufendes Aufnahmegerät, wodurch Jessie zum Schweigen verurteilt war. Als er endlich fertig war, sprudelten die aufgestauten Fragen nur so aus ihr heraus. »Können Sie mein Blut auch auf Restalkohol untersuchen? Mein Blackout könnte ja vielleicht doch an zu vielen Drinks liegen. Wäre es auch denkbar, dass mich jemand bewusstlos geschlagen hat? Oder dass ich einen Kreislaufkollaps oder so etwas hatte?«
»Der Blutalkoholgehalt wird untersucht. Wenn man Sie niedergeschlagen hätte, müsste es ein entsprechendes Beschwerdebild geben. Also ein anderes als das, welches ich eben bei der Untersuchung festgestellt habe. Haben Sie Kopfschmerzen?«
»Ich hatte heute früh welche. Einen richtigen Brummschädel.«
»Wir könnten sicherheitshalber noch ein Schädel-CT machen.«
»Ja, unbedingt«, stimmte sie zu. Sie wollte keine Chance ungenutzt lassen. Jede nur irgendwie denkbare organische Ursache für ihren Gedächtnisverlust war hoch willkommen.
»Ich vermute in Ihrem Fall aber durchaus, dass eine K.-o.-Droge zum Einsatz gekommen ist«, führte Dr. O’Donnell aus. »Ihre Schilderungen zu Ihrem Erinnerungsverlust decken sich ziemlich genau mit dem, was wir hier sonst zu hören kriegen. Eine Party oder ein Lokal, wo es von Leuten nur so wimmelt, darunter viele, die sich nicht kennen. Laute Musik, Gedränge, schlechte Beleuchtung, unbeaufsichtigt herumstehende Drinks … Es ist eigentlich immer dasselbe.«
Jessie musste gegen ein hysterisches Lachen ankämpfen. »Sie kennen meine Vorgeschichte nicht. Sonst würden Sie das vielleicht anders beurteilen.«
»Was haben Sie denn für eine Vorgeschichte?« Er half ihr vom Untersuchungsstuhl.
»Seit wann arbeiten Sie in diesem Krankenhaus?«, fragte sie zurück.
»Seit zehn Jahren. Wieso?«
»Wenn Sie vor zwanzig Jahren schon hier gearbeitet hätten, könnten Sie sich an meinen Fall erinnern.«
»Vor zwanzig Jahren war ich noch in einer Klinik in Iberia.« Er runzelte die Stirn. »Was war mit Ihnen?«
»Ich wurde schon einmal Opfer einer Vergewaltigung.« Jessie schlang beide Arme um sich, ihr war plötzlich kalt. »Vor fast genau zwanzig Jahren. Ich war bei einer Party etwas außerhalb der Stadt, zusammen mit meiner jüngeren Schwester und meiner Freundin. Wir wollten den letzten Bus erwischen und nahmen die Abkürzung durch einen Park. Es war ziemlich dunkel. Wir waren ein bisschen angetrunken und stolperten durch die Büsche. Die Typen, denen wir dann in die Arme liefen, waren zu viert. Sie lungerten da im Park herum und tranken was. Als sie uns sahen, versperrten sie uns den Weg. Kreisten uns ein. Und schnappten uns. Wir hatten keine Chance, jedenfalls meine Schwester und ich nicht. Meine Freundin war eine gute Sprinterin, sie konnte abhauen und Hilfe holen. Doch das nächste Haus war ein ganzes Stück entfernt. Sie klingelte, aber es machte ihr keiner auf. Beim nächsten Haus auch nicht. Erst nachdem sie die halbe Straße zusammengeschrien hatte, rief jemand die Polizei. Sie kam zu uns zurückgerannt, doch da war es schon passiert. Sie war vielleicht eine Viertelstunde weg gewesen, aber … das hatte den Typen gereicht.« Jessie brachte die letzten Sätze nur mit Mühe heraus. Ihre Stimme klang aufgewühlt. Jene Nacht war im Dunkel des Vergessens verschwunden, aber das, was die damaligen Geschehnisse aus ihr und Fran gemacht hatten, war noch allzu präsent.
Dr. O’Donnell runzelte die Stirn. »Ich erinnere mich an den Fall. Waren Sie die junge Frau, die von der Amnesie betroffen war? Es ging durch die Fachpresse.«
»Nicht nur durch die Fachpresse. Es stand in so ziemlich allen Schmierblättern der regionalen und überregionalen Journaille. Für meine Eltern war es die Hölle.«
»Wohl doch eher für Sie und Ihre Schwester, oder?«
»Für Fran war es unfassbar grausam«, sagte Jessie leise. »Sie hatte das Pech, alles bei vollem Bewusstsein durchmachen zu müssen. Mich hatte einer dieser Kerle vorher mit einem Kinnhaken außer Gefecht gesetzt. Ich fiel mit dem Kopf auf einen Stein und wurde erst wieder wach, nachdem alles vorbei war. Als dann klar wurde, dass ich mich an nichts erinnern konnte, sagte meine Mutter, was für ein Glück ich doch hätte. Sie nannte es ›die Gnade des Vergessens‹.« Jessie lachte bitter auf. »Damals gab ich allerdings nichts auf diese Art von Gnade. Ich fand, dass es mir auch so dreckig genug ging, und allein die Vorstellung, was diese Schweine mit mir gemacht haben, hat mir ein paar Wochen lang regelmäßig das Essen hochkommen lassen.«
»Es war eine retrograde Amnesie, nicht wahr?«, erkundigte sich Dr. O’Donnell. Sein professionelles Interesse an dem Fall war offensichtlich geweckt. »Wie viel Zeit hat Ihnen gefehlt?«
»Fast ein Monat.«
»War das die Zeit vor dem Überfall?«
»Ja. Vier Wochen waren weg. Der komplette Überfall auch. Ich weiß all die Einzelheiten nur aus den Polizeiprotokollen und aus den Schilderungen meiner Schwester und meiner Freundin. Alles war wie ausgelöscht. Die Ärzte meinten damals, das käme schon mal vor, bei so schlimmen traumatischen Erfahrungen.«
Das war nur der offizielle Teil der Wahrheit. Sie hätte dem Arzt auch von dem Jahr danach erzählen können. Von den häufigen Abstürzen. Die vielen Male, als sie unvermittelt irgendwo zu sich gekommen war, ohne sich erinnern zu können, wie sie dort hingelangt war und was sie dort vorgehabt hatte. All die Episoden, die im schwarzen Loch eines Blackouts verschwunden waren. Meist hatte es sich nur um wenige Stunden gehandelt, doch einmal hatte sie zwei volle Tage verloren. Sie war in einem Hotelzimmer in Las Vegas zu sich gekommen, im Bett mit einem Mann, den sie nie zuvor gesehen hatte und der sie mit Daisyanredete. Sie hatte ihn sich mit einer leeren Sektflasche vom Hals halten müssten, ehe sie überstürzt vom Ort des Geschehens flüchten konnte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: