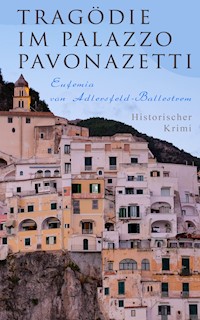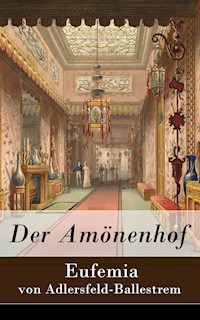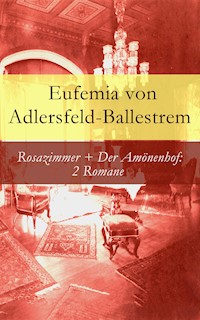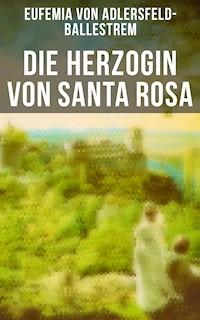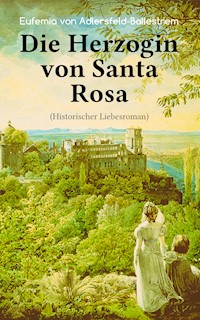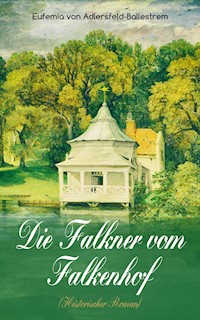1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Ihre Majestät' von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem geht es um das Leben einer Königin, die mit den komplexen Anforderungen ihrer Rolle kämpft. Der Roman ist in einem eleganten und anspruchsvollen Stil geschrieben, der die Atmosphäre des königlichen Hofes einfängt. Von Adlersfeld-Ballestrems Werk hebt sich durch ihre detaillierte Charakterisierung und die Einbettung historischer Elemente in die fiktive Handlung hervor. Die Autorin schafft es, die inneren Konflikte und äußeren Herausforderungen der Protagonistin auf fesselnde Weise darzustellen. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem war eine adlige Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, die aus erster Hand Einblicke in die Welt der Adligen und königlichen Höfe hatte. Ihre eigenen Erfahrungen spiegeln sich in der feinen Beobachtungsgabe und dem detaillierten Schreibstil wider, den sie in 'Ihre Majestät' präsentiert. Als eine Autorin, die die Dynamik von Macht und Intrigen kennt, bietet von Adlersfeld-Ballestrem ihren Lesern einen einzigartigen Einblick in die Welt der königlichen Zirkel. 'Ihre Majestät' ist ein fesselnder historischer Roman, der Liebhaber von königlichen Intrigen und historischer Fiktion gleichermaßen begeistern wird. Von Adlersfeld-Ballestrems Beschreibung der Königin und ihrer inneren Kämpfe ist nuanciert und einfühlsam, was das Buch zu einem Lesegenuss macht, der sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ihre Majestät
In der fürstlichen Haupt- und Residenzstadt Rothenburg machte sich eine gelinde, aber zweifellose Erregung bemerkbar; einem harmlos durchreisenden Fremden mußte es vorkommen, als ob sämtliche zwölftausend Einwohner auf den Beinen wären, um zu irgend etwas Ungewöhnlichem zusammenzuströmen. Evident war das Ziel der guten Rothenburger der Bahnhof, dessen Vorstand auch richtig geflaggt hatte, und auf der nicht eben breiten, aber doch auch sonst am meisten belebten Straße, die mitten durch das Städtchen zu dem auf einem waldigen Hügel thronenden fürstlichen Residenzschlosse führte, sah man hie und da eine grüngelbe Fahne lustig aus Fenstern oder von Balkonen in der schönen frischen Frühlingsluft flattern.
Die Kinder, die in natürlich überwiegender Mehrzahl auf den Bahnhof herauspilgerten, trugen Sträußchen in den Händen aus Himmelsschlüsseln, Veilchen, Schneeglöckchen, Krokus und Jonquillen, – Blumen, die der Frühling zuerst in geschützten Gärten erblühen läßt.
Ein Geschäftsreisender, mit einem Musterköfferchen in der Hand, hatte schon mehreren solch gruppenweise dahineilenden Kindern nachgeschaut und konnte sich endlich nicht mehr enthalten, nach dem »wohin« und »warum« zu fragen.
»Die Goldne kommt wieder heim und wir gehen sie auf dem Bahnhof begrüßen«, antwortete ein kleines Mädchen wichtig.
»Die Goldne?« wiederholte der Reisende erstaunt und durchaus nicht aufgeklärt.
»Dummerchen! Der Herr ist ein Fremder und kann doch nicht wissen, wer das ist!« nahm sich eine Größere der Sache an.
»Prinzessin Lily, – das ist die Schwester von unserm Fürsten, kommt von ihrer Reise zurück und wir gehen sie zu empfangen. Wir nennen sie die Goldne, weil sie doch gar so lieb und goldig ist.«
»Aha!« machte der Reisende lächelnd. Er war ein Großstädter und machte sich immer weidlich über die »Hinterwäldler« lustig.
»Ja«, fragte er dann weiter, »war die Goldne denn so lange und so weit verreist, daß ihr sie so festlich begrüßen müßt?«
»Freilich, – sechs Wochen war sie fort und es war uns allen ganz bange nach ihr«, nahm die Große wieder das Wort. »Sie war die ganze Zeit in Treustadt.«
»Nun natürlich, wenn sie so weit weg war –«, lachte der Reisende, denn Treustadt, die Residenz des Königreiches Seeland war mit der Bahn in knapp sechs Stunden zu erreichen und das ist für Leute seines Gewerbes wenig mehr als ein Katzensprung.
Und dann drehte er um und ging auch auf den Bahnhof, um die »Goldne«, dieses Duodezprinzeßchen, zu sehen und um festzustellen, ob die Rothenburger neben ihrer Verehrung auch sonst noch einen guten Geschmack hatten.
Unterwegs wurde der neugierige Merkursjünger von den fürstlichen Wagen überholt, die zum Bahnhof fuhren: voran ein offenes Break, gezogen von einem Paar flott gehenden Braunen, hinterher fuhr leer ein offener Landauer. In dem Break aber saßen eine alte Dame und drei junge, – die Jüngste von ihnen war noch ein halbes Kind in dem glücklichen oder unglücklichen Backfischalter und zum Kennzeichen dafür, daß sie noch nicht »erwachsen« war, hing ihr ein dicker, blonder Zopf auf den Rücken herunter.
Jung waren die anderen beiden übrigens auch noch und mehr oder minder hübsch, gesunde, blühende Persönlichkeiten, die die respektvollen Grüße der Rothenburger in freundlichster, ja fast familiärer Weise erwiderten. Denn diese drei jungen Damen waren die Schwestern des regierenden Fürsten mit der Staatsdame Frau von Maritz, der einzigen Repräsentantin des weiblichen Hofstaates –
Oberhofmeisterin nannten die Rothenburger sie gern, aber sie hatte den Titel nicht, wie es denn überhaupt nicht eine einzige Hofdame am Hofe von Rothenburg gab. Dieser Titel war mit dem Tode der letzten Fürstin, der Mutter des regierenden Herrn, überhaupt gestrichen worden; nicht aus Geiz oder Geldmangel, sondern weil der alte Fürst, der wie ein Patriarch unter seinen Untertanen gelebt, der Ansicht war, daß seine Töchter sehr gut einen solchen überflüssigen Appendix entbehren konnten, indem sie unter sich gerade genug wären und die jungen Damen des Adels etwas Besseres tun könnten, als hinter den Prinzessinnen dreinzuziehen und zu faulenzen. Und da sein Sohn und Nachfolger derselben Ansicht war, so blieb auch nach seinem Regierungsantritt der Rothenburger Hof hofdamenlos und nur zu feierlichen Gelegenheiten traten ein paar Damen des Stadt- und Landadels in die vakanten Stellen ein, um nach getaner Pflicht sofort wieder zu verschwinden.
Mit Frau von Maritz war es eine andre Sache, denn erstens bedurfte der gänzlich verwaiste Hof einer älteren und erfahrenen Frau zur Leitung und »Bemutterung« der jungen Prinzessinnen, und dann mußte doch auch eine Hausfrau unter irgendwelchem Titel da sein.
Zu alldem eignete sich niemand besser als die würdige Dame, welche nun schon seit Jahren alle diese Würden und Bürden trug. Sie war die intimste Jugendfreundin der Fürstin gewesen, fast gleichzeitig mit ihr hatte sie sich mit dem Adjutanten des seligen Fürsten verheiratet und, selbst kinderlos, die Erziehung der fürstlichen Kinder geleitet in demselben freien, zwanglosen und doch ganz zielbewußten Sinne, in dem sie sich eins mit der Mutter und dem Vater wußte, und hatte freie, frohe, natürliche Menschen in ihnen großgezogen.
Wie gut sie es verstanden, den früh Verwaisten, allen Fünfen miteinander, Unersetzliches zu ersetzen, das bewies die geradezu enthusiastische Liebe, mit denen der Fürst wie seine Schwestern an dieser treuen Seele hingen. Zwar gab es Leute, die finden wollten, daß das gegenseitige Verhältnis sich denn doch nachgerade zu einem allzu zwanglosen herausgebildet hatte, daß »die Fünfe« der guten Frau von Maritz einfach auf der Nase herumtanzten, aber irgend etwas müssen die Leute eben immer und bei allem auszusetzen haben; die Hauptsache war, daß man auf der Rothenburg ein durchaus zufriedenes Dasein führte und durchaus nichts »Unwürdiges« darin fand, in der ehemaligen Erzieherin und eigentlichen gegenwärtigen Hausfrau eine Freundin zu sehen, mit der man sich gelegentlich auch mal einen Spaß erlauben durfte, für den die stets heitre und gutgelaunte Dame zweifellos sehr empfänglich war, ohne sich auch nur das geringste von ihrer Würde zu vergeben; eine Kunst, die bekanntlich gar nicht so leicht ist. Ja, für das Glück, das volle Vertrauen ihrer Pflegebefohlenen zu besitzen, sich in ihren großen und kleinen Leiden und Freuden mit ihnen eins zu wissen, dafür hätte sie sogar etwas von ihrer Würde geopfert. Aber das hatte sie weder nötig, noch auch zu fürchten, denn wo die Liebe ist, da fehlt der Respekt niemals; man wacht über diesen nur dann immer so ängstlich und eifersüchtig. wenn man sich der empfangenen Liebe nicht ganz sicher fühlt.
Über diesen Punkt war nun Frau von Maritz ganz ohne Sorgen und da es ihr natürlich zu Ohren gekommen war, daß die Rothenburger »Gesellschaft« für den ihr schuldigen Respekt besorgte, so hatte sie deutlich zu verstehen gegeben, daß man sich darüber gefälligst beruhigen möchte, und wenn es den Prinzessinnen Spaß machte, ihr auf der Nase herum zu tanzen, so wäre das schon recht, denn dieses Organ wäre bei ihr groß genug geraten, um Platz für alle Vier und den Fürsten dazu zu gewähren.
Das einzige, was ihr – aber nur insgeheim – Sorge machte, war, daß ihre vier »Mädels«, wie sie die Prinzessinnen respektlos im Grunde ihres Herzens sowohl wie gelegentlich auch ganz laut nannte, in Rothenburg »versauern« möchten; denn was immer auch von seiten des Fürsten geschah, um Gelehrte, Musiker und Künstler nach seiner Residenz einzuladen, um einen frischen regen Geist hereinzubringen und den geistigen Schlaf zu verhüten – ein kleines, weltfernes Wurstnest blieb das Städtchen doch und der Horizont zog sich wie ein Gummiband immer wieder zusammen, wenn er gelegentlich einmal ausgeweitet wurde.
Daran war aber weniger der Mangel an Interesse, als die Natur der Sache selbst Schuld, denn was im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts noch möglich war: aus einem Weimar einen geistigen Brennpunkt zu machen, das verhinderte im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts der fortgeschrittene Verkehr, der die abseits vom Wege liegenden Winkel meidet und seinen Strom nach dem Zusammenfluß der Geister lenkt, nach den Großstädten.
Wenn nun der Berg nicht zum Propheten kommt, so muß eben der Prophet zum Berge und wer immer an der Scholle klebt, dem wird der Blick doch am Ende getrübt und wäre er noch so sehr ins Weite zu schauen geübt worden.
Frau von Maritz wollte aus ihren »vier Mädels« keine »kleinen« Prinzessinnen gemacht wissen, über die man an den großen Höfen lächelnd die Achseln zuckte oder sich mokierte; daß sie im Zwange eines kleinstaatlichen Hofes nicht künstlich zu Fossilen gemacht wurden, dafür war ja wohl gesorgt, indem die Etikette in Rothenburg nur dann hervorgeholt und gründlich abgestaubt wurde, wenn sich ein fremder »Regierender« mal zu einem Besuche dahin verirrte, wobei dann freilich der frischgeölte Apparat nicht immer klappte.
Aber damit war auch nicht alles getan und Frau von Maritz sorgte wenigstens dafür, daß ihre »Mädels« fremde Länder und fremdes Leben zu sehen bekamen, indem sie inkognito unter bürgerlichem Namen zwanglose Reisen mit ihnen unternahm, ohne jede Begleitung, ohne Zofen und Kammerdiener, genau wie andre Touristen, die sich ihre Stiefeln vom Hausknecht in den Hotels putzen lassen und sich im übrigen selbst bedienen, sich selbst ihre Plätze in überfüllten Zügen suchen und selbst nach den Preisen ihrer Zimmer fragen.
Das alles war so schon etwas, aber Frau von Maritz hätte gern noch mehr für ihre »Mädels« gehabt. Zum Beispiel gute Partien, das heißt gute in ihrem Sinne, nicht irgendein hochfürstliches, vergoldetes Elend, wie es so viele fürstliche Ehen waren und leider noch immer sind. Selbst unendlich glücklich in ihrer Ehe gewesen, suchte sie naturgemäß das Glück für ihre Pflegebefohlenen auch wieder in der Ehe; sie hielt nichts oder doch nur sehr wenig von dem Stande einer unverheirateten Prinzessin, der war in ihren Augen nicht Fisch nicht Vogel nach dem, was sie bisher davon gesehen hatte. Es gab da freilich ein Stift im Lande, dessen Äbtissinnenwürde immer einer Prinzessin des Rothenburger Hauses reserviert war und wenn's gerade keine gab, da regierte da nur eine »Priorin«. Jetzt eben war eine jüngere Schwester des vorigen Fürsten Äbtissin – lieber Himmel, was führte die für ein Leben! Eine kleine Hoffnung setzte Frau von Maritz auf die Verwandtschaft, aber sie kam zu der Überzeugung, daß es damit nichts Rechtes war, wenigstens was die Prinzessinnen betraf.
Von väterlicher Seite war eigentlich nur die Tante Äbtissin da, die zählte also nicht, denn eine Einladung ins Stift verursachte allemal mehr Schrecken als Freude. Die mütterlichen Verwandten, ein mediatisiertes Fürstenhaus, lebten daheim sehr zurückgezogen wegen schwerer Krankheit in der Familie; dort war auch kein froher Aufenthalt für ein junges Mädchen; blieb also nur noch die verheiratete, jetzt verwitwete Schwester des verstorbenen Fürsten, die Prinzeß Friedrich von Seeland, des gegenwärtigen Königs angeheiratete Tante. Auf diese etwas wunderliche Dame war Frau von Maritz nicht gut zu sprechen gewesen – bis vor kurzem. Nicht, daß diese Verwandte sich um ihre Nichten nicht gekümmert hätte, das konnte ihr niemand nachsagen, denn sie kargte nicht mit Geschenken, die freilich manchmal reichlich sonderbar waren, und sie lud auch ihre Nichten regelmäßig jeden Sommer zu sich auf ihr Schloß im Gebirge ein, aber was hatten die »Mädels« davon? »Einen Quark« behauptete Frau von Maritz für sich mehr drastisch als elegant, aber trotzdem nicht unrichtig, denn Ihre Königliche Hoheit lebte auf eben diesem Schlosse wie ein Einsiedler, froh, den »Rummel«, wie sie ihrerseits das Hofleben nannte, für ein paar Monate los zu sein. Hofdame und Kammerherr bekamen für diese Zeit Urlaub und »frei wie die Luft in den Gebirgen« stampfte sie in derben Schmierstiefeln und unglaublich kurzem Lodenrock in Wald und Flur durch Dick und Dünn von früh bis abend herum oder kutschierte sich selbst in einem Pürschwagen, der, wie gelegentlich Mitgenommene einmütig erklärten, in Sparta gebaut worden sein mußte, weil er so entsetzlich stieß.
An diesen Freuden durften die Prinzessinnen von Rothenburg alljährlich teilnehmen, aber sie taten es merkwürdigerweise ganz gern und kehrten immer frisch und rotwangig von der Tante zurück, die sie alle trotz ihrer vielen Absonderlichkeiten enthusiastisch lieb hatten. Dagegen hatte Frau von Maritz auch nichts einzuwenden; was sie Ihrer Königlichen Hoheit aber verdachte, war, daß Prinzeß Sophie ihre Nichten nie und niemals nach der Residenz einlud, in der sie allerdings nur die unumgänglich notwendigen, offiziellen Hoffestlichkeiten und auch diese nur unter entsetzlichem Seufzen und Stöhnen mitmachte. »Ob ich altes Reff meinen diamantenbehangenen Korpus zur Schau stelle oder nicht, danach fragt doch kein blauer Teufel«, pflegte sie zu sagen, aber es half ihr nichts; die »Diamantenlüftung« mußte mindestens ein halbdutzendmal in jeder Winterkampagne vorgenommen werden.
»Warum«, fragte Frau von Maritz sich und den Fürsten immer wieder, »warum nimmt die Prinzeß nicht eine ihrer Nichten zu sich? Das wäre doch eine passende Gelegenheit, sie zu zeigen und ihnen ein klein Stückchen von »der Welt, in der man sich langweilt?« In ihrer Fürsorge für ihre »Mädels« riskierte die gute Frau von Maritz diese Frage einmal direkt an die Prinzessin. Die Antwort kam prompt und chokierte die Gute noch mehr als die nackte Tatsache. »Meine Nichten sind verflixt hübsche Kröten und ich will nicht, daß mein Sohn sich in eine seiner Cousinen verschießt und eine dumme Partie macht. Eine Rothenburg im Hause Seeland ist gerade genug – ich kann davon ein Lied pfeifen. Ist er mal erst unter den Pantoffel gebracht dann will ich meinetwegen in den sauern Apfel beißen und Nichten ausführen. Ich freue mich schon darauf wie der Bauer, dem das Haus brennt.«
Frau von Maritz war empört, denn auf den Prinzen Erich, der also darum von seinen Cousinen so geflissentlich ferngehalten wurde, hatte sie insgeheim doch sehr gerechnet, abgeneigt wie sie sonst den Verwandtenheiraten war. »Eine dumme Partie« nannte es Prinzeß Sophie, die selbst eine Rothenburg war! Sie war doch manchmal entsetzlich geradezu, diese Königliche Hoheit! Und dann geschah ganz aus heiler Haut das Unerwartete: Prinz Erich unternahm mit einem befreundeten Thronerben eine Weltreise und kaum war er auf und davon, da kam eine Einladung von Prinzeß Sophie nach Rothenburg des Inhalts, daß eine ihrer Nichten (beileibe nicht etwa alle drei) sich nach Treustadt aufmachen sollte, um dort die Hoffeste mitzumachen. Für Courroben würde sie, die Tante, sorgen und das Los sollte entscheiden, welche der drei Erwachsenen die Freuden der Residenz genießen sollte. Frau von Maritz glaubte ihren Ohren nicht zu trauen, als der Fürst ihr diese Nachricht lachend überbrachte, aber sie hatte mit der gleichen Post alle Ursache, auch ihren Augen nicht zu trauen, als sie den Brief las, den die Prinzessin »vertraulich« an sie richtete. »Passen Sie mal auf, was ich Ihnen sagen werde«, schrieb sie in dem gleichen blühenden Stile, in dem sie zu reden pflegte. »Ich habe meine Nichten alle gleich lieb und gönne allen dreien gleich das ihnen blühende sogenannte Vergnügen. Aber wenn ich nun mal schon eine ausführe, dann will ich auch Staat mit ihr machen und das kann mir keine Katze verdenken. Elisabeth und Hedwig sind ja beide ganz hübsche und stattliche Erscheinungen, jede hat ihre Spezialvorzüge usw., aber was Außergewöhnliches sind sie nicht. Das müssen Sie selber sagen, meine gute, alte Maritz. Mit Lily ist's was anderes, die ist mal so ein Prinzessinnenphönix, wie er im Märchen steht. Die wirkt! Damit ich aber nicht für parteilich und ungerecht gelte, so habe ich meinem Neffen geschrieben, daß die Mädel das sogenannte Vergnügen unter sich auslosen sollen. Gut; das Los sollen sie ziehen, aber Sie sollen ein bissel dabei mogeln und es so einrichten, daß es Lily trifft. Verstanden? Gripps genug haben Sie ja dazu und ich vertraue Ihnen den Scherz an. Wenn Sie mich aber bemogeln, dann kriegen Sie es mit mir zu tun und den Leser, den ich Ihnen schreiben würde, den stecken Sie sich sicher nicht hinter den Spiegel. Auf in den Kampf. Mutter Maritz, – kutschieren Sie mal den Teufel am Schwanze, Sie werden's schon fertig bringen, was?«
Frau von Maritz war nach Lesung dieses Briefes erst sittlich entrüstet, aber weil sie Sinn für Humor hatte, lachte sie dann und schließlich mogelte sie sogar. Es darf nicht verschwiegen werden, daß sie es tat, in der allerbesten, liebreichsten Absicht, ohne ahnen zu können, daß sie damit wirklich das Manöver ausführte, das Ihre Königliche Hoheit ihr in so drastischen Worten empfahl. Und das Resultat war, daß Prinzeß Lily, die »Goldne«, wie die Rothenburger sie nannten, begleitet von einer für diese Gelegenheit ernannten Hofdame, Zofe und Diener nach Treustadt, der Residenz des Königreichs Seeland abreiste.
Den Januar, den Februar und die größere Hälfte des März war Prinzeß Lily fortgeblieben, sie hatte fleißig heimgeschrieben und von den glänzenden Festen, die sie mitgemacht, getreulich berichtet und nun kehrte sie heim und ganz Rothenburg war unterwegs, um sie am Bahnhof zu begrüßen – – –
Der neugierige Handlungsreisende kam für den Umweg durchaus auf seine Rechnung, denn als der Zug ankam, lohnte es sich allein schon zu sehen, wie die drei Prinzessinnen ihre Schwester begrüßten: sie fielen ihr alle gleichzeitig um den Hals und bildeten einen Knäuel, den ein gleichfalls herbeigeeilter Photograph Muße hatte, gewissenhaft zu photographieren; das Resultat dieses Bildes habe ich leider nicht gesehen, aber es muß ein merkwürdiges Konglomerat von fest aneinander hängenden Damenkostümen, Hüten und behandschuhten Händen gewesen sein, das sich erst entwirrte, als ein kleines Mädchen mit einem großen Strauß von Himmelsschlüsseln in den Händen ungeduldig mit seiner feinen Stimme piepste: »Jetzt ist's aber genug – wir wollen die Goldne auch begrüßen!«
Ein junges, frisches, helles Lachen antwortete auf diesen Appell; der Knäuel entwirrte sich und die große, schlanke Gestalt, das Opfer dieser schwesterlichen Attacke, die das Auge der Menge nicht im mindesten geniert hatte, löste sich aus den sie umschlingenden Armen, um die ihrigen zunächst mit einer reizenden Bewegung, die eine ganze Welt von Liebe ausdrückte, um den Hals von Frau von Maritz zu schlingen, die lachend der ersten Begrüßung zugesehen hatte. Dann erst wandte sich Prinzeß Lily dem kleinen Mädchen mit dem großen Strauße zu.
»Nein, Mieze – du bist auch gekommen, mich zu begrüßen?« rief sie laut mit der Überraschung, die für Kinder oft mehr ist, als Bonbons und Kuchen. »Ist das lieb von dir – von euch allen! Ich habe mich aber auch schon ganz schrecklich auf euch gefreut. Und die Blumen soll ich alle haben? Die müßt ihr mir schon bis an den Wagen tragen helfen, denn allein kann ich diese vielen, vielen Blumen ja gar nicht schleppen!«
Und sie halfen – wie halfen sie! Es dauerte, bis der ganze Segen glücklich in den zwei Wagen verstaut war so lange, daß die Pferde schon ganz ungeduldig wurden und die Prinzessinnen in der größten Angst waren, eins der Kinder möchte unter die Räder kommen, aber es lief alles glücklich ab und lächelnd und grüßend fuhren die vier Prinzessinnen im Break ab, während Frau von Maritz mit der temporären Hofdame der Prinzeß im Landauer folgte.
»Sie ist wirklich goldig«, dachte der Reisende, dem fürstlichen Wagen nachschauend. »Man kann es den Leuten nicht verdenken, wenn sie ihr gut sind. Und hübsch ist sie dabei – Donnerwetter noch einmal!«
Womit er bewies, daß er einen guten Geschmack hatte, denn es gab Leute, die Prinzeß Lily sogar für eine Schönheit erklärten, Leute, die etwas davon verstanden, oder es in ihrer Eigenschaft als Künstler doch wenigstens verstehen sollten. Eine wirkliche, dem höchsten Ideal entsprechende Schönheit hat aber zumeist etwas Kaltes, gewissermaßen Unnahbares im Gefolge und weil bei Prinzeß Lily alles Leben, Wärme, strahlende Jugend war, so konnte der Begriff »eine Schönheit« ihre ganze Erscheinung nicht genügend oder erschöpfend kennzeichnen. Streng genommen war sie's auch wahrscheinlich nicht, trotz des Urteils derer, die es wissen konnten. Ihr Mund hätte dazu vielleicht kleiner, ihre feingebogene Nase um etliche Linien länger sein müssen, aber es wäre unmöglich gewesen, sich dem Zauber dieses jungen Gesichtes mit dem Pfirsichblütenteint und den dunkel umrahmten, großen, strahlenden grauen Augen zu entziehen, um das naturkrauses, reiches, goldblondes Haar eine förmliche Glorie bildete. Das waren Schönheiten, gewiß, aber über alle diese Vorzüge siegte doch die Herzensgüte des Ausdrucks, die unsägliche Anmut des lieblichen Mundes, wenn er lächelte, wobei sich dann in den Wangen zwei herzige Grübchen bildeten. Alles das unterstützt von der natürlichen Grazie und der unbewußten Würde in jeder Bewegung der tannenschlanken, und doch nicht etwa mageren Gestalt, die ihre Schwestern um einen halben Kopf überragte.
»Gott sei Dank, daß wir dich endlich wieder haben – ich dachte schon, du kämst überhaupt nicht mehr zurück, Goldne«, lachte die Jüngste, als der Wagen endlich davonfuhr.
»Du siehst müde aus und etwas angegriffen, wir müssen dich wieder in der Ruhe unsres Daseins nach den Freuden der Residenz in die Reihe bringen«, meinte die Älteste mit einem besorgten Blick in das kaum rosig angehauchte Gesicht ihrer Schwester. »Ja, ja – die späten Stunden und alles das – man muß auch seine Vergnügen teuer erkaufen.«
Es zitterte etwas wie ein leiser, ganz leiser Seufzer über die Lippen von Prinzeß Lily, als sie mit einem halben Lächeln den Kopf schüttelte.
»I bewahre – Rothenburg wird mir die Großstadtluft bald genug wieder aus den Lungen treiben«, versicherte sie leicht. »Man kann doch hier viel besser atmen. Wie gut und frisch ihr alle ausseht – es ist eine wahre Freude.«
»Ich bin nur froh, daß ich noch nicht erwachsen bin. Das sogenannte ›Ausgehen‹ muß ja eine wahre Hausknechtsarbeit sein«, lachte die Jüngste wieder mit der ganzen Überlegenheit des Fuchses, dem die Trauben zu sauer sind. »Aber auf das Erzählen kannst du dich freuen, Goldne. Alles will ich wissen, was du gesehen und erlebt hast, alles! Verstehst du?«
»Als ob ich euch nicht alles geschrieben hätte!« verwahrte sich Prinzeß Lily entsetzt. »Ganze Folianten könnte man von den Briefen drucken, die ich für die allgemeine Neugierde heimgeschrieben habe!«
»Hast du. Aber was man gern wissen will, das hast du natürlich nicht geschrieben«, behauptete die Jüngste hartnäckig.
»Da möchte ich doch wirklich wissen, was du Naseweis noch besonders wissen möchtest –«
»Na, zum Beispiel, was du für Eroberungen gemacht hast!«
»Du, kümmre dich gefälligst um deine Schulaufgaben und nicht um meine Eroberungen«, wehrte Prinzeß Lily lachend ab.
»Aha! Sie hat welche gemacht!« triumphierte das enfant terrible des Rothenburger Fürstenhauses. »Seht ihr's, wie sie rot wird! Na wart, – ich werde dir schon auf der Seele knien, bis du bekennst! Und dann – es ist wahr, vom Polizeipräsidenten bis zum Nachtwächter hast du uns die Treustadter Typen sehr divertierend geschildert, aber von der Hauptperson – kein Wort!«
»Aber Vicky, du neugieriger Spatz du –«
»Es ist wahr! Hedwig, Elisabeth, sagt selbst, hat sie je etwas von dem König geschrieben?«
»Ja um alles in der Welt – was soll ich denn von dem Könige schreiben?« murmelte Prinzeß Lily, indem sie ihr Gesicht in den Strauß Himmelsschlüssel versteckte, den sie noch in der Hand hielt.
»Und da frägt sie auch noch«, ereiferte sich das Prinzeßchen, indem es ihrem Zopfe einen Schwung gab, der ihn über ihre eckigen Backfischschultern jagte.
»Ich dächte, der König wäre doch die Hauptperson in seiner Residenz, nicht? Und ich will wissen, wie er aussieht, wie er redet, – na, kurzum, wie er sich räuspert und wie er spuckt.«
»Vicky!« verwies Prinzeß Hedwig, aber es zuckte um ihre Mundwinkel dabei.
»Wie er aussieht, weißt du ganz genau«, neckte Prinzeß Elisabeth. »Du schwärmst ja für ihn zur Genüge, hast sein Bild in Folioformat in einem Rahmen, der deine Mittel bedenklich ins Defizit gebracht hat, in deinem Zimmer stehen und machst täglich mehrmals einen Kotau davor!«
»Aber ich will wissen, ob er wirklich so aussieht, – Photographien können retouchiert werden«, beharrte das Prinzeßchen auf seiner Forderung, den Kotau mit einer Grimasse quittierend. »Und ob er sonst nett ist, will ich wissen. Und ob er wirklich die Herzogin Xenia, seine Cousine, heiraten wird. Und ob er wirklich so schön die Geige spielt, wie es in der Zeitung steht, und ob er lustig ist oder melancholisch und so ideal! Laß mal die dummen Blumen sein, Lily, sie riechen ja doch nicht! Antworte!«
»Ein Narr frägt oft mehr, als zehn Weise beantworten können«, neckte Prinzeß Elisabeth wieder. »Wir werden das alles nach und nach erfahren, Kleine! Aber ob das Gerücht mit der Herzogin Xenia wahr ist, das möchte ich wirklich auch gern wissen.«
»Man behauptet es wenigstens steif und fest – in den Zeitungen wird diese Verlobung einfach als Tatsache behandelt«, fiel Prinzeß Hedwig ein. »Schrecklich unangenehm müssen diese öffentlichen Indiskretionen für die Betreffenden sein! Der König kann ja eigentlich gar nicht mehr anders, als die Verlobung zu proklamieren, wenn die Herzogin nicht kompromittiert werden soll. Warum kommt es denn noch immer nicht dazu? Besonders, wenn, wie man sagt, es der Herzenswunsch der Königin-Mutter ist! Was sagt denn Tante Sophie dazu?«
»O, Tante Sophie sagt, wegen ihr könnte das Gebammle mal ein Ende nehmen«, murmelte Prinzeß Lily mit dem Schatten eines Lächelns hinter ihren Blumen.
»Die Redewendung sieht Tante Sophie ähnlich«, lachte Prinzeß Hedwig hell heraus. »Es sollte mich nur Wunder nehmen, wenn sie es dem Könige nicht mit den gleichen Worten gesagt hätte.«
»Sie wird nicht ermangelt haben, es zu tun – ob sie gefragt worden ist oder nicht«, fiel Prinzessin Elisabeth mit Überzeugung ein. »Welchen Eindruck hast du denn von der Sache gehabt, Lily? Du bist den handelnden Personen doch nahe genug gekommen, um dir ein Urteil bilden zu können?«
»O – ich kann wirklich nicht sagen, wie sie selbst dazu stehen«, erwiderte Prinzeß Lily rückwärts herausschauend. »Die Herzogin Xenia ist sehr zurückhaltend – sie gibt sich sehr kühl, fast frostig. Aber sie ist sehr schön, sehr – –«
Und wieder war es ein leiser, leiser Seufzer, der dieses zweite »sehr« fast erstickte.
»Nun, wenn es wirklich der Herzenswunsch der Königin-Mutter ist – – man sagt, daß Seine Majestät sehr unter dem mütterlichen Pantoffel stehen soll – – dann wird Tante Sophie ja wohl bald die Befriedigung haben, daß das ›Gebammle‹ ein Ende hat«, meinte Prinzeß Hedwig mit einem flüchtigen, aber scharfen Blick auf die Schwester.
»Vielleicht – wahrscheinlich«, murmelte Prinzeß Lily. »Aber«, setzte sie sich umwendend mit leuchtenden Augen hinzu, »aber ihr dürft nicht glauben, daß der König ein Schwächling, ein Muttersöhnchen ist, das sich tyrannisieren läßt! Er wird aus eigner, freier Entschließung tun, was er für recht hält, vor sich, der Prinzessin und dem Lande! Und – ›Abwarten und dann Tee kochen‹, würde Tante Sophie sagen. Erzählt mir lieber, warum Hans Heinrich nicht gekommen ist, mich abzuholen. Noch kein Sterbenswort habt ihr mir von ihm gesagt.«
»Erstens hat unser Herr Bruder behauptet, wir wären zur Abholung gerade genug ohne ihn«, rief Prinzeß Vicky, sich sofort auf das neue Thema stürzend, »und dann hat er gerade dringende Geschäfte, er ›regiert‹.«
»Aha irgendeine Deputation, die empfangen werden muß«, meinte Prinzeß Lily, das stolze Wort »regieren« richtig übersetzend.
»Nein – er empfängt einen Gesandten aus Treustadt«, fiel Prinzeß Elisabeth ein. »Ich bekenne, daß ich vor Neugierde brenne, zu wissen, was der hier will. Einen außerordentlichen Gesandten, denk mal nur! Ob wir wohl an der Grenze irgend etwas verbrochen haben, das solche Maßregeln erfordert? Aber Goldne, – du wirst ja ganz blaß! Eine Kriegsdrohung wird's nicht gleich sein, wenn ich so auch der Überzeugung lebe, daß das Rothenburger Bataillon die Seeländer Armee umgehend schlagen würde.«
»Na, laß mal gut sein, Elisabeth«, rief Prinzeß Hedwig halb lachend und halb ärgerlich. »Wenn wir ja auch nur zu den Kleinsten der Kleinen gehören, unsern Stolz haben wir darum doch und es ist nicht gerade angenehm, von den Größten unter den Großen ›gerissen‹ zu werden. Das aber kann es nicht sein – dazu genügt der bei uns akkreditierte Geschäftsträger vollauf. Qui vivra verra. Irgendein Höflichkeitsakt, für den man etwas besondres springen läßt.«
»Die Goldne ist wirklich ganz blaß geworden«, stellte Prinzeß Vicky in besorgtem Ton fest, um im selben Atem neckend fortzufahren: »Du! Du hast doch in Treustadt nicht am Ende etwas ausgefressen – ach was! Mutter Maritz ist ja nicht dabei, da darf man schon mal deutsch reden – was sie dem Hofe von Rothenburg durch einen außerordentlichen Gesandten in vertraulicher Mission anzeigen! Haha! Jetzt wird sie rot, die Goldne! Ich hab's getroffen!« jubelte das enfant terrible in die Hände klatschend.
»Vicky, du bist doch ein schreckliches Mädel!« sagte Prinzeß Lily mit einem Lachen, das etwas gezwungen war und die Röte in ihrem schönen Gesichte vertiefte sich dabei.
»Ja, ja – öfter Wasser und Brot könnte ihr nichts schaden«, lachte Prinzeß Hedwig und sotto voce, so daß es nur ihre Schwester verstehen konnte, setzte sie hinzu: »Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen – usw. – –«
»Ihr seid eine so toll wie die andre«, gab Prinzeß Lily ebenso zurück, aber in dem scherzenden Tone klang es wie ein Unterton von Gequältsein, der dem feinen Ohre der Älteren nicht entging und sie scharf aufhören machte. Gewandt lenkte sie das Gespräch auf andre Dinge – auf alle die wichtigen Ereignisse, die sich während der Abwesenheit der »Goldnen« in Rothenburg zugetragen und damit erreichte der Wagen endlich, im Schritt aufwärts den steilen Hügel erklimmend, das Schloß, und fuhr dann im schlanken Trabe in den efeuumsponnenen Schloßhof ein. Im Portal stand schon wartend die schlanke, sympathische Gestalt des Fürsten Hans Heinrich, ein frohes Lachen auf dem Gesicht, und rief der wiedergekehrten einen lauten Gruß zu, ehe er sie, die er am Körpergröße doch noch um ein Beträchtliches überragte, wie eine Feder aus dem Wagen hob und sie dann trotz der Zeugenschaft der zuschauenden Lakaien, herzlich abküßte.
»Gottlob, daß wir dich wieder haben, Golde, – liebe, liebe Lily«, sagte er dabei mit einer Wärme, die ihm aus der Seele kam und die ihn mehr als all sein sonstiges klares und zielbewußtes Wirken zu dem »Liebling des Volkes« gemacht. »Ohne dich waren wir doch nur ein verstimmter Akkord, eine falsche Quinte.«
Es lag in seinem Tone indes noch etwas anderes, – etwas wie eine Frage: »Wie lange noch?« das seine Schwester rasch zu ihm aufsehen machte.
»Ich bleibe jetzt immer bei euch – immer«. murmelte sie, sich an ihn schmiegend, der ihr Vater und Bruder und Freund zugleich gewesen, seit das fürstliche Quintett so früh verwaist war.
»Na, na, – keine leichtsinnigen Versprechungen, Goldne«, gab er ebenso leise zurück und lächelte kaum merklich, als er sah, wie sie rot wurde.
Der Tee »en famille«, in die natürlich Frau von Maritz mit inbegriffen war, und zu dem die Angekommene ohne Zeremonien im Reisekleide niedersaß, gestaltete sich nicht nur deshalb allein zu einem höchst fröhlichen Mahl, weil dazu die Lieblingskuchen von Prinzeß Vicky in Hülle und Fülle serviert wurden, sondern weil der Fürst dabei eine Neuigkeit verkündigte, die in dem engen Kreise Sensation erregte, und zwar nicht zum mindesten deshalb, weil es wirklich eine Neuigkeit war, deren Geheimnis so gut gehütet worden war, daß er die vier Unbeteiligten tatsächlich bis zur Sprachlosigkeit – für den ersten Moment aber nur – überraschte. Prinzeß Hedwig, die Älteste, vierundzwanzigjährige, um drei Jahre jüngere Schwester des Fürsten, hatte sich verlobt, und zwar der Tradition entgegen mit einem simplen Edelmann, einem der wenigen Großgrundbesitzer des Fürstentums, dem Freiherrn von Burgpreppach, von dessen Hause die Legende ging, daß die Ahnen der Fürsten von Rothenburg seine Ministerialien gewesen und in seinem Gefolge geritten seien. – – »Degeneriert« konnte man die Burgpreppach trotz des hohen Alters ihres Hauses aber ebensowenig nennen, als das Rothenburger Fürstenhaus; sie hatten nie unter sich geheiratet, sondern immer frisches Blut in die Familie gebracht; auch manch Tröpflein rotes, bürgerliches Blut war darunter und hatte den blauen, »besonderen Saft« in gutem Fluß erhalten; stammte doch die Mutter des um zehn Jahre älteren Verlobten der Prinzeß Hedwig selbst aus einem guten, alten Kaufherrnhause des südlichen Deutschlands! Nach der Freude, die der Überraschung folgte, durfte man dreist zu dem Schlusse kommen, daß der Rothenburger Magnat eine höchst beliebte Persönlichkeit in der Rothenburg war, – herzlich, ja stürmisch waren die Glückwünsche, die auf die junge Braut herabregneten; nur Frau von Maritz brauchte etwas länger, um sich von der Überraschung zu erholen. Liberal, wie die gute Dame sonst auch war, für ihre Pflegekinder war sie feudal und das Schreckenswörtlein: »eine Mesalliance« war das erste, das ihr durch den Kopf fuhr. Eine Diplomatin war sie nicht und auf ihrem guten alten Gesicht war darum das Wörtlein so deutlich zu lesen, daß Prinzeß Hedwig fast bittend zu ihr sagte: »Kein ›aber‹, liebes, gutes Mutterchen! Ich liebe meinen Fritz und wenn Hans Heinrich nein gesagt hätte, so wäre ich Ihnen als alte Jungfer auf dem Halse geblieben und hätte Ihnen die Herrschaft hier streitig gemacht. Eine schreckliche Aussicht, nicht?«
Da mußte Frau von Maritz, denn doch lachen und damit hatte ihr unausgesprochener Protest die Spitze verloren.
»Für das schlechte Beispiel, das ich noch auf Ihrem Gesichte lese, müssen Sie andre verantwortlich machen«, sagte der Fürst, die treue Freundin vertraulich um die Schultern fassend. »Wenn der König von England seine Tochter einem ›Vasallen‹ zur Frau gegeben und seine Schwester doch auch nur mit einem seiner Magnaten verheiratet ist, so wird ein kleiner deutscher Fürst sich einen solchen Luxus wohl erlauben dürfen, ganz abgesehen davon, daß wir ja eigentlich die Vasallen der Burgpreppacher sind, was sie durchaus nicht vergessen haben.«
»Na, es kommt dabei immer noch auf das bessere Avancement an«, bemerkte Frau von Maritz trocken. »Im übrigen konnte Hedwig, menschlich gesprochen, eine bessere Wahl nicht treffen, wenn ich auch schon sagen muß, daß der König von England den Vergleich nicht ganz aushält, oder vielmehr, daß der Fürst von Rothenburg mehr aufs Spiel setzt, als dieser Monarch.«
»Aha! Quod licet jovi non licet bovi« wollen Sie sagen. Mutter Maritz, Sie werden anzüglich«, lachte der Fürst hell heraus. Dann setzte er halblaut hinzu: »Vielleicht haben Sie so unrecht nicht. Ja, wenn man alles voraussehen könnte – – aber vielleicht ist's doch besser, man kann es nicht. Und mit Hedwig wenigstens ist's gut so, davon bin ich überzeugt.«
»Ich auch«, gab Frau von Maritz herzlich zu. »Aber das steht auf einem andern Blatte.«
Als der kleine Kreis dann auseinanderging, wobei Prinzeß Vicky sich noch heimlich die Tasche voll Kuchen stopfte, fand Prinzeß Lily Gelegenheit, ihren Bruder einen Augenblick für sich allein zu haben.
»Hans Heinrich«, flüsterte sie ihm, blaß bis an die Lippen werdend, mit stockendem Atem zu, »was will dieser Seeländer Gesandte hier, von dem die Mädchen mir erzählt haben?«
»Staatsgeheimnis, Goldne«, erwiderte der Fürst, seiner Schwester liebevoll über das Haar streichelnd.
»Hans Heinrich!« sagte sie bittend.
»Geduld, Liebe«, entgegnete er. »Du erfährst es vielleicht noch früh genug. Vertraust du mir?«
»Ja«, versicherte sie, tapfer die Frage unterdrückend, die ihr noch auf den Lippen schwebte.
Bei dem Diner am Abend, dem außer einem größeren Kreise Eingeladener auch der geheimnisvolle Gesandte aus Treustadt beiwohnte, verkündigte der Fürst die Verlobung seiner ältesten Schwester und brachte das erste »Hoch« auf das Brautpaar aus, in das die Anwesenden begeistert einstimmten. War dieses frohe Ereignis doch ein neues Band, das Fürstenhaus mit dem Land zu verknüpfen, eine neue Kundgebung des vorurteilslosen Sinnes des Fürsten, ganz abgesehen davon, daß die Braut nicht nur populär war, sondern sich eins fühlte mit den Gesellschaftskreisen ihrer Heimat, in denen der Bräutigam eine führende Rolle spielte. Etwas Befriedigenderes als diese Verbindung konnte es demnach für die Rothenburger »Gesellschaft« gar nicht geben und darum war der Enthusiasmus auch durchaus echt und in keiner Weise gemacht, die Harmonie eine vollkommene, wenn es ja natürlich auch Leute gab, die dem »unverschämten Glücke« des Burgpreppachers ein größeres Verdienst dabei zustehen wollten, als seiner Persönlichkeit, die indes durchaus nicht zu verachten war. Womit nur der Beweis geliefert werden soll, daß auch in diesem kleinen Musterstaate die Vollkommenheit nicht lebte und webte, sintemalen Musterstaaten nur von Menschen bewohnt sind und nicht von Engeln.
Bei dem Toast auf das Brautpaar fiel es auf, das heißt es wurde von einigen wenigen aufmerksameren Beobachtern bemerkt, daß der Seeländer Gesandte sich dabei sehr zurückhaltend benahm; aber diese Leute sahen vielleicht mehr als zu sehen war, behaupteten andre, denn erstens hätte der Fremde wohl keinen Grund, Enthusiasmus an den Tag zu legen und zweitens war er überhaupt ein etwas steifer Herr. Schließlich setzte er aber doch beide Ansichten ins Unrecht. Es war nämlich beim Dessert, als ein Lakai ihm diskret etwas neben den Teller legte, was näher Sitzende als ein Telegramm erkennen wollten, worauf er mit dem Fürsten ein kurzes Zeichen wechselte und darauf die Drahtbotschaft unter dem Tischrande öffnend, ebendort auch überflog. Das Papier in die Brusttasche seines Frackes schiebend, zögerte er einen Moment, dann schlug er an sein Glas und verkündete mit lauter Stimme kurz, aber in wohlgesetzten Worten, daß ihm der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden sei, die Glückwünsche für das – hem – hohe Brautpaar von Seiner Majestät dem Könige Leo VII. von Seeland, seinem Herrn, zu übermitteln.
Über das Gesicht des Fürsten war, als der Gesandte sich erhob, ein Ausdruck von wechselnden Gefühlen geflogen; erst blitzte es auf in seinen Augen wie von stolzer Genugtuung, dann flog ein weicher Blick hinüber auf das ihm gegenüber sitzende Brautpaar und dann senkte er ihn, wie von Zweifel und Sorge umflort, aber als er dem Gesandten für die »gnädige« Botschaft dankte, da war seine Stimme fest, sein Blick klar und ein großer Ernst, den viele für eine etwas zu stark betonte Devotion für den königlichen Glückwunsch nahmen, lag auf seinem offenen, hübschen Gesicht – –
Daß er sich mit seinem fremden Gaste nach dem Diner in eine Fensternische zurückzog, während das Brautpaar die Glückwünsche der Anwesenden entgegennahm, fiel nicht besonders auf; wenn jemand in besonderem Auftrag angereist kommt, dann hat er sich mit seinem Wirte natürlich auch etwas zu sagen. Übrigens dauerte die Unterredung nur wenige Minuten und der Gesandte war danach wesentlich weniger steif als vor der Tafel.
»Wenn die Leute fort sind, Goldne, dann komme zu mir in mein Kabinett; ich habe dir etwas zu sagen«, flüsterte der Fürst im Vorübergehen seiner Schwester zu und als sie ihn erblassend mit einem fragenden Blicke ihrer großen, reinen Augen ansah, setzte er lächelnd hinzu: »Es ist nichts Böses; vielleicht, je nachdem du es auffassen wirst, vielleicht sogar etwas sehr Gutes. Also – ich erwarte dich.«
Prinzeß Lily nickte mit einem Lächeln, das etwas schattenhaft war und dann erschien es ihr, als ob dieser Abend nie ein Ende nehmen wollte. Tatsächlich aber verging er heut rascher, als es gewöhnlich der Fall war; der Fürst hatte längst schon mit der Form der Etikette gebrochen, nach der es der fürstliche Wirt ist, der seine Gäste zu »entlassen« pflegt, indem er sich zurückzieht. Es war der ältesten der geladenen Damen überlassen worden, das Signal zum Aufbruch zu geben und da es heute eine sehr alte und etwas gebrechliche Exzellenz war, die diesen Ehrenplatz einnahm, so geschah es zu ganz ungewöhnlich früher Zeit, daß die Gäste sich von der fürstlichen Familie verabschiedeten. Als die letzten gegangen waren, da reichte der Fürst Prinzeß Lily den Arm und führte sie in sein Arbeitszimmer, indem er seinen beiden ältesten Schwestern seinem künftigen Schwager und Frau von Maritz ein Zeichen gab, zurückzubleiben, weil man sich nach solchen Gelegenheiten für gewöhnlich noch zu einem gemütlichen Plauderstündchen bei ihm zusammenfand.
In seinem Arbeitszimmer schob er zunächst für seine Schwester einen bequemen Sessel neben seinem Schreibtisch zurecht und setzte sich dann selbst davor hin, indem er aus einer verschlossenen Schublade ein Schreiben entnahm.
»Es war heut ein ereignisreicher Tag für uns, mein Schwesterlieb«, begann er freundlich. »Nicht nur, daß er die Verkündigung der Verlobung von Hedwig brachte, die wir uns für deine Rückkehr aufgehoben hatten – das Geheimnis ist gut bewahrt worden, nicht? Selbst die gute Mutter Maritz war ja ganz ahnungslos und auch Vickys Spürsinn hat keinen Verdacht geschöpft, was das größere Wunder ist. Aber deiner Rückkehr sind noch zwei andre Dinge vorausgegangen, die diesem Tage eine ganz besondere Bedeutung aufprägen. Erstens brachte die Post mir am frühen Morgen ein Handschreiben der Königin-Mutter von Seeland, – dieses hier – in welchem sie mir erst allerhand Schmeichelhaftes über dich sagt. Du kannst es lesen, wenn du willst, aber ich glaube, es ist für deine Eitelkeit besser, du unterdrückst deine Neugierde. Und nach dieser gnädigen Einleitung bietet Ihre Majestät dir die Stellung einer – Hofdame bei sich an. Ich hoffe, du bist von dieser dir erwiesenen Ehre ebenso überwältigt, als ich es war, um so mehr, als die Königin-Mutter mir gnädigst versichert, es würde ihr zur Genugtuung gereichen, eine junge Dame »von guter Familie« in ihrer nächsten Umgebung zu wissen.«
Prinzeß Lily hatte sich aufgerichtet, als der Fürst den Namen der Königin-Mutter aussprach, namenloses Staunen malte sich dergestalt auf ihrem jungen, reizenden Gesichte, daß der Fürst ein flüchtiges Lächeln nur mühsam unterdrücken konnte, aber als er seine Mitteilung schloß, da sprang sie auf und stand mit flammenden Augen vor ihm.
»Aber – aber das ist ja eine – ausgesuchte Beleidigung!« stieß sie hervor.
»Ja, meine liebe Lily, das war auch mein erstes Gefühl, nachdem ich mich von meinem Staunen erholt hatte«, sagte der Fürst ruhig. »Als ich mich aber etwas beruhigt hatte, überlegte ich mir, daß es so nicht gemeint war, nicht gemeint sein konnte, daß die Königin-Mutter das Anerbieten vielmehr in voller Harmlosigkeit und im besten Glauben gemacht hat – der etwas überspannten Auffassung ihrer Abstammung und Stellung entsprechend. Man muß solche Leute eben nehmen, wie sie sind und darf es ihr besonders nicht zur Last legen, wenn ihre immer noch in den orientalischen Windeln liegenden Begriffe von den unsern etwas abweichen –«
»O, – diese Begriffe müssen solchen Leuten aber abgewöhnt werden«, rief Prinzeß Lily empört. »Am Ende ist das Nächste, daß man dir die Stellung des Königlichen Portiers anbietet, – ein sehr guter Posten für einen jungen Mann aus guter Familie!«
»Goldne, du bist zu ehrgeizig und gehst zu hoch heraus«, lachte der Fürst nun ohne Rückhalt. »Ich hatte mir den Stiefelputzer als nächstes Ideal gedacht. Aber den Scherz beiseite – –«
»Mir ist's gar nicht spaßhaft«, fiel Prinzeß Lily ein, indem es um ihren Mund zuckte und die heißen Tränen der Demütigung ihre Augen füllten. »Du kennst die Königin-Mutter nicht, aber ich kenne sie – ich! Sie will uns zeigen, daß wir nichts sind in ihren Augen, ihr nicht ebenbürtig und daß sie selbst dir geschrieben, das war nur der Zucker auf die bittre Pille, der uns blenden und überwältigen sollte!«
»Nun, der Glaube an diese »Überwältigung« ist eben der Ausfluß eines Hochmutes, den die Erziehung künstlich gezüchtet hat und der so fest sitzt, daß auch das Dasein in einer gemäßigteren Zone ihm von seiner Lebensfähigkeit nichts mehr rauben konnte«, meinte der Fürst achselzuckend. »Meine mildere Auffassung hat sich übrigens auch wesentlich geändert, als diesem Briefe, den ich zum Glück nicht in der ersten Hitze beantwortet habe, die unerwartete und unangesagte Ankunft des Grafen Ingolstadt auf dem Fuße folgte, dessen mysteriöse Mission deine Schwestern und dich wohl auch, Goldne, so neugierig gemacht hat.«
»Ah!« machte Prinzeß Lily, die Hand auf das Herz drückend. Erloschen war die Empörung über die ihr und ihrem Hause erfahrene Beleidigung, ihr schönes, junges Haupt mit der goldenen Haarkrone senkte sich tief, tief herab und mit einer Bewegung, als ob ihre Füße sie nicht mehr tragen wollten, ließ sie sich zurück in den Sessel fallen.
»Als mir die Ankunft des Grafen gemeldet wurde, fuhr es mir durch den Sinn, daß der König diese Form gewählt hatte, um dem Briefe seiner Mutter die Entschuldigung durch einen besonderen Abgesandten nachfolgen zu lassen«, fuhr der Fürst mit einem langen, zärtlichen Blick auf seine Schwester fort. »Es wäre dies, wenn er überhaupt Kenntnis von diesem Briefe hat, der einzig mögliche und richtige Weg, die Sache wieder gut zu machen. Aber meine Annahme war nicht die richtige – der König scheint nichts von dem Schritte seiner Mutter zu wissen. Graf Ingolstadt ist abgesandt worden, um im Namen des Königs um deine Hand anzuhalten.«
Prinzeß Lily senkte den Kopf noch tiefer, als wollte sie sich vor der erhaltenen Botschaft verneigen – ein rührendes Bild holdester Jungfräulichkeit und Mädchenhaftigkeit, dessen Anblick das Auge ihres Bruders feucht machte.
Dann hob sie den Kopf, das zarte Rot ihrer Wangen vertiefte sich, ein strahlender Glanz leuchtete in ihren Augen auf und ein wunderbares Lächeln irrte um ihren lieblichen Mund.
»Und deine Antwort, Hans Heinrich?« fragte sie mit vor Bewegung vibrierender Stimme, aber klar und deutlich.
»Die Antwort, meine Goldne, hängt von dir ab«, entgegnete der Fürst freundlich, »wie sie auch ausfällt, so wird der Gesandte des Königs sie erhalten. Für mich ist nicht die Krone, nicht der Glanz maßgebend, der von ihr auf mein Haus zurückstrahlt, sondern das Lebensglück meiner Schwestern. Davon hast du heut den Beweis erhalten. Dein »nein« genügt, um die uns so lockend gebotene Krone mit leichtem und frohem Herzen wieder verschwinden zu sehen.«
Prinzeß Lily faltete die Hände in ihrem Schoß und mit einem Blicke, der ganz andre Dinge schaute, als ihre Umgebung, sah sie vor sich hin und dabei kam etwas Unirdisches, seltsam Verklärtes über ihre Züge, über ihre ganze Erscheinung. Das weiße Kleid, das sie trug, aus dem die zarten, mädchenhaften Formen ihres Halses und ihrer Arme in fast noch durchsichtigerem Weiß hervorleuchteten, verlor den Eindruck des Modernen und wurde zu dem unbestimmten Gewande eines höheren Wesens, – die goldene Haarkrone über dem schönen, vergeistigten Gesichte wandelte sich zu einer Aureole, wie die seligen Geister sie tragen und die großen Augen schienen über Zeit und Raum hinweg etwas zu sehen, was des Menschen Blick sonst nicht durchdringt – und der Eindruck der Verklärung wurde schließlich so eindringlich, daß es der Fürst, der seine Schwester staunend ansah, nicht mehr ertragen konnte. Er sprang auf von seinem Stuhle und trat vor sie hin und beugte sich über sie hinab, indem er ihr die Hand leicht auf die Schulter legte.
»Lily«, sagte er leise, zärtlich. »liebe, liebe Goldne – was ist es, ja oder nein?«
Da kam sie zurück zur Wirklichkeit. Sie neigte den Kopf herab auf seinen Arm und zu ihm aufsehend sagte sie unendlich weich:
»Sei mir nicht böse, Hans Heinrich – ich liebe ihn!«
»Ja, mein Schwesterlieb – wie könnte ich denn darüber böse sein?« erwiderte er herzlich. »Das ist nun einmal so – es schlägt eben jedem seine Stunde. Aber alles ist dein Bekenntnis mir noch nicht; wie ist es mit ihm? Bist du seiner Liebe sicher?«
»Ich – ich – ach, Hans Heinrich, wie kann es denn anders sein, wenn er mich doch gewählt hat, er, der die Tochter eines Kaisers zur Gemahlin haben konnte –«, kam es leise, zagend, fragend und doch auch wieder wie ein Jubelschrei über ihre Lippen.
»Der Grund ist einleuchtend«, sagte der Fürst mit einigem Zögern. »Aber – hat der König dir nicht auch selbst gesagt – – ich will nicht etwa indiskret sein, Lily! Nur mein Interesse für dich, der innige Herzenswunsch für dein Glück läßt mich diese Frage tun. Du verstehst mich richtig, nicht wahr?«
»Wie könnte ich dich mißverstehen, Hans Heinrich! Nur, siehst du, – der König konnte so wenig sagen – wie hätte er's auch sollen, wenn wir doch niemals allein waren und vor den andern, da schweigt man über solche Dinge, nicht wahr? Aber aus dem, was zu sagen war, meine ich verstanden zu haben, daß – ach, Hans Heinrich, es hat mich so namenlos glücklich und dabei wieder so namenlos elend gemacht, weil doch alle Welt es für sicher annahm, daß er die Herzogin Xenia heiraten würde. Die Königin-Mutter hat ihre Nichte dazu erzogen, das ist ein offenes Geheimnis; Tante Sophie hat es mir selbst gesagt, daß die Königin von dem Augenblicke an, als sie die Prinzeß zu sich nahm, weil sie sich im Hause des Kaisers von Slavonien, ihres Vaters, bei ihrer Stiefmutter so unglücklich fühlte, Xenia zu ihrer Schwiegertochter erzog. Aber der König muß sie wohl doch nicht geliebt haben, sonst hätte er die Vermählung so lange nicht hinausgezogen, denn, Hans Heinrich, er ist älter als du und Xenia ist auch schon fünfundzwanzig Jahre alt. Wenn ich also trotz allen den so bestimmt auftretenden Gerüchten eine Hoffnung gegen alle Hoffnung hegte – so ganz, ganz tief und verborgen im Grunde meines Herzens – war das gar so unrecht und überhebend?«
»Sie hat dich nicht betrogen, diese Hoffnung, mein Schwesterlieb«, sagte der Fürst gerührt. »Nein, du hast recht zu glauben, daß nur eine reine Neigung der Beweggrund zu dieser unerwarteten Werbung des Königs sein kann. Ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, aber es will mir ein anderes Motiv nicht einfallen. Vielleicht schon deshalb, weil ich dieses für ganz gerechtfertigt halte. O, nicht nur aus blinder, brüderlicher Liebe, nein, sondern weil ich gerecht bin und – nun ja, – auch ein wenig stolz auf meine Schwester, für die mir eine Königskrone gerade eben nur gut genug erscheint. Ich denke dabei wirklich nicht an den Triumph unsres Hauses, trotzdem mir auch das nicht gleichgültig ist, wie ich offen bekenne. Blut bleibt nun einmal Blut, das merkt man erst, wenn's drauf ankommt. Aber es ist meine Pflicht, dich zu warnen, meine Goldne: du wirst keinen leichten Stand drüben haben. Die Königin-Mutter wird ihre getäuschten Hoffnungen nicht so leicht vergessen; daß sie für diese Hoffnungen den Kampf noch nicht aufgegeben hat, das beweist mir ihr Brief, den ich jetzt zu verstehen glaube – Nun, lassen wir das. Die Antwort darauf wird sie nicht gerade begeistern und darum möchte ich dich warnen, daß du keinen leichten Stand dieser Frau gegenüber haben wirst. Und auch wohl überhaupt nicht. Fühlst du dich solchen Kämpfen gewachsen?«
»Des Königs Liebe wird mich stärken und mich den rechten Weg führen. Und wie könnte ich an seiner Liebe noch Zweifel hegen?« erwiderte sie fest und mit strahlenden Augen.
Der Fürst unterdrückte einen leisen, ganz leisen Seufzer – warum ihm ein Zweifel kommen wollte, hätte er vielleicht selbst nicht sagen können. Vielleicht nur der unvermeidlichen Kämpfe wegen, denen dieses liebreizende junge Wesen ausgesetzt wurde, denen es mit dem seligen Vertrauen der alles bezwingenden Liebe entgegensah – – doch nur einen Moment zögerte er, dann beugte er sein Knie vor ihr und küßte ritterlich ihre Hand.
»So bin ich denn der erste der Ihrer Majestät huldigen darf«, sagte er mit großem Ernst, in den sich aber doch eine so gute Dosis brüderlicher Liebe mischte, daß Prinzeß Lily ihre Arme um seinen Hals schlang und den blonden Kopf auf seine Schultern legend ihr übervolles Herz durch Tränen der Rührung, des Glückes und der Wehmut über die Scheidestunde weinte, die ihren Schatten trotz allem und allem, unbewußt für sie selbst vielleicht noch, vorauswarf.
»Und nun genug für heut«, rief der Fürst aufspringend, als sie unter Tränen lächelnd, ihre Augen trocknete. »Es ist spät und kleine Mädchen sollten längst im Bett liegen und die Reise ausschlafen. Morgen ist auch noch ein Tag – da reden wir weiter, wenn der Herr Gesandte mit seiner Antwort wieder abgereist ist. Nur noch eins, denn ich lese eine Frage in deinen Augen, Goldne: Du willst wissen, warum ich dir erst zu so später Stunde die Werbung des Königs übermittelt habe, nicht wahr? Damit hat das Telegramm zu tun, das Graf Ingolstadt während des Diners erhielt, und der Toast, den er auf deine Schwester ausbrachte. Was die Verlobung Hedwigs damit zu tun hat, frägt dein Blick? Alles, Liebste. Denn siehst du, ich mußte sie dem Grafen mitteilen, weil ich nicht wissen konnte, ob diese Verschwägerung dem Könige genehm sein würde und – weil ich nicht willens war, das Glück deiner Schwester der glänzenderen Familienverbindung zu opfern. Sie hat dasselbe Recht an das Glück wie du, nicht wahr? Hätte also der König diese Verbindung beanstandet, so hätten wir auf die mit seinem Hause verzichten müssen. Müssen, Liebste, denn mein Wort war Fritz Burgpreppach verpfändet, und ich hätte nicht geduldet, daß er es mir zurückgab, selbst wenn deine Schwester Hedwig ihr Glück dem deinen hätte aufopfern wollen. Verstehst du das, Schwesterlieb?«
»Freilich verstehe ich's, denn ich bin ja auch eine Rothenburg«, erwiderte Prinzeß Lily ohne Zögern, indem sie ihrem Bruder frank und frei die Hand reichte. Aber sie war doch ein wenig blaß geworden. »Und der König –?« setzte sie fragend hinzu.
»Der König – oder vielmehr der Premierminister telegraphierte im Namen seines Herrn zurück, daß er kein Hindernis in der Verbindung der Prinzessin Hedwig für seine eigne Werbung sehe und diese aufrecht erhielte. Das Resultat dieses Telegrammes war dann der Toast auf das Brautpaar – im Allerhöchsten Auftrage, wohlverstanden.«
»Ich hätte es von Leo – ich meine, von dem Könige nicht anders erwartet«, sagte Prinzeß Lily mit einem reizenden, stolzen Lächeln.
* * *
Daß die Königin-Mutter von Seeland über die Nachricht von der Verlobung ihres Sohnes, des regierenden Königs, unglücklich oder zornig oder aufgebracht war, das zu sagen hätte ihre Stimmung nicht richtig geschildert: sie war einfach außer sich. Hoffnungen, die jahrelang Wurzel gefaßt haben, die mit einer Hartnäckigkeit und Zähigkeit sondergleichen gehegt, gepflegt und großgezogen worden sind, mit einem Schlage durchkreuzt, vernichtet und getötet zu sehen – das wird selbst für sanfte, geduldige, entsagungsfähige Naturen schwer zu ertragen sein und die Königin-Mutter besaß keine von diesen für das Leben so wertvollen Eigenschaften, oder sie ruhten doch zum mindesten unentwickelt in ihr.