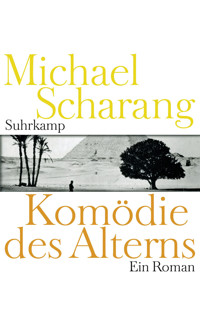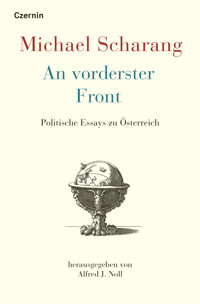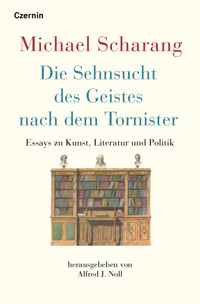19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Johann Wolfgang von Goethe bis Elfriede Jelinek, von Robert Musil bis Peter Turrini und von Karl Kraus bis Peter Handke: Michael Scharangs beste Essays zu Literatur, Literaturkritik und Politik. Oftmals kritisch, gelegentlich polemisch und zuweilen auch lobpreisend zeigt Scharang sein großes Vermögen, die jeweilige sprachliche Form in Zusammenhang mit dem jeweils vermittelten Inhalt zu stellen. Er macht zur Aufgabe der Literaturkritik, was dem heutigen Feuilleton kaum noch gelingt: die gesellschaftliche und politische Bedeutung der besprochenen Werke auszuloten. Schonungslos ehrlich konfrontiert er uns mit seinen Ansätzen und kritischen Betrachtungen und fordert uns heraus, Literatur aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten – Scharang kämpft gegen Kitsch, Erbauung, Profitgier und gegen die Marginalisierung der Literatur durch einen Literaturmarkt, auf dem diese längst schon ins Eck gedrängt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael Scharang
IM ANGESICHT DER BARBAREI
Essays zur Literatur
Herausgegeben von Alfred J. Noll
Michael Scharang
IM ANGESICHTDER BARBAREI
Essays zur Literatur
Herausgegeben von Alfred J. Noll
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Scharang, Michael: Im Angesicht der Barbarei. Essays zur Literatur Michael Scharang. Herausgegeben von Alfred J. Noll
Wien: Czernin Verlag 2024
ISBN: 978-3-7076-0849-6
© 2024 Czernin Verlags GmbH, Wien
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Coverabbildung: Louis Le Breton
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN Print: 978-3-7076-0849-6
ISBN E-Book: 978-3-7076-0850-2
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
INHALT
I.
Fünf Regeln für die Neuordnung des Schreibens
II.
Robert Musils theatralische Sendung
Ein romantischer Faust. Zu Nikolaus Lenau
Das Österreichische in der Kunst
Der räsonierende Kritiker. Zu Heimito von Doderer
Das grammatische Denken. Zu Albert Paris Gütersloh
Von allzu billigen Gemeinsamkeiten
Die und die andere Wirklichkeit. Zu Handkes »Hausierer«
Eine verpatzte »bessere Welt«
Wie man dem Gedicht das Lyrische austreibt
Wagenbachs Quarthefte
Kritik und Praxis im Angesicht der Barbarei. Zur »Dritten Walpurgisnacht« von Karl Kraus
Fichtes »Palette«. Modell literarischer Anpassung
Vergesellschaftung der Literatur
Das Nachstellen wird aufhören. Ein Vorwort
Herbert Brödls »fingerabdrücke«. Eine Kritik
Kowalski, denk ich mir, kann jeder sein. Über Peter Faeckes »Das unaufhaltsame Glück der Kowalskis«
Geschichten aus der Geschichte Österreichs. Vorbemerkung zu einem Sammelband
»du wundern mein schön deutsch sprach?« Zu Ernst Jandls dreibändiger Werkausgabe
Fürs Fernsehen schreiben? Dagegen!
Heilige Schriften. Über die Feierlichkeit in der Gegenwartsliteratur am Beispiel Handke
Von den letzten, den vorletzten und den vorvorletzten Dingen
Lebenselixier auf dem Misthaufen. Zu Elfriede Jelineks »Lust«
Die Dialektik des Dialekts. Zu Ernst Jandl
Witz der Vernunft. Rede anlässlich der Verleihung des Berliner Theaterpreises an Elfriede Jelinek im Theater »Berliner Ensemble«
Ein romantischer Realist. Zum 60. Geburtstag von Peter Turrini
Dort geht mein anderes Ich. Grabrede auf Milo Dor
Schund und Schaum. Kritik an Ronald Pohls Roman »Die algerische Verblendung«
Der Künstler des Denkens. Rudolf Burger zum 70. Geburtstag
Literatur als Erbauung. Wider Paulus Hochgatterer
Der Klassiker. Zum 70. Geburtstag von Peter Turrini
III.
Ein Freudentag
Nachwort des Herausgebers
Namensverzeichnis
Drucknachweise
Über den Autor und den Herausgeber
I.
FÜNF REGELN FÜR DIENEUORDNUNG DESSCHREIBENS
1.Schreiben Sie,wie es in Ihnen aussieht.
Wenn es nicht gut aussieht,
rufen Sie mich an,
ich habe einen Tipp:
So wie es aussieht,
kriegen wir das schon hin.
2.Schreiben Sie,wie es auf der Welt zugeht.
Kommen Sie mir nicht damit,
dass es nirgendwo so schlimm zugeht
wie bei Ihnen zu Haus.
Denn die Welt als ihr Zuhause zu beschreiben,
das schaffen wir auch noch.
3.Schreiben Sie,was die Borschoasie treibt.
Und vergessen Sie nicht:
Sie ist kein Fremdwort mehr.
Treiben Sie es aber nicht zu weit.
Sie ist, wenn auch zahlungsunwillig,
unser einziger Kunde.
4.Schreiben Sie,dass Sie mit der Kultur auf Tournee gehen.
Ich gehe jede Wette ein:
Das steht dann in der Zeitung.
Dass Sie bereichert zurückkommen,
steht allerdings in den Sternen.
Lesen werden Sie doch noch können.
5.Vor allem aber,schreiben Sie kritisch.
Müsste ich für Sie auch noch Kritik üben,
würden wir mit der Neuordnung des Schreibens nie
fertig.
Dann hätten Sie gar nicht schreiben müssen,
dass Sie kritisch schreiben.
Reißen Sie sich also zusammen.
(1992)
II.
ROBERT MUSILSTHEATRALISCHE SENDUNG
Musils dramatische Werke widersetzen sich ihrem eigenen Wollen nach der unmittelbaren Aufnahme. Ihrem Anspruch gemäß, »aufs Äußerste motiviert« zu sein, verlangen sie nach intensiver Beschäftigung. Ihre Qualität – und nicht Interesse an einer literarischen Pikanterie, bisher entlegen gebliebenen Schriften des durch ein Werk berühmt gewordenen Dichters unter dem Schutz dieses einen nachzuspüren – veranlasst diese Betrachtung.
»Die Schwärmer«, ein Schauspiel in drei Aufzügen, erschien 1921; dem gingen zwei Buchveröffentlichungen voran: 1906 der Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«, 1911 die zwei Erzählungen »Vereinigungen«. Um einen Überblick zu geben, seien die weiteren Veröffentlichungen genannt: 1923 die Posse »Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer«, 1924 die Erzählungen »Drei Frauen«, 1931 der erste Band des Romans »Der Mann ohne Eigenschaften«, 1933 der erste Teil des zweiten Bandes dieses Romans, 1936 die Prosasammlung »Nachlass zu Lebzeiten«. – Die einzelnen Werke entstanden in ihren Ansätzen nicht getrennt hintereinander, sondern in enger Berührung miteinander. Eine Ausnahme bietet Musils Erstling »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«, den er, gemessen an seiner weiteren Entwicklung, in einem relativ unproblematischen Stadium geschrieben hatte; die stoffliche Abgeschlossenheit bot auch zu keiner thematischen Wiederaufnahme Anlass. Die Arbeit daran begann Musil in den Jahren 1902/03, zu einer Zeit, als er noch an der Stuttgarter Technischen Hochschule als Volontärassistent wirkte. In der darauffolgenden Zeit seines Philosophiestudiums in Berlin wurde ihm das Schreiben zum Gegenstand der Reflexion. Er wehrte sich gegen die Ungeistigkeit stofflicher Realistik und gegen eine Darstellungsform, die dieser Ungenauigkeit entspricht. In den »Vereinigungen« tritt das Stoffliche, die Handlung zurück, und die Darstellung wird von geistigen Problemstellungen bestimmt. Da diese aber keine philosophisch-begriffliche Form annehmen durften, sondern nach stofflichem Gewand verlangten, bildeten sich schon früh zu den geistigen Motiven entsprechende stoffliche, die bei der Behandlung der gleichen Problemkreise immer wieder aufgenommen und variiert wurden. Setzt man den Hauptbeginn der Arbeit am »Mann ohne Eigenschaften« in die Jahre nach der Vollendung der beiden Theaterstücke, so kann die Arbeit bis dahin als Bemühung gesehen werden, jene Motive zu der Klarheit zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, das riesige Unternehmen des Romans zu tragen.
Der inhaltliche Ursprung der »Schwärmer« liegt in einem frühen, abgebrochenen Romankonzept (1908). Musil versuchte, aus einem Thema dieses Romans, der Rivalität Roberts und seines älteren Bruders in ihrer Liebe zu einer Schauspielerin, einige Szenen zu entwickeln, doch ist im Schauspiel dieser Anlass kaum mehr zu erkennen.
Die Posse »Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer«, Musils zweite und letzte dramatische Arbeit, ist wohl das einzige seiner Werke, dem keine Notizen in den Tagebüchern vorangehen. Unmittelbar nach den »Schwärmern« entstanden, bezieht sie ihre Intention von diesen, und zwar als ironisch-auflösende Reaktion auf die pathetische Durchführung der Themen im Schauspiel.
*
Die äußere Handlung der »Schwärmer« angeben hieße etwas präsentieren, was im Stück eigentlich nicht anzutreffen ist. Wenn frühere Dramatik die Möglichkeit zu einer Inhaltsangabe, wenn auch nicht anbot, so doch offenließ, lag das an ihrem Handlungsbegriff, der in Hegels Formulierung lautet: »Das dramatisch Wirkende nämlich ist die Handlung als Handlung und nicht die von dem bestimmten Zweck und dessen Durchführung unabhängigere Exposition des Charakters als solchen.«* In den »Schwärmern« soll die Exposition des Charakters (wobei der Begriff des Charakters ein anderer wird) das dramatisch Wirkende sein, d. h. der Exposition des Charakters wird die Aufgabe zur Handlung übertragen. Damit wird, was früher Handlung genannt wurde, zur Motivation einer Handlung, wobei diese nicht in den realen Vollzug umschlagen muss. Musils Handlungsgestalt ist die Entfaltung der Charaktere, das Medium ist nicht die Handlung, sondern der Gedanke; der Gedanke verhindert, dass die Person in Innerlichkeit zerfließt. Die Bewegung der unterschiedlichen Gedanken im dramatischen Ablauf erscheint als der Gehalt, der nun anders als in der Handlungsdramatik nicht über die Vermittlung der Handlung, sondern über die des Gedankens aufleuchtet. – Die Musil’sche Person besteht nicht aus Innerlichkeit, die sich in ausströmendem Subjektivismus äußert; vielmehr ist sie an den Gedanken gebunden, der in Form von Reflexionen und Vorstellungen sich gleicherweise auf die Innerlichkeit der Person wie auf deren äußere Situation bezieht. Im Begriff der Motivation ist sowohl die Relation der Person auf ihr Fürsichsein als auch ihre Relation zur Umwelt eingeschlossen. Dramatische Spannung entsteht dadurch, dass im Schauspiel eine Personengruppe in theoretischer Intention verharrt, um durch Bewusstwerden des wahren Verhältnisses zwischen sich und der Umwelt eine Haltung größtmöglicher Wirklichkeit zu erringen, während eine andere Gruppe – untereinander den verschiedensten Zwecken nachstrebend – die theoretische Intention missbraucht, um zu einem praktischen Vollzug zu gelangen, deren motivlicher Wert in der Zweckhaftigkeit des eigenen Gutdünkens zu suchen ist.
*
An den ersten Szenen soll exemplifiziert werden, wie sich die Exposition der Charaktere zu dem verhält, was als äußere Situation bezeichnet wurde. Regine beginnt den Dialog mit Frl. Mertens: »Sie sind also wirklich nicht abergläubisch? Sie glauben nicht an geheime persönliche Kräfte?« Frl. Mertens, ältliche cand. phil. mit einem »vom Horchen in den Sälen der Weisheit breit gewordenen Gesäß«, stellt eine Gegenfrage: »Wie denken Sie sich das eigentlich?« Regines Antwort »gar nicht« bildet bereits das Motiv, das ihre Verhaltensweise bestimmt. Es bleibt aber nicht bei der negativen Ausgrenzung des »gar nicht«: »Als Kind und noch als Mädchen hatte ich eine hässliche Stimme, sobald ich nur laut sprach; aber ich wusste, dass ich eines Tages alle Leute durch einen wunderbaren Gesang überraschen würde.« Regine versucht, jenes Unbestimmte auszudrücken, worum ihre Vorstellung kreist. Mertens’ abermalige Frage: »Und haben Sie dieses Organ bekommen?« lässt den Grundzug ihrer Verhaltensweise erkennen: Sie beharrt darauf, Regines irrationale Vorstellungen mit einer am Realen sich orientierenden Verständigkeit überprüfen zu wollen; damit ist ihre Haltung des Nichtverstehens, ihre Position im Schauspiel als Nebenfigur bestimmt. – Regine beantwortet die letzte Frage mit Nein: »Ich weiß nicht, was ich Ihnen antworten soll. Hatten Sie nie ein unerklärliches Gefühl von sich? So geheimnisvoll, dass man die Schuhe ausziehen muss und durch die Zimmer segeln wie eine Wolke? Frühe kam ich oft hierher, als noch Mama nebenan schlief.« Jetzt wird, scheinbar unvermittelt und ohne Zusammenhang mit dem Vorherigen, zum ersten Mal eine gegenständliche Sphäre berührt, indem Regine sich in eine, vorerst noch unklare, Beziehung zum Raum, zum Ort der Handlung setzt. – Es ist hier nicht möglich, an mehreren Beispielen zu zeigen, wie Musil allmählich den Raum außer durchs Bühnenbild auch durchs Wort entstehen lässt. Daher sei nur erwähnt, dass der Ort der Handlung ein außerhalb der Stadt gelegenes Landhaus ist, das Thomas und Maria, Regines Schwester, bewohnen. Wenn Regine auf den Ort der Handlung zu sprechen kommt, so geschieht dies aus der Bewegung ihrer Innerlichkeit heraus, und nicht, weil er hier für eine äußere Handlung irgend von Bedeutung wäre. Objektiv schlägt diese Innerlichkeit für einen Moment in Gegenständlichkeit um, die dramaturgisch für die Plastizität der Person notwendig ist.
Mertens stellt die Frage, wozu Regine früher hierhergekommen sei, doch diese antwortet nur »mit einer Schulterbewegung«, sie führt das Element der äußeren Gegenständlichkeit weiter zu einem der äußeren Handlung, indem sie nach Thomas ruft, der sich dort aufhält, wo Mama schon früher geschlafen hatte: »Thomas! … So komm doch schon! Der Brief von Josef ist da.« – Josef ist Regines zweiter Mann. Sie hat ihn verlassen und hat mit ihrem Begleiter Anselm, dem Jugendfreund Thomas’, in dessen Haus Zuflucht gesucht. Im Brief, von dem Regine spricht, kündigt Josef sein Kommen an, in der Absicht, Anselm als betrügerischen Entführer zu stellen und Regine wieder zu sich zu holen, um einen gesellschaftlichen Skandal zu vermeiden. Der Brief als dramatisches Requisit schafft die äußere, zeitlich gedrängte Situation; er ist im ersten Aufzug insofern das Element der äußeren Handlung, als er die betroffenen, im Haus anwesenden Personen zu raschen Entscheidungen zwingt. – Da Thomas auf sich warten lässt, kann Frl. Mertens auf die Anfangsthematik zurückkommen; sie fragt Regine, was sie »mit alldem beweisen« wolle. Mit »alldem« meint sie: »… wenn Sie sagen, dass Sie Ihren ersten Mann, der vor Jahren hier gestorben ist, zuweilen wiedersehen«. Das Gespräch, das sich zuerst im Allgemeinen bewegte, erhält nun einen realen Bezug. Regine verhält sich wie zuvor; sie will weder etwas beweisen noch etwas erklären: »Warum soll ich Johannes nicht sehen? … Ich habe eben Kräfte, die man nur hier hat! Das ist der Geist dieses Hauses: Auflehnung gegen das, was sonst aller Welt genügt!« Nun tritt Thomas auf, der Repräsentant dieses Geistes. – Durch die Erwähnung Johannes’ wird klar, warum Regine früher öfters »hierher« kam. Nun erscheint jene Stelle, die sich auf den Ort der Handlung bezieht, nicht mehr abrupt aus der inneren Bewegung gestellt. Welche Bedeutung dem Brief eingeräumt wird – abgesehen von der dramatischen Funktion und von dem Zweck, den sein Absender ihm gibt –, kann schon daraus ersehen werden, dass er als der Gegenstand, der Handlungen heraufzubeschwören scheint, sofort wieder aus dem Gespräch gedrängt wird. Es wird sich zeigen, dass er nur insofern Interesse wecken kann, als er zur Entfaltung der Charaktere und deren geistiger Bestimmung beiträgt; sein aggressives, handlungssüchtiges Moment wird von solcher Durchführung des Themas aufgehoben. – Die Wiedergabe dieser ersten Szene sollte das Verhältnis anschaulich machen, in dem die Exposition des Charakters oder, besser, des Bewusstseins zu den Momenten der äußeren Situation und Handlung steht. Das Gegenständliche sowie das auf Geschehen Drängende wird vom reflektierenden Bewusstsein absorbiert. Die Unterschiede und Gegensätze des Bewusstseins der Personen werden Gegenstand des Dramas.
*
Dem Begriff der Handlung als Handlung entspricht der des festen Charakters. Von Hegel noch als »tragisches Wollen« gedacht, verkommt er im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Rollencharge. Er zerfällt mit der Aufhebung des alten Handlungsbegriffs. Da Musils dramatisches Subjekt nicht mehr durch das belebt wird, was es tut, sondern durch das, was es denkt, schränkt er die Breite der Person ein auf die Reaktion ihres Bewusstseins, das möglichst über jeden Schritt gedankliche Rechenschaft abzulegen hat. Versuche, das Musil’sche Konzept der geistigen Person psychologisch zu interpretieren, können nur dahin gelangen, dass aus dieser Person wieder ein »Charakter« entsteht.
Wenn nun gezeigt werden soll, wie Musil eine solche Person zeichnet, wie der Bewusstseinsträger als gestische Bühnenfigur erscheint, dürfte dies vielleicht am interessantesten an einer Person auszuführen sein, die als ungeistiger Mensch sich einer Darstellungsweise zu unterwerfen hat, die das Geistige des Menschen vor Augen hat; an einer Person, die dazu noch Nebenfigur ist: Fräulein Mertens. Ihr undifferenziertes Bewusstsein hat in der Szene mit Regine die dramatische Funktion konstrastierenden, Bewegung erzeugenden Widerparts. Sie ist die Begleiterin Regines, steht ihr aber nicht freundschaftlich nah; sie begleitet eigentlich nicht die konkreten Personen Regine und Anselm, sie trägt vielmehr ein Wunschbild übersinnlicher Liebe in sich, das sie in Regine und Anselm verwirklicht sehen will. Ihre abstrakten Vorstellungen drängen zur Realisierung; sie – die Einzige, die sich an der äußeren Problematik, die durch Josefs Brief entsteht, entzündet – plant; Josef müsse man Verständnis abnötigen, Thomas sei zu fliehen, denn er »durchkältet alles mit seinen theoretischen Überlegungen«. In Illusionen befangen, sieht sie nicht ein, dass Regine sich Anselm entfremdet hat, weist sie Regines Worte von sich, dass Anselm Maria, Thomas’ Frau, liebe. Was ihre Naivität fürs Stück leistet, ist inhaltliche Information. Da sie die Problematik nicht sieht, muss sie als dramatische Person in den Hintergrund treten. Wenn sie gegen Schluss des Schauspiels die beiden Zurückbleibenden – Thomas und Regine – verlässt, scheidet sie, ohne die geringste innerliche Entwicklung durchgemacht zu haben, mit einem Missverständnis. Nachdem ihr Thomas den Kuss, den er Regine gab, gedeutet hat – »Das war eine Anti-Liebesszene. Das war eine Sozusagen-Verzweiflungsszene« –, verabschiedet sie sich: »Ich bin einer Illusion unterlegen. Denn auch ich habe einst meinen Geliebten verloren; aber ich habe ihm durch einundzwanzig Jahre reine Treue bewahrt bis heute.« Sie meint, durch andrer Schuld einer Illusion unterlegen zu sein, und hält damit ihre eigene Illusion aufrecht.
Mertens’ letzter Satz enthält das Motiv, warum sie sich Regine und Anselm angeschlossen hat, nämlich ihre Vorstellung, dass Regine in der geistigen Freundschaft mit Anselm ihrem verstorbenen Mann die Treue halte. Charakteristisch für die Musil’sche Figurenzeichnung ist, dass dieses Motiv erst am Ende ausgesprochen wird. Dadurch wird die Person nicht mehr motiviert, sondern lediglich ihre Haltung, die ohnehin immer lächerlich war, deutlich formuliert und damit dem gezielten Kommentar ausgesetzt. (Thomas: »Das Laster ist Schmutz. Aber die Tugend ist auch nur frisch genießbar!«) Verhielte es sich umgekehrt, nähme das Motiv das Aussehen von Großartigkeit an. So aber wird die »Festigkeit« in ihrer Billigkeit entlarvt. Diese der Handlungsdramatik entgegengesetzte Technik verhindert, dass die Person zur Schablone gerät.
Im Gespräch zwischen Regine und Thomas zu Beginn des ersten Aufzuges werden die Hauptmotive des Schauspiels entwickelt. Wenn Thomas sagt, Regine sei der einzige Mensch, mit dem er sprechen könne, ohne missverstanden zu werden, weist das bereits auf die Spannung zwischen ihm und den übrigen Personen. Doch besteht auch sein Verhältnis zu Regine nicht in unkritischer Übereinstimmung. Was die Geschichte mit Johannes anlangt, beginnt er nicht wie Fräulein Mertens ein Gespräch über das Undiskutierbare, sondern stellt sich Regine entgegen: »Du hast unrecht.« Sie sind zwar in ähnlicher Lage (»Ich habe jetzt auch immer unrecht. Aber je mehr man das fühlt, desto mehr übertreibt man«), innerhalb dieser Ähnlichkeit aber differenziert Thomas: Er hält an seiner »Lage« nicht starr fest, sondern er denkt darüber nach. Regine dagegen bezieht einen Gegenstandpunkt, der sich skurrilen Formen der Absonderung zu bestätigen sucht. Ähnlich in ihrer Konsequenz, es sich im Scheinleben der Standpunkte und »festen« Gefühle nicht einrichten zu wollen, leisten sie dem grundverschieden Widerstand; Regine flieht in extreme Realität einerseits – in zahlreiche Ehebrüche während ihrer Ehe mit Josef –, in ebensolche Irrealität anderseits: Im Laster sehnt sie sich nach asketischer Treue zum toten Johannes; Thomas setzt der Willkür den alles prüfenden Gedanken – motiviertes Leben – entgegen.
*
Wenn am Ende des Schauspiels sämtliche Bindungen zwischen den Personen zerfallen sind und Thomas und Regine allein zurückbleiben, kommt die Differenz ihrer Haltungen angesichts des Vakuums, das sich um sie gebildet hat, zum Ausbruch. Verzweiflung bemächtigt sich Regines, da sie sich, deren Haltung bis dahin Opposition gegen ihr Unerträgliches war, auf sich gestellt sieht: »Das Geheimnis: ich mitten zwischen alldem – ist zu Ende.« Sie will ihrem Leben ein Ende machen. Thomas ist bemüht, sie vom schwindelhaften Ausweg in die Realität (Rückkehr zu Josef) ebenso abzuhalten wie vom Selbstmord; auch will er, dass sie den trügerischen Schein ihres tragischen Entschlusses sieht: »Nichts behält in der Nähe die Leuchtkraft und bei liebloser Betrachtung …« Der unüberbrückbare Unterschied tritt über alldem, worin sie sich identisch fühlen, hervor, wenn Regine bekennt: »Für mich haben Gedanken wenig Reiz«, und Thomas darauf antworten muss: »Dagegen ist vielleicht wenig zu sagen … Aber dann kann ich dir nicht helfen.« Das Prinzip des motivierten Lebens gönnt dem Bewusstsein keinen Schwindel; Neigung wird nicht missbraucht, um dem Subjekt scheinhafte Erleichterung zu verschaffen. – Nennt Regine »lächelnd« Thomas einen »fühllosen Verstandesmenschen«, dann meint sie es nicht wie vorher Anselm und Josef als Vorwurf. Musil äußerte einmal, die Zeit kranke entgegen der Meinung beflissener Kultur-Retter nicht daran, dass sie zu viel Verstand und zu wenig Seele, sondern zu wenig Verstand in Angelegenheiten der Seele habe. In diesem Sinn wehrt Thomas sich gegen die Trennung von Verstand und Gefühl, die zur Folge hat, dass, wie bei Josef oder in erschütterend-komischer Weise beim Detektiv Stader, der Verstand nicht mehr Bewegung der Gedanken, sondern das Gegenteil ist: Mittel zur Installierung praktischer Grundsätze und Normen, während als Gefühl das hochgehalten wird, was als Seelenreaktion den Überdruss des Immergleichen der Praxis verziert. Dieses Gefühl nennt Thomas, wenn er über Anselm spricht, »prompt greifbar«; er selbst sei »lieber scheinbar gefühllos«. – Da Thomas weder in einer Linearität des Denkens noch einer des Fühlens befangen ist – Eigenschaften, die den »Bühnencharakter« auflösen –, kann er seiner Frau, die sich entschlossen hat, Anselm nachzureisen, auf ihre Frage: »Verzeihst du mir?« nur antworten: »Lass uns aufrichtig scheiden: ich habe gar nicht darüber nachgedacht.« Das »Nachdenken« ist im Sinn des »Verstandes in Angelegenheiten der Seele« gebraucht. Thomas, der sich vor der Phrase des Gefühls scheut, scheut sich damit vor der Phrase einer Theaterszene des Abschiednehmens. Marias Frage ist auf der Bühne wohl aberhundertmal gestellt worden; vielleicht wurde sie hier zum ersten Mal wahr beantwortet.
Thomas muss mitansehen, wie Maria Anselms Einfluss verfällt. Er weiß, dass Liebe nicht vom Einzelnen in theoretischer Intention erschaffen werden kann, er weiß aber auch, dass sie von der bloß praktischen Intention vernichtet wird. Sein Verhältnis zu Maria wird problematisch, als er sich fragen muss, worin die geistige Verbindung, worin die Frucht des Zusammenlebens denn bestehe, wenn Maria nun in Anselms »Honigfalle« kriecht. Er versucht ihr zu erklären: »Liebe ist das einzige, was es zwischen Mann und Frau überhaupt nicht gibt! Als einen eigenen Zustand. Das wirkliche Erlebnis ist einfach: Erwachen … Wir erwachen noch einmal und liegen im Rinnstein … Die Ekstase verraucht. Aber es wird das sein, was wir daraus machen.« Und er will ihr helfen, aus ihrer Subjektivität herauszutreten, indem er zeigt, dass Anselm nicht die zu erschließende Wirklichkeit zwischen Mann und Frau erstrebt, sondern den eingebildeten Rausch. Er setzt sein Prinzip der Leistung gegen Anselms ohnmächtige Selbstbetäubung: »Wenn man nichts leistet, so muss man geliebt werden, um bestätigt zu sein. Er stiehlt Liebe, … wenn er sie hat, weiß er nichts damit anzufangen.« Doch Maria scheint gerade diese Scheu vor der Arbeit des Verstandes, dieses blinde Anpressen ans andere Geschöpf wohlzutun, und sie verteidigt Anselm in dessen Tonfall: »Aber Anteil nimmt er. Und das kommt von innen wie eine Quelle.«
Nach dem Bruch zwischen Thomas und Anselm überrascht jener Maria, die sich anschickt, Anselm zu folgen, mit den Worten: »… Anselm und ich denken beide anders als du … Er war bloß zu schwach dazu, er hielt es nicht aus. Er drängt sich plötzlich zwischen die Menschen, die sich in dieser Welt zu Hause fühlen, und fängt an, in ihren Stücken mitzuspielen; in wunderbaren Rollen, die er für sich erfindet. Ich meine aber trotzdem, Anselm und ich können nie die Wahrheit vergessen.« Maria erkennt nicht, dass Anselm auch ihr gegenüber nur eine »Rolle« spielt, dass er sich in einen neuen Rausch stürzt, da er sein Erlebnis mit Regine – ebenfalls ein gespieltes – zerstieben sieht; sie ahnt nicht, dass er, wie Regine sagt, feig in die Realität fliehen muss, weil er es nicht »aushält«, weil er »zu schwach« ist. In Maria wird das naive Bewusstsein lebendig, das dem Betrug widerstandslos ausgeliefert ist. Als idealistisches Gemüt nimmt sie, was an Anselms Worten Klang hat, als das Sein auf, in dem sie das Glück zu finden hofft, das sie bei Thomas – »er spendet mehr Ruhe und Wärme als du« – nicht fand.
Das Falsche zu erzeugen, um es für einen Zweck einzusetzen, setzt jenes differenzierte Bewusstsein voraus, das Thomas dem Marias gegenüberstellt. Thomas verteidigt Anselm auch vor Josef, dem Tatsachengläubigen, der Anselm mit Hilfe von Beweismaterial, das er von einem Detektiv zusammentragen ließ, vernichten will, dabei aber sich selbst blamiert, da Regine, die er über Anselm aufzuklären trachtet, ohnehin alles weiß. Unerbittlich gegen Anselm ist Thomas, wenn er ihm selbst gegenübersteht. Zuerst hofft er, Anselm durch Erinnerung an ihr gemeinsames früheres Streben vom seelischen Betrug abzubringen: »Als wir jung waren, wussten wir, dass das, was wirklich geschieht, ganz unwichtig ist neben dem, was geschehen könnte. Dass der ganze Fortschritt der Menschheit in dem steckt, was nicht geschieht. Sondern gedacht wird …«
Anselm jedoch flieht die Ebene des Gedankens, denn es geht ihm gar nicht darum, Thomas gegenüber recht oder unrecht zu haben, er will durch den Kontrast bloßen Andersseins Maria in seinen Bann ziehen. Ihr Sehnen nach billiger Unbestimmtheit erhebt er zu seinem Programm: »Was diesen Gedanken fehlt, ist nichts als das bisschen Demut der Erkenntnis, dass schließlich doch alle Gedanken falsch sind und dass sie deshalb geglaubt werden müssen; von warmen Menschen!« Dieser Bescheidenheit des Standpunkts – »Demut, das ist der Letzte sein wollen, das ist, der Erste von hinten!« – steht Thomas ohnmächtig gegenüber, umso mehr, als Anselm eine weitere Konfrontation meidet,
*
Analog dem Ausspruch Thomas’ über den Fortschritt der Menschheit wird das Schauspiel nicht davon bestimmt, was geschieht, sondern davon, was gedacht wird. Deshalb liegt ihm nichts an einem Resultat, an einer Lösung im Sinn des herkömmlichen, schicksalhaften Zu-Ende-Kommens. Musil hütet sich vor dem »so ist es«, da er weiß, dass die Form des einfachen Satzes eine für die Wahrheit untaugliche Form ist, dass die Wahrheit sich durch den Widerspruch hindurchbewegender Sätze bedarf.
Wo der Affekt zur Handlung verleitet, verfällt sie der Parodie. Thomas trifft im dunklen Zimmer auf Anselm und Maria und will jenen unter Androhung des Erschießens zu einer Stellungsnahme zwingen; als Maria das Licht andreht, zeigt sich, dass sich Anselm aus dem Staub gemacht hat, dass Thomas keine Pistole in der Hand hält. Handlung erscheint als empirisches Experiment, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. – Wenn Anselm einen Selbstmord vortäuscht, als Maria ihn zu verlassen droht, ist dies, abgesehen von der Fiktion der Handlung, vorweg überflüssig, da Maria, die seine geistige Haltung nicht durchschaut, ihm ohnehin verfallen ist. – Musil ersetzt also die gebräuchlichen formalen Konventionen nicht etwa durch ungebräuchliche, sondern die Konvention wird überwunden durch die konsequente Darstellung des Gegenstandes: des geistigen Menschen beziehungsweise des Geistigen im Menschen. Die theatralische Wirkung des Schauspiels besteht darin, dass die Abgegriffenheit solcher Wirkung einerseits bewusst verwendet wird und anderseits dort darauf verzichtet wird, wo sie mit Hilfe einer inhaltlichen Schablone erkauft werden müsste. Die stoffliche Konstellation des Schauspiels enträt bewusst jener Neuheit, mit der man meistens dann spekuliert, wenn das Familienblattniveau – Musil bediente sich gern dieses Ausdrucks – sich in neuen Gewändern zu verkaufen trachtet. Musils Schauspiel zeigt, wie ein neues Drama entstehen kann, wenn »Inhalte« auf ihren Inhalt überprüft werden.
(1965)
*Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, hrsg. v. F. Bassenge, mit einem einführenden Essay v. G. Lukács, Berlin 1955, S. 1056.
EIN ROMANTISCHER FAUSTZu Nikolaus Lenau
Noch zu Lebzeiten Goethes verfasste Lenau [1802–1850] den Plan zu einer »Faust«-Dichtung. Erste Szenen entstanden vor und während seiner Amerikareise (1832/33), die den Dichter sehr enttäuschte. In bitteren Berichten machte er Land und Bewohner dafür verantwortlich, ließ aber außer Acht, den Grund der Enttäuschung auch in der eigenen hochgespannten Erwartung zu suchen, deren Sehnen ins Unbestimmte gerichtet war, wie es das seines Faust ist. 1836 veröffentlichte er das Werk, 1840 arbeitete er es zur endgültigen Fassung um: Angeregt von der Kritik, vervollkommnete er die von breiten epischen Stellen durchsetzte Dichtung hinsichtlich der dramatischen Motivierung.
Goethes »Faust« hat auf den Lenaus höchstens den Einfluss, zur Beschäftigung mit dem Stoff geführt zu haben; gemein hat er mit ihm nur äußere Anknüpfungen an die Volkssage. Ein Vergleich wird sich auf die Differenzen im künstlerischen und geschichtlichen Bewusstsein zu erstrecken haben. – In Lenaus Schaffen nimmt der »Faust« insbesondere hinsichtlich des ausgesprochenen Gehalts eine vorzügliche Stellung ein, die man angesichts seiner oft nur eines vagen Stimmungswerts wegen geschätzten Lyrik nicht wahrhaben will. Wo man es mit dem Ausweichen nicht bewenden lässt, fühlt man sich häufig bemüßigt, den »Faust« als biographisches Material zu missbrauchen; als solches, steht schon in frühen zusammenfassenden Arbeiten über Lenau zu lesen, vermöge »Faust« in erster Linie zu interessieren. Diese plumpe Auffassung hat ihren Grund in der verbreiteten geisteswissenschaftlichen Angewohnheit, dort von Subjektivismus zu sprechen, wo man eine Parallele vom unmittelbaren Denken des Künstlers zu seinem Werk in simpel biographischer Weise angeben zu können glaubt, ohne zu beachten, dass jenes angeblich Persönliche kraft der Negation durch die Form aufgehoben wird; es ist ein Unfug, Subjektives und Biographisches synonym zu setzen.
Die Periode des »Faust« war Lenaus freieste und kritischste. Der geistigen Unsicherheit, die ihr eignet und um die Lenau wusste, versuchte er nicht durch methodisches Überwinden seines augenblicklichen Standpunkts eine gewisse Orientierung zu verschaffen, sondern wollte ihr entgehen, indem er sich einem anderen, vorgegebenen Standpunkt ebenso hoffnungsfroh wie blind und äußerlich anvertraute. Sein intellektuelles Gewissen rief ihn zwar von solchem Weg stets zurück, fand dann aber das eigene Besinnungsvermögen zerrüttet vor. Die erste derartige Eskapade führte Lenau dem Christentum zu; »Savonarola« ist das typische Werk aus dieser Zeit. [Hans Lassen] Martensen [1808–1884], ein dänischer Theologe, war an dieser nicht lange vorhaltenden Bekehrung nicht unwesentlich beteiligt. Nach der Lektüre des »Faust« suchte er den Dichter in Wien auf und deutete ihm sein Werk in kurios-eigentümlicher Weise: Faustens Zugrundegehen wegen seiner Verbindung mit dem Bösen werde der Idee des Christentums gerecht, zum Unterschied von Goethe, der es in seinem »Faust« beim Humanitätsideal habe bewenden lassen.
Lenaus Hinwendung zu [Georg Wilhelm Friedrich] Hegel [1770–1831] vollzog sich zu einem guten Teil unter dem Druck der jungdeutschen Kritik. Nachdem er der Hegel’schen Philosophie lange ohne Neigung gegenübergestanden war, nahm er sie nun über die Vermittlung jener Modernitäts- und Fortschrittsvorstellungen auf, die die Jungdeutschen von Hegel abstrahierten. Auf diese Weise näherte er sich den poetischen Pragmatikern, mit denen er jedoch in der Kunsttheorie weiterhin nichts gemein haben wollte. Nach den »Albigensern« [1842], dem Hauptwerk dieser Periode, löste sich diese Anklammerung; im »Don Juan« [1844] findet sich das Programmatische in freierer dramatischer Gestalt aufgehoben.
Konstruktion und Wirklichkeit eines Zweifels
Insbesondere im zweiten Teil von Goethes »Faust« ist die Affinität zu Hegel augenfällig, wobei hier nicht so sehr an gedanklich Ausgesprochenes als an den Gehalt in seinem dramatischen Vollzug gedacht wird. Die Dialektik von Verstand und Vernunft, von absoluter Idee und existierendem Begriff wird lebendig als Vermittlungsganzes, aus dem Faust die Kraft schöpft, die Negation seines jeweiligen Zustands zu überwinden, indem er, ein unter Schmerzen Wachsender, sie als Moment seiner selbst in sich aufnimmt. In der Differenz, zu sein, was er war, als auch zu sein, was er werde, erstreitet er sich durch Handlung seine Wirklichkeit; Denken und Wollen werden aneinander konkret. Durch diese Einheit von Theorie und Praxis in der Handlung, durch das hiemit bestimmte Moment der Geschichtlichkeit hat Faust den Mephistopheles zu seinem Widersacher, der verdammt ist, jenes Moments zu entraten, der seiner abstrakten, weil einseitigen Überlegenheit wegen unterliegen muss. Der geschichtslose Teufel steht nicht in der Differenz von Erkennen und Handeln, beide kennt er nur isoliert. In seiner theoretischen Intention ist er verwiesen auf den Standpunkt des Verstandes: Gleich dem Statistiker erklügelt er auf Grund dessen, was eben ist, Zukünftiges, um Faust um seine Erfüllung zu bringen; von diesem Standpunkt aus hat Faust die Wette verloren. Zum selben Zweck will seine praktische Intention zu einem Nur-Handeln verleiten, das, nach den Worten des jungen Hegel, das Objekt, auf das es gerichtet ist, vernichtet.
Die Zuversicht auf Verwirklichung des Vernünftigen gehört zum Geist der deutschen Klassik, der, wo er nicht im Nachvollzug der Werke verspürt wird, selbst zur leeren Affirmation einer unvernünftigen Realität wird. Hegels Satz vom Wirklichen, das vernünftig sei, vom Vernünftigen, das wirklich sei – ein beliebter Tummelplatz für Ignoranten, deren lineares Denken sich hier aufbläht –, trägt die Spannung von bloß Daseiendem und Wirklichem, von bloß Verständigem und Vernünftigem in ähnlicher Weise in sich, wie Faust und Mephistopheles sie verkörpern.
Dieser geistigen Welt zeigt sich die des um zwei Generationen jüngeren Lenau tief entfremdet. Der Abgrund wird sofort ersichtlich aus der unterschiedlichen Auffassung des gleichen, die Helden ursprünglich bewegenden Motivs: des Zweifels. Das Wesen des Zweifels bei Goethes Faust ist Streben: Werden, Vervollkommnung und Erfüllung; das des Lenau’schen ist Verzweiflung: Auflösung und Selbstvernichtung. Gewiss ist dem Goethe’schen Faust Verzweiflung nicht fremd, er verfällt ihr zu Beginn der Tragödie sogar vollends. Sie ist hier charakterisiert von der Maßlosigkeit des Erkenntnisdranges, die ihre Wurzeln in der Abstraktheit des zu Erkennenden hat: Alles möge sich auftun, ohne dass er sagen könnte, worin dieses Alles bestehe, denn es ist nur etwas Utopisches. An der in dieser Verzweiflung liegenden Schwäche bricht Faust zusammen; dass er sie bis zum Zusammenbruch getrieben hat, macht ihn erstarken. Die Grenze, die der Maßlosigkeit gesetzt wird, lässt ihn zu sich selbst kommen, zugleich aber hat er mit seiner Errettung eine neue Grenze in Gestalt der mephistophelischen Verständigkeit in Kauf zu nehmen, die es als Beschränkung, aber auch als eigene Beschränktheit zu überwinden gilt.
Lenaus Faust verharrt in Verzweiflung. Er bricht zwar ebenfalls unter ihr zusammen, jedoch erst am Ende seines Schicksalsweges; verschüttet von ihr, bleibt ihm nur die Konsequenz, sich zu vernichten. Zu Beginn des Dramas bringt ihn kein Verzweiflungshöhepunkt mit Mephistopheles in Verbindung, sondern ein von diesem bereits erwarteter Zufall. Als Faust, das Gebirge als Himmelsstürmer erklimmend, sich »der Geistesnacht entraffen« will,
Da plötzlich wankt und weicht von seinem Tritt
Ein Stein und reißt ihn jach zum Abgrund mit;
Doch fasst ihn rettend eine starke Hand
Und stellt ihn ruhig auf den Felsenrand …
(Der Morgengang)
Fausts Verzweiflung findet sich hier noch eins mit einem aus ihr geborenen, sie übertrumpfenden Selbstbewusstsein, welches hier, blind sich aufschwingend, das Maßlose ausmacht. Nicht an sich verzweifelt Faust; der Teufel rettet ihn, um ihn erst dahin zu bringen. Dass er potentiell schon am Ende ist, fühlt Faust jedoch stets, weshalb er seinem Widersacher für die Rettung nie Dank weiß.
Manisch wirkt Faust in der abstrakten Ausschlachtung des Zweifel-Motives:
Warum doch muss in meiner Seele brennen
Die unlöschbare Sehnsucht nach Erkennen!
Nichts ist die Wissenschaft; doch wo ist Rettung
Aus meiner Zweifel peinlicher Verkettung?
(Der Besuch)
Dass die Wissenschaft nichts sei, bezieht sich auf die Szene im anatomischen Theater, doch meint Faust, wenn er von Wissenschaft spricht, gewiss nicht nur die empirische, die er seinem Freund Famulus Wagner gegenüber schon zur Genüge ironisiert hat. Mit der Attacke gegen Wissenschaft schlechthin, die dem Erkenntnisbedürftigen nicht gerecht werden könne, manövriert Lenau seinen Faust in eine aussichtslose Situation, aussichtslos vor allem auch in geschichtlicher Hinsicht. Hegels Polemik richtet sich zwar ebenfalls gegen die Einzelwissenschaften, die sich aus Eigenem methodisch nicht fundieren können, er gibt aber dem Erkennen eine Wissenschaft, indem er es selbst zu einer solchen erschafft, die wiederum alle Gegenstände des Erkennens in sich begreift. Lenaus Polemik setzt Wissenschaft und Erkennen einander ausschließend gegenüber, sodass der Begriff von Erkennen selbst aufgehoben erscheint. Das ist er in der Person des Faust nun tatsächlich, ohne dass Lenau es sich bewusst eingestünde: Bloßes Beteuern der Erkenntnissehnsucht bringt diese in den berechtigten Verdacht, inhaltsleer zu sein. Vielleicht hatte [Karl Ferdinand] Gutzkow [1811–1878] die oben beschriebene Stelle besonders im Auge, wenn er in einer Kritik schreibt, Lenaus Faust sei nur deshalb verzweifelt, weil er nichts gelernt habe und nichts wisse. Bedenkt man diesen Vorwurf näher, wird man die Schwierigkeit zu ermessen haben, in dieser geschichtlichen Situation überhaupt eine »Faust«-Tragödie zu schreiben. Käme der Dichter Gutzkows Forderung nach, hätte Faust einen dozierenden Junghegelianer abzugeben, der sich in pragmatischen Vorschlägen erginge. Damit aber wäre er als dramatische Person untauglich und erwiese sich seiner Idee nach als säkularisiert. Man kann annehmen, dass diese Überlegungen unbewusst in der Selbstauslöschung Faustens mitvollzogen sind.
Indes lässt sich Fausts Motiv nicht auf den konstruierten Zweifel am Wissenschaftlichen reduzieren, der als inhaltsleerer dramatisch nichts bewirken könnte als das sofortige Ende des Anfangs. Konkreter wird sein Zweifel, wenn auch in einigermaßen erzwungener Gestalt, im Bereich des religiösen Glaubens. Ein derart im beschränkten Kreis des einzelnen Individuums ausgetragenes Gottzweiflertum, wie Lenau es im »Faust« gestaltet, kannte weder die zeitgenössische noch die Literatur vor ihm. Bei den Jungdeutschen, die das vor ihnen philosophisch Erarbeitete zu einer aufklärerischen Form verkleinerten, erschien religiöser Zweifel vornehmlich in gesellschaftskritischen Zusammenhängen, die Dichtung der Klassik hingegen zeigte sich, in der Hoffnung, das allgemeine Bewusstsein werde ihr folgen, dieser Problematik entwachsen. Hegel, angefeindet vom romantischen Katholizismus, begreift Gott als absolute Vernunft, Glauben als wissenden Glauben. Erscheint so das unmittelbare, die religiöse Gemeinschaft verbindende Gefühl aufgehoben, versucht Hegel es dennoch zu retten – Gott entglitte ansonsten ins Abstrakte –, indem er es als Gesinnung fasst. Es ist fraglich, ob Religiosität in dieser Form eines gesellschaftlichen Regulativs im Rahmen des Staates noch dem christlichen Vorstellungsgehalt entspricht.
Erstes Stadium des Zweifels ist Faustens Lossagung von der christlichen Gemeinde. Dieses Moment ist wichtig: Faust geht von einem bestimmten, im Allgemeinen verwurzelten Religionsbewusstsein aus und beginnt nicht mit einem subjektiven Kampf zwischen sich und Gott, welcher im nur subjektiven Verhältnis ein ebensolches Abstraktum wäre wie in einem nur objektiven. Faust verlässt jene Gemeinschaft, da sie seinem Bewusstsein nicht gerecht wird, und spottet ihrer, als ein Mönch Bekehrungsversuche anstellt. Er fühlt auf diesem Weg: »Des Glaubens letzter Faden reißt« (Morgengang). Er flieht die Welt, der er verhaftet war, doch erstellt er sich keine wirklichere durch jenes von ihm pathetisch apostrophierte Erkennen, sondern schafft sich einen Gott als seinen persönlichen Feind.
Gott als das Unwahre
Den Herrn nicht lieben, wäre schwer;
Doch liebt mein Herz die Wahrheit mehr.
(Die Verschreibung)
Wenn Gott der Wahrheit entgegensteht, ist entweder diese Wahrheit nicht wahr – sie wäre dann nicht identisch mit der Vernunft – oder Gott stimmt nicht mit seinem Begriff überein – er wäre eine endliche Vorstellung. Selbst wenn man dies mitdenkt, damit sich Fausts Satz nicht als Tautologie erweist, macht er den Endruck eines Gedankenmodells, das sich selbst an der Nase herumführt. Doch er ist nicht nur Gedankenmodell; er hat, um überhaupt ausgesprochen werden zu können, jene Trennung zur Voraussetzung, der zufolge Gott nicht das Ganze, die Wahrheit eingeschlossen, sondern nur ein Teil ist, die Kirche. Fausts Schicksal bestimmender Ausspruch ist getragen von geschichtlicher Erfahrung: Der Klerus, wie selbstverständlich devalviert von der Idee der Freiheit und Vernunft, rüstet sich im Biedermeier zur Verteidigung seines Ungeists und betreibt ein System weltlich-geistiger Korruption, von dem sich die betroffenen Regionen heute noch nicht erholen wollen. Der gesellschaftlichen Realität soll die Möglichkeit verringert werden, dem Gedanken nachzuhinken, darob dieser in Verlassenheit gerät und sich selbst bezweifelt.
Für das dramatische Fortschreiten wird Fausts Wahrheitsbegriff bestimmend, der auch ein Licht auf sein Wesen wirft.
In meinem Innern ist ein Heer von Kräften,
Unheimlich eigenmächtig, rastlos heiß,
Entbrannt zu tief geheimnisvoll’n Geschäften,
Von welchen all’ mein Geist nichts will und weiß …
So bin ich auch mir selbst hinausgesperrt,
Und stets geneckt von Zweifeln und gezerrt, …
(Der Besuch)
Wie seine Vorstellung von Wahrheit, ist auch Fausts Wesen in sich gespalten. Das, von dem sein Geist nichts weiß, entspricht der Unbestimmtheit seiner Sehnsucht. Er kann davon nichts wissen, da der Inhalt des Unbestimmten eben unbestimmt ist; es hat den Charakter eines unerschließbaren Dings an sich. Auch ist das in Fausts Welt ins Extreme auseinandergetriebene Subjektive und Objektive dem Kant’schen Affektionsschema nicht unähnlich. Karl Siegels These, Lenaus »Faust« sei eine Polemik gegen den subjektiven Idealismus Kants [1724–1804], mag auf einzelne Stellen zutreffen, gewiss nicht auf das Ganze. Ein zum Zweck der Polemik distanzierter Faust wäre ein Hohn auf seine eigene Qual, ohne die er wiederum nichts als ein Diskussionspartner des Mephistopheles wäre.
Faust weiß sich aus sich »hinausgesperrt«, er ist sich selbst fremder Gegenstand. Nun erringt er sich nicht durch Handeln eine Konkretion des Inneren durch das ihm Äußere und umgekehrt, sondern er fixiert die Entfremdung, er sperrt sich ein. Des Teufels Ziel ist es, das Wuchern des subjektivistischen Prinzips ins Schrankenlose zu fördern. Er, der es besser weiß, gibt Faust einen Fingerzeig, der ihm Trost verschaffen soll:
Dein Schöpfer ist dein Feind, gesteh’ dir’s keck,
Weil grausam er in diese Nacht dich schuf, …
(Der Besuch)
Unter dem Aspekt des vom Teufel gewollten Subjektivismus wird die Anlage der Faust’schen Erkenntnis- und Glaubensproblematik verständlicher. Die erwähnte Schwäche des Wahrheitsbegriffs wirkt sich nun auch auf das Verhältnis zwischen Faust und Mephistopheles aus. Inhaltsleer ist die Forderung nach Wahrheit, die er an den Teufel stellt, weshalb ihr Pakt es nicht zur dramatischen Gestalt einer Wette, sondern nur zu der eines formalen Vertrags bringt. Der Teufel ließe es sogar beim Ratschlag bewenden:
Das beste Mittel wäre fast,
Du hängtest dich an einen Ast; …
(Die Verschreibung)
wäre er nicht dazu verurteilt, seines Selbstbewusstseins wegen auf dem Opfer zu bestehen. Auch er motiviert sich, verglichen mit der Goethe’schen Figur, die von einer Wette getrieben wird – Symbol der Dialektik von einander Ausschließendem und zugleich Bedingendem –, reichlich abstrakt:
So wird mein Schmerz am Göttlichen sich rächen,
So will Verstoßner ich mein Leiden kühlen.
Verderbend mich als Gegenschöpfer fühlen.
(Der Teufel)
Dieses Programm auszuführen, gelingt ihm, denn er ist, gleichviel in welcher Weise, schöpferischer als Faust. Die Beziehung zwischen beiden nimmt eine eigentümliche Form an: Fausts Wollen, soweit es sich verwirklicht, ähnelt dem des Teufels; Faust als antagonistische Person ist dadurch weitgehend aufgesogen. Unterschieden sind sie voneinander darin, dass Mephistopheles das Ziel jenes Wollens angibt und kennt, während Faust, wiewohl er sich von den einzelnen Ergebnissen seiner Handlungen schaudernd abwendet, der Illusion nachhängt, seine rasende Innerlichkeit würde letztlich doch noch einen göttlichen Faust gebären. – Das Programm des Teufels sieht nicht nur Fausts Trennung von Gott, sondern auch von der Natur vor:
Ist mir der Bruch gelungen zwischen beiden
Von jeder Friedensmacht ihn abzuschneiden,
Dann setzt er sich mit seinem Ich allein,