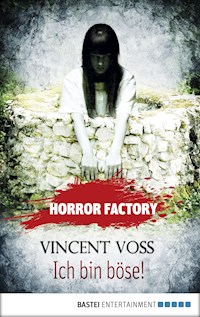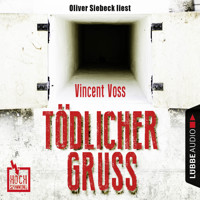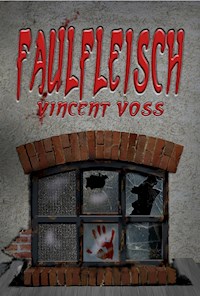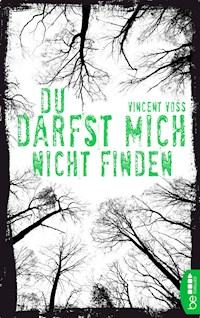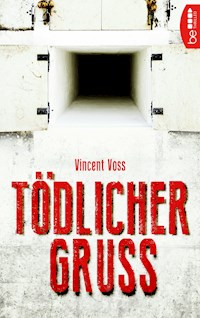Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Torsten Low
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Amelie Fischer ist Professorin am Institut für Ethnologie in Hamburg und weiß alles über die dritte deutsche Polarexpedition 1878 zum Nordpol. Das denkt sie jedenfalls, bis ihr ein Dachbodenfund in die Hände gespielt wird. Nicht die Entdeckung einer eisfreien Passage, nicht die Erforschung des ewigen Eises war das eigentliche Ziel, sondern ein Schiff namens »Sirene« sicher ins Eis zu geleiten. Je mehr sie herausfindet, umso geheimnisvoller erscheint die Expedition in der Nachbetrachtung. Und als sie beschließt, selbst eine Gruppe von Wissenschaftlern in den Nord-Osten Grönlands zu führen, um die Sirene zu bergen, bringt sie ihr Leben in Gefahr … »Im Eis« ist die deutsche Antwort auf Dan Simmons' »Terror«: dunkel, spannend und atmosphärisch dicht. Nicht ausgeschlossen, dass dem Leser heiß UND eiskalt wird. Creepy Creatures Reviews Vincent Voss spielt auf der Klaviatur des Horrors wie kaum ein Zweiter. Selbst Alltägliches mutiert bei ihm zu einer Allegorie des Grauens. Meisterhaft! Thomas Finn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Im Eis
Nachwort
Danksagung
Glossar
Besuchen Sie uns im Internet
www.verlag-torsten-low.de
Der Verlag Torsten Low ist Fördermitglied bei
PAN – dem Autorennetzwerk.
Mehr Informationen finden Sie hier:
www.phantastik-autoren.net
© 2021 by Verlag Torsten Low,
Rössle-Ring 22, 86405 Meitingen/Erlingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch
teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages
wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung, Karte & Seitenhintergründe:
Timo Kümmel
Lektorat: L. Rautenberger
Korrektorat: T. Low
eBook-Produktion:
M. Berchtold, T. Low
ISBN (Buch): 978-3-96629-018-0
ISBN (mobi): 978-3-96629-312-9
ISBN (ePub): 978-3-96629-313-6
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe sehr, Sie haben es warm und kuschelig. Denn, wenn Sie mir ins Eis folgen, wird es ungemütlich kalt und sehr wahrscheinlich auch gruselig werden. Doch bevor Sie gleich die Kälte quält und das Grauen packt, möchte ich ein paar Worte zur Entstehung dieses Romans verlieren. Die Idee und das Setting begleiten mich nämlich schon mehr als zwei Jahrzehnte. Für mein Ethnologiestudium legte ich mir das Buch »Franz Boas Bei den Inuit in Baffinland 1883-1884; Tagebücher und Briefe« für sagenhafte 70 DM zu, ein Betrag, von dem ich damals mindestens einen halben Monat überleben konnte. Die Expeditionstagebücher aus dieser Zeit waren spannend zu lesen und gebaren in mir eine Rollenspielkampagne, die ich mir für meine Shadowrun-Gruppe (Hoi, Chummers!) ersann. Dabei ging es um die Franklin-Expedition und die Bergung der beiden damaligen Schiffe Terror und Erebus.
Immer wieder schlich ich seither um diese Tagebücher herum, bereit, mich sofort auf eine vorbeilaufende Idee zu stürzen. Und wie es mit besonderen Ideen so ist, stürzen die guten selten auf einen herein, sondern sie wachsen und gedeihen. Im Februar 2019 begann ich zaghaft die ersten von ihnen dazu niederzuschreiben und bis Oktober 2021 arbeitete ich daran. Im Eis, liebe Leser, ist mein längster Roman und auch der, an dem ich am intensivsten gearbeitet habe. Ich habe aufwendig recherchiert, mit Testlesenden zusammengearbeitet, mit Menschen, die von Seefahrt etwas verstehen, mit Menschen, die im Literaturbetrieb arbeiten, mit meiner Lektorin Lilly um jedes Satzzeichen gerungen, mich von meinem Illustrator Timo begeistern lassen, ja und sogar mein großer Sohn musste das Werk lesen. Sie glauben vielleicht, dass das jetzt möglicherweise eine Art Danksagung wird und ja, da haben Sie Recht. Denn oft war die Arbeit an dem Roman auch für mich quälend, ich litt mit allen Figuren unendlich mit und warum? Wofür? Für Sie, liebe Leser! Ich schreibe so unglaublich gerne, weil es Sie gibt und weil Sie mir nun schon seit fast einem Jahrzehnt die Treue halten.
Ahoi, stechen wir also in See und erleben ein weiteres, gemeinsames Abenteuer!
Oktober 2021, Wakendorf II
Im Eis
Vincent Voss
***
Prolog
Der Wind von dort, wo die Sonne aufging, drückte das Holz an die Küste. Holz und das andere bunte Zeug, das so komisch roch, wenn man es verbrannte, und das immer mehr wurde.
»Bruderherz«, machte sie ihn auf ihren Fund aufmerksam, aber Wilhelm würde es noch nicht sehen können. Das wusste sie. Und sie konnte es nicht mit ihren Händen greifen, denn ihre Arme waren kürzer als die von Wilhelm. Aber länger als die von Maximilian. Sie lachte und hüpfte dabei auf. Wie komisch das doch war. Sie und Wilhelm. Sofort stellte sie das Hüpfen ein und sah sich um, sah an sich hinab. Nicht, dass ihr Kleid noch schmutzig wurde. Das mochte der Mann nicht, da doch heute ein Festtag war. Sie zog den Speichel hoch, der ihr aus dem Mund troff und schubste Wilhelm näher an das Wasser heran. Wilhelm stolperte, schrie so, wie der graue Vogel immer schrie, wenn es wärmer wurde, ruderte mit den Armen, als wolle er sogar wie der graue Vogel fliegen. Sie lachte wieder. Wilhelm fing sich, wollte einen Stein nach ihr werfen, aber er hatte die Orientierung verloren und warf ihn ins Wasser. Der Stein traf das Holz und erzeugte ein Geräusch, das Wilhelm aufhorchen ließ. »Pfiu … chrrr!«, sagte er. »Ja«, antwortete sie und hüpfte. Wilhelm hatte verstanden. Wenn sie das Holz und das komische Zeug ins Dorf bringen würden, um damit ein Feuer zu machen, würde der Mann sie lieb haben, wie Gott sie lieb hatte, wenn sie nur mit gutem Herzen lebten. Wilhelm streckte den Kopf, sog laut Luft durch die Nase, noch lauter und ging auf die unklare Linie zu, wo die Brandung auf dunkelgraue und schwarze Steine traf. Kopfgroß. Einige so groß wie Maries Kopf, andere so groß wie der Kopf von Elisabeth, die nun bei den anderen wohnte und auf sie runter schaute, ob sie alles gut machten. Ihr Kopf war wirklich groß gewesen! Wilhelm hatte jetzt das Holz erreicht, packte es. Er war kräftig und zog den Stamm und das Zeug heraus. Viel Zeug und Wilhelm nahm sich etwas davon, leckte daran, aber verlor dann die Lust. Er reichte ihr den Stamm, so dass sie sich ihn unter den Arm klemmen und mithelfen konnte, und sie gingen zurück in ihr Dorf. Oben auf dem schneebedeckten Hügel stand der Mann und überwachte alle. Der Mann, der eigentlich Mein Hirte genannt werden wollte, aber in ihrem Kopf hieß er der Mann. Und auch wenn der Mann viel konnte, in ihren Kopf konnte er nicht sehen, glaubte sie. Einmal hatte sie den Mann gefragt, warum er der Hirte sei, wo doch kein einziges Schaf hier im Eis lebte, sondern nur Moschusvieh, Seerobben, Fisch, Fisch und noch mal Fisch und Eisbären. Da hat der Hirte den Bruderherz Elias beauftragt, sie zu züchtigen und sie konnte danach drei Tage keinen Schritt mehr tun. Seitdem fragte sie nicht mehr. Sie musste aufpassen, dass sie nicht über ihr Kleid stolperte. Heute sollte doch gefeiert werden. Die anderen Brüder- und Schwesterherzen, die im Dorf geblieben waren, um alles vorzubereiten, sangen schon.
»Kjah! Kjah!«, rief Wilhelm, als er das Feuer im Dorf roch. Er ließ den Stamm los und winkte. »Noch nicht!« Wilhelm hob den Stamm wieder an und sie gingen weiter. Der Mann hatte einen Eisbären geschossen, es würde Fleisch geben. Sie gingen an dem besonderen Haus des Mannes vorbei und passten auf, nicht einen einzigen neugierigen Blick darauf zu werfen. Auf dieses Haus, das aussah wie alle anderen Häuser, nur, dass es aus Stein und nicht aus Holz war. Und dem Zeug, das aber anders war. Niemand wusste, was da drin war, nur der Mann, aber es roch dort so, als wenn ein Tier frisch geschlachtet wurde. Immer. Es roch dort immer so. Magdalena mochte das Haus nicht. Und andere auch nicht. Der Mann war die letzten Tage oft lange in dem Haus geblieben. Sie fiel mit Wilhelm in den Gesang ein, beschwor den Segen aus der Tiefe, aus der tiefsten Tiefe des Meeres, den Zorn des Wassers, und aus den Augenwinkeln sah sie, wie Benjamin wieder beim Singen seinen Oberkörper so stark hin und her warf, dass er sich gleich verletzen würde. Und Benjamin durfte nicht bluten, denn dann verlor er so viel Blut, dass er wie das besondere Haus roch. Gerade wollte sie ihm beistehen, als sie einen Ruf hörten. Alle sahen hoch zum Hügel, gegen die Sonne, sahen nur seinen Umriss. Der Mann! Der Mann hatte auf dem Hügel gerufen und winkte ihnen mit seinen langen Armen und langen Händen zu und schwenkte seinen Hut dabei. Weil der Mann immer Recht hatte, wussten sie, was damit gemeint war. Elias hatte dort, wo die Sonne hochstand, ein Schiff gesehen. Das Schiff, das ihnen der Mann versprochen hatte. Jetzt konnten sie das Schlafende aus der Tiefe wecken, das seine Kinder immer im Herzen trug.
I
Wenn man sich wie Amelie Fischer ein Leben lang einer Sache widmet und dann feststellen muss, dass alles auf einer Lüge aufbaut, dann fühlt es sich an, als habe man einen Schlag direkt in den Unterleib bekommen. Ihr erging es in dem Moment so, in dem sie die geheimen Tagebücher des Kapitäns Johannes Werkmeister über die dritte Polarexpedition in Empfang nahm. Sie wurden ihr ins ethnologische Institut mit einem Kurier geschickt, und als sie mit zittrigen Händen quittierte, spürte sie noch die Ausläufer ihres Schocks. Die dritte Polarexpedition zum Nordpol war Thema ihrer Magisterarbeit gewesen, zu ihrer Doktorarbeit angewachsen und Amelie war durch sie die Expertin für historische Circumpolarforschung geworden. Die dritte Polarexpedition war ihr so nahe gegangen, dass sie oft dachte, sie wäre selbst Matrosin auf der Teutonia unter Kapitän Werkmeister oder führe auf dem Zweitschiff, der Morgenröte, unter dem Kommando Kapitän Heinrich Heitmanns mit. Und jetzt hielt sie ein Paket in den Händen, das geheime und jahrzehntelang verschollene Tagebücher eines Mannes beinhalten sollte, der sie schon seit der Studienzeit durch ihr Leben begleitet hatte. Und der ihr offenbar Tagebücher über seine Fahrt in den Osten Grönlands vorenthalten hatte. Sie fühlte sich verraten. Und, auch wenn sie diese Erfahrung wissentlich noch nicht hatte machen müssen, betrogen. So musste es sich anfühlen, wenn man betrogen wurde.
Sie trug das Paket in ihr Büro. Vielleicht wog es vier oder fünf Kilo, doch Amelie hatte das Gefühl, es würde sie hinab ziehen, als würde es Tonnen wiegen. Mit der Hüfte schlug sie die Tür hinter sich zu, stellte das Paket auf ihrem Schreibtisch ab und atmete tief durch. Ein Griff zur Schere, ein Ruck und sie schnitt durch das Klebeband des Pakets, öffnete die beiden Klappen und sah einen in Zeitung eingeschlagenen Quader vor sich. Mehr als ein Buch. Zwei. Vielleicht drei. Vom Format waren diese den anderen Tagebüchern Werkmeisters gleich. Eine Papierschöpferei aus Leipzig hatte jene in bordeauxrotem Leder eingeschlagenen Bücher gefertigt, denen Werkmeister seine Gedanken und Gefühle anvertraut hat. Amelie hob den Inhalt aus dem Paket. Doch die Bände entglitten ihr und sie fielen mit einem dumpfen Klatschen auf den Teppich. Amelie hob sie schnell wieder auf, zitterte und schüttelte den Kopf darüber. Sie wickelte sorgfältig das Zeitungspapier ab, und noch ehe der Inhalt ausgepackt war, fühlte sie drei Bücher. Und noch ehe die letzte Lage Zeitung, die Süddeutsche, wie ihr beiläufig auffiel, entpackt war, nahm sie den leichten Duft von hochwertigem Leder wahr. Von altem Papier. Und – da glaubte sie jedoch, ihre überbordende Vorstellungskraft würde mit ihr durchgehen – von einem Dachboden, der im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt für all die in Vergessenheit abgeschobenen Dinge war.
Ihre Bürotür ging auf. Amelie zuckte zusammen.
»Hier steckst du«, sagte Jakob, ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter, und wollte eintreten. Zögerte.
»Ist was passiert?«, fragte er, warf einen Blick auf das Paket und wieder auf sie. Amelie schüttelte den Kopf.
»Nein. Alles ist gut, Jakob, aber ich möchte jetzt gerne für mich sein.«
Jakobs Blick blieb einen Augenblick auf dem Paket haften, auf den in die letzte Lage Zeitungspapier eingeschlagenen Tagebüchern in ihren Händen. Dann nickte er.
»Ich mache gleich Feierabend. Muss noch was für Weihnachten besorgen.«
Sie antwortete nicht, nickte nur. Ein letzter prüfender Blick, dann zog sich Jakob zurück und schloss die Tür hinter sich. Wieder atmete Amelie tief durch, aber die Anspannung wich dadurch nicht.
Waren die Tagebücher nur zufällig verschollen oder hatte es einen Grund dafür gegeben? Waren es vielleicht Eitelkeit und enttäuschte Erwartungen? Wie bei dem Urvater der anthropologischen Feldforschung, Bronislaw Malinowski, dessen ehrliche Tagebücher einen interdisziplinären Flächenbrand entfacht hatten. Ihm wurde anschließend vorgeworfen, er sei ein Rassist, weil er die Eingeborenen seiner von ihm erforschten Ethnie beschimpfte. Und die, so mutmaßten einige, bewusst der Öffentlichkeit zugespielt wurden, um seinen Ruf zu beschädigen. Wollte Werkmeister selbst diese Bücher zurückhalten, denn die anderen Tagebücher hatte er in einer testamentarischen Verfügung der Polarforschungsgesellschaft in Bremerhaven vermacht. Warum nicht diese? Die letzte Lage Papier und bordeauxrotes Leder offenbarte sich. Hirschleder, wie sie recherchiert hatte. Aus einer mittelständischen Manufaktur aus Offenbach am Main. Sie breitete alle drei Bücher wie einen Fächer vor sich auf ihrem Schreibtisch aus und spürte Hitze in sich aufsteigen. Am rechten unteren Rand des Buchdeckels glänzten die goldenen Lettern der Papierschöpferei.
Papierschöpferey Hegebart zu Leipzig
Sie strich mit dem Zeigefinger darüber, erspürte die Buchstaben wie eine Gravur und schloss die Augen. Eine Zeit lang war sie in Johannes Werkmeister verliebt gewesen. Das hörte sich albern an, aber das war es nie. Es war ihr ernst mit diesem Mann gewesen. Vor allem mit seiner Haltung, seinen Tugenden und ja, seiner Stärke. Sie sah aus dem Fenster und stellte ihn sich vor. Wie er auf der Schiffsbrücke das Steuerrad hielt und seinem Ziel entgegensah. Sie atmete hörbar aus. Werkmeister war ein äußerst willensstarker Mann gewesen und Amelie hatte sich während ihrer Doktorarbeit in ihn verliebt, in einer Lebensphase, in der sie sich am meisten nach einem starken Partner an ihrer Seite gesehnt hatte. Bisher war sie einem Mann wie ihm noch nicht begegnet, aber sie war sich auch heute noch sicher, in einen solchen Mann würde sie sich verlieben. Auch das stand jetzt auf dem Spiel. Sie schlug alle drei Buchdeckel nacheinander auf. Werkmeister hatte auf das erste Blatt immer das Datum geschrieben. Rechts oben. Schwungvoller Duktus, aber nicht verspielt. Ästhetisch. Und dabei mit einem klaren Ziel vor Augen. In der Mitte der Seite im selben Stil eine Ortsangabe. Dort, wo er sich zu Beginn der Tagebuchaufzeichnung befunden hatte. Das mittlere war das älteste Buch. Bremerhaven. Von dort war die Expedition gestartet. Amelie klappte die anderen beiden Tagebücher zu, schob sie beiseite, setzte sich und zog das aufgeklappte Buch zu sich heran. Sie rückte noch ihren Stuhl zurecht, so wie sie es immer tat, wenn sie las, warf einen Blick auf die kleine Grünfläche, die blattlosen Pappeln, auf die sie aus ihrem Institut sehen konnte und erschauerte bei dem Anblick des wirbelnden Schnees im bitterkalten Dezember. Dann begann sie zu lesen.
Hamburg, den 18. März, 1878
Ein eisiger Wind weht die Elbe stromaufwärts und eine Böe erfasst die am Pier stehende Abschiedsgesellschaft. Sie weht den Damen und Herren ihre Hüte von den Köpfen. Nur der Kaiser im Sattel seines Rosses und sein Reichskanzler Graf Otto von Bismarck stehen wie ein Fels in der Brandung und lassen sich nicht von all der dadurch ausgelösten Turbulenz anstecken. Sie salutieren, als zum Abschiedsgruß drei Mal aus Hinterladergewehren gefeuert wird. Die Männer winken ihren Liebsten, die mit bunten Taschentüchern die Grüße erwidern.
Den alten Petermann konnte ich sehen, wie er hartnäckig meinen Blick suchte, aber ich ignorierte ihn. Zu viel Streit hatte es vorher gegeben, und er trug mir immer noch nach, dass ich seinen Kontrakt zur Expedition nicht unterzeichnet habe. Das war der Preis für die Bedingung gewesen, von der, so denke ich, auch er nichts wusste. Nachdem wir unter Dampf abgelegt hatten und Heinrich mit seiner Morgenröte neben meiner Teutonia gleichauf lag, tauschten wir über das Wasser Blicke aus. Ich meine, dass in diesem kurzen Augenblick unser beider Fassade fiel und wir einander unser sorgenvollstes Antlitz zeigten.
Kurz vor der Insel Neuwerk ließen wir die Maschinen drosseln, und Heinrich und ich riefen jeder seine Mannschaft und die Wissenschaftler zusammen. Ich sagte ihnen, dass wir ein drittes Schiff bei Neuwerk erwarteten. Die Sirene unter dem Kommando des Kapitäns Georg Braun. Die Fragen meiner Männer konnte ich nicht beantworten, denn es gab nichts, was ich über ihn berichten konnte, obwohl ich mich in Stralsund, Rostock, Lübeck, Hamburg und Bremen erkundigt hatte. Niemand kannte einen Kapitän Braun oder hatte etwas über ihn gehört. Unser Auftrag vom Reichskanzler höchstpersönlich lautete, die Sirene bis Sabine Islands zu begleiten. Es sollten den Wissenschaftlern »die handelsüblichen Arbeiten auf so einer Expedition bis dahin gestattet sein, aber das eigentliche Ziel muss schnell erreicht werden«. Bestenfalls noch bis Anfang Mai. Da Heinrich und ich von diesen Plänen auch erst seit drei Tagen wussten, beschlossen wir, diese Ergänzung erst nach dem Ablegen kundzutun, um möglichst wenig Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Den zeitlichen Rahmen erwähnten wir beide noch nicht. Verwundert, aber mit dem Schwung der Abfahrt und dem gemeinsamen großen Ziel vor Augen, akzeptierten die Männer die Ansage. Der heiße Rum mit Zitrone tat sein Übriges.
Neuwerk.
Die Sirene lag stromabwärts hinter dem Eiland vor Anker. Wir bekamen sie das allererste Mal zu Gesicht, als wir die nordöstliche Landzunge mit dem rot geklinkerten Lotsenhaus passierten. Und da lag sie und sah nicht nach einem Schiff aus, das für eine Polarfahrt geeignet war. Es war ein dickbäuchiger Kauffahrer mit zu geringer Stahlverkleidung am Bug. Ein Dreimaster ohne verstärkende Längsstreben luv- und leeseits, so dass sich vor allem meine Männer bei diesem Anblick die Frage stellten, wie wir dieses große Handelsschiff sicher durch das Eis nach Sabine Islands geleiten sollten. Gespenstisch war auch die Ruhe. Es war niemand zu sehen und erst als mein Bootsmann hinüberrief, betrat Kapitän Braun allein das Deck. Ein stattlicher Mann, in der Tat. Bestimmt an die zwei Meter groß und drahtig dabei. Sein schwarzer Backenbart verlieh seinem Gesicht etwas Düsteres. Er trug einen langen, schwarzen Wachsmantel und einen Kapitänszylinder, wie ich sie vor allem bei englischen Seeleuten gesehen hatte. Ohne zu grüßen schritt er zur Reling, umfasste diese, stützte sich darauf ab und sandte uns Blicke zu, mit denen man unliebsame Fremde bedachte. Dieser Mann war mir gleich unsympathisch. Wir suchten alle nach der Mannschaft der Sirene, lauschten in den Wind und in die Wogen, aber bis auf das Pfeifen des Windes in der Takelage und die klatschenden Wellen am Schiffsrumpf war nichts zu hören. Ich grüßte den Kapitän mit seinem Namen, er nickte und grüßte mich und Kapitän Heitmann zurück.
Ich rief hinüber: »Wir haben den Auftrag, die Sirene unter ihrem Kommando zur Walfängerstation auf Sabine Islands zu bringen. Erlaubt mir die Bitte, zu euch überzusetzen, um mir ein Bild von der Takelage zu verschaffen. Vielleicht können kleine Schiffszimmereiarbeiten, die wir jetzt noch in milden Gewässern tätigen, einen großen Effekt auf die Sicherheit im Eis haben und...«
»Nein!«, unterbrach er mich. »Es ist der Belegschaft der Teutonia und der Morgenröte unter gar keinen Umständen erlaubt, die Sirene zu betreten. Ich wiederhole, unter gar keinen Umständen«, sagte er so laut, dass es Heinrich und meine Männer gut hören konnten.
»Selbst auf die Gefahr hin, dass die Sirene sinkt?«, vergewisserte sich Heinrich, und Kapitän Braun bestätigte es ihm.
»Fahren Sie bitte voraus, ich folge Ihnen alsbald. Vielen Dank!« Kapitän Braun wandte sich ab und verschwand unter Deck. Heinrich und ich tauschten ob des seemännischen Unsinns einen Blick aus. Seinem entnahm ich eine ebensolche Verachtung, wie sie auch ich in diesem Augenblick verspürte. Ich nickte dem Maat zu, der der Mannschaft befahl, Fahrt aufzunehmen, und gemeinsam mit der Morgenröte folgten wir dem Strom. Ich nahm mein Fernglas und hielt Ausschau nach etwas, was ich im angrenzenden Wald an der Küste zu sehen geglaubt hatte. Zwei Reiter standen dort, durch das blattlose Geäst nur scheinbar getarnt. Sie beobachteten uns. Als sie sahen, dass auch ich sie beobachtete, steckte einer der beiden sein Fernrohr in eine Satteltasche. Sie wendeten ihre Rösser und verschwanden tiefer in den Wald hinein. Ein Blick achtern, die Sirene folgte uns unter ablandigen Wind unter Segel. Die Besatzung an Deck erschien gewöhnlich. Bärtige Männer zwischen zwanzig und dreißig Jahren, doch ich staunte sehr, als ich zwei junge Frauen an Deck erkennen konnte.
»Kapitän, habt ihr eine Nixe gesehen?«, wollte Wilhelm, mein Maat und Steuermann, von mir wissen, denn offenbar trug ich das nackte Erstaunen in meinem Gesicht. Wortlos ging ich unter Deck und fragte mich, welcher Teufel Braun geritten hatte, dass er Frauen mit ins Eis nahm.
Amelie Fischer klappte das Buch zu und atmete schwer. Nie hatte sie lesen als so anstrengend, als Qual empfunden, heute aber war es so. Ihr Kopf schmerzte, sie litt unter Atemnot und sie schwitzte, obwohl es nicht besonders warm in ihrem Büro war. Eher wurde sich oft über die Kälte bei ihr beschwert.
Es hatte also ein drittes Schiff gegeben. Es gab weitere Tagebücher von Johannes Werkmeister, und Amelie fühlte Wut darüber in sich aufkeimen. Verraten und betrogen. Werkmeister hatte sie verraten und betrogen. Sie und auch seine Mannschaft. Ihr Idol, ihr Ratgeber in schweren Zeiten. Ihr leuchtendes Licht in dunklen Stunden begann zu flackern, strahlte weniger hell.
Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und warf einen Blick nach draußen. Es dämmerte bereits und war still im Institut. So still, dass sie das Rauschen des Nachmittagverkehrs vor dem Dammtor bewusst hörte. Sie würde die Bücher in ihrem Büro lassen und jetzt Feierabend machen. Es war ihre Arbeit, nicht ihr Leben, nicht ihre Liebe, sagte sie sich und wusste um den inneren Widerspruch.
»Scheiße, Johannes!«, fluchte sie, zog sich ihre Winterjacke an, ließ die Bücher auf ihrem Schreibtisch liegen, löschte das Licht, verließ ihr Büro, drehte um und schloss seit langem wieder ihre Tür hinter sich zu.
Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) hat im Rahmen der internationalen Initiative IceGeoHeat ein Zusammenspiel von geothermischer Heizung und dem grönländischen Eisschild untersucht. Sie zeigten, dass die Dicke des grönländischen Eispanzers sehr variabel ist, was zur Folge hat, dass die oberflächliche Erdtemperatur damit auch stark variieren kann. Die steigenden Luft- und Wassertemperaturen lassen den Eispanzer schmelzen, aber nun zeigt sich die Wirkung des Abschmelzens durch den Wärmefluss im Inneren. Somit verliert Grönland jährlich mehr als 200 Milliarden Tonnen Eis, so die Forschungsergebnisse von 2013.
Weiterführende Informationen zur Studie: siehe QR-Code
II
Amelie hatte in der Nacht kaum Schlaf gefunden, und wenn, dann wurde sie von Träumen heimgesucht, die ihr keine Erholung bescherten. Allesamt hingen sie mit dem Bücherfund und Kapitän Johannes Werkmeister zusammen, der ihr dieses Mal nicht als idealisierter Traummann, sondern als dubioser, unnahbarer Seefahrer erschien. Sie duschte gegen fünf Uhr morgens kalt und saß um sechs Uhr in ihrem Büro und schlug das Tagebuch auf, um weiterzulesen.
25. März 1878: 56° 37' nördliche Breite; 5° 12' westliche Länge; 12 Knoten, Westsüdwest bei 65 Faden Tiefe, steiniger Grund
In den frühen Abendstunden bei ruhiger See ließen wir die Morgenröte und die Teutonia nebeneinander ankern, und Heinrichs Mannschaft setzte, bis auf eine Notbesatzung, auf ein Wort und einen ersten Umtrunk über, wie es Brauch war unter ehrenwerten Seefahrern. Ich erwähne dies, weil es keinen Vorstoß Kapitän Brauns gab, der als Versuch einer kameradschaftlichen Annäherung gelten konnte. Schlimmer noch, die Sirene hielt so auffällig großen Abstand, dass es uns nur möglich war, im Fernrohr die gehissten Segel zu erkennen, aber keine Besatzung. Beinahe waren Heinrich und ich erleichtert, den Umtrunk nicht in Gesellschaft von Kapitän Braun abhalten zu müssen. Wir umarmten uns, klopften uns auf die Schultern, als hätten wir uns Ewigkeiten nicht gesehen, aber die ausgetauschten Herzlichkeiten waren von ehrlicher Natur. Eher wie ein Drang, welcher alle Mannschaftsteile erfasste. Einige von uns hatten schon die zweite Polarexpedition gemeinsam bestritten, und man konnte behaupten, dass es sehr familiär zuging. Wilfried schenkte ein, alle standen zusammengedrängt in unserer Messe, hielten ihre Gläser hoch und warteten auf einen Toast.
»Auf die dritte Polarexpedition des deutschen Reiches«, hob ich an. »Auf ein gemeinsames Abenteuer, das wir gemeinsam bestreiten, und Heinrich, auf dich, mit dem ich wieder Kiel an Kiel ins Eis fahren darf. Es ist mir eine Ehre. Herr Poseidon, sei uns wohlgesonnen und bringe alle Männer wohlbehalten zu ihren Familien zurück!« Ich schüttete den Rum auf den Boden, Heinrich tat es mir gleich, und sofort schenkte uns Wilfried nach. »Prost!«, rief ich und »Prost!« erklang das Echo aus durstigen Seefahrerkehlen. Wir stießen an und ließen uns das erste Fass Rum schmecken. Nach einiger Zeit verließen Heinrich und ich das gesellige Beisammensein und gingen an Deck. Die Kälte kühlte schnell mein glühendes Gesicht, aber nicht mein Gemüt, das sich augenblicklich erhitzte, als Heinrich fragte, was ich von Kapitän Braun halten würde.
»Gar nichts«, antwortete ich unumwunden. »Und auch von der Sache an sich halte ich gar nichts.«
»Hier kannst du das ja sagen. Glaube kaum, dass der Reichskanzler sich als blinder Passagier an Bord geschmuggelt hat«, flunkerte Heinrich.
Ich wusste aber, was er meinte. Von Bismarck selbst hatte uns den Auftrag übertragen.
»Hast du die Sirene gesehen, Heinrich? Keinerlei Verstärkung gegen das Eis. Ein dickbäuchiger Kauffahrer, der auf Ladung ausgelegt ist. Das erste Packeis und wir bekommen Probleme. Damit erreichen wir niemals Sabine Islands.« Heinrich nickte, stopfte sich eine Pfeife und zündete sie an einem Streichholz an. Es war eine sternenklare und windstille Nacht. Heinrich sah dem gen Himmelszelt kräuselnden Rauch nach. »Und dann haben sie Frauen an Bord, Heinrich. Frauen in Kleidern. Erzähl mir, was das für eine Expedition ins Eis sein soll!« Nein, mein Gemüt wollte sich nicht abkühlen in dieser Sache. »Wir können es nicht ändern, Hannes. Es ist, wie es ist. Aber wir müssen auf sie aufpassen.«
Amelie klappte das Buch zusammen, trank einen Schluck Wasser. Sie erinnerte sich an die Passage des ersten gemeinsamen Umtrunks.
»Die Rede steht doch genauso im Tagebuch«, erinnerte sie sich laut. Das Gespräch an Deck mit Heinrich Heitmann hingegen nicht. Um sicher zu gehen, musste sie jedoch gegenlesen. Sie ging rüber zu Jakob.
»Ich werde noch mal in die Museumsbib gehen«, sagte sie. Jakob grinste und verzog sofort das Gesicht.
»Alles klar«, sagte er.
»Ist was? Geht es dir gut?«, wollte sie wissen.
Er zuckte mit den Schultern und stöhnte. »Ich glaube, ich hab mir was eingefangen. Kopfschmerzen, so ein Kratzen im Hals. Alles tut weh …«
»Du stirbst«, unterbrach sie ihn und bemerkte jetzt erst den Schal, den er trug. »Männergrippe«, schlussfolgerte sie. Er nickte.
»Wenn es nicht geht, musst du einen Rettungswagen holen«, empfahl sie ihm, winkte und schloss die Tür. Amelie ging zu Fuß die Rothenbaumchaussee bis zum Völkerkundemuseum hinauf. Nasskalt und windig war es, sie zog sich die Kapuze über den Kopf. Auf dem Vorplatz des Museums vertäuten Arbeiter eine Bambushütte, die auf die bevorstehenden Südseetage hinweisen sollte. Amelie ging an der Seite des Gebäudes vorbei und durch den rückwärtigen Eingang für das Personal. Von dort gelangte sie über den alten Treppenaufgang direkt in das zweite Geschoss, wo auch die Museumsbibliothek zu finden war, die für den Publikumsverkehr so früh noch geschlossen war. Sie prüfte, ob die Tür schon geöffnet war, zog sie auf und begrüßte Sabine, die Halbtagskraft, die schon ihren Dienst versah und zurückgebrachte Bücher austrug. »Amelie!«, grüßte sie zurück, erhob sich und kam ihr entgegen. Amelie winkte ab. »Bleib ruhig sitzen. Ich will mir nur wieder mal Werkmeisters Tagebücher ausleihen«, sagte sie und lachte. Dennoch umarmten sie sich, nur noch selten kam Amelie in die Museumsbibliothek, in der sie damals gerne ganze Tage verbracht hatte, um für ihre Arbeiten zu recherchieren. Es gab immer noch, und ganz bewusst, Schlagwortkarten in Karteikästen und immer noch musste man Pappplatzhalter ausfüllen und anstelle der ausgeliehenen Bücher ins Regal stellen. Sabine hatte schon während Amelies Studienzeit hier gearbeitet und war so etwas wie die gute Seele des Hauses. »Du hast Glück, sie sind letzte Woche wieder zurückgegeben worden.«
»Sie waren ausgeliehen?«, fragte Amelie nach. Bisher waren die Tagebücher über die erste und zweite Polarexpedition nur kurz nach ihrer Doktorarbeit einmal ausgeliehen worden, ansonsten hatte sich das Interesse an ihnen in Grenzen gehalten.
»Ja, ein älterer Mann hatte sie sich ausgeliehen. Und etwas über die Inuit.« Sabine erinnerte sich an jedes Buch und jeden Entleiher.
»Na, da hab ich ja Glück. Ich … brauche sie nämlich dringend«, antwortete Amelie, ging dann an Sabine vorbei zur steilen Wendeltreppe aus schwarz lackiertem Eisen und stieg hinauf ins dritte Bibliotheksgeschoss, wo die Antiquariate ihr Zuhause fanden.
Amelie schritt zielsicher in die Nordamerikaabteilung und dort auf ihre Tagebücher zu. Dann verharrte sie. Der Geruch. Sie zögerte. Der Geruch war anders. Sie sog Luft durch die Nase, schloss ihre Augen. Alle die Jahre hatte es immer gleich gerochen. Nach alten Büchern, altem Papier, altem Leder und dem Geruch der altehrwürdigen Bibliothek. Jetzt verbarg sich darin die kaum zu erkennende Note eines Parfüms. Ein Herrenparfüm. Sie verharrte einen weiteren Augenblick, um die aufbrandenden Gefühle zu analysieren. Überwiegend war es Wut, aber auch Enttäuschung und etwas Neugier. Das waren doch ihre Bücher! Bei dem Gedanken musste sie schmunzeln, immerhin erkannte sie ihren Spleen mit diesen Tagebüchern. Sie zog sie aus dem Regal heraus, roch ein weiteres Mal unauffällig daran, legte sie auf einen Tisch am Fenster mit Blick auf die Tennisplätze des Instituts für Sport, füllte die Platzhalter aus und legte sie ins Regal. Mit den schweren Büchern unter dem Arm ging sie zurück zu Sabine und füllte dort die beiden Ausleihscheine aus. »Viel Spaß damit«, wünschte ihr Sabine, Amelie drückte die beiden Bücher an sich. »Werde ich haben«, sagte sie, nicht ohne Selbstironie, und verließ die Museumsbibliothek. Im Souvenirgeschäft des Völkerkundemuseum kaufte sie noch ein paar Sachen für Jacob und ging dann zurück zum Institut.
Dort klopfte sie bei Jakob an, wartete die Antwort nicht ab, sondern öffnete sofort die Tür und trat vor seinen Schreibtisch. Er sah von seinem Monitor auf. »Jetzt auch noch Schnupfen«, jammerte er. Wortlos holte sie etwas aus ihrem Rucksack und stellte es vor ihm auf den Tisch. »Ingwer mit Zitrone. Indianischer Honig und Schokolade. Ach warte, die war für mich.« Sie steckte die Schokolade zurück in ihre Tasche. »Ich mache dir jetzt einen Tee. Und dann fühlst du dich besser!«
Später im Büro öffnete sie die Fenster und schlug beide Bücher auf, um den Parfümgeruch loszuwerden. Sie begann, nach jenen Passagen zu suchen, die im ›geheimen‹ Tagebuch ergänzt oder erweitert worden waren. Eigentlich wollte sie sie auflisten, aber sofort geriet sie in den Sog von Werkmeisters Beschreibungen.
III
28. März 1878: 60° 45' nördliche Breite; 2° 4,3' westliche Länge; 8 Knoten, Nordost bei 42 Faden Tiefe, steiniger Grund
Tümmler.
Dr. Weber hatte eine Schule Tümmler gesichtet, die uns steuerbord in einem Abstand von einhundert Metern und manchmal sogar darunter folgten. Ein schöner Anblick, wie sich die glänzenden Körper aus der Gischt erheben, in der Luft liegen, um dann wieder einzutauchen, ohne dass dabei Wasser aufspritzt. »Elegant wie die Teutonia!«, rief ich Heinrich zu, der backbord neben uns unter vollen Segeln fuhr. »Eher wie die Morgenröte!«, antwortete er nicht minder laut, und die Männer an Deck lieferten sich nun über das Wasser hinweg eifrige Wortgefechte. Dr. Weber holte sich indes meine Erlaubnis ein, die Tiere jagen zu dürfen, und ich erteilte sie ihm. Durch das Fernglas beobachteten die Wissenschaftler die Schule und machten in ihr ein einzelnes männliches Tier aus, auf das sie anlegten. Wir sprachen uns mit Heinrichs Mannschaft ab und sie gewährten uns den ersten Schuss auf das Tier. Ich glaube, es war Dr. Webers Schuss, der traf. Jedenfalls trieb das Tier obenauf und wir holten es ein. Ein geschlechtsreifer Bulle, der, nachdem die Wissenschaftler ihre Untersuchungen vorgenommen haben würden, uns leckeren Speck und Gulasch einbringen würde, wie uns unser Smutje versicherte. Danach verließ uns die Herde. Auf einen weiteren Jagderfolg verzichteten wir also.
Ergänzung aus dem dritten Tagebuch
Wir fuhren weiter unter Segel Kurs Nord-Nord-West und Fritz sichtete alsbald die Segel der dickbauchigen Sirene, die uns auf ihrem Kurs kreuzen würde. Das wunderte sowohl Heinrich als auch mich. Wir hatten die Sirene bewusst mit Abstand hinter uns gelassen und wollten bei gleichbleibendem Wind die Segel runternehmen, damit sie bis zum Abend aufschließen konnte. Dass sie nun vor uns fuhr, konnten wir uns beide nicht erklären. Und auch der navigationskundige Rest der Besatzung nicht, so dass unverzüglich das Gerede wie die Pest um ging, das man landläufig Seemannsgarn nannte. Heinrich und ich verbaten es uns ausdrücklich, und glücklicherweise sprangen uns die Herren Gelehrten bei, die allerhand wissenschaftliche Erklärungen auffuhren. Unter uns; sicherlich fabulierten hier auch einige ins Blaue hinein, aber immerhin beruhigte sich dadurch die Besatzung, und ein unterseeischer Strom, der ein Schiff über mehrere Seemeilen beschleunigte, war nicht nur denkbar, sondern auch tatsächlich möglich. Statt uns zu kreuzen, ging die Sirene dann auf Kurs, als wüsste sie unser Ziel, und anstatt die Segel herunterzunehmen, ließen wir sie voll aufziehen, um die Sirene einzuholen. Sowohl Heinrich als auch ich standen auf der Brücke und beschlossen mit Braun ein ernstes Wort zu sprechen, denn es war ausgemacht, dass die Sirene uns folgen und nicht überholen sollte. An seinem Blick und meinem Gefühl machte ich unser Unbehagen aus. Sicher konnte eine Strömung das Schiff an uns vorbeigetragen haben, aber wir hätten sie sichten müssen, denn sowohl die Teutonia als auch die Morgenröte hatten den Ausguck besetzt. Gewiss ist manches Mal einer der Matrosen schläfrig und schludert etwas auf offener See, aber dass zwei Männer sich gleichzeitig irrten, ist mir noch nicht vorgekommen. Und die Segel der Sirene hätten auch irgendjemandem an Deck auffallen müssen. Es war und blieb also sonderbar und auch für Heinrich und mich, trotz aller Versuche, nicht wirklich erklärbar. Doch was dann geschehen sollte, wunderte uns weitaus mehr, und ich will gestehen, es war auch das erste Mal, dass ich so etwas wie Angst verspürte.
Max und Dr. Westermann wurden als erste darauf aufmerksam und ich sah von der Brücke aus, wie sie den anderen etwas zuriefen. Bald hatten sich alle am Klüvernetz versammelt, stakten mit Harpunen ins Wasser, warfen Eimer ins Meer und holten sie an Seilen wieder heraus, um dann den Fang zu überprüfen. Als mich die ersten hilfesuchenden Blicke Dr. Westermanns trafen, wusste ich, es war kein gewöhnlicher Fang. Währenddessen zogen die Männer den kopflosen Kadaver eines Tümmlers an Bord, dazu hatten sie mit einigen Eimern Teile eines Tümmlers gefangen, die sie nun an Deck mit dem Wasser ausgossen. Rückenflossen, Innereien, Haut- und Fleischfetzen. »Dat sünn ma Schlachtabfälle, so sühd dat ut«, stellte Fiete fest. Schweigend standen wir um die Kadaverreste, während Dr. Westermann und Max noch an der Reling hantierten. Fragende Blicke ruhten auf mir und ich hob den Blick auf das Meer hinaus und sah weitere Teile, ganze Leiber toter Tümmler an uns vorbeitreiben. Und am Horizont die Sirene, die unter vollen Segeln vorweg fuhr. Es war naheliegend, dass die toten Tiere von ihr stammten. Als Abfall. Jedoch stellte sich mir die Frage, warum sie die Tiere getötet hatten.
»Seht euch das an!«, empörte sich in diesem Augenblick Dr. Westermann und wir gingen an die Reling Steuerbord, um zu sehen, was ihn so wütend werden ließ. Ein weiterer Tümmler, der im Wasser taumelte. »Die Augen! Irgendwer hat ihm die Augen ausgestochen und es gezielt auf die Lungen abgesehen. Da! Und da! Das sieht nach gezielten Stichen aus. Jeder, der sich mit Fangmethoden auskennt weiß, dass man so kein Tier tötet, sondern nur verwundet und es elendig leiden muss!«
»Wer mokt denn sowat?«, wollte Fiete wissen und ich weiß, er brachte sein Ansinnen rein rhetorisch hervor, denn auf den Kopf gefallen war der Matrose mit Sicherheit nicht. Er wusste sehr genau, wer im Verdacht für diese Untat stand; die Sirene und allen voran Kapitän Braun. Unter Anleitung des eifrigen und empörten Dr. Westermann wurden wir aller Teile der getöteten Tümmler habhaft, die in unsere Reichweite trieben. Wir kamen auf sieben getötete Tiere, waren uns aber sicher, dass es wohl weit mehr sein mussten. Ein Tier, dem sämtliche Flossen abgetrennt worden waren, fanden wir etwas später. Wir holten es an Bord und die Männer hatten Mitleid mit dem Tier, glaubten in seinem Blick einen stummen Hilfeschrei nach Erlösung zu sehen und waren froh, als Erich, unser Smutje, das Tier mit einem Stich erlöste und ausbluten ließ, um das verwertbare Fleisch zu retten.
»Davon ess’ ich nix«, murrte jemand aus der zweiten Reihe.
»Dann kannst du verhungern«, antwortete ich knapp in die Runde. »Dr. Westermann, bitte nehmen Sie sich für Ihre Untersuchungen, was Sie brauchen, und der Rest geht zurück über Bord. Wer immer dafür verantwortlich ist und dafür keine hinreichende Erklärung hat; Gott und das Meer werden ihn richten. Und nun geht jeder seiner Arbeit nach, hier gibt es nichts weiter zu sehen!« Ich löste die ängstliche Gesellschaft auf.
Das Kommando übergab ich Wilhelm und ging unter Deck in den Raum, den wir zur See Fahrenden nur ›das Labor‹ nannten und der den Wissenschaftlern für ihre Arbeit vorbehalten war. Er lag direkt neben der Messe. Man musste zwei Schritte eine Treppe hinab. Ich hatte schon beobachtet, dass die Plätze in der Nähe des Labors bei den Männern eher unbeliebt waren, angeblich, weil es dort manchmal sonderbar roch. Und in der Tat, so war es auch. Manchmal roch es dort verbrannt oder leicht nach Schwefel, aber die Wissenschaftler hatten mir versichert, dass keinerlei Gefahr von den Dünsten ausging. Ich klopfte an und trat ein, Dr. Westermann und unser Meeresbiologe Herr Hagen Leupertz standen um den festverschraubten großen Arbeitstisch in der Mitte herum und begutachteten die Leichenteile der Tiere. Westermann sichtete mit einer Lupe, während Leupertz die Wunden mit Hilfe medizinischen Werkzeugs offenlegte.
»Die Tiere sind nicht einfach getötet, sie sind gequält und beinahe hingerichtet worden, Kapitän Werkmeister«, eröffnete Dr. Westermann das Gespräch und sah auf. Leupertz nickte. Auch im Gesicht des Biologen sah ich Abscheu und Verachtung. »Verstehe«, antwortete ich und umrundete den Tisch, um mir einen ganzheitlichen Eindruck verschaffen zu können. Schnittwunden, aber vor allem tiefe Wunden mit zerfetzten Wundrändern.
»Schätze, die haben noch gelebt, Kapitän«, sagte Leupertz und zeigte mir eine Wunde, als ich bei ihm stand. »Die Wunden sind voller Blut, da hat das Herz noch gepumpt«, erklärte er. Ich nickte und umrundete den großen Arbeitstisch, begutachtete die Tierkadaver. »Und gibt es dafür eine Erklärung, die Ihnen einfällt?«, wollte ich von den beiden wissen. Leupertz und Dr. Westermann sahen sich lange an, ehe Dr. Westermann zu einer Antwort fand. »Ich muss gestehen, Kapitän, etwas Gescheites will uns dazu nicht einfallen, außer …« Er ließ seinen Blick über den Arbeitstisch schweifen.
»Nur Mut, Doktor«, ermunterte ich ihn zu einem offenen Wort.
»… außer jemand wollte die Tiere mit Absicht quälen«, schloss er seinen Bericht. Ich hatte den Tisch beinahe umrundet, prägte mir alle Einzelheiten ein und dachte über das Gesagte nach. Für mich lag auf der Hand, wer die Tiere so zugerichtet hatte, jedoch suchte ich nach einer anderen Plausibilität in dem Massentod der Tiere. Erst hatte ich noch auf einen Unfall gehofft, aber gerade die tiefen Wunden mit den ausgefransten Wundrändern passten auf kein nautisches Werkzeug, das sie versehentlich hätte verursachen können. Es sah eher so aus, als hätte ein Wahnsinniger mit einem gezackten Löffel bis auf die Knochen der Tümmler das Fleisch aus deren Leibern geschabt. Es gab immer mal wieder einen, dem es Vergnügen bereitete, Tiere zu quälen, aber der Kapitän hätte dies sofort unterbinden müssen. Das hatte er offensichtlich nicht getan. »Vielen Dank für Ihre Beurteilung«, bedankte ich mich und verließ das Labor.
02. April 1878: 60° 33' nördliche Breite; 0° 7' westliche Länge; 9 Knoten, Ostnordost bei 700 Faden Tiefe, steiniger Grund
Die letzte Nacht, bevor wir das Polarmeer erreichen werden. Wir hielten es wie die Jahre davor. Jedes Schiff sollte sein ganz eigenes Ritual mit den Greenhands feiern. Heinrich hatte derer zwei an Bord. Bei mir waren es Doktor Ganz, der den Auftrag hatte, neue nautische Apparate in der Anwendung zu überprüfen, der Matrose Jürgen Petersen und unser Küken, der junge Leichtmatrose Konrad Müller. Während alle im Geheimen mit den Vorbereitungen beschäftigt waren, war ich an Deck der Morgenröte und stieß mit Heinrich vorab an. Auch um uns zu besprechen. Wir hatten kabbelige See und einiges an Wind und Regen gehabt, heute Abend aber war die See ruhig und der Himmel klar. Allerdings wirkte es auf uns nur wie die Ruhe vor dem Sturm und Heinrich und ich erwarteten beide ein bevorstehendes Unwetter in den kommenden Tagen. Ich schenkte uns beiden etwas Rum nach, Heinrich schmökte an seiner Pfeife und sah dem fast vollen Mond auf der See zu, dessen Spiegelbild von den Wellen verzerrt wurde. »Es war Braun. Welcher Teufel auch immer ihn geritten hatte. Aber klar ist, er war es. Keiner seiner Männer, die hätte er aufhalten müssen. Wir waren direkt in seinem Kielwasser. Und die Tümmler sind ganz frisch … geschlachtet worden«, mutmaßte Heinrich.
»Geschlachtet ist noch zu schön für das, was es war, Heinrich«, widersprach ich und spürte wieder Empörung in mir aufkeimen. »Wenn du schlachtest, hat es anschließend einen Nutzen. Es wird Nahrung aus dem Leben hergestellt. Die Tümmler wurden gequält und nicht einmal ihr Tod stand im Vordergrund. Zwei lebende, verstümmelte Tiere haben wir gefangen.«
Heinrich nickte. »Das macht es nicht besser, oder?«, antwortete er mit einer Gegenfrage.
»Nein«, antwortete ich und nippte an meinem Becher, um die aufbrandende Wut zu bekämpfen. Sicherlich war Heinrich der falsche Adressat dafür.
»Und warum?«, fragte er nach einigen Zügen aus seiner Pfeife. Jetzt war ich es, der schwieg und auf die See starrte. Oft waren unsere Gespräche so. Es wurde wenig geredet, viel geschwiegen und doch viel gesagt.
»Wenn ich das nur wüsste, Heinrich. Als alleiniger Grund fällt mir nur ein, dass Braun uns damit einschüchtern oder verunsichern wollte.«
Heinrich brummte eine Bestätigung. »Aber warum? Wollen sie uns aus der Reserve locken? Befinden sie sich im Krieg mit uns?«
Ich zuckte mit den Schultern. Eine Antwort wollte mir auf die Schnelle nicht einfallen, so dass wir beide wieder schwiegen.
»Loyalität«, sagte Heinrich, und ich sah ihn fragend an. Er grinste. »Loyalität, Johannes. Sie prüfen uns. Der Kanzler prüft uns. Bei den Geschichten, die man von dem Alten hört, wäre das nur eine weitere Finesse aus seinem Oberstübchen.« Wir sahen uns an und ich dachte über seinen Vorschlag nach. Eine List, um unsere Loyalität zu prüfen. Vielleicht sogar noch mehr. Belastbarkeit. Tümmler und Delphine galten als des Seefahrers Freund und wie oft hatte es gerade bei den ersten Expeditionen Tumulte an Bord gegeben, wenn Wissenschaftler Jagd auf die Tiere zu Forschungszwecken gemacht hatten. Viele der Seeleute reisen nicht das erste Mal mit mir zusammen. Sie wissen, was sie erwartet. Aber Konrad zum Beispiel war beim Klang der ersten Schüsse doch sehr ergriffen gewesen. »Der Kanzler?«, fragte ich nach, aber eigentlich nur, um die Pause zu unterbrechen.
»Der Kanzler«, antwortete Heinrich bestätigend, langte nach dem Rum, um uns noch einen Lütten nachzuschenken, als wir beide am Horizont ein Licht sahen. Licht, wie von einem Feuer. »Die Sirene?«, fragte Heinrich und wir beide griffen jeweils nach unserem Fernrohr.
»Das ist sie«, stellte Heinrich als erster fest. »Und mit heruntergelassen Hosen«, ergänzte ich und spielte darauf an, dass ihre Segel gerefft waren, während ich weiter nach dem Grund für das Feuer suchte, das ich in der Mitte an Deck verorten konnte. Funken stieben auf und das war wohl zumindest die Ursache für die zusammengerafften Segel.
»Du, da ist ja die gesamte Mannschaft an Deck«, erkannte Heinrich. Und tatsächlich standen alle um das Feuer herum und kaum, dass ich sah, dass dort gesungen wurde, wehten dünne Stimmen in einer Melodie zu uns herüber. »Mensch, die singen. Und sie tragen alle weiße Kleider. Nicht nur die ganzen Frauen, auch die Männer. Und da sind sogar Kinder dabei, Heinrich! Kinder!«, flüsterte ich nun und sah Kapitän Braun inmitten der Gesellschaft in einem weißen Überwurf stehen, der mich an ein übergroßes Bettlaken erinnerte. Aber er war einer von vielen und sah wie alle anderen zu drei Gestalten auf, die auf dem Kapitänsdeck standen und wie Dirigenten die Arme zum Gesang bewegten und nach oben in den Himmel sahen.
»Die singen da nicht nur, Johannes, die machen da irgendetwas anderes, von dem ich gar nicht wissen will, was es ist. Achtersteven und am Klüvernetz schmeißen die was aus Eimern ins Wasser, aber ich weiß nicht, was«, sagte Heinrich, ohne das Fernrohr herunterzunehmen. Ich suchte nach dem Geschehen, erfasste eine Gestalt achterdecks, die gerade den Inhalt eines Eimers in die See schüttete und bei Gott, in diesem Augenblick zweifelte ich erst an dem Gesehenen und später an meinem Verstand. Eine Hand. In diesem kurzen Augenblick glaubte ich, aus dem Eimer sei eine menschliche Hand ins Meer gekippt worden. Doch jetzt, während ich schreibe, nagen die Zweifel an mir. Will ich das Gesehene nicht wahrhaben, oder will ich die Wahrheit nicht sehen? Ein Teil in mir ist sich sicher, den Anblick einer menschlichen Hand gesehen zu haben, wie sie im mondbeschienenen Zwielicht über die Reling geschüttet wurde. Erst Flüssigkeit, die mich in der Dunkelheit und bei dem Schattenwurf an schwarze Tinte erinnerte, die nicht meine vollumfängliche Aufmerksamkeit genoss, weil meine Sinne noch damit beschäftigt waren, mein Ziel bei diesen Sichtverhältnissen genau zu erkennen, als – und genau jetzt melden sich Zweifel an – etwas aus dem Eimer schwappte, das wie eine menschliche Hand aussah. Und meine Intuition scheint das Bild zu konkretisieren, denn ich schließe aus dem Bauch heraus aus, dass es sich um die Hand eines erwachsenen Mannes handelte. Und auch bin ich genauso sicher, dass meine Sinne mir einen, wie man so schön sagt, Streich spielten. Das Verhältnis von mir und Kapitän Braun war nicht das Beste und führte dazu, dass ich ihn im umgangssprachlichen Gebrauch für alles verantwortlich machte. Ausgelöst hatte dieses Denken die Mannschaft. Als Ludwig kurz hinter England bei der Deckpflege einen Eimer mit Wischwasser umstieß und mit sich schimpfte, beschwichtigte ihn Georg und sagte, das sei bestimmt Brauns Hand gewesen, die den Eimer umkippen ließ, und wenn das nicht reichte, hätte die Mannschaft der Sirene Wind geblasen und die Frauen ihre Röcke gehoben, um damit Sturm zu fächeln. Was im Scherz begann, verfestigte sich zunehmend, und ehe Heinrich und ich es als das erkannten, was es war, nämlich Angst, war es schon zu spät. Wir konnten es durch Ansagen unterbinden, doch dann wurde im Geheimen geflüstert. Daher kann ich annehmen, dass mir meine Sinne durchaus einen Streich gespielt hatten, gespeist aus einer kollektiven Angst, die uns ergriffen hatte.
»Na ja, es ist wie es ist«, schloss Heinrich sodann seine Beobachtungen und ich tat es ihm gleich. Die Hand erwähnte ich mit keinem Wort.
Unser Smutje legte sich tagsüber schon ins Zeug und es roch bereits zur Morgenwache lecker nach Bratkartoffeln, Eiern mit Speck und Fischsuppe; Köstlichkeiten für die anstehende Einfahrt ins Polarmeer. Und auch unser gewähltes Festkomitee, bestehend aus dem erfahrenen Dr. Westermann, den Vollmatrosen Fiete und Wilfried sowie dem Schiffsarzt Dr. Wernecke, der großen Gefallen daran fand, sich neckische Späße auszudenken, um die Greenhands zu erschrecken, stand bereit. Den Karten, dem Wind und dem Wetter nach würden wir das Polarmeer zwischen der vierten und der fünften Stunde des Nachmittags passieren. Ich spürte, wie die Stimmung stieg, aber auch die Anspannung, denn für jeden Seefahrer war das auch nach einem Dutzend Malen ein besonderer Moment. Die Teutonia und die Morgenröte fuhren auf Sichtweite nebeneinander, und wieder und wieder scherzten die beiden Mannschaften miteinander, auch wenn die See etwas rauer wurde. Zur dritten Nachmittagsstunde schenkte ich als Kapitän heißen Kaffee aus, sah wie Dr. Westermann, Fiete und Wilfried unter Deck verschwanden, um sich vorzubereiten, und wartete auf das Signal des zweiten Kapitäns, Ernst Weddelbrook, der genau überprüfte, wann die Überquerung stattfand. Auf seinen Zuruf warteten alle gespannt, während wir den Kaffee mit etwas Rum verdünnten und ihn in der Kälte zu uns nahmen.
»Jetzt!«, schallte es aus der Kapitänskajüte und Weddelbrook stürmte an Deck. Ich winkte zur Morgenröte hinüber und Gerhardt, als Kanonier und Salutgeber bestimmt, gab einen Kanonenschuss backbord ab. Nachdem uns das Klingeln in den Ohren verlassen hatte, applaudierten wir, und die Männer, die das Ritual kannten, blickten gespannt zu den Deckaufgängen am Bug und achtern. Unsere Greenhands, Dr. Ganz, Jürgen und Konrad ließen wir indes bei uns in der Mitte stehen und hielten sie gut unter Beobachtung, denn sie waren nicht eingeweiht und alle wollten sich an ihrer Überraschung erfreuen. Am Bug erschien als erstes der launische Poseidon mit weißem Bart und einem zwei Schritt langem Dreizack. Selbst ich war von der Verkleidung überwältigt, wusste ich doch im ersten Moment nicht, ob es sich um den großgewachsenen Dr. Westermann oder um unseren Hünen aus Husum, also um Fiete, handelte. Wilfried konnte es nicht sein, denn der tauchte als nächster am Heck auf. Mit grau schillernder Farbe und einer ebensolchen Rückenflosse stellte er einen Delphin dar, der den Schiffbrüchigen in tosender See Hilfe angedeihen lassen sollte. Die Greenhands standen dort mit offenen Mündern und starrten auf die sich ihnen nähernden Gestalten. Einige Matrosen trugen drei Stühle in die Mitte des Decks und baten die Greenhands sich dort zu setzen. Friedlich folgten sie der Aufforderung und leisteten noch keinen Widerstand, aber ich muss gestehen, Konrads und Dr. Ganz’ Blicke ließen beinahe etwas anderes erwarten.
»Nun soll es so sein!«, grollte Poseidon mit drohender Stimme und schritt auf die Drei zu. Der Delphin Wilfried indes hatte die auf den Stühlen Sitzenden erreicht, verteilte längliche Tücher und forderte sie auf, sich die Augen damit zu verbinden, denn der Anblick des göttlichen Poseidon aus der Nähe sei für normal Sterbliche, die noch nicht den Polarkreis überquert hätten, nur schwer zu ertragen. Manch einer hätte seinen Verstand verloren und sei freiwillig ins Meer gestürzt. Jürgen und Konrad zögerten nur kurz und verbanden sich dann die Augen, wahrscheinlich hatten ein oder zwei an Bord doch nicht ganz dichtgehalten, und sie vertrauten auf die Äußerungen der Männer. Dr. Ganz hingegen war das Spektakel nicht geheuer, sein Mund öffnete und schloss sich und ich erwartete schon Widerworte, doch dann fügte er sich seinem Schicksal und verband sich die Augen. »So testet einmal, ob diese Herren und Jungmänner noch etwas sehen können«, forderte Poseidon auf und zwei Männer sprangen herbei und täuschten Schläge vor den verbundenen Augen der Delinquenten vor. Ich glaube, Dr. Ganz hat etwas sehen können, doch er zeigte sich so beherrscht, dass die Männer es ihm durchgehen ließen. Nun kam der Barbier mit einem Eimer Schaum und seinem Werkzeug an Deck. Ich musste lachen, denn es war unser Fiete, der trällernd und flötend die Häupter unserer Greenhands einseifte, sich hinter sie stellte und von einem zum anderen schritt, zum Rasieren ansetzte, eine Hand ans Ohr legte und die Reaktion der Besatzung abwartete. Das lauteste Johlen erscholl, als er zum zweiten Mal hinter dem guten Dr. Ganz stand, der nun sichtlich in Angst auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Fiete begann den Doktor zu scheren, wie es guter Brauch war, presste ihm dann ein Rohr auf den Mund und Poseidon verkündete, ihm nun das edelste aller Getränke des Meeres einzuflößen und Dr. Ganz solle seinen Mund öffnen. Anschließend goss Fiete Salzwasser in das Rohr und der arme Dr. Ganz begann zu prusten. Fiete nahm ihm das Tuch ab, die Männer klopften sich vor Lachen auf die Schenkel und deren Erheiterung wurde durch den dösigen Blick des Doktors noch verstärkt, der jetzt einen Becher guten Rums ausgehändigt bekam und ins allgemeine Gelächter mit einstieg. Anschließend besah er sich dasselbe Procedere beim Matrosen Jürgen und unserem Leichtmatrosen Konrad. Eine unglaubliche Chuzpe, wie unser Küken das Ritual über sich ergehen ließ. Beim Einflößen des Poseidon-Getränks ließ er sich den Mund volllaufen und stieß es dann wie ein Wal durch das Rohr und nässte Fiete ein. Das Gelächter war groß und Fiete ertrug es mit Fassung, nahm Konrad in den Schwitzkasten und verpasste seinem Kopf mit den Fingerknöcheln eine Abreibung. Damit war die Polartaufe für unsere Greenhands abgeschlossen und sie bekamen ein jeder von uns eine Wollmütze, damit sie ihre kahlrasierten Schädel gegen die drohende Kälte schützen konnten. Gerhardt holte alsbald seine Fidel heraus, spielte fröhliche Lieder und Leupertz begleitete ihn nach dem zweiten Lied mit einer Maultrommel. Zwei weitere Becher Rum und Fiete begann wie ein Kosak zu tanzen. Ich zog mich zurück und löste meinen zweiten Kapitän am Steuer ab. Im Osten zeigte sich ein nachtschwarzes Wolkenband am Horizont. Im Nordwesten versank die Sonne und malte die Wogen in flüssigem Gold. Heinrich winkte mir aus der Ferne zu. Auch er hatte nun das Kommando übernommen und ließ seine Mannschaft feiern. Ich versuchte mich an meine Polartaufe zu erinnern, als ich einen Knall hörte. Es klang, als hätte jemand direkt neben meinem Ohr eine Kanone gezündet. Tatsächlich taumelte ich zwei Schritte zurück und hielt mir aus einem Reflex heraus die Ohren zu. Ein Blick auf das Unterdeck zeigte, dass es der Besatzung nicht anders erging. Fiete fiel wie ein geschlagener Baum auf die Planken und beinahe hätte Leupertz seine Maultrommel ins Meer geschleudert. Ich suchte am Horizont nach der Sirene, nahm mein Fernrohr zur Hilfe, doch egal wie sehr ich mich anstrengte, es waren nur Heinrich und ich auf dem weiten Ozean unterwegs. Braun und seine Sirene waren die letzten Tage nach Belieben aufgetaucht und hatten sich nicht an Absprachen gehalten. Heinrich und ich hatten uns darauf verständigt, damit leben zu müssen.
»Dr. Westermann, welches physikalische Phänomen könnte dafür verantwortlich gewesen sein?«, rief ich ihm zu. Erst jetzt entledigte er sich seiner Verkleidung und nahm sich den wallenden Bart aus dem Gesicht. »Mir fällt auf die Schnelle keines ein, Kapitän!«, antwortete er in einer Manier, als sei er immer noch ein Meeresgott. Die Blicke der Männer huschten zwischen mir und dem Doktor hin und her. Fiete stand stöhnend wieder auf. Ich ließ meinen Blick schweifen und atmete die Stimmung an Bord ein, wie es die Aufgabe eines Kapitäns zur See war. Diese Stimmung, und das erfreute mich in diesem Augenblick, war weitaus gelöster, als ich es vermutet hatte. Vielleicht schloss ich auch zu sehr von meinem eigenen Befinden auf das der Mannschaft, denn diese, danach sah es aus, schien an der konkreten Ursache für diesen Knall gar nicht interessiert zu sein. Vielleicht hatte ein jeder mal ein Wetterphänomen erlebt, das ähnlich war. Kein Grund zur Beunruhigung. Wenn ich mich besann, fielen auch mir welche ein, die einem Wetterleuchten vorausgegangen waren. »Musik und Prost!«, rief ich und die Mannschaft verfiel augenblicklich wieder in eine ausgelassene Feierstimmung. Wenige Momente später begeisterte Fiete alle mit seiner Darbietung, als tanzender Kosake keinen Schluck aus seinem gut gefüllten Becher zu verschütten, den er mit ausgestreckten Arm vor sich hielt. Ich weiß noch, wie ich ausatmete, als müsse ich die ganzen in mich aufgesogenen Gemüter wieder aus mir entlassen. Die Anspannung wich und sofort kehrte sie wie ein Kaventsmann zurück, als das Schiff von einem Stoß erfasst wurde, als wären wir bei starkem Achterwind unter vollen Segeln und unter Dampf aus allen Rohren gegen einen Eisberg gefahren. Es gab kaum jemanden, der sich auf den Beinen halten konnte, und ich befürchtete die eine oder andere Verletzung, hoffte aber inständig, dass sich niemand einen Knochen gebrochen hatte. Ich selbst prellte mir den Brustkorb am Ruder, wurde dann hin und her geschüttelt und stieß mir den Ellenbogen an einer Backskiste mit Tauen hinter mir. Verwirrt kam ich wieder hoch, sah hinüber zum Ausguck am Klüver, dessen Besatzung sich den Kopf hielt und diesen verneinend schüttelte. Er hatte nichts sehen können. Ich drehte mich, beugte mich über die Reling und suchte die Wasseroberfläche nach etwas ab, dass diese durchstieß. Genauer gesagt, ich suchte nach einem Eisberg, der hier eigentlich noch gar nicht hätte treiben dürfen. Luft- und Wassertemperatur zeigten noch lange kein Eis an. Es sei denn, es hätte sich ein gigantischer Berg gelöst, der bis hierhin noch nicht gänzlich geschmolzen wäre. Doch dessen Ausmaß mochte ich mir nicht vorstellen. Nein, ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber ich konnte auch nichts in den Wellen erkennen. Die Schreie und Rufe der Mannschaft musste ich erst einmal ignorieren, denn in diesem Moment ging es darum, zu erkennen, was uns gerammt hatte und vor allem, ob wir ein Leck hatten und uns immer noch in Gefahr befanden. Ich rief Wilhelm, den Maat, zu mir und befahl ihm, unter Deck nach einem Leck suchen zu lassen und gleichzeitig sollte er ein Beiboot klar machen lassen. Steuerbord, Backbord. Nichts.
»Es könnte ein Wal gewesen sein«, wollte Leupertz eine Erklärung für den Stoß liefern und erntete einen verächtlichen Blick meinerseits, für den ich mich später entschuldigte. Was für ein Wal hätte der Teutonia, einem mit Bleiwänden verstärkten, unter Dampf fahrenden Dreimaster, solch einen Stoß versetzen können? Bang wartete ich auf Antwort von Unterdeck und sah hinüber zur Morgenröte, die ungefähr einhundertzwanzig Schritt neben uns auf gleicher Höhe gefahren war. Auch sie war mit etwas kollidiert, wie ich an dem chaotischem Treiben an Deck dort erkennen konnte. Entweder waren es also zwei Objekte, die uns gerammt hatten oder ein sehr großes. Waren es zwei, so musste es ein sehr großer Zufall gewesen sein, dass diese sich nebeneinander befunden hatten; es sei denn, sie wären miteinander verbunden, was bedeutete, dass man es auch als ein großes Objekt betrachten konnte. Ein großes Objekt, dessen bin ich mir sicher, hätte ich unter der Wasseroberfläche erkennen müssen. Schattierungen, Kontraste, so etwas wäre mir nicht verborgen geblieben. Ich musste also denken, dass es zwei ausreichend große Objekte waren, die uns mit dieser Wucht gerammt hatten. Zwei Objekte, die zufällig nebeneinander trieben …. Ich musste schlucken, als ich mir meiner Erkenntnis bewusst wurde. Es war unwahrscheinlich, dass wir zufällig mit zwei Objekten zusammenstießen. Viel wahrscheinlicher war, dass uns etwas bewusst rammte. Angriff. Ein Wal, wie Leupertz es angedeutet und ich es für unvorstellbar und auch naiv gehalten hatte. Wie groß musste so ein Wal sein, der uns mit solch einer Wucht rammen konnte?
»Kein Leck gefunden, Kapitän!«, meldete sich Wilhelm und sorgte für eine erste Erleichterung bei mir. »Andere Schäden?«, wollte ich von ihm wissen.
»Nichts, was wir nicht beheben können«, antwortete er, deutete auf Karl, unseren Schiffszimmerer, der ein Nicken andeutete.
»Wissen Sie, was uns gerammt haben könnte?«, fragte ich Wilhelm und sah an seinem Gesicht, dass er sich mit der Antwort sehr schwertat. Seine Kiefernmuskeln bewegten sich und seine Stirn kräuselte sich. »Nein, Kapitän.« Er kam einen Schritt näher an mich heran, stand seitlich vor mir. »Die Männer sagen, es könnte ein Riesenkrake gewesen sein.« Ich hatte es beinahe befürchtet und nickte Wilhelm zu, der mich weiterhin ansah, als würde er es selbst glauben.
»Weitermachen!«, befahl ich den Männern, wandte mich ab und suchte Ruhe für Gedanken in meiner Kajüte.
04. April 1878: 63° 38' nördliche Breite; 7° 13' westliche Länge; 10 Knoten, Süd bei 800 Faden Tiefe, steiniger Grund
Nach dem gestrigen Unwetter war es eine ruhige Nacht bei ruhiger werdender See. Ich saß über meine Karten gebeugt und sann verschiedenen Routen nach der Insel Jan Mayen nach. Auch oder gerade im Hinblick auf die Unzuverlässigkeit der Sirene