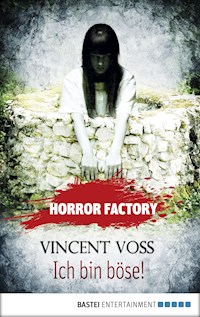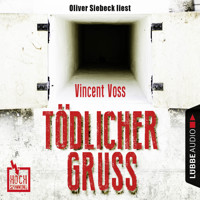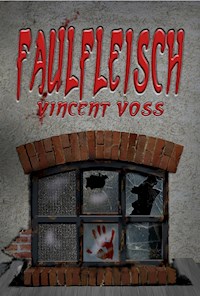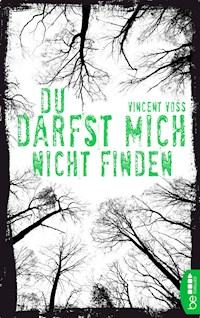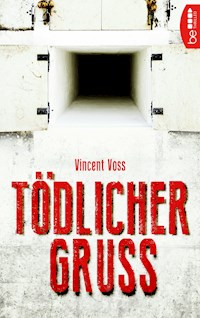Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Flüchtlinge gibt es nicht nur im Hier und Heute, sondern auf fernen Planeten, in der Zukunft, unter Wasser, in alternativen Welten, unter Drachen und Einhörnern. Zumindest wenn man den Autor:innen dieser Anthologie glauben darf. Eins ist allen Geschichten gemein: Sie unterhalten, ohne zu belehren, und sie gehen ans Herz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marianne Labisch (Hrsg.)
StrandgutAnthologie
Mit einem Vorwort von Jacqueline Montemurriund Einleitungen von Michael K. IwoleitIllustrationen von Uli Bendick und Mario Franke
Originalausgabe
© 2024 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage März 2024
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Unsere Bücher kann man auch abonnieren!
Layout:www.benswerk.com
Cover-Illustration: Mario Franke
Illustrationen: Uli Bendick, Mario Franke
Lektorat: Klaus Farin
ISBN:
PRINT: 978-3-98857-054-3
EPUB: 978-3-98857-055-0
PDF: 978-3-98857-056-7
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/
INHALT
Vorwort
Vincent Voss: Die Geschichte von zwei Reisen
Arno Endler: Rote Nase
Aiki Mira: Was wir im Traum einander antun
Regina Schleheck: Rosinenpicken
Friedhelm Schneidewind: Rebell aus Liebe
Heidrun Jänchen: Ausreißer
Yvonne Tunnat: Das ist hier nicht Bullerbü
Achim Stößer: Stürzender Stern
Rudolf Arlanov: Die Verstoßenen
Veith Kanoder-Brunnel: Die Tiere vor den Fenstern
Karsten Lorenz: Ein paar Minuten noch
Monika Niehaus: Kneipenasyl
Anke Höhl-Kayser: Tiefes Wasser
Janika Rehak: Hashtag #back_to_normal
Ansgar Sadeghi: Manuels Worte und Imaras Geschichten
Michael Tinnefeld: Livorno sehen und …?
Michael Schmidt: Segmentfäule
Jol Rosenberg: Ankommen
Jacqueline Montemurri: Hoffnungs-Tief
Marianne Labisch: Hope
Nachwort
Vitae Iwoleit, Bendick und Franke
VORWORT
Als Marianne Labisch mich fragte, ob ich ein Vorwort zu einer Anthologie zum Thema »Flüchtlinge« schreiben möchte, war ich überrascht und erfreut zugleich. Eigentlich hatte ich immer versucht, meine beiden Leben als Flüchtlingsberaterin und Autorin voneinander abzugrenzen. Doch tief in mir drin war schon längst der Wunsch geboren, mich auch im Science-Fiction-Bereich einmal mit dem Thema Flucht zu beschäftigen. Denn als Autorin in diesem Genre befasst man sich schließlich mit den Themen der Zeit. Das ist den wenigsten Menschen bewusst, wie ich aus zahlreichen Gesprächen entnehmen konnte. Die meisten Leser:innen in Deutschland machen um die Science-Fiction im Buchladen einen Bogen, da sie meinen, es geht darin nur um Weltraumschlachten und Aliens. Natürlich haben diese Themen ihre Berechtigung; doch SF ist so viel mehr. Sie beschäftigt sich mit sehr vielfältigen Themen und Problemen der heutigen Zeit und extrapoliert sie zum Teil in die Zukunft oder in andere Welten. Und eins dieser brandaktuellen Themen ist nun mal Migration und Flucht, da es uns tagtäglich vor Augen geführt wird. Das Thema spaltet die Gesellschaft, denn die einen möchten den Menschen, die zu uns kommen, helfen, sich zu integrieren und ein neues Leben zu beginnen, und die anderen fühlen sich von den fremden Kulturen bedroht, sehen sie als Schmarotzer und sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge.
Wie sollen wir also mit dem Thema umgehen? Schauen wir uns doch einfach mal in der Welt um: Fast 7,9 Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten … und fast jeder 80ste davon ist auf der Flucht. 100 Millionen Menschen auf der Flucht! 100 Millionen Menschen haben ihre Heimat verlassen, weil sie im »goldenen Westen« – in den reichen Industriestaaten – gern als »Schmarotzer« des Sozialsystems leben wollen. Dies zumindest ist das Vorurteil jener, die sich bedroht fühlen in ihrer Existenz und in ihrer Lebensweise, wenn Menschen in ihrem Land Zuflucht suchen. Aber ist das so?
Menschen, die sich aufmachen, ihre Heimat zu verlassen, ihre gewohnte Lebensweise, ihre Familie, das Land ihrer Eltern, tun dies stets aus einem starken Druck heraus. Manchmal ist die Situation für Außenstehende und für die Aufnahmeländer sichtbar und deshalb nachvollziehbar: ein Angriffskrieg wie in der Ukraine, ein Bürgerkrieg wie in Syrien und Afghanistan, Naturkatastrophen wie Erdbeben, Dürren, Flutwellen … Dann ist die Aufnahmebereitschaft und die Hilfsbereitschaft in Deutschland oft groß. Aber Fluchtgründe sind so vielfältig und individuell wie die Anzahl der Flüchtenden. Oft sind die Gründe nicht sofort ersichtlich, müssen im Gespräch in der Flüchtlingsberatung durch das Aufbauen von Vertrauen erst aufgedeckt werden.
Da ist zum Beispiel Nio aus Mali. Schon früh verlor er seine Eltern und gelangte als Kind in Mali in die Sklaverei. Sklaverei von bestimmten Ethnien ist in Mali normal und staatlich nicht verboten. Er schaffte es jedoch, zu fliehen und auf einem weiten und beschwerlichen Weg als Minderjähriger nach Deutschland zu gelangen, wo er sich ein besseres, selbstbestimmtes Leben aufbauen möchte.
Da sind Diayr und Meral, zwei junge Männer aus dem Iran. Ihnen droht dort die Todesstrafe. Weil sie Mörder oder Terroristen sind? Nein, weil sie sich lieben. Homosexualität ist in diesem Land eines der schlimmsten Verbrechen. Doch auch hier in Deutschland sind die beiden zunächst nicht in der Lage, über ihre sexuelle Neigung zu sprechen, da die Angst vor Repressalien groß ist. Erst durch lange Gespräche und das damit aufgebaute Vertrauen schaffen sie es, ihren Fluchtgrund preiszugeben und sich zu outen. Und ja, auch hier bei uns, wo sie zwar rechtlich geschützt sind, erleben sie bezüglich ihrer Homosexualität negative Reaktionen ihrer Mitmenschen, mit denen sie zurechtkommen müssen.
Sarah aus Guinea ist mit ihren beiden Töchtern nach Deutschland gekommen. Sie möchte ihnen das Schicksal ersparen, das ihr selbst zuteilwurde. In Guinea, Somalia und Kenia ist nämlich die Beschneidung von Frauen ein Initiationsritus. Dabei werden die Geschlechtsteile, besonders die Klitoris, zerstört, damit die Frau keine sexuelle Lust verspüren kann. Sarah hat alles zurückgelassen – die Familie, die gewohnte Umgebung, ihre bescheidene Habe –, um ihren beiden Töchtern ein normales Leben als Frau zu ermöglichen.
Diese Liste könnte ich noch unendlich weiterführen, denn die beschriebenen Menschen sind alle Beispiele aus meinem Alltag in der Flüchtlingsberatung; nur habe ich aus persönlichkeitsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Gründen die Namen geändert.
Letztendlich geht es für jeden einzelnen Menschen immer darum, eine Möglichkeit zu finden, ein menschenwürdiges Leben zu führen und den Kindern eine Zukunftsperspektive zu bieten. Nur weil die Flucht nicht unmittelbar mit Krieg zu tun hat, nennen wir diese Menschen Wirtschaftsflüchtlinge. Menschen fliehen nicht nur wegen Krieg und Verfolgung, sondern auch vor Armut, Perspektivlosigkeit und Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. Aber auch in den Aufnahmeländern leben sie oft nicht in der erhofften Sicherheit. Wenn der Fluchtgrund nicht anerkannt wird, verharren sie in ständiger Angst, nachts von der Polizei aus dem Bett gezerrt und in ihr Herkunftsland zurückgeschickt zu werden. Falls sie zu den Glücklichen gehören, denen Asyl zuteilwird, sind sie trotzdem oft den Vorurteilen ihrer Mitmenschen ausgesetzt, weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion haben. Alltagsrassismus ist an der Tagesordnung.
Bei vielen Fluchtgründen müssen wir – die Industriestaaten – uns an die eigene Nase fassen, weil wir indirekt die Auslöser der Flucht sind. Wir liefern zwielichtigen Staaten Waffen, wo die Regierungen sie gegen das eigene Volk einsetzen, verschiffen unseren Müll in arme Länder, EU-subventioniertes Gemüse überschwemmt afrikanische Märkte und nimmt den ortsansässigen Bauern ihre Lebensgrundlage … Schließlich lässt auch der Klimawandel, der hauptsächlich durch die Industriestaaten vorangetrieben wird, schon seit vielen Jahrzehnten den Äquatorbereich in Afrika mehr und mehr zur Wüste werden. Ich zitiere mal aus dem Film Lawrence von Arabien:
»In der Wüste ist gar nichts. Und kein Mensch braucht gar nichts.«
Wenn die Bedingungen zerstört sind, um sich selbst zu versorgen und die eigene Familie zu ernähren, dann ist der Prozess nicht mehr umkehrbar. Die Menschen sind gezwungen, sich einen anderen Lebensraum zu suchen, was auf unserer überbevölkerten Erde schwer ist.
In dieser Anthologie spüren viele namhafte SF-Autor:innen diesem komplexen Themenbereich der Flucht nach. Sie extrapolieren die Probleme in andere Zeiten und Welten, um sie dann in den richtigen Fokus zu stellen. Auch in diesen Geschichten geht es um Menschen oder andere Wesen, die ihre Heimat in der Hoffnung auf ein besseres Leben verlassen, aber in den meisten Fällen erneut in Angst, Unterdrückung und Ausbeutung landen.
Ich hoffe, dass der Mensch sich irgendwann besinnt, dass nicht Macht, Finanzen, Rohstoffe und Landgewinn der Sinn des Lebens sind, sondern dass jeder Mensch ein freies, selbstbestimmtes und würdevolles Leben leben kann. Aber wahrscheinlich ist dieser Wunsch nur Science-Fiction.
Jacqueline Montemurri
Es gibt wenig, was den Durchschnittsbürger in der relativen Sicherheit und Stabilität einer westlichen Industrienation so sehr schreckt wie die Befürchtung, dass etwas vom Elend der Welt vor die eigene Haustür schwappen könnte. Das Foto des zweijährigen syrischen Jungen Alan Kurdi, der 2012 ertrunken an die türkische Mittelmeerküste angeschwemmt wurde, ist zum zwiespältigen Symbol für einen Fluchtweg verzweifelter Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten geworden: das Mittelmeer, das Panikmacher und Rechtspopulisten in beispielloser Ignoranz und Verlogenheit zum Einfallstor einer regelrechten Invasion ins goldene Europa aufgebauscht haben. In Vincent Voss’ Erzählung, die zahlreiche Schicksale und Geschichten kunstvoll miteinander verwebt, macht ein Fischer an der portugiesischen Mittelmeerküste unversehens Karriere als Geschichtenerzähler, und nicht selten liefert Strandgut, das einst Flüchtlingen gehörte, die Inspiration für seine anfangs frei erfundenen Geschichten, die immer mehr an Präsenz und Wirklichkeit gewinnen. Was er über die Menschen herausfindet, deren individuelle Leben in der Masse der Verschollenen, Verunglückten und Misshandelten untergegangen sind, wirft Schlaglichter auf die wahren Hintergründe der Flüchtlingskrise – und was wir damit zu tun haben.
DIE GESCHICHTE VON ZWEI REISEN
Vincent Voss
Mein Name ist José Garcia Goncalves, ich bin 49 Jahre alt, war mehr als 20 Jahre Fischer, bin dann Strandgutsammler, Geschichtenerzähler und Bestatter geworden. Als Geschichtenerzähler verdiene ich seit nunmehr fünf Jahren mein Geld und verdiene gut. Ich erzähle Geschichten über den Tod und die Zeit darüber hinaus. Das ist das, was die Leute hier im Süden an der Küste interessiert, wenn sie in ihren Hotelenklaven nach Entspannung und Abenteuern mit Lokalkolorit suchen. Wenn sie Hummer in Knoblauchsauce essen, Portwein trinken und ihnen nach Zerstreuung und fremder Kultur verlangt. Es geht um das Mittelmeer und um all die verstorbenen Menschen darin. Um ihre Geister, die zu einem weltweit bekannten Phänomen geworden sind, ähnlich dem Seeungeheuer von Loch Ness. Über 125.000 Menschen sind darin ertrunken. 125.000, deren Leichen geborgen werden konnten; man kann davon ausgehen, dass es weitaus mehr Tote sind.
Wann genau das mit den Geistererscheinungen begann, lässt sich nicht recht festmachen, aber ich mutmaße, dass es in den späten 2030ern war und mit dem Schicksal der La Laguna zusammenhing. Ein ehemaliger Frachter mit über 500 Menschen aus dem Sudan, dem Jemen und Eritrea. Alte, Frauen, Kinder, die es bis zur Küste geschafft hatten und jetzt all ihre Hoffnung und ihre Gebete in eine reibungslose Überfahrt legten. Griechenland, Italien, Portugal und sogar die Kanarischen Inseln wiesen die La Laguna auf einer wochenlangen Tortur ab, und die ersten Menschen starben auf dem Schiff. Zwar gab es Unterstützung von mehreren NGOs, die das Schiff mit Medikamenten und ärztlicher Unterstützung versorgten, dennoch waren die Zustände dramatisch. Über das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik ist damals ausreichend berichtet worden, die Bilder der sterbenden Kinder an Bord des Schiffes waren entsetzlich, aber ehe die EU sich zu einem gerechten Verteilungsschlüssel der Geflohenen auf die verschiedenen Länder durchringen konnte und die Menschen gerettet werden konnten, sank das Schiff in einem Herbststurm vor der Küste Frankreichs – und mit ihm das europäische Gewissen, das Europa sich bis dahin noch in der Flüchtlingspolitik bewahrt hatte. Und danach begannen die Geschichten von der La Laguna.
Als Erstes berichteten die Fischer darüber. Von Schreien und Klagen aus dem Nebel, von blinkenden Positionslichtern, ehe man die abgeblätterte weiße Farbe des Schiffsnamens erkennen konnte: La Laguna. Und langsam zog das dunkle Schiff, das übrigens nie geborgen wurde, an den Fischern vorbei. Was die Geschichte zu einer wirklich guten Geschichte werden ließ, einer Geschichte, der man glauben konnte, war, dass sie unabhängig voneinander an verschiedenen Orten gleichzeitig erzählt wurde. Und immer dort, wo die La Laguna in einem Hafen um Hilfe gebeten hatte.
Sie fragen sich sicherlich, ob ich deswegen Geschichtenerzähler geworden bin. Ja und nein. Ich habe vorher immer bei uns im Valle Gran Rey, einem kleinen Fischerstädtchen, das aufgrund seiner idyllischen Lage in einer kleinen Bucht am Hang einer Steilküste mehr und mehr Touristen anzog, abends Geschichten in meiner Stammtaverne La Vida erzählt. Alte Sagen und Märchen und ein paar ausgedachte Geschichten über die Seefahrt und die Fischerei. Manolo, der Wirt, stellte fest, dass immer, wenn ich Geschichten erzählte, mehr Gäste anwesend waren, und er fragte mich, weil er wusste, dass ich mich mit Sprachen, vor allem Englisch und Deutsch, leichttat, ob ich nicht auch einmal in der Woche Geschichten für die Touristen erzählen wollte. Er offenbarte mir seinen gewöhnlichen Umsatz eines Wochentages und schlug mir vor, die Hälfte des zusätzlichen Gewinns mit mir zu teilen. Ich vertraute Manolo und ließ mich auf das Geschäft ein. Und es funktionierte. So gut, dass ich mir ein Repertoire an Geschichten für jeden Wochentag aneignete. Ich fischte nur noch, weil ich die See liebte, aber mein Geld verdiente ich als Geschichtenerzähler.
Inspiration holte ich mir auf langen Strandgängen, für die ich jetzt Zeit hatte. Nach Norden ging ich die Küste oft bis zum kleinen Leuchtturm in Targuirra, ungefähr neun Kilometer. Dieser Strandabschnitt war wenig erschlossen, vor allem touristisch. Und das obwohl er in meinen Augen wunderschön war. Immer noch paarte sich hier der raue Atlantik mit dem gemäßigten Mittelmeer, die Steilküste ragte erst nach 40 bis 50 Metern feinem, fast weißem Strand auf, einige Felsformationen bildeten Höhlen und kleine schattenspendende Überhänge. Da nur kleine Trampelpfade und selten ein landwirtschaftlich genutzter Feldweg bis zur Küste führten, war dieser Strandabschnitt nur Einheimischen oder Insidern bekannt, oft jungen Familien oder Paaren, die manchmal für Tage in einer Höhle Unterkunft fanden, auf offenem Feuer kochten und den Tag einen lieben Tag sein ließen.
Anfangs hat mich Politik noch wenig geschert. Mein erträgliches Auskommen mit Seemannsgeschichten, mein neues Leben als Berühmtheit einer kleinen Küstenstadt, eine glückliche Frau, zwei große Kinder – ich würde sagen, das Leben meinte es verdammt gut mit mir. Auf meinen Strandspaziergängen las ich immer öfter Strandgut auf, und eine dunkelbraune, antik aussehende Rumflasche mit verwittertem Etikett, auf dem man mit etwas Fantasie ein Piratenschiff erkennen konnte, weckte die Muse in mir. Noch auf dieser Wanderung ersann ich eine Piratengeschichte, und die gefundene Rumflasche stand im Mittelpunkt dieser Erzählung. Und während ich sie dann meinem Publikum vortrug und die Flasche zum Ansehen herumreichte, erntete ich ein erstauntes Raunen. Die Geschichte war an sich schon gut, aber so wurde sie anfassbar, beinahe zu einem Erlebnis. Ich beschloss, immer wieder nach passendem Strandgut Ausschau zu halten und mir dazu eine Geschichte auszudenken. Und was sich am Strand alles finden ließ! Kisten, Truhen, alte Flaschen, Fischernetze, zerrissene Taucheranzüge, Werkzeug, aber der Höhepunkt war ein von Muscheln bewachsener, echter Totenschädel, den ich unter einer Felsplatte, halb im Sand begraben, gefunden hatte. Und schon hatte ich einen echten Piratenkapitän für eine weitere Geschichte, in die ich auch die Flasche Rum einwob.
2014. Im November fand ich kurz hinter dem Trampelpfad nach Garancha, direkt am Strand in den heranrollenden Wellen, etwas Rotes, das von jeder Welle auf den Sand getragen und von jeder nächsten wieder ins Wasser gespült wurde. Meine Neugier war erwacht und ich eilte dorthin, um das Fundstück dem Atlantik zu entreißen. Es war ein Schuh. Ein roter Kinderschuh. Ein kleiner roter Mädchenschuh, und dem Schuh als Begleiter taumelte ein Stofftier, ein Hase in den Wogen.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich erfasste, dass es sich bei dem Schuh nicht unbedingt um den Schuh eines kleinen Mädchens gehandelt haben muss, der bei einem Familienurlaub am Meer einfach vergessen wurde. Er und Mr. Rabbit, das Lieblingskuscheltier. So etwas vergessen Mama und Papa nicht einfach. Vielmehr stellte ich mir mit der Wucht eines Geschichtenerzählers den Untergang eines Schlauchbootes vor, Vater und Mutter, die versuchten das kleine zweijährige Mädchen über Wasser zu halten. Das vielleicht vor Angst strampelte, einen Schuh und in der Panik sogar noch ihr Kuscheltier verlor, das sie die ganze Zeit über als Beschützer begleitet hatte. An diesem Tag unterbrach ich meine Wanderung zu meinem eigentlichen Ziel, kehrte um und erzählte auch keine Geschichte mehr. Stattdessen baute ich im Garten unseres kleinen Hauses eine Art Unterstand aus Holz und legte dort die Fundsachen ab. Auf einem verwitterten Holzbrett brannte ich mit Glut das Datum und den Fundort in das Brett und stellte es vor den Schuh und Mr. Rabbit. Und ich muss sagen, dass sich mit dem 14. November 2014 der Kurs meines weiteren Lebens verändern sollte.
Charles Dickens hat einmal gefragt, ob es eine bessere Form gibt, mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor. Ich versuchte dies, obgleich mich der rote Schuh und der Stoffhase in meinen Träumen verfolgten. Ich rief auffällig oft meinen Sohn in Lissabon und meine Tochter in Porto an und erkundigte mich nach ihnen, sagte ihnen, wie sehr ich sie liebte und dass wir sie vermissten. Später erzählte mir meine Frau, dass Maria und Pablo sie anriefen, um zu fragen, ob ich eine schwere Krankheit hätte.
Ich erzählte in diesen Tagen eher lustige Geschichten, obwohl mein Herz ein sehr, sehr trauriges war. Und mit der Zeit veränderte ich mich, und meine Geschichten veränderten sich mit mir. Ich las viel in den Zeitungen von den Menschen, die vorwiegend aus Afrika zu uns kamen, die Gründe ihrer Flucht, die Gefahren, die auf sie lauerten, und von den erschwerten Fluchtrouten, die die Menschen an und ins Mittelmeer trieben. Auf meinen Strandgängen hielt ich jetzt vermehrt Ausschau nach Fluchthinterlassenschaften von durch das Mittelmeer geflüchteten Menschen und wurde immer häufiger fündig, vor allem, wenn ich ab Sagres die Mittelmeerküste hinauf wanderte. Kleidungsstücke, Schuhe, Spielzeug. Einmal fand ich das Portemonnaie eines jungen Mannes aus Afghanistan, wie man mir nachträglich erklärte. Die sogenannte Tazkira wies ihn als Nasrullah Nezami aus, und er war gerade 18 Jahre alt. Mein kleiner Unterstand im Garten wurde zu einem kleinen Museum erweitert und meine Frau bot mir ihre Hilfe beim Arrangement an; sie hat eindeutig ein besseres Händchen als ich dafür.
Im Sommer 2015, zu Beginn der Ferienzeit, erzählte ich an einem Samstagabend zuerst eine klassische Piratengeschichte des fiktiven Kapitäns Manolo Goldzahn, der um Sagres sein Unwesen getrieben hatte, und wie ihm die Menschen mit einer List beigekommen waren. Zur Ansicht ließ ich den Totenschädel herumgehen, und wie immer beobachtete ich die vielen Kinder, die jetzt an ihre Eltern die Frage richteten, ob der Schädel und somit auch die Geschichte wahr sei. Anschließend trug Luis etwas Saudade vor, melancholische Klänge unseres oft gequälten und unterdrückten Volkes.
Um 22 Uhr hatte ich weitere 25 Minuten Programm, die Familien mit den kleinen Kindern hatten das Restaurant mittlerweile verlassen und die ersten Nachtschwärmer schlürften Cocktails. Ich erzählte eine Geschichte von der zweijährigen Maryam aus Aleppo, die mit ihrer Familie und ihrem Stoffhasen Mr. Rabbit aus ihrem Haus flüchten musste. Ihr Vater betrieb eine Seifenmanufaktur und fertigte handgemachte Seifen aus Olivenöl, die er in alle Welt exportierte, ihre Mutter war Lehrerin an einer Grundschule. Mit ihren beiden älteren Brüdern schafften sie es als Letzte in ein Boot, das sie zur italienischen Insel Lampedusa bringen sollte. Das Schiff kenterte jedoch, und ich beschrieb daraufhin die Reise des Kinderschuhs und Mr. Rabbits. Beides reichte ich dem Publikum, und ich spürte … Widerwillen. Als müsse ich vorher einen schweren Vorhang beiseiteziehen. Danach war es erst einmal still im La Vida. Dann brandete Applaus auf, und ich glaubte, das Schicksal der Menschen wäre den meisten Leuten nahegegangen. Einige bedankten sich im Anschluss auch bei mir. Aber Manolo präsentierte mir an diesem Abend noch den Gewinn und verglich ihn mit den Gewinnen von anderen Samstagabenden, garniert mit Piraten- und Fischergeschichten. Offensichtlich regte die im Mittelmeer ertrunkene Maryam das Publikum nicht zum ausschweifenden Feiern an. Manolo sagte, er fand die Geschichte ausgesprochen gut. Sehr traurig und wichtig, sie sei ihm sehr nahegegangen, aber sie passe nicht zum La Vida. Hör mal, sagte er, allein der Name seines Restaurants, La Vida, das Leben, das passe nicht mit so einer traurigen Geschichte zusammen. Ich sagte ihm, dass ich das sehr schade fände, und erbat mir Bedenkzeit. Ich war auch wütend und unsicher, ob ich überhaupt im La Vida weitermachen wollte. Aber nach drei Tagen und Gesprächen mit meiner Frau ging ich zu Manolo und sagte ihm, dass ich weitermachen würde: Ich würde die Welt nicht retten können, sagte ich mir. Aber sagt sich das nicht jeder? Und wenn nun alle, die die Welt nicht retten können, zusammen die Welt retten?
Ende Sommer 2024 lagen an einem schmalen Strand etwas nördlich der Igreja de Nossa Senhora da Graça an der Atlantikküste 24 angespülte Leichen jeden Alters und jeden Geschlechts auf einem Strandabschnitt von einem Kilometer Länge. Die von mir am weitesten entfernten erkannte ich bloß daran, dass Schwärme von Möwen um sie herum kreisten und sich stritten. Der Gestank war unbeschreiblich, aber als Fischer war man einiges gewohnt, sodass ich mich langsam den Leichen näherte und mich umsah, ob jemand helfen konnte. Allerdings war ich an diesem frühen Vormittag allein. Ich versuchte Isabella, meine Frau, mit dem Smartphone zu erreichen, und nach dem siebten Klingeln nahm sie das Gespräch endlich an. Ohne ihre Wut abzuwarten, weil sie einen Arzttermin hatte und ich sie störte, berichtete ich ihr aufgeregt und bat sie, den Pfarrer der katholischen Kirche und den Bestatter anzurufen und sie augenblicklich herzubitten. Und unsere Bürgermeisterin. Isabella hatte Verständnis und versprach, zu helfen. Ich beendete das Gespräch und begann, die aufgeblähten Wasserleichen im Schatten eines vier Meter hohen Felsens nebeneinander zu legen und gegen die hungrigen Möwen zu verteidigen. Ein ungefähr vierjähriger schwarzer Junge war der jüngste Ertrunkene und eine schwarze Frau die Älteste. Ich schätzte sie auf über 80 Jahre. Ich erinnerte mich an den roten Mädchenschuh und weinte, während ich in der heißen Sonne die letzte Würde der Verstorbenen verteidigte.
Isabella meldete sich, ich legte den angefressenen und aufgedunsenen Leichnam eines arabischen Mannes vorsichtig ab und nahm das Gespräch entgegen. Die Bürgermeisterin würde sofort kommen und den Bestatter einsammeln und mitbringen, damit dieser sich ein Bild von der Lage machte. Die Bürgermeisterin wollte wissen, ob ich schon mit Journalisten gesprochen hätte. Isabella setzte mich über diese Frage, die mir surreal erschien, nur in Kenntnis und hatte an meiner statt geantwortet, dass ich selbstverständlich mit keinen Medienvertretern gesprochen hätte. Nichts würde mir ferner liegen. Nachdem ich alle 24 Leichen geborgen und sie versammelt hatte, suchte ich mir einen Knüppel, um sie gegen die Möwen zu verteidigen. Ich schwitzte und hatte großen Dunst wegen der körperlichen Anstrengung und nichts zu trinken mitgenommen.
Ich musste noch einige Zeit ausharren, ehe ich die Bürgermeisterin Rebelo mit dem Bestatter Morais einen Pfad die Küste hinunterklettern sah. Ich winkte und rief ihnen aus der Ferne zu. Die Bürgermeisterin, eine Kinderärztin im Ruhestand, bekreuzigte sich beim Anblick der Toten, der Bestatter stöhnte, schnaufte dann und fragte laut, wer denn das alles bezahlen solle. Ich warf ihm einen verächtlichen Blick zu, fand dann aber Verständnis für seine Reaktion. Bestatter war sein Beruf, nicht seine Berufung. Die Bürgermeisterin antwortete, dass es da schon einen Weg geben werde, und anschließend beschränkte sich der Bestatter, ein älterer, hagerer Mann mit naturgegebener ernster Miene und grauen Haaren, auf das Jammern, wie er das denn alles bewerkstelligen solle, er jemanden einstellen müsse, es so warm wäre und zu wenig Kühlmöglichkeiten gäbe. Ich hatte ihn bisher nur manchmal auf Stadtfesten gesehen und seine Dienste zum Glück noch nie in Anspruch nehmen müssen. Jetzt schwor ich mir, dass ich niemals sein Kunde werden wollte.
Pfarrer Duarte ließ noch eine weitere Stunde auf sich warten, und in dieser Zeit verstärkte sich der Verwesungsgeruch enorm; ebenso wie der Hunger der Möwen, die immer zahlreicher erschienen und uns umflogen, landeten, von mir verjagt wurden, nur um nach kurzer Zeit einen weiteren Angriff zu wagen. Bürgermeisterin Rebelo telefonierte indes mit ihrer Verwaltung, und Bestatter Morais jammerte ohne Unterlass, nahm grob die Maße der Toten und notierte sie in einem schwarzen Notizbuch. Pfarrer Duarte brachte seinen Küster mit, und nach einer kurzen Betrachtung kam er zu dem Entschluss, dass es sich bei den Toten vornehmlich um nichtchristliche Menschen handelte und er somit eine Bestattung auf dem Gottesanger der Kirche verwehren müsse. Bestatter Morais nickte, er hatte eine solche Antwort wohl geahnt; Bürgermeisterin Rebelo und ich starrten ihn beide gleichermaßen fassungslos an. Wie er das denn wissen konnte, wollte ich von ihm wissen. Er sagte, dass man das mit ausreichender Lebenserfahrung erkennen könne und er dazu befähigt war. Rebelo wollte der Beherrschung willen tief Luft holen, unterbrach ihr Vorhaben dann und fragte, was er denn vorschlagen würde. Der Geistliche überlegte und schwieg, der Küster aber unterbreitete den Vorschlag, die Toten in der Nähe des Strandes zu bestatten; die Kirche würde dort noch über ungenutzte Liegenschaften verfügen, und ein alter, verwitterter Turm trotzte da auch noch unbewohnt in dem garstigen Marschland Wind und Wetter. Morais stimmte zu; aus seiner Sicht würde es Sinn machen, einfach eine große Grube auszuheben und eine »Sammelbestattung« umzusetzen. Kalk würde man dafür benötigen, aber das könne er besorgen, wenn denn die Kostenfrage geklärt sei. Er warf der Bürgermeisterin einen fragenden Blick zu. Diese verstaute ihr Smartphone und warf einen Blick in die Runde.
Es war Zeit, Haltung zu zeigen, und ich sprach mich gegen eine »Sammelbestattung«, sondern für Einzelgräber und zwar auf dem kirchlichen Friedhof aus. Genug Platz gäbe es dort, und niemand könne wissen, ob es sich bei den Ertrunkenen nicht auch um Christen gehandelt haben könne. Und selbst wenn nicht, sei es nicht eine Frage des christlichen Anstands? Pfarrer Duarte verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf. Ein einfacher Geschichtenerzähler könne das wohl am wenigsten beurteilen, wandte er ein, ein Platz auf dem christlichen Friedhof sei ausgeschlossen. Die Bürgermeisterin nickte. Und Einzelgräber? Sie blickte fragend.
Bestatter Morais stöhnte, schimpfte über die jungen Leute, die sich einfach nicht mehr die Hände schmutzig machen wollten, und welchen Wert es denn überhaupt habe, diese Toten einzeln zu bestatten? Niemand kenne sie, niemand, der jemanden kenne, würde sie vermissen. Man müsse auch den betriebenen Aufwand zum Nutzen betrachten, und das sei hier unausgewogen. Mit diesem Urteil beendete er seine Expertise. Bürgermeisterin Rebelo setzte zu einer Entscheidung an, aber ich fiel ihr ins Wort. Ich würde das machen, sagte ich. Ich würde es schon schaffen, 24 Gräber auszuheben, und ich würde dafür weder den Bestatter noch den Pfarrer brauchen.
Rebelo rieb sich das Kinn, warf einen Blick zu den Toten, überlegte, Duarte und Morais schüttelten verächtlich den Kopf. So machen wir das, antwortete die Bürgermeisterin und wies den Küster an, mir den Ort zu zeigen. Der Bestatter sollte indes dafür sorgen, dass die Toten bis dahin abtransportiert und gekühlt werden. Sie wünschte einfache, aber gute Särge, und sie sollten nicht mehr kosten als jene, die das Sozialamt bezahlte, wenn man mittellose Menschen ohne Angehörige bestattete. Morais und Duarte wollten widersprechen, stellten ihren Widerstand dann aber ein. Durch den gefühlten Sieg freute ich mich jetzt über ihre Verachtung und bot dem Bestatter meine Hilfe beim Transport an.
Er könne leider nicht helfen, sagte Morais, als wir gemeinsam mit dem Küster den zukünftigen Ort der letzten Ruhe für die Verstorbenen begutachteten. Der Küster sagte, er hätte es sich sandiger vorgestellt. Es tue ihm leid, und er schäme sich etwas für seinen Vorschlag. Selbstverständlich werde er mir helfen, die Gräber auszuheben. Morais klopfte mir auf die Schulter. Ich solle ihm Bescheid geben, wenn die Gräber ausgehoben sind, aber viel Zeit hätten wir nicht. Die Leichen seien in einem erbärmlichen Zustand. Das werde auch die Bürgermeisterin erkennen, wenn er sie in die Kühlhalle auf den Friedhof rufe. Und leider müsse er das tun.
Pfeifend ging er zu seinem Wagen zurück, und der Küster und ich stampften mit unseren Füßen auf dem harten, trockenen und steinigen Boden herum. Im Inneren des Landes hinter dem Turm war es wiederum zu feucht und sumpfig, weil hier langsam ein kleiner See verödete. Einen Meter 80 müsse ein Grab tief sein, sagte der Küster. Er könne einen kleinen Aushubbagger organisieren, müsse ihn nur irgendwie hierher bekommen. Mir tat der Mann mittlerweile leid, schließlich war er durch meine Wut in diese Geschichte hineingeraten. Ob man das dann zu zweit schaffe, wisse er jedoch nicht. Aber versuchen solle man es, sagte er und schenkte mir ein gequältes Lächeln. Ja, sagte ich und gab ihm meine Telefonnummer. Ein Blick in den Himmel zeigte, dass es bestimmt auch morgen nicht regnen werde, um den Boden etwas lockerer werden zu lassen. Er schrieb mir seine Nummer auf einen Zettel und reichte ihn mir. Ich werde ihn morgen anrufen, sagte ich ihm, und notfalls könne man immer noch nur eine Grube ausheben. Ja, könne man. Beide sahen wir uns die unwirtliche Fläche an, beide quälte uns die Vorstellung, hier die Toten einfach in eine Grube zu werfen und mit Kalk zu bedecken. Es sind Menschen, sagte er und ging. Ich blieb noch ein wenig und ging dann auch nach Hause.
Ich berichtete alles meiner Frau, nahm ein Bad, trank ein großes Glas Port und ging unzufrieden, wütend und erschöpft zu Bett. Mit dem Wissen, verloren zu haben, und der Enttäuschung darüber schlief ich ein und beschloss, morgen Bürgermeisterin Rebolo zu erklären, dass unser Vorhaben nicht gelingen würde.
Ich wachte früh auf, kochte einen Kaffee und sah als erste Meldung einen reißerischen Artikel in den sozialen Medien über die angeschwemmten toten Geflüchteten. Die Küstennachrichten waren ein Schundblatt, jeder wusste das, dennoch ärgerte mich der Artikel maßlos. Keinerlei Anteilnahme, sondern nur Empörung darüber, dass die Leichen angetriebener Wirtschaftsflüchtlinge unsere schönen Strände verunreinigen und Touristen zukünftig abhalten würden, unsere Stadt und die umliegenden Dörfer zu besuchen. Welche Touristen, fragte ich mich, las die ersten beiden Kommentare und beschloss, damit aufzuhören. Isabella kam zu mir in die Küche, nahm meinen Kopf in den Arm, drückte ihn an sich und strich mir durch das Haar. Erst wollte ich nicht, aber dann musste ich weinen. Ich müsse der Bürgermeisterin absagen, teilte ich ihr mit. Wir verscharren sie in einer Grube wie Aussätzige, sagte ich. Warte noch etwas, sagte sie. Ich sah auf und blickte sie fragend an. Warte noch etwas. Sie nickte mir zu, goss mir Kaffee ein, und ich wartete noch etwas, ohne zu wissen, auf was.
Es klingelte kurz nach 9 Uhr an der Tür, ich öffnete sie und Pablo und Maria begrüßten mich. In meiner Auffahrt standen weitere Menschen, Freunde von Pablo und Maria, aber auch Manolo, ehemalige Fischer, mit denen ich zur See gefahren bin; Menschen, denen meine Geschichten gefielen, Freunde von mir; selbst hinter den Heckenrosen auf der Straße vermutete ich noch weitere Menschen. Sogar Bürgermeisterin Rebolo stand, bekleidet mit Jeans und einem Baumwollhemd, mit einer Schaufel in meinem Garten.
Ich habe Pablo und Maria davon erzählt, sagte Isabella. Und dann Manolo. Jeder kannte wen, der helfen wollte. Mit dem Gefühl, ein glücklicher Mann zu sein, rief ich den Küster an und sagte ihm, dass wir genügend helfende Hände hätten und dass er den kleinen Aushubbagger besorgen solle.
Bei Einbruch der Dämmerung hatten wir Schwielen an den Händen, den Älteren tat durchweg der Rücken weh, aber wir hatten es geschafft und 24 Gräber ausgehoben. Ich umarmte Isabella, Maria und Pablo, gab ihnen jeweils einen Kuss auf die Stirn.
Ob ich am nächsten Tag eine Rede halten wolle, fragte mich Bürgermeisterin Rebolo. Schließlich könne ich gut Geschichten erzählen, vielleicht würde ich dann auch eine Rede in Gedenken an die ertrunkenen Geflohenen halten können. In Anbetracht der wenigen Zeit würde niemand etwas Ausgefeiltes erwarten. Ja, das wollte ich, und ich sagte zu.
Am nächsten Tag, es war ein Freitag, ließen wir gemeinsam alle 24 Ertrunkenen nacheinander zu Grabe. Es war nahezu windstill und heiß und der Anlass zudem ein bedrückender, sodass Stille herrschte. Alle hatten sich zu den Grabbeigaben Gedanken gemacht, den Kindern wurden Spielzeuge mitgegeben, selbstgemalte Bilder von Kindern aus dem Ort; ein junger Mann, ein Freund von Maria, warf in jedes Grab einen Schwimmflügel und hatte einen knallroten Rettungsring mitgebracht, den er auf eines der Gräber legen wollte. Meine Andacht hielt ich mit dem Turm im Rücken. Es war eine kurze, und ich fragte mich darin, was ein Mensch wohl erdulden müsse, dass er freiwillig seine Heimat verließ und ein ungewisses Schicksal in Kauf nahm, das auch den Tod bedeuten konnte. Ich sagte außerdem, dass die Gründe für Flucht auch von uns verursacht wurden. Die eigenen Schatten unserer Geschichte aus der Kolonialzeit musste ich gar nicht erwähnen, den Anwesenden waren sie bestimmt bewusst, aber auch unser Reichtum sorgte an anderer Stelle für Armut. So war es zumindest meine Überzeugung, und die Realität konnte ich damals täglich als Mitbesitzer eines kleinen Fischerbootes erfahren, wenn wir mit den großen Fischtrawlerflotten um die immer kleiner werdenden Fischbestände kämpfen mussten. Am Ende meiner Rede spürte ich Trauer und Liebe gleichermaßen. Ich entspannte mich und steckte den kleinen roten Kinderschuh, den ich während meiner Rede gedrückt gehalten hatte, unter mein Hemd.
Bis heute folgten weitere Fälle, in denen ich als Bestatter arbeitete, und der kleine Friedhof am Meer mit dem Turm wuchs stetig an, sodass wir heute 121 Gräber zählen. Die Kommunalpolitik warb Gelder für die Pflege der Gräber ein, sodass wir uns mit Gartengeräten und Werkzeugen ausstatten konnten, den Turm als Kapelle nutzen durften, aber die Arbeit verrichteten wir ehrenamtlich, und ich bin stolz, unsagbar stolz auf alle, die seither mithalfen. Manolo sagte, er wolle immer noch nicht, dass ich rührselige Geschichten erzähle, aber einen Teil seines zusätzlichen Gewinns spendete er seither entweder für uns oder an eine Organisation, die sich für Geflüchtete in Seenot engagiert. Angespülte Fundstücke, die gekenterten Geflohenen gehören mochten, sammelten wir bei mir im Garten und auf dem neuen Friedhof. Die Verstorbenen fotografierte ich und schickte die Bilder einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die im Mittelmeer Ertrunkenen aufzulisten, und ihnen damit eine Identität gab. Zudem versuchten sie nach einer Identifizierung die Angehörigen ausfindig zu machen, um diese zu verständigen.
Somit wissen Sie jetzt, wie ich zu einem Bestatter und gewissermaßen auch zu einem Friedhofspfleger geworden bin, und ich kann verraten, dass ich mein Wissen in dem Handwerk so weit vertiefte, dass ich jederzeit in diesem Gewerbe arbeiten könnte. Und so wissen Sie nun fast alles über mich, sodass ich Ihnen jetzt eine beziehungsweise zwei Geschichten über zwei Reisen erzählen könnte. Doch zuvor will ich Ihnen noch ein Geheimnis anvertrauen, ein Geheimnis, dass Sie vielleicht gruseln wird. Mit etwas Unbehagen und einem schlechten Gewissen berichtete ich Ihnen, womit ich mein Geld derzeit verdiene: Mit dem Erzählen von Geschichten und vor allem mit Gespenstergeschichten über ertrunkene Geflohene. Sie erinnern sich doch? Die La Laguna.
Im November 2039 – ich hatte schon eine Gespenstergeschichte in mein Repertoire aufgenommen, mochte die Geschichte aber nicht gerne erzählen, auch wenn sie sehr nachgefragt war – ging ich am Strand die Atlantikküste nach Norden. Ich erinnere mich noch genau an den dichten Nebel und die Windstille. Es gab zwei Gesichter dieser Gegend im Herbst. Entweder war es stürmisch und tosend oder aber still und nebelig. Wie das Land, so die Leute, sagte man hier gerne, und es beschrieb uns im Allgemeinen doch ganz treffend. Ich hing in Gedanken meinen Geschichten nach und dachte, es wäre einmal an der Zeit, eine mitreißende Geschichte über die Liebe zu erzählen. Die Liebe zu einer Frau, die Liebe zu seinen Kindern, seinen Freunden, den Ort, den man liebte. Bisher hatte ich mich noch nicht getraut, eine solche Geschichte zu erzählen, einfach, weil ich nicht wusste, ob sie beim Erzählen auch funktionieren würde.
Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Ich blieb stehen und versuchte, es einzuordnen, weil es hier fremd und unwirklich klang. Es war das Wehklagen eines kleinen Kindes. Und jetzt rief es etwas, aber ich konnte nicht verstehen, was es sagen wollte. Ich eilte zum Wasser hin und lauschte. Mumya, rief das Kind, und ich glaube, jeder, der selbst Kinder hat, weiß in solchen Augenblicken, nach was das Kind ruft, egal in welcher Sprache: Mama. Das Kind, das dort im Nebel rief, rief nach seiner Mama. Ich rief nach dem Kind, damit es wusste, dass ich da war und helfen konnte, dass es nicht aufhörte, zu rufen, damit ich es orten konnte. Ich watete durch das Wasser. Mumya, Mumya, rief es, Alab, Alab! Hier bin ich, rief ich. Hier! Warte, ich komme zu dir! Bis zur Hüfte reichte mir das Wasser, es war eiskalt und brannte auf meiner Haut. Das Kind weinte, verschluckte sich, hustete. Oh mein Gott, es ertrinkt, dachte ich und watete weiter ins Wasser, dorthin, wo ich das dünne Stimmchen im Nebel vermutete.
Etwas tanzte seicht auf den flachen Wellen, etwas Rotes, Verblichenes. Ich griff danach. Ein roter Mädchenschuh, das Gegenstück zu jenem, den ich vor Jahren am Strand gefunden hatte. Hier war jedoch die Farbe verblasst, das Material zerfaserter, aber er war so weit intakt. Und es war der fehlende linke Schuh zu dem Rechten. Die Größe passte. Ich schluckte trocken, nahm den Schuh an mich und rief weiter nach dem Kind. Es antwortete nicht. Ich rief lauter, schrie, aber nur das träge, seichte Wasser plätscherte leise vor sich hin. Bis zur Brust reichte mir der Atlantik jetzt, meine Lippen, mein ganzer Körper zitterte. Langsam verlor ich den Kontakt zum Boden und würde gleich schwimmen müssen.
Hey, wo bist du?
Antworte!
Du darfst nicht ertrinken! Du hast es fast geschafft!
Ich stieß mich mit dem linken Fuß ab und schwamm hinaus in das Meer und in den dichten Nebel hinein. Weit und lange würde ich es nicht mehr in dem kalten Wasser aushalten können, die erste Angst um mein eigenes Leben beschlich mich.
Hey?!
Und dann lichtete sich der Nebel vor mir und ich konnte ein kleines, höchstens zwei Jahre altes Mädchen sehen, dass sich an einen Rettungsring klammerte. Es blickte leer zu mir, durch mich durch, ihre Augen verweint, und mir schien, als konnte ich eine Hoffnungslosigkeit darin erkennen, die dem Alter des Kindes nicht gerecht wurde. Mir war, als hätte das Mädchen begriffen, dass es jetzt untergehen würde. Dass es sterben würde. Und genau so war es auch, es glitt von dem Rettungsring ab und tauchte unter, ohne einen Laut von sich zu geben.
NEIN!
Ich kraulte zu dem Rettungsring, zu dem ertrinkenden Mädchen, schluckte selbst Wasser und spürte, wie meine Kräfte mich schnell verließen, als würde ich einen Eimer Wasser auskippen. Den Rettungsring, ich griff danach und … griff durch ihn hindurch. Er löste sich vor meinen Augen in nichts auf. Das Mädchen sah ich noch, ihr Gesicht, wie es mit weit geöffneten Augen in die Tiefe sank und etwas losließ. Mr. Rabbit. Dann löste es sich ebenfalls auf.
An diesem Tag im November hatte ich meine eigene Erfahrung mit einem Geist gemacht, meine eigene Geschichte erfahren. Ich drehte um, hatte den passenden Schuh des ertrunkenen Mädchens gefunden und die Gewissheit, dass sie wirklich gestorben war. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind die ersten, denen ich von diesem Erlebnis berichte. Und vielleicht lindert diese Beichte mein schlechtes Gewissen darüber, dass ich mit »Geistergeschichten« über ertrunkene Geflohene einen Großteil meines Einkommens bestreite, aber ich will nicht, dass dieses Thema so verblasst wie der Geist des Mädchens, der sich vor meinen Augen aufgelöst hat.
Sie wissen jetzt, dass ich Geschichten erzähle und wie ich dazu gekommen bin. Sie können mich gerne im La Vida bei Manolo besuchen, dort erzähle ich unter der Woche Geschichten von 19 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 und am Wochenende samstags ab 20 Uhr abwechselnd mit verschiedenen Musikern und sonntags ab 18 Uhr. Das La Vida hat glücklicherweise ebenso wie ein Großteil des pittoresken Fischerhafens den Anstieg des Meeresspiegels überlebt. Ebenso der von uns betriebene Friedhof für ertrunkene Geflohene. Aber das … das ist eine andere traurige Geschichte, die nur insofern mit meiner zusammenhängt, als dass der Klimawandel in der heutigen Zeit den größten Motor für Migration weltweit darstellt.
Im Herbst und Winter habe ich überwiegend frei, nehme jedoch häufiger werdende Anfragen aus Braga, Porto und mittlerweile sogar Lissabon entgegen. Und beginne erst jetzt, Ihnen meine eigentliche Geschichte von zwei verschiedenen Reisen zu erzählen. Beginne einfach ohne eine weitere lange Vorrede …
Die S3-X ist eine Einhandfeuerwaffe oder auch Faustwaffe, eine Pistole mit einem zweireihigen Stangenmagazin für 11 Schuss aus der Manufaktur eines Waffenherstellers im nördlichen Schleswig-Holstein. Sie kann im Einzelschussmodus schießen, aber auch kurze Salven mit jeweils drei Schuss, wobei die vierte Salve nur zwei Schuss abfeuert. Verbessert zum Vorgängermodell wurden sowohl die Reichweite als auch die Schussgenauigkeit, vor allem im Salvenmodus. Konzipiert und entwickelt wurde sie für die europäische Armee, deren Vorgänger FRONTEX war, jene Einheit, die die Ankunft von Flüchtlingen an der außereuropäischen Grenze in geordnete Bahnen lenken sollte. In der ersten Auflage wurden 50.000 Stück produziert. Das war in den frühen 40ern gewesen; seither ist die S3-X ein Verkaufsschlager geworden, und das aus zweierlei Gründen: Erstens hat sich die Pistole als extrem robust in jedem Gelände erwiesen. Wahrscheinlich ist es die neue Legierung, die sie in feuchten Sumpfgebieten oder in trockenen Wüsten so äußerst wenig anfällig werden ließ. Zweitens ist es die einfache Handhabung dieser Pistole; sie ist so einfach zu bedienen, dass man es jedem sechsjährigen Kind innerhalb von zwei Minuten erklären kann und es danach damit umzugehen weiß. Nicht nur schießen, nein, auch das Nachladen ist wirklich einfach. Durch ihr wuchtiges und gefährliches Aussehen wurde sie zudem in der Unterwelt sehr beliebt. Ein 38er-Kaliber, das aussieht wie ein 45er. Und auch das Magazin mit 11 Schuss führte vor allem in etlichen südamerikanischen Favelas zu neu aufstrebenden Gangs, deren Mitglieder sich die »11« ins Gesicht tätowieren ließen. Die S3-X wurde zu einem Kultobjekt, zu einer Lebenseinstellung von Jugendgangs und richtigen Schwerkriminellen.
Die Pistole mit der Seriennummer 45/05/10011 verließ 2045 die Produktionsstätte mit dem Ziel Sultanat von Oman. Der Sultan Balarab bin Haitham Al-Saïd hatte 2.000 Exemplare für seine persönliche Sicherheitsgarde geordert, und für das Sultanat gab es zu keiner Zeit ein Waffenexportverbot, da es sich aus politischen und kriegerischen Konflikten des Nahen Ostens stets herausgehalten hatte. Die SR3-X 45/05/10011 wurde einem Offizier namens Hadlib bin Tarigh zugewiesen, der sie als Dienstwaffe vier Jahre lang benutzte und sie fünf Mal in Ausübung seines Berufes im Einsatz abfeuerte; allerdings waren alle Schüsse lediglich Warnschüsse.
2049 verstarb der Sultan und sein Nachfolger wurde nach langen Streitereien der Wirtschaftsminister Qabus ibn Taimur. Dieser wollte nichts von seinem Vorgänger übernehmen und wechselte sowohl das Fabrikat als auch den Hersteller der Waffen für seine private Spezialarmee. Der ranghöchste Offizier bekam den Auftrag, sämtliche SR3-X einzusammeln und zu entsorgen, aber einer seiner Cousins hatte einen guten Kontakt zu jemandem im Jemen, der gutes Geld für Waffen zahlen würde. Von dort sollten sie weiter nach Äthiopien verbracht werden, und niemand würde je wieder im Sultanat von diesen Waffen hören.
Für den ranghöchsten Offizier hörte sich das Angebot viel zu lukrativ an, um Nein zu sagen – alle drei seiner Söhne studierten im Ausland, sein BMW war nicht mehr das neueste Modell –, also sagte er zu, und die SR3-X 45/05/10011 gelangte in die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, in die Hand von tigrayischen Rebellen im nördlichen Hochland von Abessinien, mit denen die Zentralregierung seit über 25 Jahren einen Bürgerkrieg ausfocht. Neben dem Krieg der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gegen die ENDF, den äthiopischen Streitkräften und einfallenden Militärs aus Eritrea quälen jährliche, immer länger werdende Dürreperioden das so schon unfruchtbare Land. Viele der dort lebenden Menschen flohen in den Sudan; die, die blieben, waren entweder Opfer oder Täter und oftmals beides.
Binyam Afeworki wurde neuer Besitzer dieser Pistole, und im erbitterten Krieg um die ewig umkämpfte Regionalhauptstadt Mek’ele oder die Stadt Shire erschoss er damit insgesamt fünf Menschen. Zwei verloren im Gefecht um ein Quartier von wenigen Häusern ihr Leben. Es gab kaum noch schwere Geschütze auf beiden Seiten; alles war zerstört, ohne Munition oder unbrauchbar geworden. Man bekämpfte sich in den Städten mit wenigen Mörsern, Macheten, Messern und sogar Knüppeln. Die SR3-X war ein wahrer Segen für die Krieger der TPLF geworden. Vor allem aufgrund des Salvenmodus war sie allen anderen Waffen überlegen und in den Straßen der ruinierten Städte und Dörfer sehr gefürchtet. Die beiden Männer waren schreiend mit Macheten auf Binyam Afeworki zugestürmt. Binyam hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie jemanden getötet. Besser, er wusste nicht, ob er jemanden getötet hatte. Ob das eine Bedeutung hat, dass man wusste, ob man jemanden getötet hatte? Gewiss. Gerade in Gruppen, die martialische Handlungen begingen und patriarchalisch strukturiert waren. Jemanden zu töten, zeichnete einen Mann aus; je mehr er getötet hatte, desto höher sein Ansehen.
Ich bin der Überzeugung, dass es in der Straße der untergehenden Sonne in Mek’ele nicht anders war als zum Beispiel in französischen oder portugiesischen Streitkräften. Wer tötete, der war jemand. Sagen wir, wer getötet hatte und nicht nach seiner Heimkehr an PTBS litt, war jemand. Aber für Binyam Afeworki, einen 19-jährigen Gelegenheitsarbeiter aus einem kleinen Dorf namens Mariam Setta nördlich von Mek’ele, spielte jetzt und auch später der Begriff PTBS keine Rolle, als er zwei kurze Salven aus seiner SR3-X abfeuerte und seinem ersten Gegner damit das halbe Gesicht wegschoss und dem zweiten drei Kugeln wie Knöpfe oberhalb des Bauchnabels in die Brust jagte. Erschrocken schoss er noch eine weitere Salve in den Putz eines ehemaligen Lehmhauses, das vor Jahren mal einen Barbier beherbergt hatte.
Jemand klopfte ihm auf die Schulter. Es war Teklu, ihr Anführer mit dem grauen Bart, und er bot ihm eine Zigarette an. Binyam nahm sie entgegen und versuchte das Zittern seiner Hände zu verbergen. Es gelang ihm nicht, und Teklu hielt mit einer Hand seine beiden Handgelenke fest, gab ihm Feuer und eine schallende Ohrfeige. Er solle seine Hände ausstrecken. Binyam tat dies. Sie zitterten. Er konnte es nicht kontrollieren. Konnte nicht. Musste immer wieder zu dem Mann sehen, dem er das Gesicht weggeschossen hatte. Er lag auf dem Rücken, trug eine hellblaue Jeans und hatte sich eingenässt. Und immer wieder zuckten dessen Beine so unkontrolliert wie jetzt Binyams verdammte Hände. Teklu schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, sodass Binyam die Zigarette fallen ließ. Teklu bückte sich, hob sie auf und gab sie ihm zurück. Er solle weiterrauchen, befahl der Anführer, zog seine SR3-X und richtete sie auf Binyams Kopf. Wenn du nach der Zigarette immer noch zitterst, sagte Teklu, schieße ich dir in den Kopf, weil du dann niemals ein richtiger Mann werden wirst. Binyam nahm drei tiefe Züge, bekämpfte sein Zittern, und gemeinsam bezwangen er und sein Gegner es. Sein Gegner fand den endgültigen Tod, Binyam wurde mit dem Leben belohnt. Dachte er. Aber als Teklu abdrückte und er das Klicken des Abzughahns hörte, dachte er, es wäre vorbei. Teklu lachte. Leer, sagte er. Leer! Und schüttelte sich vor Lachen und eine weitere Zigarette aus seiner Packung, die er Binyam anbot. Binyam nahm sie entgegen, beugte sich vor, um sie Teklu anzünden zu lassen. Genieß die jetzt, du Mann, sagte sein Anführer und nickte ihm anerkennend zu. Den anderen Männern gab er den Befehl, die Toten zu plündern und zu verstümmeln, um sie sichtbar aufzuhängen. Jeder sollte wissen, dass die TPLF keine Gefangenen nahm. Schon lange nicht mehr. Niemand machte noch Gefangene.
Die dritte Person, die Binyam mit der SR3-X tötete, war eine Frau. Sie hatten auf einer Kreuzung von Mek’ele eine menschliche Falle gelegt. Einem Jungen von 13 Jahren, dessen Vater für die ENDF arbeitete oder mit ihr sympathisierte, so glaubte zumindest Teklu, schnitten sie beide Achillessehnen durch und öffneten seine Bauchdecke mit einem Messer, ohne seine Organe anzurühren. Sie legten den Jungen auf einer Kreuzung ab und warteten an jeder Ecke auf Mitglieder der ENDF, die dem schreienden Jungen helfen wollten. Aber die kamen nicht. Stattdessen eine Mutter, die Binyam schon öfter auf der Suche nach Wasser und Nahrung für ihre Kinder gesehen hatte. Er kaute nervös auf einigen Kathblättern, sah hinüber zu dem Posten, in dem sich Teklu befand, und stellte fest, dass dieser die Frau gesehen hatte und ihn beobachtete.
Binyam gab sich ausdruckslos, lehnte mit erhobener SR3-X an einer Mauer und kaute. Vor drei Tagen war er 20 Jahre alt geworden und hatte bestimmt allein einen Liter Kaitaka, einen einheimischen Schnaps, den ihm seine Waffenbrüder zur Feier des Tages spendiert hatten, gesoffen. Die Kathblätter halfen ihm über seine innere Zerrissenheit hinweg. Er wusste Teklus Blick einzuschätzen. Teklu, dessen Mission es war, aus ihnen gnadenlose Krieger für die Freiheit und die Unabhängigkeit zu formen. Er wusste, dass Teklu die Frau kannte, Binyam kannte sie ja selbst auch vom Sehen. Er glaubte, keine Wahl zu haben. Als die Mutter sich neben den klagenden Jungen kniete, kam er aus seiner Deckung hervor und erschoss sie mit zwei gezielten Schüssen. Einen in den Kopf, einen ins Herz, das Markenzeichen der TPLF. An diesem Tag ging ihnen niemand mehr in die Falle; den Jungen ließen sie liegen, er starb zwei Tage später.
Binyam erhielt von Teklu für seinen heldenhaften Einsatz und seine Gabe, auch schwere und manchmal unmenschliche Entscheidungen zu treffen, einen großen Jutesack voller Kathblätter, jener einheimischen Droge, die dafür sorgte, dass sich mehrere Länder nicht mehr selbst versorgen konnten, weil die wenigen Bauern für Kath mehr Geld bekamen als für Getreide. Waffen, Dollar, Drogen, das waren die drei Währungseinheiten in dieser Region für die Mächtigen. Wasser und Lebensmittel raubte man jenen, die sich nicht wehren konnten. Und Sex ebenso.
Die vierte Person, die Binyam mit der SR3-X umbrachte, war sein Waffenbruder Efrem. Sie hatten ein kleines Dorf außerhalb der Stadt geplündert und feierten das. Efrem hatte sich in ein junges Mädchen, das bisher überlebt hatte, verliebt. Mit einer Flasche Schnaps in der Hand erzählte er einigen Waffenbrüdern, dass er sie heiraten werde, mit ihr Kinder kriegen und als Automechaniker ein normales, schönes Leben führen wolle, wenn der Krieg erst einmal vorbei sei. Die anderen hörten trinkend zu, jeder von ihnen hatte einen ähnlichen Wunsch, und diese schönen Worte fanden in ihnen Anklang. Nur nicht bei Teklu, der aufstieß, spuckte und zu dem Mädchen ging, das gefesselt in einer Hütte lag. Alle sahen ihrem Anführer nach, und Efrem brachte den Mut auf, ihm hinterher zu schwanken und ihn zu fragen, was er vorhabe. Er wolle die Kleine jetzt ficken, ihr einmal zeigen, was so ein gut geöltes Rohr an weißem Gold raushauen könne, antwortete er, schnippte seine Zigarette weg und betrat die Hütte. Efrem wankte bis zum Eingang hinterher, blieb dann stehen und schrie seine Wut in die Nacht hinein.
Das kannst du nicht machen!
Bitte!
Ich will sie heiraten!
Er flehte, fiel vor der Hütte auf die Knie, Aregay kam zu ihm, legte einen Arm um seine Schultern, spendete Trost. Natürlich konnte Teklu das machen. Jeder wusste das. Und jeder wusste, dass Efrem dumm war, weil er seine naiven Wünsche so laut und … mädchenhaft allen mitgeteilt hatte. Aus der Hütte hörten sie das Mädchen jetzt schreien und eindeutige Geräusche eines gewaltsam vollzogenen Geschlechtsakts. Teklu feierte lautstark die Enge ihres Beckens.
Es gefällt ihr, interpretierte Abassi die Schreie des Mädchens, und diese Deutung war zu viel für Efrem. Wut und Hass ließen ihn aufspringen, seine Waffe ziehen, er stürmte in die Hütte … und Binyam schoss ihm zwei Salven in den Rücken. Efrem fiel zu Boden, kein Schrei, kein Klagen, er war einfach tot, still gestorben. Alle starrten Binyam an, starrten zur Hütte. Niemand außer Teklu hatte das Recht, einen Waffenbruder zu strafen, geschweige denn, ihn sogar zu richten. Aber aus der Hütte erklangen nur die vertrauten Geräusche einer Vergewaltigung, Teklu ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Später trat er aus der Hütte, schloss vor den Augen der Krieger seinen Gürtel und sah auf Efrems Leichnam. Ob Binyam geschossen hätte, wollte er wissen, und alle, auch Binyam, nickten. Binyam erwartete jetzt, selbst gerichtet zu werden, die Kathblätter gaben ihm Gelassenheit, den Tod zu empfangen. Aber Teklu erschoss ihn nicht, sondern stellte sich vor ihn, packte ihn an den Schultern und umarmte ihn.
Du darfst sie haben, mein Bruder. Und vielleicht vereinen sich in ihr dein und mein Saft und aus ihr geht ein mutiger Freiheitskämpfer hervor, der die Welt verändern wird. Sie soll leben und unter unserem Schutz stehen. Und den Verräter werft ihr den Hunden zum Fraß vor.
Teklu zog sich zur Ruhe zurück. Einige seiner Waffenbrüder klopften ihm auf die Schulter. Er war jetzt die rechte Hand ihres Anführers. Und er durfte ficken, was ihr Anführer gefickt hatte. So eine Auszeichnung hatte noch niemand von ihnen erhalten.
Als er 22 Jahre alt war, sollte Binyam etwas außerhalb Mek’eles einen kleinen Trupp befehligen, der Schmuggler aufspüren sollte, die für die ENDF Waffen in die Stadt bringen sollten. Wieder einmal herrschte eine Dürre und das abessinische Hochland entwickelte sich durch den fortschreitenden Klimawandel mehr und mehr zu einem unfruchtbaren Ödland. Binyam kaute seine Kathblätter, als ihm einer seiner Brüder Reisende meldete, die von Norden herkamen. Mit einem Fernglas konnte er 18 Menschen erkennen; zwei Männer zogen einen Karren mit großen Wasserplastikflaschen hinter sich her. Sie trugen Taschen, mehr nicht. Drei ältere von ihnen mussten gestützt werden, drei Kinder waren nicht älter als sechs Jahre alt. Binyam wollte das Fernglas weiterreichen, verharrte dann aber. Das … waren doch Mengstu und Yassin! Und dort ihre beiden Geschwister. Binyam erkannte in ihnen seine ehemaligen Nachbarn und Freunde aus Mariam Setta.
Das sind Menschen aus meinem Dorf, sagte er und erinnerte sich an vergangene Tage, die ihm jetzt so seltsam und fern vorkamen wie die Sterne, die er in der Nacht am Himmel sehen konnte. Er gab den Befehl, sich den Geflüchteten zu nähern, aber sie nicht anzugreifen.
Es waren Mengstu und Yassin, und sie berichteten, dass ihr Dorf erst von der Freiheitsbewegung und dann von den Regierungstruppen geplündert worden war. Viele von ihnen waren getötet worden, und sie hatten nur noch Wasser und ihren Willen, um Äthiopien mit dem Ziel Sudan zu verlassen. Binyam erklärte, dass es im Sudan auch nicht viel besser sei. Überall herrsche Krieg. Die Menschen aus Mariam Setta zuckten mit den Schultern und Binyam verstand. Jeder versuchte aus einer Hölle in eine andere, etwas bessere Hölle zu fliehen. Er wünschte ihnen viel Glück, konnte ihnen aber ausreden, nach Mek’ele zu ziehen, wo sie eigentlich ein paar Vorräte von ihren letzten Ersparnissen kaufen wollten. Sie zogen landeinwärts die karge Steppe in Richtung Westen weiter und Binyam wünschte ihnen viel Glück auf ihrer Reise.
Nur vier Stunden später schlug ihn Teklu zwei Mal ins Gesicht, sodass seine Nase brach, und nannte ihn einen Dummkopf. Sie saßen unter Sonnenschirmen draußen vor einer kleinen Bar, die unter ihrem Schutz stand, und tranken Bier, während Binyam von der Begegnung berichtet hatte.
»Die Schmuggler werden nun wissen, dass wir da sind, und du lässt sie mit dem Wasser und ihrem Geld einfach laufen? Du bist eine Schande für die TPLF. Aregay, begleite deinen blinden Bruder, erschieße Binyams Freunde zur Strafe, damit er daraus lernen kann, und komm mit dem Geld und dem Wasser wieder zurück. Binyam, du wirst Aregay begleiten und unter seinem Ko…«
Binyam schoss ihm eine Salve ins Gesicht und drei Knopflöcher in die Brust, Teklu kippte mit seinem Bier in der Hand und seinem roten Plastikstuhl rücklings um.
Alle, auch Binyam, brauchten Zeit, um das Geschehene zu verstehen. Um zu reagieren. Binyam war der Schnellste unter ihnen und richtete die SR3-X auf seine Waffenbrüder. Mit zwei schnellen Bewegungen tauschte er den Munitionsstreifen und wechselte in den Einzelschussmodus. »11 Schuss, 11 Tote«, sagte er zu seinen Waffenbrüdern, die sich ruhig verhielten und am Leben bleiben wollten. Er ließ sich von ihnen Wasser, etwas Proviant und eine Decke bringen, nahm die Lederbörse ihres Kommandanten und zog seinen Leuten in den Sudan hinterher. Viel schlimmer, dachte er, konnte es dort auch nicht werden. Verfolgt wurde er durch seine Waffenbrüder nicht.
Das waren die fünf Toten, für die die SR3-X und ein Gelegenheitsarbeiter aus dem nördlichen Tigray Äthiopiens sich verantwortlich zeigen müssen. 750 € hat die Waffe im Einkauf gekostet, jeder Tod hat damit bisher einen Preis von 150 €. Ich weiß, das sind keine wirklich faktischen Belege, aber solche Dinge manchmal in ein Verhältnis zu setzen, kann sehr erhellend sein. Ich werde jetzt diese Geschichte vorerst unterbrechen, weil ich Ihnen bis hierhin doch sehr viel zugemutet habe. Jetzt will ich Ihnen zur Abwechslung einmal von etwas Schönem berichten.
Ajani Adebayo war ein sehr glückliches Kind. Sein Vater Boubacar und seine Mutter Sade betrieben 20 Kilometer östlich der Stadt Wukari mit einer KOKODOLA-Projekt-Förderung eine Kakaoplantage. Der Klimawandel hatte diese Gegend des Kontinents weitgehend verschont und war nur indirekt durch eine große Anzahl zu ihnen geflohener Menschen sichtbar. Seine Brüder Dayo und Femi und seine Schwestern Yemaya, Fayola und Sulola gingen alle wie auch er zur Schule, anstatt wie andere Kinder auf den elterlichen Plantagen zu helfen. Bildung war der Familie Adebayo wichtig. Aber im Gegensatz zu seinen Geschwistern, von denen sogar Dayo, Femi und Fayola in Wukari studierten oder studieren wollten, interessierte sich Ajani schon seit er vier Jahre alt war außerordentlich für die Arbeit seiner Eltern. Er half seinem Vater dabei, die Setzlinge zu pflanzen, und pflegte sie. Fäule, Pilzbefall und sogar Krankheiten lernte er zu erkennen, und sein Vater, der ein ausgebildeter Kakaobauer war, lehrte ihn, was man dagegen unternehmen konnte. Ajani lernte, dass es nachhaltiger war, nicht willen- und grenzenlos Pestizide einzusetzen, sondern dass man andere Mittel einsetzen konnte, zum Beispiel Faulstellen sorgsam aus den erwachsenen Bäumen herauszuschneiden.
Am meisten Spaß hatte Ajani in der Haupterntesaison. Zwar zwangen ihn Boubacar und Sade dazu, zur Schule zu gehen, auch wenn er viel lieber geholfen hätte, aber Ajani bewies seinen Eltern, dass er die Ausdauer hatte, beides in dieser Zeit zu schaffen. Also schlug er die Bohnen von den Bäumen, sortierte sie nach Qualität, brachte sie ins Lager und überwachte, wie sie dort in Kisten mit Löchern für ausreichend Sauerstoff, damit die Bohnen nicht schimmelten, reiften und ein gutes Aroma entwickelten. Er liebte den Geruch von Kakao und noch mehr den Geschmack, er liebte die Arbeit auf der Plantage, ihrem Land, und das Gefühl, abends ins Bett zu gehen mit dem Wissen, etwas getan zu haben. Ajani wollte wie sein Vater Boubacar Kakaobauer werden, und seine Eltern waren froh darüber, da sie ihr Handwerk ebenso als Berufung, als Lebenssinn verstanden.