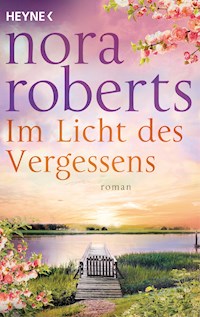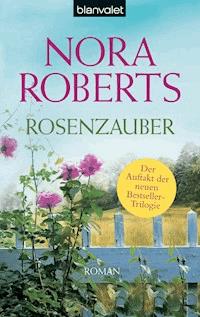Über das Buch
Über die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 geboren und gehört heute zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von über 500 Millionen Exemplaren, und auch in Deutschland erobert sie mit ihren Romanen regelmäßig die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland, USA.
Nora Roberts
Im Licht des Vergessens
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Christiane Burkhardt
Diana
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel High Noon bei G. P. Putnam’s Sons, Penguin Group (USA) Inc., New York
Copyright © 2007 by Nora Roberts
Published by Arrangement with Eleanor Wilder
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 und dieser Ausgabe 2009
by Diana Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: t.mutzenbach design
Covermotive: Shutterstock.com (Nella, Dai Mar Tamarack (2x), John McManus Photographer, Jones M)
Redaktion | Barbara Raschig
Für Amy Berkover,die Verhandlerin
ANFANGSPHASE
»Do not forsake me, oh, my darlin’.«
AUS DEM TITELSONG VON HIGH NOON -ZWÖLF UHR MITTAGS
1
In den Tod zu springen war eine ziemlich bescheuerte Art, den St. Patrick’s Day zu begehen. Und wenn man an diesem freien Tag angerufen wurde, um jemanden davon abzuhalten, am St. Patrick’s Day in den Tod zu springen, konnte man sich das grüne Guinness und die springen, konnte man sich das grüne Guinness und die Dudelsackmusik erst mal abschminken.
Phoebe bahnte sich mühsam ihren Weg durch die Einheimischen und Touristen, die zur Feier des Tages die Straßen und Gehsteige bevölkerten. Der Officer in Uniform wartete schon auf sie, wie vereinbart. Sein Blick huschte über ihr Gesicht und wanderte dann nach unten bis zur Dienstmarke, die sie an ihrer Hosentasche befestigt hatte. Sie trug eine dreiviertellange Baumwollhose, Sandalen und ein kleeblattgrünes T-Shirt unter der Leinenjacke. Nicht gerade das professionelle Outfit, auf das sie im Job normalerweise Wert legte, dachte Phoebe.
Aber egal, schließlich sollte sie jetzt eigentlich zusammen mit ihrer Familie auf der Terrasse ihres Hauses sitzen, Limonade trinken und sich die Parade ansehen.
»Lieutenant MacNamara?«
»Richtig. Fahren wir los.« Sie stieg ein, holte mit einer Hand ihr Handy heraus und schnallte sich mit der anderen an. »Captain, ich bin gleich da. Wie ist die Situation?«
Die Sirene heulte, während der Fahrer aufs Gas drückte. Phoebe holte ihren Block heraus und machte sich Notizen.
Joseph (Joe) Ryder, Selbstmordkandidat, bewaffnet. Siebenundzwanzig, weiß, verheiratet/geschieden. Barmann/entlassen.
Religionszugehörigkeit unbekannt. Keine Familienangehörigen vor Ort.
WARUM? Seine Frau hat ihn verlassen, die Sportsbar, in der er arbeitete, hat ihn rausgeworfen, Spielschulden.
Keine Vorstrafen, keine vorausgegangenen Selbstmordversuche.
Die Person ist abwechselnd weinerlich/aggressiv. Bisher sind noch keine Schüsse gefallen.
»Gut.« Phoebe atmete hörbar aus. Schon bald würde sie Joe besser kennenlernen. »Wer redet mit ihm?«
»Er hat sein Handy dabei, da war aber nichts zu machen. Wir haben seinen Arbeitgeber geholt – seinen ehemaligen Arbeitgeber, der gleichzeitig sein Vermieter ist.«
»Gut. In ungefähr fünf Minuten bin ich da.« Sie sah kurz zum Fahrer hinüber, der zustimmend nickte. »Halte ihn mir so lange am Leben.«
In Joe Ryders Wohnung im vierten Stock plagte Duncan Swift das Gewissen. Schweiß stand auf seiner Stirn. Jemand, den er kannte, mit dem er ein paar Biere gezischt und rumgewitzelt hatte, saß auf dem Dachvorsprung mit einer Waffe in der Hand. Verdammt.
Weil ich ihn rausgeworfen habe, dachte Duncan. Weil ich ihm nur einen Monat Zeit gegeben habe, die Wohnung zu räumen. Weil ich nicht aufgepasst habe.
Jetzt würde sich Joe vielleicht eine Kugel in den Kopf jagen oder sich vom Dach stürzen.
Nicht gerade die Art Volksbelustigung, auf die die Menschenmassen an St. Patrick’s Day gewartet hatten. Was sie allerdings auch nicht davon abhielt, zahlreich herbeizuströmen. Die Polizei hatte den Wohnblock abgesperrt, aber vom Fenster aus konnte Duncan sehen, wie sich die Menschen gegen die Absperrungen drängten und nach oben sahen.
Er nahm das Handy. »Komm schon, Joe, wir finden bestimmt eine Lösung.« Wie oft, fragte sich Duncan, würde er diesen Satz noch wiederholen müssen, den der Polizist in seinem Notizbuch einkringelte. »Lass die Waffe fallen und komm wieder rein.«
»Du hast mich gefeuert, verdammt noch mal!«
»Ja, ja, ich weiß. Es tut mir leid, Joe. Ich war echt sauer.« Du hast mich beklaut, dachte Duncan. Du hast mich bestohlen. Du hast sogar versucht, mir eine reinzuhauen. »Mir war nicht klar, wie sehr dich das alles mitnimmt, ich hatte ja auch keine Ahnung, was eigentlich mit dir los ist. Wenn du wieder reinkommst, finden wir schon eine Lösung.«
»Du weißt doch, dass mich Lori verlassen hat.«
»Ich …« Nein, nicht ›Ich‹, fiel Duncan wieder ein. Ihn quälten unerträgliche Kopfschmerzen, trotzdem bemühte er sich, den Anweisungen, die ihm Captain McVee gegeben hatte, Folge zu leisten. »Du musst völlig durch den Wind sein deswegen.«
Statt zu antworten, schluchzte Joe erneut los.
»Einfach weiterreden«, murmelte Dave.
Duncan hörte sich Joes Gejammer an und versuchte die Sätze zu wiederholen, die man ihm beigebracht hatte.
Plötzlich kam diese Rothaarige ins Zimmer geschossen. Während sie mit dem Captain redete, schälte sie sich blitzschnell aus ihrer Sommerjacke und streifte sich eine kugelsichere Weste über.
Duncan verstand nicht, was die beiden sagten, und konnte seine Augen nicht von ihr lassen. Willensstark, dachte er sofort. Energisch und sexy.
Sie schüttelte den Kopf und sah Duncan an – ihre grünen Katzenaugen musterten ihn kühl und gründlich.
»Das geht nur von Angesicht zu Angesicht, Captain. Und das wusstest du auch, als du mich gerufen hast.«
»Du kannst erst mal versuchen, ihn übers Handy zum Aufgeben zu überreden.«
»Das wurde doch bereits versucht.« Sie beobachtete den Mann, der beruhigend auf den heulenden Selbstmordkandidaten einredete. Der ehemalige Arbeitgeber und Vermieter, nahm sie an. Dafür war er aber noch ziemlich jung. Ein ziemlich gut aussehender Kerl, der sich schwer zusammenriss, nicht panisch zu werden.
»Er braucht ein Gegenüber, einen Ansprechpartner. Ist das der Arbeitgeber?«
»Duncan Swift, ihm gehört die Bar im Erdgeschoss. Er hat den Notruf gewählt, nachdem ihn unser Kandidat angerufen und gedroht hat, sich vom Dach zu stürzen. Swift hat sich seitdem nicht vom Einsatzort entfernt.«
»Verstehe. Du leitest diesen Einsatz, aber ich bin die Verhandlerin. Ich muss da rauf. Mal sehen, wie der Selbstmordkandidat reagiert.«
Sie ging zu Duncan hinüber und wies ihn an, ihr das Telefon zu geben.
»Joe? Hier spricht Phoebe. Ich gehöre zur Polizei. Wie geht es Ihnen da oben, Joe?«
»Wieso fragen Sie?«
»Ich will nur sicher sein, dass es Ihnen gut geht. Ist Ihnen nicht zu heiß, Joe? Die Sonne knallt heute ganz schön. Ich werde Duncan bitten, uns ein paar Flaschen kaltes Wasser zu holen. Ich würde sie Ihnen gerne bringen und mich mit Ihnen unterhalten.«
»Ich bin bewaffnet!«
»Ich weiß. Wenn ich Ihnen was Kaltes zu trinken rausbringe, Joe, werden Sie mich dann erschießen?«
»Nein«, sagte er nach langem Schweigen. »Nein, verdammt. Warum sollte ich? Ich kenne Sie doch gar nicht.«
»Ich bring Ihnen eine Flasche Wasser raus. Ich ganz allein, Joe. Ich möchte, dass Sie mir versprechen, jetzt nicht zu springen oder zu schießen. Versprechen Sie mir, dass ich zu Ihnen kommen und Ihnen eine Flasche Wasser bringen darf?«
»Ein Bier wär mir lieber.«
Der sehnsüchtige Klang in seiner Stimme gab ihr etwas, wo sie einhaken konnte. »Was für ein Bier hätten Sie denn gern?«
»Ich hab noch eine Flasche Harp im Kühlschrank.«
»Ein kaltes Bier ist schon unterwegs.« Sie ging zum Kühlschrank, und als sie die Flasche herausholte, trat Duncan neben sie, um sie aufzumachen. Sie nickte, nahm sich selbst eine Dose Cola und riss sie auf. »Ich komm jetzt mit dem Bier zu Ihnen rauf, einverstanden?«
»Ja, ein Bier wär schön.«
»Joe?« Ihre Stimme war so kühl wie die Flasche in ihrer Hand, während ein Polizist ihr beim Anseilen half und ihr die Waffe abnahm. »Ich stehe jetzt vor der Tür zum Dach, Joe. Darf ich raufkommen?«
»Ja, ja, das hab ich Ihnen doch schon gesagt, oder?«
Sie hatte recht gehabt, was die Sonne betraf. Sie knallte auf das Dach wie ein heißer roter Ball. Sie sah nach links und entdeckte ihn auch schon.
Er trug nur eine Art schwarze Boxershorts. Ein Typ mit aschblondem Haar und heller Haut, die bereits gefährlich rot war. Er blinzelte ihr aus seinen vom Weinen verquollenen Augen zu.
»Ich hätte zusätzlich zum Bier lieber noch etwas Sonnencreme mitbringen sollen.« Sie hielt die Flasche hoch, damit er sie sehen konnte. »Sie holen sich hier einen Riesensonnenbrand, Joe.«
»Mir doch egal.«
»Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Waffe fallen lassen würden, Joe, damit ich Ihnen Ihr Bier bringen kann.«
Er schüttelte den Kopf. »Vielleicht ist das ja nur ein Trick.«
»Ich verspreche Ihnen, keinerlei Tricks anzuwenden, wenn Sie die Waffe zur Seite legen, während ich Ihnen das Bier bringe. Ich will nur mit Ihnen reden, Joe, nur Sie und ich. Und reden macht Durst, vor allem hier draußen in der prallen Sonne.«
Während er seine Beine über den Dachvorsprung baumeln ließ, senkte er die Waffe und legte sie auf seinen Schoß. »Stellen Sie das Bier dort ab, und gehen Sie wieder.«
»Einverstanden.« Während sie auf ihn zuging, ließ sie ihn nicht aus den Augen. Sie roch seinen Schweiß und seine Verzweiflung, und sie sah das Selbstmitleid in seinen blutunterlaufenen braunen Augen. Sie stellte die Flasche vorsichtig auf den Dachvorsprung und trat wieder einen Schritt zurück. »Geht das so?«
»Wenn Sie irgendwelche Tricks versuchen, spring ich.«
»Verstehe. Warum sind Sie eigentlich so verzweifelt?«
Er griff nach dem Bier, umklammerte erneut seine Waffe und nahm einen großen Schluck. »Warum hat man Sie hier rausgeschickt?«
»Mich hat niemand geschickt, ich bin freiwillig gekommen. Das ist mein Job.«
»Wie bitte? Sind Sie Psychologin oder so was?« Er schnaubte verächtlich und nahm noch einen Schluck.
»Nicht ganz. Ich rede mit den Leuten, vor allem, wenn sie in Schwierigkeiten sind oder es zumindest glauben. Was ist mit Ihnen, Joe?«
»Ich bin ein Versager, das ist alles.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Meine Frau hat mich verlassen. Wir waren nicht mal ein halbes Jahr verheiratet, und schon ist sie weg. Dabei hat sie’s mir mehrfach gesagt. Wenn ich wieder mit dem Spielen anfange, ist sie weg. Ich hab nicht auf sie gehört, ich hab ihr einfach nicht geglaubt.«
»Das scheint Sie wirklich wahnsinnig traurig zu machen.«
»Sie war das Beste, was mir je passiert ist, und ich hab’s’s versaut. Ich dachte, ich würde gewinnen – ich wollte noch ein paarmal gewinnen und dann endgültig aufhören. Aber es hat nicht geklappt.« Er zuckte die Achseln. »Es klappt nie.«
»Aber das ist doch noch lange kein Grund, sich umzubringen. Von einem geliebten Menschen verlassen zu werden ist schlimm, und es tut weh. Aber wenn Sie sich jetzt umbringen, können Sie’s nie wiedergutmachen. Wie heißt denn Ihre Frau?«
»Lori«, murmelte er, während ihm wieder die Tränen kamen.
»Ich glaube nicht, dass Sie Lori wehtun wollen. Wie glauben Sie, wird sie sich erst fühlen, wenn Sie das tun?«
»Warum sollte ihr das jetzt noch was ausmachen?«
»Sie hat Sie immerhin so sehr geliebt, dass sie Sie geheiratet hat. Macht es Ihnen was aus, wenn ich mich hierher setze?« Sie klopfte wenige Meter von ihm entfernt auf den Dachvorsprung. Da er nur mit den Achseln zuckte, setzte sie sich und nippte an ihrem Getränk. »Ich glaube, wir finden eine Lösung, Joe. Wir finden eine Möglichkeit, Ihnen und Lori zu helfen. Sie klingen wie jemand, der eine Lösung finden möchte.«
»Ich bin meinen Job los.«
»Das ist schlimm. Was war das für ein Job?«
»Ich war an der Bar in dem Laden da unten. Lori wollte nicht, dass ich in einer Sportsbar arbeite, aber ich hab ihr gesagt, dass ich das im Griff habe. Aber das stimmte leider nicht. Ich hab angefangen, heimlich mitzuwetten. Und als ich anfing zu verlieren, hab ich in die Kasse gegriffen, damit sie nichts merkt. Je mehr ich gewettet habe, desto mehr habe ich verloren und desto mehr habe ich gestohlen. Dann wurde ich erwischt und gefeuert. Mit der Miete war ich auch schon im Rückstand.«
Er griff nach der Waffe und drehte sie in seiner Hand. Phoebe konnte sich gerade noch beherrschen, nicht instinktiv in Deckung zu gehen. »Wozu das alles? Ich hab doch nichts mehr.«
»Ich kann gut verstehen, dass Sie das derzeit so sehen. Aber es ist nun mal so, dass Ihnen noch viele Möglichkeiten offenstehen, Joe. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Wenn Sie sich jetzt umbringen, ist es vorbei, und zwar endgültig. Dann gibt es kein Zurück mehr, dann können Sie sich weder mit Lori noch mit sich selbst aussöhnen. Wie würden Sie sich denn mit ihr versöhnen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?«
»Keine Ahnung.« Er sah über die Stadt hinweg. »Ich kann Musik hören. Die muss von der Parade stammen.«
»Das Leben ist lebenswert, auch für Sie. Welche Musik hören Sie denn gern?«
Drinnen in der Wohnung wandte sich Duncan an Dave. »Musik? Was für Musik er mag? Was zum Teufel macht die Frau da draußen?«
»Sie verwickelt ihn in ein Gespräch. Sie überredet ihn, wieder runterzukommen. Jetzt antwortet er.« Dave wies mit dem Kinn auf den Mann auf dem Dach. »Solange er über Coldplay redet, stürzt er sich nicht vom Dach.«
Duncan hörte zu, während sie sich die nächsten zehn Minuten über Musik unterhielten. Eine Unterhaltung, die er in jeder Bar oder jedem Restaurant der Stadt hätte hören können. Als er sich klarmachte, dass Joe auf dem Dach saß, kam ihm die ganze Szene völlig irreal vor. Als er sich klarmachte, dass die zierliche, durchtrainierte Rothaarige mit den Katzenaugen Small Talk mit einem halb nackten, bewaffneten Barmann mit Selbstmordabsichten machte, kam ihm das vor wie ein Ding der Unmöglichkeit.
»Meinen Sie, ich sollte Lori anrufen?«, fragte Joe unsicher.
»Möchten Sie das denn?« Sie wusste schon, dass man versucht hatte, Joes Ehefrau zu erreichen, leider ohne Erfolg.
»Ich möchte ihr sagen, dass es mir leidtut.«
»Schauen Sie mich an, Joe.« Als er ihr den Kopf zuwandte, sah sie ihm fest in die Augen. »Wollen Sie ihr so zeigen, dass es Ihnen leidtut? Indem Sie sie zwingen, Sie zu begraben und um Sie zu trauern? Wollen Sie sie bestrafen?«
»Nein!« Seinem Gesicht und seiner Stimme nach zu urteilen, entsetzte ihn diese Vorstellung. »Das ist alles meine Schuld. Alles nur meine Schuld.«
»Ich glaube nicht, dass Menschen an allem selbst schuld sind. Suchen wir lieber nach einem Ausweg. Suchen wir nach einer Möglichkeit, wie Sie das Ganze wiedergutmachen können.«
»Phoebe, ich habe beinahe fünftausend Dollar Spielschulden.«
»Fünftausend sind ziemlich viel, kann einem ganz schön Angst einjagen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, Geldprobleme zu haben. Wollen Sie etwa, dass Lori für Ihre Schulden aufkommen muss?«
»Nein. Wenn ich tot bin, muss niemand mehr zahlen.«
»Ach ja? Aber sie ist Ihre Frau. Sie ist mit Ihnen verheiratet.« Phoebe wusste nicht genau, wie sich die Sache juristisch verhielt, aber es war eine Chance. »Es kann gut sein, dass sie Ihre Schulden übernehmen muss.«
»Ach du Scheiße.«
»Ich glaub, ich weiß, wie wir das Problem lösen können, Joe. Joe? Ich weiß, dass Ihr Chef in der Wohnung ist. Und zwar, weil er sich Sorgen um Sie macht.«
»Der ist in Ordnung. Dunc ist ein netter Kerl. Ich hab ihn belogen und betrogen. Ich kann’s ihm nicht verübeln, dass er mich gefeuert hat.«
»Ich verstehe, und ich sehe auch, dass Sie sich für Ihre Fehler verantwortlich fühlen. Sie sind ein verantwortungsbewusster Mensch, und Sie wollen diese Fehler wiedergutmachen. Dunc ist ein netter Kerl, sagen Sie. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass er Verständnis haben wird. Ich rede mit ihm, wenn Sie das wollen. Ich bin gut im Reden. Wenn er Ihnen genügend Zeit gibt, das Geld zurückzuzahlen, wäre Ihnen doch schon mal sehr geholfen, oder?«
»Ich … äh … ich weiß nicht.«
»Ich werd mit ihm reden.«
»Er ist ein netter Kerl. Und ich habe ihn bestohlen.«
»Sie waren verzweifelt, hatten Angst und haben einen Fehler gemacht. Ich spüre, dass es Ihnen leidtut.«
»Es tut mir auch leid.«
»Ich red mit ihm«, wiederholte sie. »Sie müssen mir nur die Waffe geben und vom Dach kommen. Sie wollen doch Lori nicht wehtun.«
»Nein, das nicht, aber …«
»Wenn Lori jetzt hier wäre, was würden Sie ihr sagen?«
»Ich – wahrscheinlich, dass ich auch nicht weiß, wie es so weit kommen konnte, und dass es mir leidtut. Dass ich sie liebe. Und dass ich sie nicht verlieren will.«
»Wenn Sie sie nicht verlieren wollen, wenn Sie sie lieben, dann geben Sie mir die Waffe und kommen vom Dach. Denn sonst lassen Sie sie mit ihrer Trauer und der Schande allein.«
»Es ist nicht ihre Schuld.«
Phoebe erhob sich vom Dachvorsprung und streckte eine Hand aus. »Sie haben recht, Joe, Sie haben vollkommen recht. Und jetzt zeigen Sie’s ihr.«
Er sah die Waffe, sah, wie Phoebe langsam danach griff. Sie war ganz schlüpfrig von seinem Schweiß, als sie sie sicherte und in ihren Gürtel steckte. »Kommen Sie vom Dach, Joe.«
»Und was dann?«
»Kommen Sie vom Dach, und ich erklär es Ihnen. Ich werde Sie nicht belügen.« Wieder streckte sie ihm ihre Hand entgegen. Eigentlich durfte sie das nicht, und das wusste sie auch. Verhandler können von einem Selbstmörder leicht mit in die Tiefe gerissen werden. Aber sie sah ihm dabei fest in die Augen und umschloss seine Hand.
Nachdem er sich vom Dachvorsprung entfernt hatte, ließ er sich einfach zu Boden fallen und schluchzte erneut. Sie blieb bei ihm, legte den Arm um ihn und schüttelte heftig den Kopf, als sie sah, dass Polizisten zur Tür geeilt waren.
»Alles wird gut. Joe, Sie müssen die Polizisten begleiten. Sie müssen sich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Aber alles wird gut.«
»Es tut mir leid.«
»Ich weiß. Und jetzt kommen Sie bitte mit. Bitte.« Sie half ihm auf und stützte ihn, während sie zur Tür gingen. »Aber erst ziehen Sie sich etwas an. Keine Handschellen«, zischte sie. »Joe, einer der Officer wird Ihnen ein Hemd, eine Hose und Schuhe holen. In Ordnung?« Als er nickte, gab sie einem der anwesenden Officer ein Zeichen.
»Muss ich ins Gefängnis?«
»Für kurze Zeit. Aber wir fangen sofort damit an, Ihre Probleme zu lösen.«
»Werden Sie Lori anrufen? Wenn sie kommen könnte, dann … dann könnte ich ihr zeigen, dass es mir leidtut.«
»Aber natürlich. Ich möchte, dass der Sonnenbrand behandelt wird, außerdem muss er jede Menge trinken.«
Joe schlug die Augen nieder und zog seine Jeans an. »Tut mir leid, Mann«, murmelte er zu Duncan.
»Mach dir deswegen mal keine Sorgen. Hör zu, ich besorg dir einen Anwalt.« Duncan sah sich Hilfe suchend nach Phoebe um. »Oder?«
»Das ist eine Sache zwischen Ihnen und Joe. Sie hängen da mit drin.« Sie tätschelte kurz Joes Arm. Zwei Polizisten führten ihn ab.
»Gut gemacht, Lieutenant.«
Phoebe zog die Waffe aus dem Gürtel und öffnete sie. »Nur eine Kugel. Er hatte nie vor, irgendjemand anders außer sich selbst zu erschießen, und die Chancen dafür standen fünfzig zu fünfzig.« Sie reichte ihrem Captain die Waffe. »Du hast gespürt, dass er mit einer Frau reden musste.«
»Den Eindruck hatte ich«, bestätigte Dave.
»Es sieht ganz so aus, als ob du recht gehabt hättest. Irgendjemand muss seine Frau ausfindig machen. Wenn sie sich weigert, ihn zu sehen, rede ich mit ihr.« Sie wischte sich die Schweißtropfen von den Brauen. »Gibt es hier irgendwo Wasser?«
Duncan reichte ihr eine Flasche. »Ich hab welches kommen lassen.«
»Danke.« Sie nahm einen großen Schluck und musterte ihn. Dichtes, volles braunes Haar, ein markantes Gesicht mit einem schönen, kräftigen Mund und hellblauen Augen, die im Moment allerdings ziemlich besorgt dreinsahen. »Werden Sie Anklage erheben?«
»Wegen was?«
»Wegen des Geldes, das er aus der Kasse genommen hat.«
»Nein.« Duncan ließ sich auf einen Stuhl sinken und schloss die Augen. »Meine Güte, nein.«
»Wie viel war es?«
»Ein paar Tausender, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das spielt keine Rolle.«
»O doch. Er muss es zurückzahlen, allein schon, damit er die Selbstachtung nicht verliert. Wenn Sie ihm wirklich helfen wollen, bestehen Sie darauf.«
»Gut. In Ordnung.«
»Sie sind auch sein Vermieter?«
»Ja. Sozusagen.«
Phoebe hob die Brauen. »Dann sind Sie doch der Gelackmeierte? Können Sie es sich leisten, noch einen Monat ohne Mieteinnahmen auszukommen?«
»Ja, ja, kein Problem.«
»Gut.«
»Hören Sie … ich weiß nur, dass Sie Phoebe heißen.«
»MacNamara. Lieutenant MacNamara.«
»Ich mag Joe. Ich will nicht, dass er ins Gefängnis muss.«
Ein netter Kerl, hatte Joe gesagt. Womit er sicher recht hatte. »Ich weiß das durchaus zu schätzen, aber die Sache hat nun mal Konsequenzen. Wenn Sie wissen, wem er die fünftausend schuldet, sollte er die auch begleichen.«
»Ich wusste nicht, dass er spielt.«
Diesmal lachte sie kurz auf. »Sie besitzen eine Sportsbar, und wissen nicht, dass darin gewettet wird?«
Ihm stellten sich die Nackenhaare auf, dabei hatte er längst einen Knoten im Magen. »Moment mal, Slam Dunc’s ist eine nette Kneipe und keine finstere Spelunke. Ich wusste nicht, dass er ein Spielsuchtproblem hat, sonst hätte ich ihn hier nicht arbeiten lassen. Ich bin vielleicht nicht ganz unschuldig daran, aber …«
»Nein, nein.« Sie hob abwehrend die Hand und rollte die kalte Flasche über ihre schweißnasse Stirn. »Mir ist heiß, und ich bin gereizt. Sie trifft nicht die geringste Schuld. Es tut mir leid. Die äußeren Umstände haben ihn auf diesen Dachvorsprung getrieben, und für diese Umstände ist er selbst verantwortlich, genauso wie für seine Entscheidungen. Wissen Sie, wo wir seine Frau finden können?«
»Ich nehme an, sie schaut sich die Parade an, wie alle anderen in Savannah außer uns.«
»Wissen Sie, wo sie wohnt?«
»Nicht genau, aber ich habe Ihrem Captain ein paar Telefonnummern gegeben. Von Freunden des Paars.«
»Wir werden sie finden. Kommen Sie jetzt allein klar?«
»Nun, ich habe nicht vor, auf dieses Dach zu klettern und zu springen, wenn Sie das meinen.« Er seufzte laut und schüttelte den Kopf. »Darf ich Sie auf ein Getränk einladen, Phoebe?«
Sie hielt ihre Wasserflasche hoch. »Das haben Sie doch schon.«
»Es gibt Besseres.«
Hmmm, ein kleines charmantes Zwinkern. »Ist schon o.k. Sie sollten jetzt nach Hause gehen, Mr. Swift.«
»Duncan.«
»Hm-hm.« Sie schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln und griff nach ihrer achtlos beiseitegeworfenen Jacke.
»He, Phoebe.« Als sie hinausging, eilte er ihr nach. »Darf ich Sie anrufen, wenn ich auf Selbstmordgedanken komme?«
»Versuchen Sie’s mal mit der Notfallnummer«, rief sie, ohne sich umzudrehen. »Dort wird man Sie bestimmt wieder davon abbringen.«
Er trat an das Treppengeländer und sah zu ihr hinunter. Willensstark, dachte er wieder. Er konnte sich durchaus für willensstarke Frauen begeistern.
Gleich darauf setzte er sich auf eine Stufe und zog sein Handy hervor. Er rief seinen besten Freund an, der außerdem sein Anwalt war, und überredete ihn, einen Barmann mit Selbstmordabsichten zu vertreten, der zu allem Überfluss auch noch spielsüchtig war.
Von ihrem Balkon im zweiten Stock aus sah Phoebe dem Gepfeife und Getrommle auf der Straße unter ihr zu.
Auch wenn sie den Auftakt verpasst hatte – es gab keinen besseren Ort, den Rest der Parade mitzuverfolgen.
Neben ihr sprang Phoebes siebenjährige Tochter in ihren knallgrünen Turnschuhen auf und ab. Carly hatte sie lange und ausgiebig um diese Schuhe angebettelt, und natürlich war es ihr egal gewesen, dass sie zu teuer waren. Sie trug sie zu kurzen grünen Hosen mit rosa Pünktchen und einem grünen T-Shirt mit einem rosa Dudelsack drauf – wofür die kleine Modediva ebenfalls ihre gesamten Überredungskünste aufgeboten hatte. Doch selbst Phoebe musste zugeben, dass die Kleine unglaublich süß darin aussah. Ihre feuerroten Haare hatte Carly von ihrer Großmutter und Mutter geerbt. Aber die Locken stammten von ihrer Großmutter, die allerdings eine Generation übersprungen hatten, denn Phoebes Haare waren glatt wie Schnittlauch. Die strahlenden knallblauen Augen stammten ebenfalls von Essie. Die mittlere Generation, dachte Phoebe, hatte sich stattdessen für Grün entschieden. Der blasse Teint war ihnen allen gemeinsam, aber Carly hatte die Grübchen geerbt, die sich Phoebe als Kind so gewünscht hatte, und den hübschen Kussmund. Es gab Momente, in denen Phoebe ihre Mutter und ihre Tochter ansah und voller Liebe für sie darüber staunte, wie sie nur das Bindeglied zwischen zwei solch perfekten Ebenbildern sein konnte.
Phoebe strich über Carlys Schulter und beugte sich vor, um ihr einen Kuss auf den wilden Rotschopf zu drücken. Prompt begann Carly über das ganze Gesicht zu strahlen und zeigte anstelle ihrer beiden Schneidezähne eine riesige Zahnlücke.
»Wir haben hier die besten Plätze.« Essie stand hinter ihnen im Zimmer und strahlte.
»Hast du den Hund gesehen, Gran?«
»Natürlich.«
Phoebes Bruder drehte sich zu ihr um. »Möchtest du dich setzen, Mama?«
»Nein, mein Schatz«, wehrte Essie Carters Angebot ab. »Ich bin ganz zufrieden so.«
»Komm doch vor ans Geländer, Gran. Ich halte auch die ganze Zeit deine Hand. Genau wie im Gerichtssaal.«
»Na gut.« Trotzdem wirkte Essies Lächeln gezwungen, als sie zum Geländer vortrat.
»Von hier aus kannst du viel besser sehen«, rief Carly. »Da kommt noch eine Marschkapelle. Ist das nicht toll, Gran? Schau nur!«
Lieb, wie sie ihre Grandma tröstet, dachte Phoebe, wie ihre kleinen Hände ihre Hand drücken, um ihr Halt zu geben. Und wie Carter sich an Mutters andere Seite stellt und ihr sanft über den Rücken streicht, während er mit der anderen auf die Menschenmenge zeigt.
Phoebe wusste, was ihre Mutter sah, wenn sie Carter betrachtete: sein dichtes braunes Haar, seine warmen haselnussbraunen Augen, die Form seines Kinns, seiner Nase, seines Mundes – in alldem erkannte die Mutter ihren Mann, den sie so früh verloren hatte. Und mit ihm alles, was noch hätte sein können.
»Frische Limonade!« Ava schob einen Teewagen durch die offene Tür. »Mit viel Minze, damit wir auch was Grünes haben.«
»Ava, du hättest dir nicht so viel Mühe machen sollen.«
»Von wegen!« Ava lachte Phoebe zu und warf ihre langen blonden Haare nach hinten. Mit dreiundvierzig war Ava Vestry Dover immer noch die schönste Frau, die Phoebe kannte. Und vielleicht auch die netteste.
Als Ava den Glaskrug hob, kam Phoebe ihr eilig zu Hilfe. »Nein, lass nur, ich schenke ein. Geh und sieh dir das Spektakel an! Mama wird sich besser fühlen, wenn du ihr Gesellschaft leistet«, fügte Phoebe noch leise hinzu.
Mit einem Nicken ging Ava zu Essie hinüber und berührte sie sanft an der Schulter.
Das war sie, ihre Familie, dachte Phoebe. Das hier war ihr Zuhause, ihr Fels in der Brandung. Ohne ihre Familie würde sie fortgeweht wie eine Staubflocke.
Sie goss Limonade ein, gab jedem ein Glas und ging dann zu Carter. Sie lehnte ihren Kopf gegen seine Schulter.
»Es tut mir leid, dass Josie nicht hier sein kann.«
»Mir auch. Sie versucht, zum Abendessen zu kommen.«
Ihr kleiner Bruder, dachte sie, ein verheirateter Mann. »Ihr solltet hier übernachten, damit ihr euch den Feiertagsstau und die wilden Horden erspart.«
»Wir mögen wilde Horden, aber ich werd sehen, was ich tun kann. Weißt du noch, wie wir zum ersten Mal hier oben standen und uns die Parade ansahen? Im ersten Frühjahr nach Reuben.«
»Ja, ich weiß.«
»Alles war so hell und laut und ausgelassen. Alle waren so glücklich. Sogar Bess hat sich das ein oder andere Lächeln abgerungen.«
2
Frisch geduscht und mit einem ziemlichen Kater saß Duncan an seiner Küchentheke und brütete bei einer Tasse schwarzem Kaffee über seinem Laptop. Eigentlich hatte er nicht so viel trinken wollen, hatte nur noch ein bisschen quatschen wollen im Slam Dunc’s, bevor er noch auf den ein oder anderen Song und ein, zwei Bier ins Swifty’s, seinen Irish Pub, verschwand. Als Barbesitzer empfiehlt es sich, nüchtern zu bleiben, so viel hatte er bereits gelernt. Aber am St. Patrick’s Day oder an Silvester konnte es schon vorkommen, dass er diese Regel nicht so genau nahm. Er wusste durchaus, wie man mit ein, zwei Bier durch die Nacht kam.
Aber es war nicht der festliche Trubel gewesen, der ihn ein paarmal zu oft nach der Bierflasche hatte greifen lassen, sondern pure Erleichterung. Joe war am Leben, und darauf wollte er trinken. Er musste dringend an die frische Luft und einen Spaziergang machen. Oder ein Schläfchen in der Hängematte. Danach würde er weitersehen. Das tat er allerdings schon sieben lange Jahre. Und es gefiel ihm.
Er saß noch kurz stirnrunzelnd über dem Laptop und schüttelte dann den Kopf. Wenn er jetzt arbeitete, oder auch nur so tat, als ob, würde sein Kopf explodieren.
Stattdessen nahm er seinen Kaffee und ging auf die hintere Veranda. Die Carolinatauben gurrten und wackelten mit dem Kopf, während sie unter dem Vogelhäuschen auf dem Boden herumpickten. Zu fett und zu faul, um hochzufliegen, dachte Duncan. Stattdessen gaben sie sich lieber mit den Resten zufrieden.
Viele Menschen verhielten sich genauso.
Sein Garten war gut gepflegt, alles blühte und gedieh, und er war stolz darauf. Er könnte ein wenig spazieren gehen und zum Bootssteg laufen. Er könnte auch eine Runde segeln gehen und über den Fluss kreuzen. Im Grunde war es ein idealer Tag dafür, einer von diesen Vormittagen mit knallblauem Himmel und einer frischen Brise, wie man sie sich im Juli so oft vergeblich wünscht. Er könnte auch einfach nur zum Bootssteg gehen, auf die Salzwiesen hinausschauen und dem tanzenden Sonnenlicht zusehen. Er könnte seinen Kaffee mitnehmen und einfach nichts tun an diesem herrlichen Frühlingsmorgen. Eine fantastische Idee.
Was Joe wohl gerade tat? Saß er in einer Zelle? In einer Gummizelle? Und was tat die Rothaarige? Es hatte keinen Sinn, so zu tun, als sei heute ein ganz normaler Tag, wo ihm der gestrige einfach nicht mehr aus dem Kopf ging. Warum sollte er sich vormachen, dass er gern auf dem Bootssteg sitzen und seinen Kater auskurieren würde, so, als sei alles in bester Ordnung?
Also ging er die Treppe zu seinem Schlafzimmer hoch, zog eine saubere Hose und ein Hemd aus dem Schrank, das nicht so aussah, als ob er darin geschlafen hätte. Dann holte er seinen Geldbeutel, seine Schlüssel und all den anderen Kram aus den Taschen seiner Jeans, in der er tatsächlich geschlafen hatte, nachdem er halb betrunken ins Bett gefallen war. Zumindest war er so schlau gewesen, ein Taxi zu nehmen, erinnerte er sich, während er sich mit den Fingern durch sein verstrubbeltes braunes Haar fuhr.
Vielleicht sollte er lieber einen Anzug anziehen? Vielleicht mochte die Rothaarige ja Anzüge, und da er sie unbedingt ausfindig machen wollte … Zum Teufel damit!
Er eilte die großzügig gewundene Haupttreppe hinunter und lief über die auf Hochglanz polierten weißen Fliesen im Foyer. Als er eine der Doppelflügeltüren öffnete, sah er einen kleinen roten Jaguar um die letzte Kurve seiner Auffahrt sausen.
Der Mann, der umständlich aus dem Wagen kletterte, war tadellos gekleidet. Phineas T. Hector schaffte es sogar noch nach einem Ringkampf im Schlamm, wie aus dem Ei gepellt auszusehen.
Duncan steckte die Daumen in die Hosentaschen und betrachtete Phin, wie er auf ihn zustolzierte. Er schien nie in Eile zu sein, fiel Duncan auf. Er sah aus wie ein Anwalt, fand er, und zwar wie ein sehr teurer. Und genau das war er inzwischen auch. Als sie sich kennengelernt hatten – war das wirklich schon wieder zehn Jahre her? -, hatte Phin kaum das Taxi zum Gericht bezahlen können, geschweige denn ein teures Outfit. Das Licht spiegelte sich in Phins dunkler Sonnenbrille, als er am Fuß der weißen Treppe stehen blieb, um Duncan zu mustern.
»Du siehst mitgenommen aus, Kumpel.«
»So fühle ich mich auch.«
»Das kann ich mir vorstellen, nach dem vielen Alkohol, in dem du gestern Nacht dein Selbstmitleid ertränkt hast.«
»Da hat es sich noch gut angefühlt. Was machst du hier?«
»Ich halte mich an unsere Verabredung.«
»Wir waren verabredet?«
Phin schüttelte nur den Kopf, während er die Treppe hochschritt. »Dass du dich daran nicht mehr erinnern kannst, hätte ich mir eigentlich denken können. Du warst viel zu sehr damit beschäftigt, irisches Bier zu trinken und ›Danny Boy‹ zu singen.«
»Ich habe nicht ›Danny Boy‹ gesungen.« Lieber Gott, bitte mach, dass das nicht wahr ist.
»Beschwören kann ich es nicht. Für mich klingen diese irischen Lieder alle gleich. Du wolltest gerade gehen?«
»Ja, ich war schon auf dem Sprung. Wir sollten lieber reingehen.«
»Hier draußen können wir genauso gut reden.« Phin ließ sich auf einer langen weißen Liege nieder und legte seine Arme auf die Seitenlehnen. »Überlegst du immer noch, dieses Anwesen zu verkaufen?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht.« Duncan sah sich um – Gärten, Bäume, schattige Täler, sattes, grünes Gras. Er wusste nie, wie er am nächsten Tag zu dem Anwesen stehen würde. »Wahrscheinlich schon. Irgendwann.«
»Ein wirklich schönes Fleckchen. Nur ein bisschen weit vom Schuss.«
»Genau deswegen. Hab ich dich gebeten, zu mir rauszukommen, Phin? Ich erinnere mich nur undeutlich.«
»Du hast mich gebeten, heute Morgen bei Joe, dem Selbstmörder, vorbeizuschauen und danach herzukommen, um dir Bericht zu erstatten. Als ich mich einverstanden erklärte, hast du mich umarmt und mir einen feuchten Kuss gegeben.«
Duncan kramte nach den Schlüsseln in seiner Hosentasche. »Ich wollte gerade in die Stadt fahren und nach ihm sehen.«
»Die Fahrt kannst du dir sparen. Es geht ihm gut im Vergleich zu gestern.«
»War seine Frau …«
»Sie war da«, unterbrach ihn Phin. »Sie war ziemlich sauer, aber sie war da. Er hat einen schlimmen Sonnenbrand, der gerade behandelt wird, und als sein Anwalt habe ich eingewilligt, dass ihm vom Gericht ein Psychiater zur Seite gestellt wird. Da du keine Anklage erhebst, muss er nicht lange einsitzen. Er bekommt Hilfe, so wie du es wolltest.«
»Ja.« Aber warum hatte er dann trotzdem solche Schuldgefühle?
»Wenn du ihn wieder einstellst, Dunc, trete ich dir in den Hintern.«
»Das schaffst du nicht.« Duncan schenkte ihm ein breites Grinsen. »Dafür kämpfst du mit zu weichen Bandagen, mein Freund.«
»Du hast bereits mehr getan, als die meisten Leute tun würden. Und du hast ihm den besten Anwalt von ganz Savannah verschafft.«
»Das will ich angesichts deines Wucherhonorars auch hoffen«, murmelte Duncan.
Phin grinste nur. »Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Nun, dann werd ich mich mal wieder auf den Weg machen und ein paar andere Mandanten über den Tisch ziehen.«
»Und was ist mit der Rothaarigen?«
»Welche Rothaarige?« Phin schob seine Sonnenbrille auf die Nasenspitze und musterte Duncan über ihren Rand hinweg. »Gestern Abend gab es einige Blondinen und eine tolle Brünette, die dich angemacht haben, aber du warst ja viel zu sehr mit deinem Bier beschäftigt.«
»Ich rede nicht von gestern Abend. Ich meine Phoebe MacNamara. Lieutenant Phoebe MacNamara.« Mit einem langen, übertriebenen Seufzer legte Duncan die Hand aufs Herz. »Ich brauch ihren Namen nur auszusprechen und werde schon ganz schwach. Ich fürchte, ich muss mich wiederholen: Lieutenant Phoebe MacNamara.«
Phin verdrehte die Augen. »Du bist mir einer, Swift, was willst du denn mit einer Polizistin anfangen?«
»Oh, keine Sorge, da fällt mir so einiges ein. Sie hat grüne Augen und eine gute Figur. Und sie ist auf dieses Dach rausgeklettert. Da sitzt dieser Typ mit einer Waffe in der Hand auf dem Dachvorsprung, ein Typ, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat, aber sie geht da raus.«
»Und das findest du attraktiv?«
»Ich finde das faszinierend. Und scharf. Du hast sie doch kennengelernt. Was meinst du?«
»Ich fand sie sehr direkt, höflich und raffiniert. Außerdem hat sie einen fantastischen Arsch.«
»Sie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich fürchte, ich muss sie wiedersehen, und jetzt rate mal, warum. Du kannst mich in die Stadt mitnehmen, ich muss sowieso mein Auto abholen.«
Nachdem sie zwei Stunden trainiert hatte, setzte sich Phoebe an ihren Schreibtisch. Sie hatte das Haar zurückgebunden und im Nacken zu einem Knoten geschlungen, hauptsächlich, damit es ihr nicht ins Gesicht fiel. Außerdem fand – beziehungsweise hoffte – sie, dass ihr diese Frisur eine gewisse Autorität verlieh. Viele der Polizisten, die sie ausbildete, nahmen eine Frau zunächst nicht besonders ernst. Dabei mochte sie in Dave zwar einen Fürsprecher gehabt haben, der ihr geholfen hatte, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber die Tür weit aufgestoßen hatte sie selbst. Sie hatte sich ihren Dienstgrad und ihre Position hart erarbeitet. Und eben deshalb musste sie sich jetzt mit jeder Menge Papierkram herumschlagen und den Nachmittag auf dem Gericht verbringen, um in einem Fall von häuslicher Gewalt, der als Geiselnahme geendet hatte, als Zeugin auszusagen. Danach musste sie wieder zurück, um so viel zu erledigen wie möglich, und anschließend dringend auf den Markt. Sobald sie den Haushalt erledigt hatte, warteten die Fachbücher auf sie. Sie hatte noch eine Vorlesung über Verhandlungen in Krisensituationen vorzubereiten. Und irgendwann musste sie auch noch die Zeit finden, ihre längst fällige Buchhaltung zu machen und nachzurechnen, ob sie sich irgendwie ein neues Auto leisten konnte, ohne dafür gleich eine Bank überfallen zu müssen.
Sie öffnete die erste Datei und begann sich um ihren kleinen Bereich im Police-Department von Savannah-Chatham zu kümmern.
»Lieutenant?«
»Hmmmmm?« Ohne aufzusehen, erkannte sie Sykes, einen der Verhandler aus ihrer Gruppe.
»Da draußen ist ein Typ, der dich sehen will. Duncan Swift.«
»Hmmm?« Diesmal hob sie stirnrunzelnd den Blick und konnte aus ihrem Bürofenster sehen, wie Duncan das Department beäugte, als sei es ein fremder Planet. Sie dachte an die viele Arbeit, die sie in so kurzer Zeit bewältigen musste, und wollte ihn eigentlich schon wegschicken. Doch dann trafen sich ihre Blicke, und er lächelte.
»Na gut.« Sie erhob sich von ihrem Schreibtisch und trat in die Tür. »Mr. Swift?«
Er hatte ein verdammt gewinnendes Lächeln. Aber sie sah auch, dass ihm das Lächeln leichtfiel und oft eingesetzt wurde. Seine knallblauen Augen sahen sie durchdringend an. Ihrer Erfahrung nach gab es nicht viele, die so einen intensiven Blickkontakt angenehm fanden.
»Sie sind beschäftigt«, sagte er, als er schließlich vor ihr stand. »Soll ich ein andermal wiederkommen?«
»Wenn Ihr Anliegen zehn Jahre warten kann, gerne.«
»Ich fürchte, nein.«
»Dann kommen Sie herein.«
»Wow. Hier sieht es aus wie im Fernsehen, aber dann doch wieder nicht. Stört es Sie nicht, hier zu sitzen, wo jeder sehen kann, was Sie so den ganzen Tag machen?«
»Wenn es mich stört, kann ich immer noch die Jalousien runterlassen.«
»Ich wette, das kommt so gut wie nie vor.«
»Ich hab mit dem Anwalt gesprochen, den Sie mit der Vertretung von Joe beauftragt haben. Er macht einen sehr kompetenten Eindruck.«
»Und ob. Ich bin hier, weil … ich Sie fragen wollte, ob ich Selbstmörder-Joe besuchen soll …«
»Wie bitte? Selbstmörder-Joe?«
»Entschuldigen Sie, wir haben ihn gestern Abend so genannt, und der Spitzname ist einfach hängen geblieben. Soll ich ihn besuchen, oder ist es besser für ihn, wenn ich mich fernhalte?«
»Was möchten Sie denn?«
»Keine Ahnung. Wir waren schließlich nicht befreundet oder so. Aber das mit gestern geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.«
»Was zählt, ist eher, wie es in seinem Kopf aussieht.«
»Ja. Ja. Ich hatte diesen Traum.«
»Ach ja?«
»Ich saß da draußen in der Unterhose auf dem Dachvorsprung.«
»In Boxershorts oder Slip?«
Er musste lachten. »In Boxershorts. Wie dem auch sei, ich saß auf dem Dachvorsprung, und Sie saßen neben mir.«
»Hegen Sie Selbstmordgedanken?«
»Kein bisschen.«
»So was nennt man Übertragung. Sie versetzen sich in ihn hinein. Das war eine traumatische Erfahrung, für Sie und für Joe, auch wenn sie gut ausgegangen ist.«
»Hatten Sie auch schon Fälle, bei denen das nicht so war?«
»Ja.«
Er nickte und hakte nicht weiter nach. »Und wie nennt man das, wenn ich Sie nicht mehr aus dem Kopf kriege? Wunschdenken?«
»Das kommt ganz auf Ihre Wünsche an.«
»Ich hab Sie gegoogelt.«
Sie lehnte sich zurück und hob die Brauen.
»Als eine Art Abkürzung, um die Neugier zu befriedigen. Aber manchmal macht man lieber einen Umweg und recherchiert direkt an der Quelle, vielleicht sogar bei einem guten Essen und einem Drink. Und falls Sie sich jetzt fragen, ob das eine Anmache sein soll, kann ich das nur mit einem eindeutigen Ja beantworten.«
»Ich bin eine geschulte Beobachterin. Wenn ich etwas weiß, muss ich mich das nicht fragen. Ich weiß Ihre Aufrichtigkeit und Ihr Interesse sehr zu schätzen, aber …«
»Bitte sagen Sie jetzt nicht aber, nicht von Anfang an.« Er beugte sich vor, griff nach einer Haarspange, die sie vorher verloren haben musste, und gab sie ihr. »Sie könnten es als eine Art öffentliche Dienstleistung betrachten, und ich bin die Öffentlichkeit. Wir könnten uns bei einem guten Essen unsere Lebensgeschichte erzählen. Wann und wo, bestimmen Sie. Und wenn uns das, was wir da hören, nicht gefällt – na und?«
Sie legte die Haarspange auf ihren Schreibtisch. »Jetzt sind Sie der Verhandler.«
»Und darin bin ich ziemlich gut. Wir könnten auch nur was trinken gehen – eine halbe Stunde, direkt nach der Arbeit oder nach Dienstschluss, wie Sie es nennen.«
»Heute Abend kann ich nicht – da hab ich schon was vor.«
»Und gibt es irgendeinen Abend in nicht allzu ferner Zukunft, an dem Sie noch nichts vorhaben?«
»Jede Menge sogar.« Sie wippte sanft mit ihrem Stuhl vor und zurück und musterte ihn. Warum sah er auch so verdammt gut aus? Sie hatte jetzt wirklich keine Zeit für so was. »Morgen Abend, von neun bis halb zehn. Ich treffe Sie in der Bar.«
»Prima. In welcher Bar?«
»Wie bitte?«
»Sie wollen doch bestimmt nicht ins Dunc’s – und erst recht nicht nach dem gestrigen Tag. Außerdem ist es dort laut und voll, und die Jungs reden nur über Sport. Ich bin eher fürs Swifty’s.«
»Gehört Ihnen das Swifty’s?«
»Sozusagen. Waren Sie schon mal da?«
»Ein Mal.«
Er zog die Brauen zusammen. »Und es hat Ihnen nicht gefallen.«
»Mir schon. Aber meinem damaligen Begleiter nicht.«
»Wenn Sie lieber woanders hinwollen …«
»Nein, ist gut. Um neun also. Sie können dann einen Großteil der halben Stunde damit bestreiten, mir zu erklären, wie man ›sozusagen‹ ein paar Bars und ein Mietshaus besitzen kann.«
Er schenkte ihr wieder sein gewinnendes Lächeln. »Ich hoffe, Sie überlegen es sich nicht wieder anders.«
»Das passiert mir selten.«
»Gut zu wissen. Also dann bis morgen, Phoebe.«
Das war unvernünftig, dachte sie, während sie ihm nachsah. Aber wahrscheinlich war es immer unvernünftig, sich mit einem schlaksigen, charmanten Mann mit knallblauen Augen zu verabreden, und erst recht mit jemandem, der ihr Schmetterlinge im Bauch bescherte, wenn er sie anlächelte.
Egal, es war ja nur auf einen Drink. Außerdem war es schon lange her, dass sie sich eine halbe Stunde aus den Rippen geschnitten hatte, um mit einem Mann unvernünftig zu sein.
Kurz nach sieben kam Phoebe mit einer Tüte voller Lebensmittel und einer schweren Aktentasche vollkommen genervt nach Hause. Ihr Auto hatte in der Nähe des Polizeireviers den Geist aufgegeben. Die Abschleppkosten würden einen Großteil ihres monatlichen Budgets auffressen. Und wenn sie dann noch an die Reparaturkosten dachte, gefiel ihr die Idee mit dem Banküberfall immer besser.
Sie ließ ihre Aktentasche fallen und sah sich im prächtigen Foyer um. Es war lächerlich, in einem verdammten Herrenhaus zu leben und nicht zu wissen, woher man das Geld nehmen soll, um einen acht Jahre alten Ford Taunus reparieren zu lassen. Es war lächerlich, von Antiquitäten, Kunst, Silber und Kristall umgeben zu sein, ohne irgendetwas davon verkaufen, verpfänden oder eintauschen zu können.
Sie lehnte sich gegen die Eingangstür und schloss so lange die Augen, bis sie wieder so etwas wie Dankbarkeit empfinden konnte. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, ihre Familie hatte ein Dach über dem Kopf. Dafür war stets gesorgt.
Solange sie sich an die Regeln hielt, die eine tote Frau aufgestellt hatte.
Sie richtete sich auf und verdrängte ihre Sorgen, bis sie sich wieder gefasst hatte. Dann trug sie die Tüte mit den Lebensmitteln quer durchs Haus in die Küche.
Da waren sie auch schon, ihre Mädels. Carly saß am Küchentisch und brütete über ihren Hausaufgaben. Mama und Ava standen am Herd und machten das Abendessen. Phoebe kannte das Sprichwort, dass zwei Köche den Brei verderben, aber auf die beiden Frauen traf das nicht zu.
In der Küche duftete es nach Kräutern, Gemüse und Frauen.
»Ich hab euch doch gesagt, dass ihr mit dem Abendessen nicht auf mich warten sollt.«
Als Phoebe hereinkam, fuhren alle Köpfe zu ihr herum. »Mama, ich bin fast fertig mit Schönschreiben!«
»Gut gemacht, Kleines.« Phoebe stellte ihre Tüte auf der Küchentheke ab und ging zu Carly, um ihr einen dicken Kuss zu geben. »Ich wette, du hast Hunger.«
»Wir wollten auf dich warten.«
»Natürlich haben wir gewartet.« Essie kam auf sie zu und strich ihr über den Arm. »Alles in Ordnung, Liebes? Du musst unglaublich müde sein! So was Dummes mit dem Wagen.«
»Es geht schon.«
»Wie bist du nach Hause gekommen?«
»Ich hab den Bus genommen, was ich auch in Zukunft tun werde, bis der Wagen repariert ist.«
»Du kannst meinen haben«, sagte Ava.
Aber Phoebe schüttelte nur den Kopf. »Es ist mir lieber, wenn ich weiß, dass ihr hier ein Auto zur Verfügung habt. Macht euch keine Sorgen. Was gibt’s zum Abendessen? Ich bin am Verhungern.«
»Geh nur und wasch dir die Hände. Und dann setzt du dich an den Tisch. Alles ist fertig – also ab mit dir!«
»Aber gern.« Sie zwinkerte Carly zu, bevor sie vom Flur aus ins Bad ging.
Auch dafür konnte sie dankbar sein, ermahnte sie sich. Es gab jede Menge Aufgaben und Pflichten, die sie sich nicht aufhalsen musste, weil ihre Mutter und Ava da waren. Tausend kleine Sorgen, die sie einfach beiseitewischen konnte. Da sollte man sich über ein altes Auto nicht den Kopf zerbrechen.
Sie musterte sich im Spiegel, während sie die Hände abtrocknete. Sie sah zugegebenermaßen müde und verspannt aus. Wenn sie sich jetzt nicht ein wenig ausruhte, würde sie morgen Falten haben, die heute noch nicht da gewesen waren.
Aber mit dreiunddreißig kommen unweigerlich die ersten Falten. Das ist nun mal der Lauf der Natur, und deshalb wollte sie sich trotzdem ein großes Glas Wein zum Abendessen gönnen, das würde sie entspannen. Sie hörte Carly zu, die von der Schule erzählte, und ihrer Mutter, die über das Buch sprach, das sie gerade las.
»Du bist so still, Phoebe. Bist du einfach nur erschöpft?«
»Ein bisschen«, sagte sie zu Ava. »Aber eigentlich höre ich euch bloß zu.«
»Wir können nicht mal für fünf Minuten die Klappe halten. Erzähl uns, was dir heute Schönes passiert ist.«
Das war ein altes Spiel, das ihre Mutter mit ihnen spielte, seit Phoebe denken konnte. Sobald etwas Schlimmes, Trauriges oder Ärgerliches passierte, bat Essie, ihr etwas Schönes zu erzählen.
»Hm, mal sehen. Der Unterricht ist gut gelaufen.«
»Das zählt nicht.«
»Dann zählt es bestimmt auch nicht, wenn ich sage, dass der Staatsanwalt mit meiner Zeugenaussage vor Gericht höchst zufrieden war.«
»Etwas Schönes«, sagte Essie, »das ist die Regel.«
»Na gut. Mann, ist die streng!«, sagte Phoebe zu Carly, um sie zum Lachen zu bringen. »Ob das was Schönes ist, weiß ich nicht, aber zumindest mal was Neues. Heute kam ein sehr gut aussehender Mann zu mir ins Büro.«
»Das zählt nur, wenn er dich zum Abendessen eingeladen hat«, hob Ava an, doch als sie Phoebe ansah, blieb ihr der Mund offen stehen. »Du hast eine Verabredung?«
»Na ja, aber deswegen brauchst du noch lange nicht so zu tun, als handele es sich um eine wissenschaftliche Sensation.«
»Die kommt in etwa genauso selten vor. Wer …«
»Außerdem ist es keine Verabredung. Nicht wirklich. Es geht um den Selbstmörder, den ich gestern überredet habe, aufzugeben – das heißt, nicht um ihn, sondern um seinen Arbeitgeber. Er will nur etwas mit mir trinken gehen.« Sie gab Carlys Nase einen Stups. »Wenn du längst im Bett liegst.«
»Ist er süß?«, fragte Ava.
Der Wein und die angenehme Gesellschaft verfehlten ihre Wirkung nicht. Phoebe musste breit grinsen. »Wahnsinnig süß. Aber ich treffe ihn nur auf einen Drink, und damit basta.«
»Sich mit Männern zu verabreden, ist keine lebensbedrohliche Krankheit.«
»Und das musst ausgerechnet du sagen.« Phoebe spießte ein Stück Huhn auf ihre Gabel und sah ihre Mutter an. »Und was meinst du, Mama?«
»Ich hab gerade überlegt, wie schön es wäre, wenn du jemanden hättest, mit dem du essen, ins Kino und spazieren gehen könntest.« Sie legte eine Hand auf die von Phoebe. »Wenn in diesem Haus mal eine Männerstimme zu hören ist, dann nur, wenn Carter zu Besuch ist oder ein Handwerker kommt. Und was macht dieser süße Mann so?«
»Das weiß ich nicht so genau. Ich habe eigentlich keine Ahnung.« Sie nippte erneut an ihrem Wein. »Aber das werde ich morgen schon herausfinden.«
Wenn sie zu Hause war und es zeitlich schaffte, ließ Phoebe es sich nicht nehmen, Carly ins Bett zu bringen. Jetzt, wo ihre kleine Tochter die sieben überschritten hatte, wusste sie, dass die Zeiten sich bald ändern würden, und sie genoss dieses Ritual.
»Höchste Zeit für dich, ins Bett zu gehen, Liebes.« Phoebe beugte sich vor, um Carly einen Kuss auf die Nasenspitze zu geben.
»Nur noch ein bisschen! Darf ich am Freitagabend aufbleiben, so lange ich will?«
»Hmmm.« Phoebe strich über Carlys Locken. »Das lässt sich bestimmt einrichten. Mal sehen, wie du am Freitag beim Diktat abschneidest.«
Begeistert von der Idee hopste Carly auf ihrem Stuhl auf und ab. »Wenn ich eine Eins schreibe, leihen wir uns dann eine DVD aus, machen Popcorn und ich darf aufbleiben, so lange ich will?«
»Das ist aber eine saftige Belohnung. Hast du am Freitag nicht auch noch eine Matheprüfung?«
»Vielleicht. Die ist schwerer als das Diktat.«
»Das fand ich auch immer. Aber wenn du in beiden Prüfungen eine gute Note schreibst, dann bin ich mit der DVD, dem Popcorn und dem langen Aufbleiben einverstanden. Aber jetzt marsch ins Bett, damit du dich morgen gut konzentrieren kannst.«
»Mama?«, fragte Carly, als Phoebe die Nachttischlampe löschte.
»Ja, Kleines.«
»Vermisst du Roy?«
Nicht ›Daddy‹, dachte Phoebe schmerzlich. Nicht ›Dad‹. Nicht einmal ›meinen Vater‹. Phoebe setzte sich auf die Bettkante und strich Carly über die Wange. »Vermisst du ihn denn?«
»Ich hab dich gefragt.«
»Ja, richtig.« Ehrlichkeit war eine Grundvoraussetzung in der Beziehung zu ihrer Tochter. »Nein, Süße, ich vermisse ihn nicht.«
»Gut.«
»Carly …«
»Ist schon in Ordnung. Ich vermiss ihn auch nicht, und es geht mir gut damit. Ich hab nur über das nachgedacht, was Gran beim Abendessen gesagt hat. Dass du jemanden haben sollst, mit dem du spazieren gehen kannst und so.«
»Ich kann doch mit dir spazieren gehen.«
Carlys hübscher Mund verzog sich zu einem Strahlen. »Wir könnten doch am Samstag einen Spaziergang machen. Einen richtig langen. Bis zur River Street.«
Phoebe durchschaute den Trick und kniff die Augen zusammen. »Wir werden nicht einkaufen gehen.«
»Wir können doch einfach nur in die Schaufenster gucken, ohne etwas zu kaufen.«
»Das sagst du jedes Mal. Außerdem ist die River Street am Samstag voller Touristen.«
»Dann können wir ja einfach nur in die Mall gehen.«
»Du bist wirklich raffiniert, meine Kleine, aber dieses Spiel gewinnst du nicht. An diesem Wochenende wird nicht eingekauft. Und du liegst deiner Oma nicht damit in den Ohren, dass sie dir irgendwas aus dem Internet bestellen soll.«
Jetzt verdrehte Carly die Augen. »Na gut.«
Lachend beugte Phoebe sich vor, um ihre Tochter noch einmal fest zu umarmen. »Komm her, ich hab dich wirklich zum Fressen gern!«
»Ich dich auch, Mama. Wenn ich in den nächsten drei Prüfungen eine Eins schreibe, darf ich dann …«
»Heute wird nicht mehr verhandelt. Und jetzt gute Nacht, Carly Anne MacNamara.«
Sie legte den Zeigefinger auf die Lippen und stand auf. Als sie hinausging, ließ sie die Tür einen Spalt offen, damit Flurlicht ins Zimmer schien, so, wie es ihre Tochter gern hatte.
Sie musste jetzt dringend mit ihrer Arbeit weitermachen. Sie würde noch mindestens zwei Stunden brauchen. Aber anstatt sich in ihr Arbeitszimmer zu begeben, steuerte Phoebe das Zimmer ihrer Mutter an.
Dort saß Essie, wie an den meisten Abenden, und häkelte.
»Ich hab einen Auftrag für ein Taufkleidchen«, sagte Essie und sah lächelnd auf, während ihre Finger emsig mit Faden und Häkelnadel beschäftigt waren.
Phoebe ging zu ihr und setzte sich in den hübschen kleinen Gobelinsessel, der zu dem gehörte, in dem ihre Mutter saß. »Du machst so wunderschöne Sachen.«
»Ich genieße es. Es macht mich glücklich. Ich weiß, dass wir damit nicht gerade viel Geld verdienen, Phoebe, aber …«
»Hauptsache, es füllt dich aus. Die Leute, die deine Handarbeiten kaufen, kaufen sich ein Familienerbstück. Sie können sich glücklich schätzen. Mama, Carly hat nach Roy gefragt.«
»Ach ja?« Essies Hände hielten abrupt inne. »Macht sie sich Sorgen?«
»Nein, kein bisschen. Sie wollte nur wissen, ob ich ihn vermisse. Ich hab ihr die Wahrheit gesagt, nämlich, dass ich ihn nicht vermisse, und kann nur hoffen, dass das richtig war.«
»Ich finde, ja.« In Essies Augen stand Besorgnis. »Wir hatten wirklich ein verdammtes Pech mit den Männern, was, meine Kleine?«
»Allerdings.« Phoebe lehnte sich zurück und ließ ihren Blick über den prächtigen Stuck an der Zimmerdecke wandern. »Ich überlege, ob ich die morgige Verabredung nicht lieber absagen soll.«
»Aber warum denn?«
»Es geht uns doch gut, oder? Carly ist glücklich. Du hast deine Arbeit, die dich ausfüllt, und ich meine. Ava ist zufrieden – obwohl ich mir wünschen würde, dass sie und Dave endlich aufhören, uns was vorzumachen. Jetzt, wo sie beide frei und ungebunden sind … Warum sollte ich irgendetwas daran ändern, indem ich mit einem Mann, den ich kaum kenne, etwas trinken gehe?«
»Weil du eine hübsche junge Frau bist, die noch ihr ganzes Leben vor sich hat. Du musst dringend mal hier raus aus diesem Hühnerstall. Das mag komisch klingen, wenn ausgerechnet ich das sage – trotzdem.« Essies Hände fuhren mit ihrer Arbeit fort. »Das Letzte, was ich mir für dich wünsche, ist, dass du dich abkapselst und dich in diesem Zuhause, das wir uns geschaffen haben, vergräbst. Du wirst morgen Abend mit diesem gut aussehenden Mann ausgehen. Und das ist ein Befehl!«
3
Phoebe nahm vor der versammelten Klasse Platz. Fünfundzwanzig Polizisten ließen sich von ihr ausbilden, eine bunte Mischung aus Uniformen, Zivilkleidung und verschiedenen Rangstufen.
Und die meisten davon, das wusste sie, wollten eigentlich gar nicht hier sein.
»Heute werde ich darüber sprechen, welche Taktiken der Verhandler in einer Krisensituation oder bei einer Geiselnahme verfolgen kann. Aber zunächst einmal möchte ich wissen, ob es noch Fragen zum gestrigen Unterricht gibt.«
Eine Hand wurde gehoben. Phoebe spürte spontan Ärger in sich aufsteigen. Officer Arnold Meeks, Polizist in dritter Generation. Ein streitsüchtiger Sturkopf, der sich gern als Macho aufspielte.
»Officer Meeks?«
»Yes, Ma’am.« Sein Lächeln war eher ein Grinsen. »Sie haben neulich am St. Patrick’s Day einen Selbstmordkandidaten von seinem Vorhaben abgebracht?«
»Das stimmt.«
»Na ja, da wir bei Ihnen Unterricht haben, hätte ich dazu gern ein paar Details gehört. Vor allem, weil Sie offenbar einige Grundregeln für Verhandler gebrochen haben. Oder gelten für Sie mit Ihrer FBI-Ausbildung andere Regeln?«
Ihre FBI-Ausbildung sorgte mit schöner Regelmäßigkeit für Irritationen. Damit würde sie wohl oder übel leben müssen. »Welche Regeln habe ich denn gebrochen, Officer Meeks?«
»Na ja, Ma’am …«
»Sie dürfen mich mit meinem Dienstgrad ansprechen, so wie ich das auch bei Ihnen tue, Officer.«
Sie sah eine Spur von Verärgerung in seinem Gesicht. »Die Person war bewaffnet, aber Sie sind ihr allein gegenübergetreten, ohne Deckung.«
»Das stimmt. Und es stimmt auch, dass es ein Verhandler nach Möglichkeit vermeiden sollte, einem Bewaffneten allein gegenüberzutreten. Aber manchmal gibt es Umstände, die genau das erfordern. Wir werden bei den Rollenspielen im zweiten Teil unserer Ausbildung noch auf solche Krisensituationen zu sprechen kommen.«
»Warum …«
»Ich will das gerade erklären. Meiner Meinung nach machte es der Fall am St. Patrick’s Day erforderlich, der Person allein gegenüberzutreten. Man kann sogar sagen, dass die meisten Selbstmordkandidaten positiv darauf reagieren. Die Person war nie als gewalttätig aufgefallen und hatte noch nicht geschossen. Meiner Einschätzung nach überwogen die Vorteile die Nachteile bei Weitem. Da wir die anderen Aspekte dieser sogenannten ›Face-to-face‹-Verhandlungen bereits durchgenommen haben …«
»Stimmt es auch, dass Sie die Person mit Alkohol versorgt haben?«
Ich wette, du hast ein Potenzproblem, dachte sie, nickte aber. »Ich habe der Person auf ihren eigenen Wunsch hin ein Bier gebracht, das ist nicht verboten. Die Entscheidung liegt beim Verhandler und hängt davon ab, wie er die Situation und die Person einschätzt.«
»Wenn man ihn betrunken genug gemacht hätte, wäre er vielleicht noch vom Dach gefallen.« Arnies Bemerkung brachte ihm ein paar Lacher ein. Phoebe legte den Kopf schräg und wartete, bis sie wieder verstummt waren.
»Wenn Sie das nächste Mal auf einem Dachvorsprung sitzen, Officer, werde ich daran denken, dass Sie schon von einem Bier betrunken werden, und Ihnen stattdessen eine Cola bringen.«
Jetzt hatte sie die Lacher auf ihrer Seite, doch als sie sah, wie Arnies Gesicht wutrot wurde, sagte sie: »Wie bereits erwähnt, gibt es selbstverständlich bestimmte Grundregeln für Verhandlungen. Trotzdem muss der Verhandler flexibel bleiben und selbst überlegen, was in der jeweiligen Situation angebracht ist.«
»Aber Sie geben mir recht, dass es riskant ist, Alkohol oder Drogen zu verabreichen?«
»Natürlich. Nur, dass ich das Risiko in diesem Fall für äußerst gering hielt. Die Person forderte keinen Alkohol, sondern bat höflich um ein Bier. Indem ich dem Mann das Gewünschte brachte, gab ich ihm das Gefühl, die Situation besser im Griff zu haben. Und jetzt hören Sie mir mal gut zu«, sagte sie zu Arnie, bevor er seinen grinsenden Mund wieder aufmachen konnte. Sie machte eine lange Pause, um danach ruhig und gelassen weiterreden zu können. »Die Rettung eines Menschenlebens ist immer das vordringlichste Verhandlungsziel. Alles andere ist nebensächlich. Deshalb habe ich mich in der Situation – und jede Situation ist anders – dafür entschieden, dem Mann allein gegenüberzutreten und ihm ein Bier zu bringen. Einfach, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich ihn so leichter zum Aufgeben bewegen kann. Da er noch lebt und es keine Verletzten gab, da er die Waffe nicht benutzte, sondern mir übergab, gehe ich davon aus, dass meine Entscheidung in diesem speziellen Fall richtig war.«
»Sie haben sogar noch einen Mittelsmann hinzugezogen.«
Jetzt lächelte Phoebe zuckersüß. »Officer Meeks, wie ich sehe, scheinen Sie eine ganze Reihe von kritischen Fragen hinsichtlich dieses Falles und meines Umgangs damit zu haben. Das klingt ja fast so, als ob Sie zufriedener wären, wenn die Person gesprungen wäre.«
»Da das Haus, auf dem der Betreffende saß, nur vier Stockwerke hoch war, hätte er sich höchstens ein paar Knochen gebrochen. Außer, er hätte vorher erst Sie und dann sich selbst erschossen.«
»Eine Person mit Selbstmordabsichten nicht ernst zu nehmen ist auch eine interessante Herangehensweise.«
Sie hob lässig die Hand, um sich eine Strähne aus dem Gesicht zu streifen. Wie nebenbei sagte sie: »Ich kannte