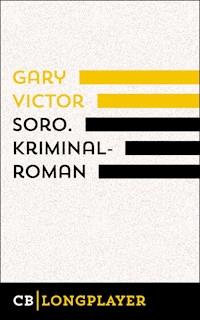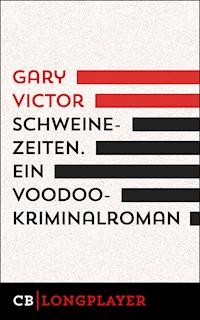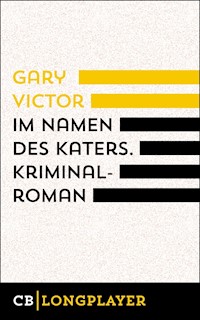
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Inspektor Dieuswalwe Azémar ermittelt in einer Mordserie, die ihm persönlich nahegeht: Alle Opfer waren wie er dem lokalen Zuckerrohrschnaps, dem kleren, zugetan und als Konsumenten von Katzenfleisch bekannt, das nach Meinung vieler kleren-Liebhaber besonders gut zu diesem Getränk passt. Als er die Ermittlungen auf Befehl seines Vorgesetzten unterbricht, um einen gewissen Georges zu suchen, den eine Dame aus höchsten Kreisen als vermisst gemeldet hat, ahnt er nicht, in welches Wespennest er sticht. Je weitere Kreise der scheinbar skurrile Fall zieht, desto gefährlicher wird es für den Inspektor, den auch die Geister der eigenen Vergangenheit bedrängen. Im Kampf gegen Bandenkriminalität und okkulte Machenschaften kann Azémar sich auch auf seine engsten Mitarbeiter nicht mehr verlassen, doch es bleiben ihm seine Tochter Mireya, seine Beretta und die zwei W in seinem Vornahmen. »Haiti ist nur reich an Not und Elend. Selbst damit wird es noch ausgebeutet. Gary Victor führt das vor in finster leuchtenden Krimis.« Elmar Krekeler, Die Welt »Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur.« Thomas Wörtche, Leichenberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Inspektor Dieuswalwe Azémar ermittelt in einer Mordserie, die ihm persönlich nahegeht: Alle Opfer waren wie er dem lokalen Zuckerrohrschnaps, dem kleren, zugetan und als Konsumenten von Katzenfleisch bekannt, das nach Meinung vieler kleren-Liebhaber besonders gut zu diesem Getränk passt. Als er die Ermittlungen auf Befehl seines Vorgesetzten unterbricht, um einen gewissen Georges zu suchen, den eine Dame aus höchsten Kreisen als vermisst gemeldet hat, ahnt er nicht, in welches Wespennest er sticht. Je weitere Kreise der scheinbar skurrile Fall zieht, desto gefährlicher wird es für den Inspektor, den auch die Geister der eigenen Vergangenheit bedrängen. Im Kampf gegen Bandenkriminalität und okkulte Machenschaften kann Azémar sich auch auf seine engsten Mitarbeiter nicht mehr verlassen, doch es bleiben ihm seine Tochter Mireya, seine Beretta und die zwei W in seinem Vornahmen.
»Harter Stoff, grandios gemacht. Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur und damit zu den wichtigsten Schriftstellern auf diesem Planeten.« Thomas Wörtche
Über den Autor
Gary Victor, geboren 1958 in Port-au-Prince, studierter Agronom, gehört zu den populärsten haitianischen Gegenwartsautoren. Außer Romanen, Erzählungen und Theaterstücken schreibt er auch Beiträge für Rundfunk und Fernsehen, die in Haiti regelmäßig für Aufregung sorgen. Einige seiner Gestalten sind zu feststehenden Typen geworden. Im deutschsprachigen Raum wurde er durch die Krimis Schweinezeiten (2013), Soro (2015) und Suff und Sühne (2017) bekannt, die sich sowohl auf der Krimibestenliste der ZEIT als auch auf der Bestenliste Weltempfänger von Litprom platzieren konnten. Seine drastischen Schilderungen gesellschaftlicher Missstände stellen ihn in die Tradition der Sozialromane des 19. Jahrhunderts und machen ihn zum subversivsten Gegenwartsschriftsteller Haitis. Er wurde mit mehreren Preisen, darunter dem Prix RFO ausgezeichnet.
Gary Victor
Im Namen des Katers
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Das französische Original erschien 2018 unter dem Titel »W ap konn Georges«, © C3 Editions, Delmas, Haiti
Deutsche Printausgabe: litradukt, Literatureditionen Manuela Zeilinger-Trier, Trier 2019
Aus dem Französischen von Peter Trier
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Januar 2019
ISBN 978-3-95988-129-6
0
Begriffe, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, werden im Anmerkungsteil erklärt.
Die Machete in seinen Händen war so schwer, dass er sie eigentlich gar nicht hätte halten können. Eine Machete, wie er sie noch nie gesehen hatte. Sie ähnelte einem Säbel. Er konnte nur zur Kenntnis nehmen, wie geschickt er die Waffe handhabte, denn er war nicht mehr Herr über seinen Körper und seinen Willen. Er wusste, was geschehen würde, aber von seinen Lippen konnte nicht einmal ein Schluchzen abheben. Er war zu einer menschenförmigen, nur noch aus Ohnmacht und Schmerz bestehenden Gestalt geworden. Die Klinge schlug den Kopf mit einem Hieb ab, und warme, vom Schwung des Stahls fortgeschleuderte Tropfen vom Blut seines Opfers besudelten sein Gesicht. Er ließ die Machete fallen; sein Geist, den etwas Schreckliches in seinem Griff gehalten hatte, war wieder frei. Im Erwachen sprang er aus dem Bett, als wäre eine Bande von Dämonen hinter ihm her. Seine Füße verhedderten sich in den Laken, und er fiel der Länge nach auf den feuchten Boden. Mühsam erhob er sich, ihm war schwindelig. Zum Aufstehen musste er sich am Bett festhalten. Eine Frau schlief darin tief und fest. Der Lärm hatte sie nicht geweckt. Wer war sie?, fragte sich Dieuswalwe Azémar. Er erinnerte sich an nichts. Wahrscheinlich eine Nutte, die er nach zu reichlichem soro*-Genuss auf der Place du Champ-de-Mars aufgelesen hatte. Schwankend, mit fiebrigem Körper erreichte er das Badezimmer, drehte den Hahn am Waschbecken auf, ließ sich Wasser in die hohlen Hände laufen und besprengte sich damit. Es kam ihm immer noch so vor, als hätte er Blutstropfen auf dem Gesicht, einem angstverzerrten Gesicht, das er in dem seit dem Erdbeben gesprungenen Spiegel – er hatte nie daran gedacht, ihn zu ersetzen – kaum erkannte. Er war noch magerer geworden. Dieser Albtraum war realer gewesen als die früheren. Es hatte einige Tage begonnen, nachdem Landeng, der Magier, ihm diesen garde* am Arm unter die Haut genäht hatte. Der Geist namens Loko sollte ihm die Kraft verleihen, es mit denen aufzunehmen, die ihn beschuldigten, einen brasilianischen General ermordet zu haben. Er wurde den Eindruck nicht los, dass die Nacht für Nacht präziser werdende Albtraumwirklichkeit aus dem Bereich des Traums in seinen Alltag hineindrängen und sich darin festsetzen würde. Jedes Mal versuchte er sich dann zu beruhigen, sich zu sagen, dass all das auf den Stress zurückzuführen war, auf die erzwungene Trennung von seiner Tochter Mireya und darauf, dass er in seinen Ermittlungen über mehrere Morde nicht weiterkam. Die Opfer waren allesamt als Alkoholiker, sogenannte kaka-kleren, und vor allem als große Konsumenten von Katzenfleisch bekannt gewesen. Der Albtraum von dieser Nacht hatte einem ausgefeilteren Szenario gehorcht. Er allein in einer Savanne, in der als einziger Baum eine Königspalme* stand. Sein Körper wie eingeschlossen in einen Sarkophag aus Eis. Er konnte nicht die geringste Bewegung machen, bis jemand, er konnte nicht sehen wer, ihm die Machete in die Hand drückte. Die Waffe war so schwer, dass er sie eigentlich nicht so leicht hätte handhaben können. Aus einem unerfindlichen Grund wusste er bereits, was von ihm erwartet wurde, und kämpfte mental mit allen Kräften darum, eine gewisse Kontrolle über seinen Willen zu behalten, auch wenn sein Körper dem Geist gehorchte, von dem er besessen war. Er musste töten. Der scharfe Befehl hallte in seinen Ohren. Die Frau, die mit auf den Rücken gefesselten Händen vor ihm kniete, flehte ihn weinend um Erbarmen an. »Töte!« Jedes Mal kämpfte er mit all der Kraft, die er aufbringen konnte, setzte ein, was ihm an Energie blieb. Ein Feuer pulsierte an seinem Arm, da, wo Landeng ihm den garde eingenäht hatte. In allen vorherigen Albträumen hatte er seinem Peiniger standhalten können, obwohl er wusste, dass seine Kräfte abnahmen und er irgendwann zwangsläufig nicht mehr in der Lage sein würde, die Frau zu verschonen. Er war immer schweißgebadet und mit einer Migräne aufgewacht, die durchaus kein Anreiz gewesen war, an seinen soro-Vorrat zu gehen. Nun war eingetroffen, was er befürchtet hatte. Er konnte auf seinem Gesicht nichts erkennen, spürte die Blutstropfen aber noch immer. Die Vision von der Enthauptung der Frau sprang ihn an. Er stürzte zur Toilette und erbrach das wenige, was er im Magen hatte. Mehrere Minuten verharrte er in einem Zustand der Betäubung. Das Brennen in seinem Arm holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Genau an der Stelle, an der der bòkò* gearbeitet hatte, pulsierte etwas. Dieuswalwe Azémar stürzte in die Küche und nahm ein Messer, entschlossen, sich ins Fleisch zu schneiden, um zu entfernen, was Landeng dort eingesetzt hatte. Erneut fand er sich im Kampf gegen einen Willen, der sich bemerkbar machte, sobald die Klinge sich seiner Haut näherte. Die Kraft, die sich seiner Bewegung entgegenstellte, war so stark, dass er das Messer in ohnmächtigem Zorn an die Wand warf. Er konnte dem Verlangen, eine Flasche soro vom Kühlschrank herunterzuholen, nicht mehr wiederstehen. Er genoss sein Lieblingsgetränk immer warm. Der Alkohol stärkte ihn ein wenig. Auf der Wanduhr war es Viertel nach eins. Die Frau schlief immer noch, gleichgültig gegen seine Qualen. Wo zum Teufel hatte er sie nur aufgegabelt? Sie war absolut nicht sein Typ. Eher dick, die Haare blau gefärbt. Sie schlief mit offenem Mund und gab dabei eine Art Zischen von sich. Eine Schlange in meinem Bett, dachte Dieuswalwe schaudernd.
Die besagte Stelle an seinem Arm begann erneut zu brennen. Ein unerträglicher Schmerz. Er brauchte eine Antwort. Es war eine verrückte Idee gewesen, dem Hexer zu vertrauen. Er zog eine Jeans, ein kurzärmliges Baumwollhemd und Mokassins an, dann hob er die Matratze leicht an und griff nach seiner Beretta. Sie war geladen. Für das, was er zu tun hatte, würde ein Magazin genügen. Er nahm ein Paar Handschuhe. Die Frau schlief weiter. Sie war wohl betrunken. Was hatte er mit ihr gemacht? In seinem Gedächtnis herrschte Leere. Verdammter soro, schimpfte er und bereute sofort, sein Lieblingsgetränk beleidigt zu haben. Er musste in spätestens einer Stunde zurück sein. Sollte die Frau vorher aufwachen, würde sie allerdings nicht verschwinden und dabei mitgehen lassen, was ihr gefiel. Sie wusste, mit wem sie es zu tun hatte: einem Polizeiinspektor, der sie überall finden würde.
Er öffnete lautlos die Tür, schloss sie ebenso vorsichtig und stieg die kleine Treppe zur Garage hinunter. Der alte Nissan sprang sofort an. Sein Mechaniker vollbrachte wahre Wunder. Er fuhr die Place Jérémie entlang und bog dann in die Avenue Magloire Ambroise ein. Es hatte geregnet. Der Asphalt war von Unrat bedeckt. Die Bewohner der Slums an den Berghängen nutzten den kleinsten Regenschauer aus, um den Müll in die Sturzbäche zu werfen, die von den Höhen herunterschossen. Niemand auf der Straße. Nur Hundemeuten auf der Suche nach Fressbarem. Am Ende der Avenue nahm er die Route des Dalles. Nur ein Tanzlokal war geöffnet. Aus einem Lautsprecher, der inmitten der leeren Tische auf dem Bürgersteig stand und trotz der späten Stunde voll aufgedreht war, dröhnte Malere, ein Hit von Alan Cave: »Malere, gade jan nou malere. N ap mache bwete poutan janm nou pa kase. Nou tout nou malere nou pran pòz nou pa wè.«* Dieuswalwe Azémar überquerte die Avenue Monseigneur Guilloux, dann war er am Ziel. Er parkte vor dem Eingang des Korridors, der zu Landengs Tempel und Wohnhaus führte. Bevor er ausstieg, blieb er einige Minuten im Auto sitzen, nur um Fühlung mit der Umgebung aufzunehmen. Anscheinend war niemand auf der Straße. Gegenüber die Auslagen einer Garköchin. Zwei Kessel und sonstige Utensilien waren sorgfältig auf zwei Tische geräumt, die den gesamten Bürgersteig einnahmen. Unter dem Torbogen eines Geschäfts schlief in Lumpen gehüllt ein Mann. Ein Leichenwagen mit einem Polizeiblaulicht auf dem Dach fuhr mit ausgeschalteten Scheinwerfern vorbei. Der Inspektor blickte dem Fahrzeug auf dem Boulevard nach, bis es an einer Kreuzung verschwand.
Er stieg aus dem Auto, vergewisserte sich, dass die Tür gut verriegelt war, und schlüpfte in den Korridor, der zu Landeng führte. Der Pfad war nun betoniert, das Werk einer NGO, die in diesem Elendsviertel tätig war. Der Inspektor wunderte sich über die Stille an diesem sonst so lauten Ort. Keine Radios, die mit voller Lautstärke konpa*- oder rabòday*-Hits dudelten! Keine Pastoren, die die Teufel geißelten und dazu aufriefen, sich auf die Rückkehr Jesu vorzubereiten. Der starke Regenschauer hatte die Leute betäubt und ihren Evangelisierungseifer abgekühlt. Ihm fiel der Nachmittag wieder ein, an dem ein vom Schicksal geschickter Regen verhindert hatte, dass die Anhänger des Priesters auf dem Präsidentensessel, der damals zu allem bereit war, um eine mörderisch gewordene Macht zu verteidigen, alles in Brand steckten. Auch für ihn war der Regen ein Geschenk des Schicksals, dachte der Inspektor. Ansonsten wäre die Sache schwieriger.
Er kam vor Landengs Tempel an, stieg eine Treppe hoch und klopfte an die Tür.
»Wer ist da?«, fragte eine Stimme.
»Ich muss Landeng etwas Wichtiges überbringen«, log Inspektor Azémar.
»Es ist dringend.«
»Papa ist nicht da«, sagte die Stimme.
»Das ist ein Geschenk aus Pont-Sondé. Der Geist, um den er gebeten hat.«
Auf der anderen Seite herrschte Schweigen. Der Inspektor hatte sich alles ausgedacht, ohne zu überlegen. Die dreistesten Lügen erzielen immer die gewünschte Wirkung. Sein verunsicherter Gesprächspartner überlegte. Er hatte keine Lust, mitten in der Nacht einem Unbekannten die Tür zu öffnen.
»Papa Landeng hat mir nichts von einer Lieferung heute Nacht gesagt.«
»Hör zu«, sagte der Inspektor und nahm einen drohenden Tonfall an. »Landeng wird nicht erfreut sein, wenn ich wieder gehe, ohne den Geist übergeben zu haben. Die Zeit drängt. Gleich wachsen mir die Flügel am Rücken. Hol ein heiliges Tuch, um den Geist entgegenzunehmen. Du darfst ihn auf keinen Fall mit den Händen berühren.«
Anscheinend hatten die Argumente des Inspektors über das Misstrauen seines Gesprächspartners gesiegt.
»Warten Sie, ich hole ein Tuch. Ist es schwer?«
»Nein, mach schnell.«
Er, der Inspektor, hatte es mehr als eilig. Innen waren Schritte zu hören. Eine Minute verging. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Darauf hatte Dieuswalwe Azémar gewartet. Die Bewegung des Inspektors war so schnell, dass Landengs Diener nicht mehr reagieren konnte. Ein fast zwergenhaft kleiner Mann in einem Frauennachthemd. Er hatte einen kahlen, ölglänzenden Schädel und hervortretende Augen. Der Lauf von Azémars Waffe bahnte sich gewaltsam einen Weg in seinen Mund. Vor Schreck stieß er ein schrilles Quieken aus. Der Zwerg ließ das malvenfarbene Tuch fallen, das er in der Hand hielt.
»Ich habe keine Zeit zu verlieren. Willst du eine Kugel in den Mund?«
Der Zwerg schüttelte verängstigt den Kopf. Azémar nahm ihm die Pistole aus dem Mund.
»Wo kann ich Landeng finden?«
»Er ist nicht da. Er ist zu einer Behandlung gegangen.«
»Wo?«
»Auf dem Friedhof.«
»Dauert die Behandlung lang?«
»Bis Sonnenaufgang.«
»Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, komme ich wieder und bringe dich um. Weißt du, wer ich bin?«
»Du hast Marasa und seine Diener getötet … Erbarmen, ich lüge nicht.«
»Dann weißt du, dass du absolut nichts bist. Ein Moskito ist mehr wert als du.«
Der Zwerg nickte. Er war schweißgebadet. Es fehlte nur die Pfütze zu seinen Füßen.
»Wo auf dem Friedhof?«, fragte der Inspektor.
»Beim Simbi-Grab.«
Das Simbi-Grab war eine Quelle unter einem Grabgewölbe des Friedhofs. Ein Haufen Spinner kam dorthin, um darin zu baden, da sie glaubten, auf diese Weise die Geister gnädig zu stimmen.
»Du hast kooperiert, und ich lasse dich am Leben. Aber du hast mich nie gesehen. Verstanden?«
»Verstanden«, antwortete der Diener und faltete die Hände.
»Ich sage nichts. Ich habe niemanden gesehen.«
»Sonst komme ich wieder und mache dich kalt, und ich verfehle dich nicht.«
»Ich sag doch, dass ich nichts sage«, flehte der kleine Mann. Vielleicht war es ein Fehler, ihn am Leben zu lassen, aber die Stille machte den Inspektor vorsichtig. In dem Lärm, der normalerweise im Viertel herrschte, hätte ein Schuss niemanden groß beunruhigt. Es war üblich, dass jemand im trunkenen Zustand herumballerte, aus Freude über den Sieg seiner Fußballmannschaft oder weil er gar so stolz darauf war, eine Frau ordentlich flachgelegt zu haben. Wie würden die Leute im Viertel reagieren, wenn um diese Zeit in Landengs Höhle Radau zu hören war? Er versetzte dem Zwerg einen heftigen Stoß, so dass dieser gegen eine Wand flog, an die eine rotäugige Erzulie mit einem Dolch zwischen den Zähnen gezeichnet war. Möglicherweise hatte Landengs Diener sich bei dem Aufprall die Wirbel gebrochen, aber der Inspektor kümmerte sich nicht darum. Er verließ den Tempel, als wäre nichts gewesen. Alles war noch genauso ruhig. Er gelangte ungehindert zur Straße. Der Schläfer unter dem Torbogen war erwacht und trank im Sitzen aus einem verrosteten Topf. Er bemerkte den Mann in dem Nissan nicht. Das Auto fuhr lautlos an, als wollte es sich seine dreißig Dienstjahre nicht anmerken lassen.
*
Er musste den Haupteingang des Friedhofs meiden. Er hätte sich durchaus beim Wächter melden und seinen Status als Polizeibeamter geltend machen oder ihm ein Bakschisch in die Hand drücken und behaupten können, er sei wegen eines Rituals von allergrößter Bedeutung hier, aber er konnte keinen lästigen Zeugen gebrauchen. In einem Land, in dem so viele Leute ihn zur Strecke bringen wollten, vor allem diejenigen, die ihm nicht verziehen, dass er Marasa und seine Diener vom Leben zum Tode befördert hatte, musste er seinen Rücken freihalten.
Er parkte auf dem Bürgersteig an einer Stelle, an der die Mauer so niedrig war, dass er sie überklettern konnte. Er war mager. Sein hemmungsloser soro-Konsum ließ ihn schlecht aussehen, aber seine körperliche Verfassung ließ nicht zu sehr zu wünschen übrig. Er landete auf dem noch nassen Gras des Friedhofs nicht allzu weit von der Kapelle, in der die Gläubigen der Jungfrau Maria ihre Huldigungen darbrachten, während die lwa* in nächster Nähe des heiligen Ortes darauf warteten, dass man nach den obligatorischen Kniebeugen vor Jesus zu ihnen zurückkehrte, damit sie sich um die konkreteren Dinge kümmerten.
Der Inspektor orientierte sich ohne Schwierigkeiten in den Alleen des Friedhofs. Er kannte sich dort aus, denn er war mehrmals im Rahmen der oft abstrusen Ermittlungen dort gewesen, mit denen ihn die Dienststelle betraute. Der Vollmond spielte ihm in die Hände, denn die Laternen, die den Friedhof erhellen sollten, waren außer Betrieb. Wenn der Strom schon in der Stadt der Lebenden so sparsam verteilt wurde, dann konnte die Wohnstätte der Toten nicht anspruchsvoller sein.
Die Gesänge zeigten ihm an, dass er sich dem Simbi-Grab näherte. Gedämpfte Gesänge, als fürchtete man, indiskrete Ohren könnten die Anrufungen auffangen. Es waren etwa zehn Männer und Frauen, alle in Weiß mit einer Kerze in der linken Hand. Auf einem Grab beugte Landeng sich über eine seltsame Szene. Ein auf der Seite liegender Mann, der mit Stricken an eine riesige Ziege gefesselt war und im Gegensatz zu den anderen zwei Kerzen in den Händen hielt, sprach die Formeln nach, die ihm der Magier vorsagte. Es würde lange dauern, vielleicht über eine Stunde, aber er, Inspektor Azémar, hatte keine Zeit. Er trat näher, schoss zweimal in die Luft und schrie: »Dyab lan di bay zòn nan!«* Sofort rannten alle auseinander und ließen die Kerzen im Gras zurück. Der überrumpelte Landeng hatte nicht die Zeit zu fliehen. Azémar packte ihn am Gürtel, hielt ihm den Lauf der Waffe an die Schläfe und stieß ihn in einem irren Lauf durch die Gassen des Friedhofs vor sich her, damit die Leute sie nicht fanden, falls sie nach der ersten Überraschung die Verfolgung aufnahmen. Er drückte seinen Gefangenen zwischen zwei Grüfte, wo er mit Sicherheit einige Minuten lang ungestört sein würde.
»Du bist verrückt, Dieuswalwe Azémar«, stieß Landeng hervor.
»Du weißt nicht, was du tust. Du bist jetzt auf unserer Seite.«
»Ich auf eurer Seite! Niemals.«
»Die Tage vergehen, Dieuswalwe Azémar«, kicherte der Hexer.
»Du müsstest es wissen. Es gibt Anzeichen.«
»Was für Anzeichen?«, schrie der Inspektor. »Diese Albträume, die immer wiederkommen? Dieses Brennen am Arm?«
Der Magier ließ ein leises, unheilverkündendes Lachen hören.
»Du hast bestimmt gekämpft, ich kenne dich. Aber Loko gewinnt immer. Du hast den Kopf abgeschlagen. Gib’s zu. Vorläufig war es nur ein Albtraum.«
Der Inspektor ohrfeigte ihn mit der Hand, in der er die Waffe hielt. Landeng war angeschlagen. Er spuckte Blut, seine Augen sandten hasserfüllte Blitze aus.
»Du entkommst unserer Rache nicht, Dieuswalwe Azémar. So ist es nun mal. Sechsundsechzig Tage, nachdem er eingepflanzt wurde, verlangt der garde nach Blut. Wenn du dich nicht entschließt, ihm welches darzubringen, und ich weiß, dass du dich weigern wirst, dann ergreift er Besitz von dir, und du bist nur noch ein Zuschauer seiner Lust. Er wählt das Opfer aus. Und er hat keine Hemmungen, Personen auszuwählen, an denen du hängst. Ich zähle die Tage, Inspektor. Es sind noch gerade mal sechs, Dieuswalwe Azémar. Sechs! Wie ich sehe, trägst du Handschuhe. Willst du mich ermorden, ohne Spuren zu hinterlassen? Der Hölle entkommt man nicht, Inspektor.«
Mit der Kraft, die die Wut ihm verlieh, hob Azémar Landeng am Kragen hoch.
»Schluss mit den Scherzen. Du wirst mich von diesem Ding in meinem Arm befreien. Deswegen bin ich hier. Sonst nehme ich dir, woran du am meisten hängst: dein elendes Leben!«
Landeng schüttelte mit gespieltem Bedauern den Kopf.
»Ich kann nichts für dich tun, Dieuswalwe Azémar. Wenn der garde einmal eingepflanzt ist, ist man bis zum Tod mit ihm verbunden.«
Er kicherte erneut.
»Du glaubst, du bist immer der Klügere, Dieuswalwe Azémar. Jetzt hör auf meinen Rat: Mach dich auf den Tag gefasst, an dem du in die Hölle aufgenommen wirst. Ziemlich viele Leute haben sie dir heiß gemacht, wie man so schön sagt.«
Dieuswalwe Azémar wusste nicht mehr weiter und hielt Landeng mit Tränen in den Augen seinen Arm hin. Unerträgliches Brennen. Er unterdrückte ein Stöhnen.
»Nimm ihn mir raus, bitte … Nimm ihn mir raus.«
Der Magier brach in Gelächter aus, in seinen Mundwinkeln sammelte sich blutiger Schaum. Ein Hampelmann aus der Hölle, so kam er Azémar vor.
»Ich bin glücklich, dass du mich anflehst, Dieuswalwe Azémar, aber ich kann nichts für dich tun. Selbst wenn ich wollte, wäre ich machtlos.«
Der Inspektor drückte den Abzug. Er hatte auf Landengs Schulter gezielt. Die Wucht des Projektils schleuderte den Hexer auf eine Grabplatte. Er versuchte aufzustehen. Der Fuß des Inspektors auf seiner Brust zwang ihn, auf dem Boden liegenzubleiben.
»Zum letzten Mal, Landeng. Nimm mir dieses Ding aus dem Arm.«
»Wir sehen uns in der Hölle, Dieuswalwe Azémar.«
Der Inspektor zog den Flachmann mit soro aus der Gesäßtasche. Er schraubte den Verschluss ab und tat einen tiefen Zug.
»Willst du auch einen Schluck?«, fragte er. »Wenn man schon zur Hölle fährt, dann wenigstens mit dem besten Geschmack der Welt im Mund. Dem Geschmack des soro.«
»Fick dich!«, schrie Landeng.
Die zweite Kugel zerschmetterte ihm den Schädel.
Tag 1
Die Klimaanlage war wieder ausgefallen. Er dachte nicht einmal daran, den Wartungsdienst zu rufen: Er hatte genug von den Technikern, die jedes Mal versprachen, ein erneutes Versagen sei nicht möglich. Er öffnete die Fenster. Die heiße Luft aus den Bergen, die ein Teppich von Slums bedeckte, erstickte ihn noch mehr. Die große Flasche gekühltes Wasser, die man ihm brachte, verschaffte ihm keine Erleichterung. Nur der soro wäre ihm eine große Hilfe gewesen, aber Kommissar Dulourd behielt ihn im Auge. Zu den Bürozeiten bemühte er sich nüchtern zu bleiben. Es fiel ihm schwer, dabei seine Intelligenz auf seinem normalen Niveau zu halten. Dennoch musste er mit dem soro-Entzug leben. Das war die Bedingung, damit er seinen Job bei der Polizei behielt.
Er hatte etwa dreißig Fotos auf seinem Schreibtisch ausgebreitet. Lauter Männer, denen man die Kehle durchgeschnitten hatte. Hingerichtet, weil sie Katzenfleisch gegessen hatten. Der Mörder hatte Wert darauf gelegt, dass der Grund für seine Taten klar erkennbar war. Er hatte ein Büschel Katzenhaare im Mund jedes seiner Opfer zurückgelassen, die alle notorische Alkoholiker waren. Leute, die viel Alkohol tranken, insbesondere kleren*-Trinker, schienen Katzenfleisch zu schätzen. Dieuswalwe Azémar war davon angeekelt. Er konnte sich nur schwer vorstellen, Katzen zu essen, auch wenn Freunde von ihm, die ebenfalls dem soro zugetan waren, behaupteten, zum Schnaps gebe es nichts Besseres. Ein weiterer Geisteskranker, der frei auf den Straßen eines Landes herumlief, in dem die Polizei alle Mühe hatte, ihren Auftrag zu erfüllen, nämlich die Bürger zu schützen. Immer derselbe Modus Operandi. Der Mörder war Rechtshänder. Er hatte eine Waffe mit ausreichend scharfer Klinge benutzt, denn laut dem Gerichtsmediziner hatte er jedes Mal nur einen Schnitt benötigt. Das Werk von jemandem, der seine Arbeit so eifrig und sorgfältig wie ein unerlässliches Ritual ausführt. Diese Ermittlungen kümmerten niemanden. Welcher Politiker würde sich um Bürger scheren, die nur dafür bekannt waren, dass sie literweise kleren, Rum oder Whisky trinken konnten, ohne die geringsten Ausfallerscheinungen zu zeigen? Der Inspektor hatte, unter allgemeinem Desinteresse, hartnäckig alle möglichen Spuren verfolgt und etwa hundert Personen befragt. Er sah noch immer keinen noch so entfernten Schimmer einer Lösung. Der Mörder schlug aufs Geratewohl zu. Die Morde hatten an verschiedenen Orten stattgefunden, immer nachts auf offener Straße. Jedes Mal hatte der Mörder seine Tat gut geplant. Man wusste, dass er eine Kapuze trug. Abgesehen davon hatte kein Zeuge irgendeine Information liefern können, die die Ermittlungen weiterbrachte.
Er hatte keine Spur. Er war bei null. Er musste warten, bis der Mörder einen Fehler beging. So war es immer. Oft wollte der Verbrecher die Latte höher legen, die Herausforderung steigern, seinen Verfolgern zeigen, dass er der Stärkere war. Die Lust am vollen Risiko, am Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Vielleicht trugen solche Mörder auch einen Rest an Menschlichkeit in sich, der nach Erlösung, das heißt nach Bestrafung für ihre Missetaten verlangte. Er wollte wirklich nicht gern in der Haut eines Serienkillers stecken. War er einer? Er hatte Marasa und dessen Diener sowie jede Menge weiterer Schurken getötet, Mörder, die die Justiz dieses Landes nach einer vorgetäuschten Untersuchung und einem Scheinprozess wieder auf die Straßen geschickt hätte. Einige Richter nutzten dies aus, um sich zu bereichern, ohne sich um die Gefahren für die Gesellschaft zu sorgen. Diese Nacht hatte er Landeng erschossen und sich zum Rächer aufgeschwungen, um den bòkò dafür büßen zu lassen, dass er ihm diese grässliche Strafe auferlegt hatte. Diesen tötenden garde in seinem Arm. Stimmte es, dass ihm nur noch einige Tage blieben, inzwischen waren es fünf, bis der Geist Besitz von seinem Willen ergriff und er, ohnmächtig wie in jenem Albtraum, sich dabei zusehen musste, wie er eine Frau enthauptete?
Es klopfte an der Tür. Ein diensthabender Polizist, Wachtmeister Patrick, trat ein, um ihm mitzuteilen, dass der Kommissar ihn sofort in seinem Büro sprechen wollte. Der Blick des jungen Wachtmeisters verriet dem Inspektor, dass es einen besonderen Grund für diese Vorladung gab. Wachtmeister Patrick hatte eben erst die Polizeischule abgeschlossen und hatte seine familiären Verbindungen spielen lassen, um diesem Kommissariat zugeteilt zu werden. Er wollte in einem Team mit Inspektor Dieuswalwe Azémar arbeiten. Das hatte dem Inspektor gefallen, aber zugleich wurde er in Gegenwart des jungen Polizisten ein Gefühl der Verlegenheit nicht los. Dieser erinnerte ihn an eine verstörende Episode seiner Laufbahn. Den Fall von Wachtmeister Colin, der auf der Treppe zu jenem Glück, das aus Illegalität und Korruption geschmiedet wird, alle Stufen auf einmal hatte nehmen wollen. Azémar räumte die Fotografien weg, kontrollierte den Sitz seiner Uniform und meldete sich dann bei seinem Vorgesetzten. Im Zimmer befand sich noch ein anderer Offizier. Der Inspektor kannte ihn nicht, aber er witterte, das war wie ein sechster Sinn, einen hochrangigen Angehörigen der Generalinspektion.
»Inspektor Azémar, setzen Sie sich«, begann Kommissar Dulourd, ohne ihm die Hand zu reichen.
Er setzte sich in Erwartung dessen, was folgen würde.
»Wo waren Sie gestern Nacht zwischen ein und drei Uhr morgens?«, fragte der Kommissar ohne Vorrede.
»Zu Hause«, antwortete der Inspektor und setzte eine überraschte Miene auf. »Ich wage nicht zu sagen, dass ich etwas getrunken hatte und in wenig empfehlenswerter Gesellschaft war.«
»Ihre bedauerlichen Laster sind uns bekannt«, griff der anwesende Offizier ein. »Kann jemand bezeugen, dass Sie zu dieser Zeit zu Hause waren?«
»Inspektor Garcia von der Generalinspektion«, bemerkte Kommissar Dulourd. »Wir haben eine üble Sache am Hals. Ein sehr mächtiger bòkò wurde auf dem Friedhof ermordet. Zeugen haben jemanden beschrieben, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen hatte.«
»Eine gewisse Ähnlichkeit!«, wunderte Azémar sich. »Was heißt das?«
»Im Moment nichts«, seufzte der Kommissar.
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet«, beharrte Inspektor Garcia.
»Die einzige Person, die zu meinen Gunsten aussagen könnte, ist eine Nutte, die ich betrunken aufgelesen habe, aber ich erinnere mich weder an ihr Gesicht noch an ihren Namen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht im Dienst war.«
»Darf ich Ihre Finger untersuchen?«, fragte Inspektor Garcia, der auf dem Tisch des Kommissars eine Tasche öffnete.
»Bitte«, antwortete der Inspektor.
»Gefällt Ihnen Ihr ausschweifendes Leben?«, fragte Inspektor Garcia.
»Ich bin ein guter Polizist«, antwortete Dieuswalwe Azémar.
»Darauf kommt es an.«
»Glauben Sie, dass Sie unserer Jugend ein gutes Beispiel geben?«
»Gibt es in unserem Land gute Beispiele für die Jugend?«, spottete Inspektor Azémar. »Ich kann als Entschuldigung meine Resultate vorweisen.«
»Die außergerichtlichen Exekutionen? Sind Sie stolz darauf?«
»Das sind unbewiesene Anschuldigungen«, behauptete Dieuswalwe Azémar, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Wenn Sie so stolz auf Ihr Werk wären, dann müssten Sie sich dazu bekennen und nicht Ihre Energie damit vergeuden, der Gerechtigkeit zu entkommen.«
»Zu viele Delinquenten würden sich freuen, wenn Sie mich in den Knast befördern, Inspektor Garcia.«
Kommissar Dulourd hob die Hand, um die Diskussion zu beenden.
»Meine Herren Inspektoren, lassen wir das Palaver und gehen wir an die Arbeit. Inspektor Azémar, geben Sie mir Ihre Wohnungsschlüssel«, befahl der Kommissar. »Ich hoffe, Sie bestehen nicht auf einen Durchsuchungsbefehl, damit die Generalinspektion sich bei Ihnen umsehen darf.«
»Sie suchen die Beretta, aber sie werden sie nicht finden«, dachte der Inspektor. »Sie wollen mich einschüchtern. Sie wissen, dass der soro mich nicht so dämlich macht, dass ich die unerlässlichen Vorsichtsmaßnahmen vergesse, etwa Handschuhe zu tragen, damit man an meinen Fingern keine Schmauchspuren findet.« Er kramte seine Wohnungsschlüssel hervor und reichte sie dem Kommissar. Der Mann von der Generalinspektion strich mit einem Wattestäbchen über jeden von Dieuswalwe Azémars Fingern und verstaute das Stäbchen vorsichtig in einer Art Fläschchen aus Metall.
»Ich bin unschuldig schwarz wie ein sternen- und mondloser Himmel«, kicherte Inspektor Azémar. »Den Ausdruck ›weiß wie Schnee‹ finde ich in unserem Fall unpassend.«
»Wenn Inspektor Azémar in den Mord verwickelt ist, dann hat er sicher seine Vorkehrungen getroffen«, sagte Dulourd mit verärgertem Ausdruck.
»Irgendwann begeht jeder einen Fehler«, erwiderte der Offizier von der Generalinspektion.
»Warum hätte ich einen bòkò auf einem Friedhof ermorden sollen?«
»Wir kennen auch das Motiv für die Morde an Marasa und seinen Dienern bei den Stinkenden Quellen nicht«, konterte Inspektor Garcia. »Aber deswegen waren Sie es trotzdem.«
»Es gibt keinerlei Beweis, dass ich diese Verbrechen begangen haben soll«, protestierte Dieuswalwe Azémar. »Man hat es auf mich abgesehen, weil ich der beste Polizist dieses Landes bin.«
»Bescheidenheit ist nicht gerade Ihre Stärke«, antwortete der Offizier von der Generalinspektion. »Die Schlüssel des Inspektors bitte, Herr Kommissar. Ich muss meine Arbeit tun.«
Der Kommissar übergab sie ihm. Inspektor Garcia erwies den vorschriftsmäßigen Gruß, bevor er seine Mappe unter den Arm klemmte.
»Ich schicke Ihnen die Schlüssel noch heute Vormittag zurück. Die Gerechtigkeit wird Sie ereilen, Inspektor Azémar. Selbst wenn Sie der menschlichen Gerechtigkeit entgehen: Die Gerechtigkeit Gottes wird sie in die Hölle verbannen.«
Inspektor Garcia verließ das Zimmer, als hätte ihn seine letzte Tirade erleichtert. Das war jetzt schon das zweite Mal innerhalb weniger Stunden, dass ihm jemand einen Aufenthalt in der Hölle wünschte. Verdiente er es, für alle Zeiten und in Ewigkeit unter den Verdammten zu weilen? Ein Schauer lief ihm den Rücken hinunter. War er im Unrecht? Hatte er sich geirrt? Hätte er den moralischen Grundsätzen gehorchen und die Regeln der Institution, zu der er gehörte, einhalten müssen, auch wenn das darauf hinauslief, dass die Schurken und Abtrünnigen in diesem Land das Sagen hatten? Was er tat, war nur ein Tropfen und der Niedergang dieses Landes ein heißer Stein. Nichts hatte sich geändert. Er hatte Menschen umsonst das Leben genommen. Nein, schalt er sich. Jeder Einzelne musste den Traum von einer anderen Gemeinschaft, einem anderen Land hegen. Jedes Mal, wenn er durchgegriffen hatte, wenn er zum Arm der Gerechtigkeit geworden war in einem Land, in dem die Gerechtigkeit in den Schmutz gezogen wurde, hatte er mehreren Personen das Leben gerettet, Familien neue Hoffnung verliehen. Wenn die Hölle sein Lohn dafür war, dann würde er auf den Himmel pfeifen. Er hatte getan, was er für seine Pflicht hielt, und bereute es nicht.