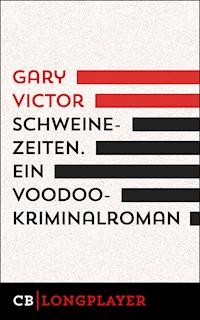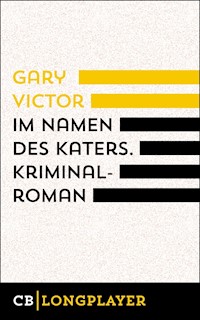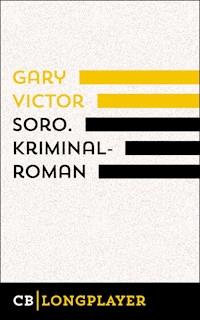
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Port-au-Prince, 12. Januar 2010: Kaum dem Erdbeben entronnen, erhält Inspektor Azémar einen neuen Spezialauftrag seines Freundes und Vorgesetzten Kommissar Solon: Er soll herausfinden, mit wem die Frau des Kommissar in dem Stundenhotel war, unter dessen Trümmern ihre Leiche gefunden wurde. Dumm nur, dass dieser Mann der Inspektor selbst war … Außerdem ist da der berühmte Maler, der angeblich dem Erdbeben zum Opfer gefallen ist. Ausgerechnet in dieser heiklen Lage ist auf den bisher besten Verbündeten des Inspektors, den aromatisierten Zuckerrohrschnaps namens Soro kein Verlass mehr. Einmal mehr kann Azémar nur seiner Intuition und seiner Beretta vertrauen. »Harter Stoff, grandios gemacht. Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur und damit zu den wichtigsten Schriftstellern auf diesem Planeten.« Thomas Wörtche, Leichenberg Dieuswalwe Azémar und seine klarsichtigen Suff-Halluzinationen stehen im Mittelpunkt eines Dramas um Liebe, Freundschaft und Loyalität vor dem apokalyptischen Hintergrund des zerstörten Port-au-Prince. Das ist wuchtige, große Literatur. »Harter Stoff, grandios gemacht. Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur und damit zu den wichtigsten Schriftstellern auf diesem Planeten.« Thomas Wörtche, Leichenberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Port-au-Prince, 12. Januar 2010: Kaum dem Erdbeben entronnen, erhält Inspektor Azémar einen neuen Spezialauftrag seines Freundes und Vorgesetzten Kommissar Solon: Er soll herausfinden, mit wem die Frau des Kommissar in dem Stundenhotel war, unter dessen Trümmern ihre Leiche gefunden wurde. Dumm nur, dass dieser Mann der Inspektor selbst war ...
Außerdem ist da der berühmte Maler, der angeblich dem Erdbeben zum Opfer gefallen ist. Ausgerechnet in dieser heiklen Lage ist auf den bisher besten Verbündeten des Inspektors, den aromatisierten Zuckerrohrschnaps namens soro kein Verlass mehr. Einmal mehr kann Azémar nur seiner Intuition und seiner Beretta vertrauen.
Dieuswalwe Azémar und seine klarsichtigen Suff-Halluzinationen stehen im Mittelpunkt eines Dramas um Liebe, Freundschaft und Loyalität vor dem apokalyptischen Hintergrund des zerstörten Port-au-Prince. Das ist wuchtige, große Literatur.
»Harter Stoff, grandios gemacht. Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur und damit zu den wichtigsten Schriftstellern auf diesem Planeten.«
Thomas Wörtche, Leichenberg
Über den Autor
Gary Victor, geboren 1958 in Port-au-Prince, von Beruf ursprünglich Agronom, gehört zu den populärsten Gegenwartsautoren Haitis. Für seine Romane, Erzählungen und Theaterstücke wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter der Prix du livre RFO und der Prix littéraire des Caraïbes. Sein schonungsloser Blick auf die Gesellschaft macht ihn zum subversivsten Autor seines Landes, dessen Radio- und Fernsehbeiträge regelmäßig für Aufregung sorgen.
Gary Victor
Soro
Kriminalroman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2015
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Das französische Original erschien 2011 unter dem Titel »Soro«, © Éditions Mémoire d’Encrier, 2011
Deutsche Printausgabe: litradukt, Literatureditionen Manuela Zeilinger-Trier, Trier 2013
Aus dem Französischen von Peter Trier
eBook-Cover: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 06.07.2015
ISBN 978-3-944818-95-5
Inhaltsverzeichnis
Für meine Freunde aus Carrefour-Feuilles, den ehemaligen Kommissar der Police Nationale d’Haïti Carlo Lochard, Réginald Léande Pierre (Larco), Judith, Madame Berouard und die anderen
Für Lisa M’Bele Bong
Begriffe, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, werden im Anmerkungsteil erklärt.
-1-
Er hätte niemals in dieses Hotelzimmer gehen dürfen! Es sei denn, er erlebte gerade eine der Phantasmagorien, die sein Geist veranstaltete, wenn sein Delirium nach einigen Flaschen tranpe* Fahrt aufnahm. Er lag nackt mit ausgebreiteten Armen auf einem großen Bett, sicherlich Kingsize, sie, ebenfalls nackt und schweißgebadet, ritt ihn mit der Wildheit einer Amazone und stieß dabei Schreie aus, die sich wie die Rufe anhörten, mit denen die Reiter ihre widerspenstigen Pferde antreiben. Er hätte niemals in dieses Hotelzimmer gehen dürfen, diese Wahrheit hämmerte in seinem Schädel. »Du bringst dich gerade in eine üble Bredouille, Dieuswalwe«, flüsterte ihm eine Stimme in seinem Kopf zu. »Genauso gut könntest du dir eine Kugel durch den Kopf schießen.« Sie ritt immer noch auf ihm, ihre nackten, schlaffen Brüste flogen im Rhythmus ihrer gierigen Hüftbewegungen. Sie feuerte ihn an, schrie »hüh! hüh!«, während sie die Fersen an seine Beine presste, damit er sie schneller zum Orgasmus trug. »Ich muss aufhören, solange noch Zeit ist«, dachte Dieuswalwe Azémar. Wie war er in dieses Hotelzimmer gekommen? Er konnte sich nicht erinnern, in seinem Gedächtnis machte sich ein weißer Fleck breit. Der verdammte soro*!, dachte er zornig. Es hieß, dieses Getränk sei blutreinigend, wirke gegen schädliches Fieber und befreie die Leber von allem, was sie belaste. Außerdem sollte es die Manneskraft stärken, wovon er sich gerade überzeugen konnte. Zumindest bei ihm hatte es aber auch die ärgerliche Macht, sein Gedächtnis auf unbestimmte Zeit in Isolationshaft zu nehmen. Früher hatte der soro seinen Neuronen niemals geschadet. Es hatte einige Monate nach der Rettung seiner Tochter begonnen. Er hatte sie im letzten Moment aus den Fängen einer amerikanischen Sekte* befreit, die die Kinder ausschlachtete, um ihre Organe in die Vereinigten Staaten zu verkaufen. Einige Gläser soro, und auf einmal hatte er eine Erinnerungslücke. Für einige Stunden war alles aus seinem Gedächtnis gelöscht. Anschließend hatte er alle Mühe, seine Erinnerungen wieder zu ordnen. In der Dienstzeit, in der er achtgab, die Dosis nicht zu überschreiten, ging es. In der Nacht jedoch leerte er ein Glas nach dem anderen, vor allem, wenn er versuchte, mit seinen Ausschweifungen seinen Schmerz, seine Wut und seinen Ekel vor dem Leben in diesem Land zu lindern, das er in seinem tiefsten Inneren gleichwohl liebte. Auf dem Körper einer flüchtigen Bekannten oder einer Nutte kam es dann, so wie jetzt im Hotelzimmer, zum Filmriss. Er hatte zunächst geglaubt, dass seine Hauptlieferantin, Madame Baptiste, und die anderen Schnapshändler, bei denen er verkehrte, ihm gepanschten Alkohol unterjubelten. Nachforschungen und eine erste Analyse hatten jedoch jeden Verdacht gegen den kleren* ausgeräumt. Da er eine vorzeitige Alzheimererkrankung befürchtete, hatte er einen befreundeten Arzt konsultiert, welcher ihm gesagt hatte, dass mit seinem Nervensystem und seinem Gehirn alles in Ordnung war. Es war eine seltsame Reaktion seines Organismus auf seinen exzessiven soro-Konsum. Der Spezialist hatte ihm empfohlen, seine Leidenschaft für den tranpe und insbesondere den soro zu zügeln. Hätte man ihm das unmittelbar bevorstehende Weltende angekündigt, der Schock hätte nicht größer sein können. Aber schon bald hatte er sich entschieden: Er würde mit seinem soro und den Gedächtnislücken während der Delirien und danach leben. Sein Gedächtnis zu verlieren und Erinnerungen, die ohnehin schmerzlich waren, für einige Minuten oder Stunden zu vergessen, konnte nichts Schlimmes sein.
Er hätte niemals in dieses Hotelzimmer gehen dürfen. Er wusste nicht, wessen Zimmer es war. Durch die Jalousien drang die Helligkeit des frühen Abends. Die Frau bearbeitete ihn weiter, während sie sich zu ihm hinunterbeugte und gierig seine Lippen suchte. Er ließ es mit einem Anflug von Ekel geschehen wie eine Ehefrau, für die die Kopulation nur noch eine lästige Pflicht zur Befriedigung ihres Mannes ist. Eine Erinnerung brach durch. Er sah sich zusammen mit der Frau im Hotel ankommen. Ein Mann in einer verwaschenen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit dem Bild von Wyclef Jean* führte sie ins Zimmer. Ein wilder Hüftstoß seiner Partnerin verschüttete den Zugang zu seinen Erinnerungen wieder. »Hüh! Hüh!«, brüllte sie. »Es fehlt nur noch die Gerte«, dachte Azémar. Mit verschwitztem Gesicht, verdrehten Augen, offenem Mund und munter fliegenden Brüsten verfolgte sie eine launenhafte Lust, die sich ihr immer in dem Moment zu entziehen schien, in dem sie sie zum Greifen nah glaubte. Er versuchte vergeblich, seine Hände zu befreien, doch ihr geübter, unvermutet fester Griff und ihre überzähligen Kilos hielten ihn unbeweglich mit ausgebreiteten Armen auf dem Bett fest. Er sagte sich, dass es in dieser Position schwerlich klappen würde, denn selbst unter in seinen Augen normalen Bedingungen kam er nur selten zum Höhepunkt. Sein Versuch steigerte die Begierde der Frau, die auf ihm saß. Sie hob und senkte ihr Becken mit mechanischer Regelmäßigkeit. Dennoch gelang es ihm, eine Hand zu rühren, die, mit der er die ganze Zeit über die Flasche soro umklammert hatte. Sie ließ es geschehen, da sie begriff, dass es ihm nicht mehr darum ging, sich aus ihrer Umklammerung zu befreien, sondern darum, aus der Quelle zu trinken, die er nicht mehr entbehren konnte. Er setzte die Flasche an die Lippen und trank ihren restlichen Inhalt in einem Zug. Sie bearbeitete ihn weiter: »Hüh! Hüh!« Ihre animalische Wildheit ließ nicht nach. Er wunderte sich, dass er eine so starke Erektion hatte, obwohl sein Geist sich von seinem Körper abgekoppelt hatte, welcher jetzt nur noch zu minimalem Lustempfinden in der Lage war. Wie bei seinen nächtlichen Ausschweifungen war irgendwo in ihm der Wunsch, sich auszulöschen, ohne Möglichkeit zur Rückkehr in die Finsternis zu tauchen. Er sehnte sich nach dem Nichts, dem einzigen Ort, an dem er wirklich zur Ruhe kommen, an dem er das Feuer löschen könnte, das ihn verbrannte und verzehrte, ohne dass es ihn erledigen konnte, das Feuer seiner unmöglichen Liebe zu diesem Land, zu den Frauen, die ihm, dem alkoholsüchtigen, verkommenen Polizisten, bei seinen schändlichen Unternehmungen über den Weg liefen, denn diese Liebe war nur immerwährendes Leid, eine Glut, die einen endlosen Tunnel in seine Seele und seinen Körper grub. Die Frau schrie auf und fiel auf ihn nieder, ihre riesigen, schlaffen Brüste legten sich auf sein Gesicht. Es war nur falscher Alarm, ein fehlgeschlagener Orgasmus. Sie richtete sich wieder auf und setzte ihren Ritt fort: »Hüh! Hüh! Hüh!« Er hätte niemals in dieses Hotelzimmer gehen dürfen! Wer war sie? »Gefahr!«, flüsterte ihm eine Stimme zu. Die Frau schnaufte wie eine Lokomotive, Krämpfe spannten ihren Körper. Einer schleuderte sie auf den schmächtigen Dieuswalwe Azémar, den sie ergriff wie einen Rettungsring, während ihr Orgasmus mit der verheerenden Wucht eines Orkans anbrandete. Der Inspektor kam im selben Moment, gleichzeitig schwankte das Zimmer, als hätten riesige, feindselige Hände es ergriffen. Die Hände schüttelten das Zimmer, als wollten sie es von irgendwelchem Ungeziefer befreien. Noch nie hatte er im Delirium so etwas erlebt, dachte er. Um sie herum brach plötzlich alles zusammen. Ein Teil der Decke stürzte auf die Frau; er hörte das Knacken von Knochen und Knorpel, als ihr Körper auf seinem zerdrückt wurde. Das Bettgestell hielt dem Aufprall nicht stand. Im Delirium kann der Geist auf Ressourcen zählen, die ihm in wachem Zustand nicht zur Verfügung stehen. Azémar machte sich von dem zermalmten Körper los und hatte dabei den Reflex, sich seine Kleider und seine Dienstwaffe zu schnappen, die aus irgendeinem Grund in Griffweite lagen. Der Absturz der Decke war vorerst zum Stehen gekommen und hatte einen winzigen Raum frei gelassen, in dem er überlebt hatte. Er kroch verzweifelt zu einer Öffnung, durch die ein menschlicher Körper nur mit Mühe hindurchkam. Ihm war, als sähe er Mireya, die Frau, die er eine Nacht lang in La Brésilienne geliebt hatte. Sie ergriff seine Hand und half ihm, sich im Staub und im Krachen des Betons vorzuarbeiten. Als er sich verstört, staubdeckt und mit schlotternden Beinen im Freien aufrichten konnte, wurde ihm klar, dass das Hotel nicht mehr existierte. Die Erde bebte noch heftiger. Er verlor das Gleichgewicht und musste sich an einem Baum festhalten, der mitten im Hof stand. Eine Mauer stürzte mit Getöse auf ein Allradfahrzeug, einen RAV4, den er erkannte. Das war das Auto, mit dem sie in diesem Hotel angekommen waren. Seines, ein über zwanzig Jahre alter Nissan, war seit einer Woche in der Werkstatt. Er hörte Schreie, Rufe, flehentliche Bitten, verzweifelte Klagegesänge. Um ihn herum waren nur Staub und Trümmer. Ein Bombardement? Ein Erdbeben? Das Ende der Welt? Ihm fiel auf, dass er nackt war, aber eine Hose, ein Hemd und seine Dienstwaffe in der Hand hielt. Mit Mühe zog er die Kleider an. Sein Körper zitterte im Rhythmus der unablässigen Nachbeben. Er war barfuß, aber es kam im Moment nicht in Frage, seine Schuhe zu holen. Er entfernte sich humpelnd. Ihm fiel ein, dass er mit einer Frau in dem Hotelzimmer gewesen war. Sie war sicher tot. Er war mit Blut befleckt, und zwar nicht mit seinem eigenen. Er blieb stehen, um zu kotzen. Ein Meer von miesem soro. Er stellte sich vor, wie sein Erbrochenes, das voll Säure war, eine Ritze in den Asphalt ätzte. Erneut setzte er sich in Bewegung. Eines seiner Beine blutete. Den rechten Arm konnte er nur mit Mühe bewegen. Sein Körper hatte schon einen heftigen Schlag abbekommen, als die Frau auf ihm zerquetscht wurde. Er hatte Glück, dass er noch am Leben war. Auf der Straße in Staub gehüllte menschliche Gestalten, die rannten, brüllten, den Allmächtigen anriefen: »Kehrt um! Die Strafe Gottes ist über uns gekommen!« Die meisten Häuser des Viertels waren eingestürzt. Dieuswalwe Azémar wurde klar, dass das, was er erlebte, die Wirklichkeit war. Was seit Jahren befürchtet wurde, war eingetreten: Ein Erdbeben hatte seine Stadt zerstört.
Er hatte dem Motorradfahrer die Mündung seines Smith & Wesson an die Schläfe drücken und ihm gleichzeitig seine Polizeimarke unter die Nase halten müssen. Der junge Mann hatte verstanden, dass man mit diesem nach kleren stinkenden Mann nicht diskutieren durfte. Nach dem grauen Staub zu schließen, der sein Gesicht wie eine Maske bedeckte, war er gerade erst dem Erdbeben entronnen. Seine Hand zitterte. Um ein Haar hätte er auf den Abzug gedrückt, ohne es zu merken. »Zur Place Jérémie! Schnell!«, schnauzte er. Der hastige Start, bei dem der Inspektor fast von der Maschine gefallen wäre, hing sicherlich mit der Nervosität des Fahrers zusammen. Und mit der Nervosität der Erde, welche weiterbebte. Alle Fahrzeuge hatten auf der Straße angehalten, die Fahrer wussten angesichts der zahlreichen Nachbeben nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand. »Das ist das Ende der Welt«, rief der Motorradfahrer. »Sie hätten mir eine Kugel in den Kopf jagen sollen, dann müsste ich das, was jetzt noch kommt, nicht mitansehen.« »Schnauze!«, brüllte der Inspektor, dass dem Fahrer das Blut in den Adern gefror. Er schlängelte sich schweigend zwischen den Autos, den Trümmern der eingestürzten Häuser, die auch auf die Straße gefallen waren, und den Mengen verängstigter, in ihren Gewändern aus grauem Staub ziellos umherirrender Menschen hindurch. Ihr Gang ließ den Schmerz ihrer Körper erahnen, die wie durch ein Wunder den Trümmern entkommen waren. Die Erde bewegte sich unablässig. Jedes Mal stiegen Klagerufe zum Himmel, die Gott und seinen Sohn Jesus um Vergebung für die Schändlichkeiten der Menschen anriefen. Frauen hielten die Leichen ihrer Kinder empor, Männer die ihrer Frauen. Es wurde geschrien, vom Stadtzentrum sei nichts mehr übrig, alle Kirchen seien zerstört, sogar die Kathedrale, in der die Beherrscher des Landes immer das traditionelle Te Deum feierten, um anschließend die Nation auszusaugen. Improvisierte Pastoren erinnerten daran, dass die Bibel diesen Tag vorausgesagt habe, die Menschen in ihrer Verblendung die Warnungen jedoch in den Wind geschlagen hätten. Nun müsse man den Kelch bis zur Neige leeren. Auf der Terrasse eines schäbigen Hauses, das wundersamerweise noch stand, brüllte ein Mann, der Grund für die Apokalypse sei die Explosion einer amerikanischen Bombe in der Bucht von Port-au-Prince. Der Inspektor durchquerte die Stadt, ohne etwas zu sehen, ohne einen Gedanken an das, was er gerade in dem Hotel erlebt hatte, an die tote Frau, von der er weder wusste, wie sie hieß, noch wo er sie getroffen hatte. Der soro hielt sein Gedächtnis immer noch in seinem Griff. Er hatte nur seine Mireya im Kopf. Mireya war seine Adoptivtochter, seit er damals im hintersten Winkel des Landes in dem kleinen Dorf La Brésilienne in einem rätselhaften und turbulenten Fall ermittelt hatte. Sein Auftrag war nicht etwa gewesen, die gestohlenen Glocken einer Kirche wiederzufinden, sondern – deren Klang! Er war mit diesem kleinen Mädchen zurückgekehrt, einem damals fast stummen Waisenkind, das auf der Straße bettelte, jedoch einzigartige Kräfte besaß. Ein junger Polizist namens Colin hatte sie zu spüren bekommen, nachdem er der Korruption verfallen war, die in der Polizei grassierte. Der Inspektor hatte damals alles riskiert, um seine Tochter zu retten. In diesem Moment musste sie mit Manon, der alten Frau, die wie eine Mutter über sie wachte, bei ihm zu Hause sein. Mireya kam immer um 16 Uhr aus der Schule. Das Erdbeben hatte ungefähr um 16 Uhr 55 zugeschlagen. Seine Wohnung lag in einem Mietshaus, das nicht den geltenden Baunormen entsprach, aber dies wurde dem Inspektor erst jetzt richtig klar. Er wusste zumindest, dass die Stadt, die auf einer Plattengrenze lag, früher oder später einem Erdbeben zum Opfer fallen würde, hatte aber gelebt, also wäre dies eine abstrakte Erkenntnis, die sich zu seinen Lebzeiten niemals konkretisieren würde. Und wie hätte er seine Gedanken auch umsetzen sollen? Eine andere Wohnung konnte er sich nicht leisten. Diese hier war preiswert, und der Besitzer, den er mehrmals mit seiner Waffe bedroht hatte, um ihm klarzumachen, dass ein Chef* seine Miete zahlen durfte, wann er wollte, war nun vorsichtig genug, nicht mehr auf pünktliche Erfüllung seiner Verpflichtungen zu drängen. Man konnte nicht wissen, wie weit ein Mann gehen würde, der unmäßig Alkohol trank und obendrein von der Institution, der der Schutz des Bürgers oblag, zum Führen einer Waffe berechtigt war, obwohl sein körperlicher und geistiger Verfall jeden Tag sichtbarer wurde. Ein Schluchzen erschütterte seine Brust und ließ eine Klage wie überschüssige Luft durch seine Lippen entweichen. Der Hass auf dieses Land und der Ekel, den es ihm einflößte, schnürten ihm die Luft ab, so dass er nur noch wie ein Asthmatiker röcheln konnte. Er betrachtete die Stadtteile von Port-au-Prince, die dieses offensichtlich starke Beben dem Erdboden gleichgemacht hatte, und sagte sich, dass ein weiteres Mal das Volk zu leiden hatte. Die Reichen würden, selbst wenn die blinde Gewalt des Naturphänomens auch sie getroffen hatte, bald Profit aus der Katastrophe schlagen. Armut und Leid waren das Gold Haitis, das die Reichen des Landes auf den öffentlichen Plätzen der großen Hauptstädte der westlichen Welt trefflich zu vermarkten verstanden. »Wenn Mireya tot ist«, grollte er, »wenn sie glauben, dass sie aus ihrer Leiche Zaster schlagen können, dann jage ich ihnen allen eine Kugel in den Kopf. Ich kaufe mir eine Bazooka und mache ihre Luxusautos, ihre Villen und ihre Paläste platt.« Das Motorrad kam in den mit Menschen überfüllten Straßen nur mühsam voran, denn überall hatte man begriffen, dass das, was an diesem Nachmittag noch den Schlaf und das Tun der Menschen beherbergt hatte, nun der größte Feind des Lebens war. Entsetzt stellte Inspektor Dieuswalwe Azémar fest, dass der große Bau des Hotels Castel Haïti, der im Süden auf einem Hügel die Stadt überragt hatte, verschwunden war. Er malte sich aus, dass sein Viertel Bas-Peu-de-Chose nicht mehr existierte und der Körper seiner kleinen Tochter eins mit dem Beton, dem Eisenschrott und dem Schutt geworden war. Wenn auch nur die geringste Chance bestand, dass Mireya noch lebend unter den Trümmern lag, würde er alles, was ihm an Knochen, Blut und Willen blieb, einsetzen, um die Materie zu besiegen, um seine Tochter der Erde zu entreißen. Als das Motorrad in die abschüssige Straße einbog, die zu seinem Viertel führte, konnte er nicht umhin, vor Freude aufzuschreien und dem Himmel innerlich zu danken, als könnte er ein Auserwählter unter der vom Erdbeben betroffenen Bevölkerung sein. Die meisten Häuser standen noch, als hätten die Schockwellen des Erdbebens hier ihre zerstörerische Kraft gedämpft. Das Gebäude, in dem er wohnte, hatte jedoch Risse. Eine göttliche Hand hatte im letzten Moment verhindert, dass es zusammenfiel. Mitten auf der Straße in der konsternierten Menge, die nicht mehr wusste, wohin sie fliehen sollte, denn es ging das Gerücht, dass die Erde sich jeden Moment unter den Füßen der Lebenden auftun konnte und man sich besser der göttlichen Barmherzigkeit befehlen sollte, bemerkte er Manou, die alte Dienerin, mit Mireya in den Armen. Er befahl dem Motorradfahrer anzuhalten. Dieser ging nicht das Risiko ein, den Preis für die Fahrt zu fordern, sondern fuhr eilig weiter, sobald der Polizist abgestiegen war. Er rief ihm nur eine Warnung zu: »Deine Waffe wird dir nicht mehr viel nützen. Das ist die Apokalypse. Bete lieber für dein Seelenheil.« Dieuswalwe Azémar hörte jedoch nichts, er sah nur seine Tochter Mireya, lebend in Manous Armen. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge. Manou sah ihn und reichte ihm das weinende Mädchen. Er nahm sie und drückte sie an sich. Die Berührung erfüllte ihn mit einer Energie, die die sich aufbäumende Erde unter seinen Füßen zur Vernunft bringen konnte. »Wo warst du, Papi?«, schluchzte Mireya. »Wo warst du?« Die Scham erhellte blitzartig den Moment, den er gerade mit der Frau im Hotel erlebt hatte: Es war die Ehefrau von Kommissar Solon! Kommissar Solon! Seinem Vorgesetzten! Vor allem seinem Freund. Er war der Einzige in der Polizei, der ihn immer verteidigt, der seine Verdienste erkannt hatte. Der Einzige, der ihn nicht verächtlich ansah, der sich über seinen Verfall nicht freute. Der Einzige auch, der eines Tages in seinem Büro die zwei tranpe-Flaschen ergriffen hatte, die er in einer Schublade versteckte, sie an der Wand zerschlagen und gesagt hatte: »Sie sind zu brillant, Inspektor Azémar, um sich so zu zerstören. Sie sind das effizienteste Gehirn in unserer Polizei und zu so etwas sind Sie jetzt geworden.« Ein anderer hätte den Zorn von Dieuswalwe Azémar auf sich gezogen. So seine zwei Flaschen tranpe zu opfern, eine solche Beleidigung hätte die Bestie wecken können, die tief im Inneren jedes Menschen schlummert. Aber Kommissar Solon war jemand andres. Kommissar Solon und Mireya waren auf dieser Erde die einzigen Wesen, die ihm einen Grund zum Leben lieferten. Und dennoch hatte er es soeben in einem Moment des Irrsinns mit der Frau seines Freundes in einem Hotel getrieben. Nach und nach fielen ihm die Umstände wieder ein, die ihn ins Hotel Jardin des Nuits geführt hatten. Die Frau machte ihm seit mehreren Monaten Avancen, denen er widerstand. An diesem Dienstag hatte er das Büro früher als üblich verlassen. Er hatte keine laufenden Fälle mehr. Er spürte, dass er noch tiefer in die Eingeweide der Erde sank. Er hatte Erklärungen des Präsidenten der Republik gehört und hätte angesichts eines solchen Ausmaßes an Dummheit am liebsten gekotzt. Die Frau des Kommissars hatte ihn unter dem Vorwand angerufen, sie müsste mit ihm über eine wichtige Sache reden, die die Sicherheit ihres Mannes betraf. Der Inspektor hatte akzeptiert. Er hatte zu viel getrunken. Da er kein Auto hatte, hatte die Frau des Kommissars ihn an einem diskreten Ort abgeholt. Anschließend hatte sie das Heft in die Hand genommen. Irgendetwas hatte sein Widerstreben überwunden. Was? Der soro hatte diesmal noch größere Lücken in sein Gedächtnis gerissen. Sie waren in diesem Hotel gelandet. Und dann das Erdbeben! »Wo warst du, Papi?«, wiederholte Mireya, die fast schon eine Nervenkrise hatte. »Ich musste Banditen sehr weit weg von hier verhaften«, brachte er heraus. »Ich bin so schnell wie möglich zu dir gekommen, mein Liebling.« Sie klammerte sich an ihn, und ihr kleiner Körper begann im Rhythmus eines Nachbebens, das die Welt um sie herum wackeln ließ, zu zittern. »Wir wären fast gestorben, Papi. Ich habe dich gesehen, erdrückt. Ich habe dir die Hand gereicht ... Ich habe mich gefragt, ob du davonkommst.« Er drückte sie noch fester an sich: »Ich bin davongekommen«, sagte er, während ihm heiße Tränen über Wangen und Lippen liefen. Er bemerkte, dass sie nach soro schmeckten. Er sagte sich, dass das Blut in seinen Adern nun aus Zuckerrohrschnaps bestand. Zu Recht entfernten sich seine rauchenden Kollegen jedes Mal von ihm, wenn sie eine Zigarette anzündeten. Mit einem solchen Äthanolgehalt war sein Körper eine wandelnde Bombe.
»Dein Hemd ist blutig«, bemerkte Mireya.
Sie zeigte ihm die Flecken am Kragen und auf der Brust. Er erschauerte. Das war das Blut von Madame Solon, die auf ihm erdrückt worden war. Er wusste nicht, wie er mit dem Leben davongekommen war. Das Hemd brannte ihm auf der Haut. Sein Körper begann zu schwitzen. Er hatte auf einmal das Gefühl einer nahen Bedrohung. Das hatte nichts mit dem Erdbeben zu tun, sondern mit der Leiche der Frau im Jardin des Nuits. Er hätte niemals in dieses Hotelzimmer gehen dürfen!
*
In der Nacht schlief er fast gar nicht. Wenn er ein Auge zutat, so bemerkte er es nicht. Die Bewohner des Viertels hatten sich auf der Straße und auf den Bürgersteigen eingerichtet. Man hatte sich zwischen zwei Nachbeben in die Häuser gewagt, um so viel wie möglich von dem zu holen, was für eine Nacht unter freiem Himmel nötig war, und gehofft, es möge nicht regnen, denn es war nicht auszudenken, was passieren würde, wenn zu dieser Katastrophe auch noch das Inferno eines Wolkenbruchs hinzukam. Die alte Dienerin war so selbstlos, mehrmals, nur mit der Taschenlampe eines Nachbarn bewaffnet, in die dunkle Wohnung einzudringen und mit Decken und Kleidern für Mireya, den Inspektor und sich selbst zurückzukommen. Azémar selbst brachte es nur einmal fertig, die Wohnung zu betreten, als sein Bedürfnis nach tranpe die panische Angst bezwang, die er empfand, seit er in dem Hotel durch ein Wunder dem Tod entronnen war. Er kam beschämt zurück, denn die Gallone mit seinem Lieblingsgetränk war in Stücke gegangen und lag zusammen mit anderen zerbrochenen Glasgefäßen, Porzellanscherben und Büchern auf dem Boden. Der tranpe auf dem Mosaik verströmte ironisch seinen Duft nach Zuckerrohr und asorosi*. Mireya, die ihn nicht hatte gehen lassen wollen, klammerte sich bei seiner Rückkehr an ihn: »Ich will nicht, dass du noch einmal von mir weggehst, Papi. Warum bebt die Erde so?« Er hatte auf nichts mehr eine Antwort. Er setzte sich neben seine Tochter und nahm sie in die Arme, während Manou zusammen mit anderen Frauen aus dem Viertel Litaneien für die Heilige Jungfrau aufsagte. Er hätte sich gewünscht, dass seine Tochter rasch einschlief, damit er auf die Suche nach Alkohol gehen konnte. Wenn er nichts fand, um seinen Durst zu löschen, würde es schlimmer als die Hölle werden. »Du musst schlafen, mein Liebling. Morgen brauchen wir unsere Kräfte.« In der Mitte der Straße hatten die Menschen, die aus Angst vor den Erdstößen aus ihren Wohnungen geflohen waren, eine schmale Gasse freigelassen. Andere Menschen trugen darin Tote oder Verletzte vorbei, deren Klagen als schaurige Gesänge durch die Dunkelheit schallten. Nachrichten und Gerüchte zirkulierten: Vom Stadtzentrum sei nichts mehr übrig. Ganze Viertel seien dem Erdboden gleichgemacht. Der Platz in einigen Metern Entfernung von der Stelle, an der sie sich befanden, wurde von Tausenden Obdachlosen gestürmt. Erst bei Sonnenaufgang, so hieß es, werde man das Ausmaß der Katastrophe erfahren – falls man den Sonnenaufgang erlebte, denn nun kam das beunruhigendste Gerücht von allen auf, nämlich, dass ein Tsunami zu befürchten sei. Das Meer könne die Bucht verlassen und in die Hauptstadt strömen. Man sah Menschen ihre Habseligkeiten schultern und sich auf den Weg ins Gebirge machen. Die meisten Bewohner des Viertels beschlossen indessen auf Drängen Inspektor Azémars, zu bleiben, wo sie waren. »Wenn ihr geht, fallen die Plünderer wie ein Heuschreckenschwarm über eure Behausungen her. Ich feuere keinen Schuss ab, um zu schützen, was euch noch bleibt. Tsunami in der Hose! Das Erdbeben ist schon einige gute Stunden her. Wenn das Meer über die Ufer treten sollte, hätte es das bereits getan.« Das war sein einziger vernünftiger Beitrag in dieser Nacht, denn sobald Mireya einschlief, vertraute er sie Manou an und ging zur nächsten Avenue, wo er eine tranpe-Händlerin kannte. Ihr Geschäft befand sich in der Nähe einer Schlucht, in der seinerzeit ein Verrückter eine Hütte hartnäckig immer wieder aufgebaut hatte, bis die Wassermassen sie beim nächsten Wolkenbruch erneut mit sich rissen. Er betrat einen Endzeitfilm. Zu beiden Seiten der Straße waren die Häuser eingestürzt. Leute versuchten im Licht von Lampen oder Kerzen Angehörige oder Freunde zu befreien, die noch unter den Trümmern gefangen waren. Verzweifelt suchte er nach der Auslage seiner tranpe