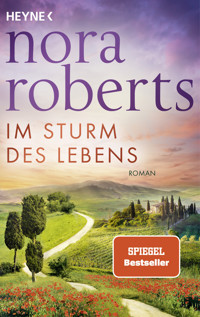
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packendes Familiendrama über Liebe und Loyalität inmitten prächtiger Weinberge
Als Sophia Gambelli die Nachfolge ihrer Großmutter antritt, hätte sie eigentlich jeden Grund zur Freude – wäre da nicht Tyler MacMillan, mit dem sie gemeinsam das Weingut leiten soll. Heftige Streitigkeiten bestimmen die widerwillige Zusammenarbeit. Doch dann tauchen Weine ihres Guts auf, die vergiftet worden sind. Plötzlich ist nicht nur das Lebenswerk von zwei Familien, sondern vor allem das Leben unschuldiger Menschen bedroht. Sophia muss sich entscheiden, wem sie vertrauen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Teresa Giambelli führt ihre Weinfirma mit Niederlassungen in Venetien und Kalifornien mit starker Hand. Zu ihren Nachfolgern in dem Familienunternehmen hat sie ihre Enkelin Sophia und Tyler, den Enkel ihres zweiten Mannes, bestimmt, die charakterlich so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Während der ruhige Tyler die harte körperliche Arbeit der Winzer liebt, genießt die lebhafte Sophia die gesellschaftliche Herausforderung in Presse und Marketing. Um die Zusammenarbeit der beiden zu fördern, entwickelt Teresa einen folgenreichen Plan - ein Jahr lang sollen Sophia und Tyler die Rollen tauschen, eine Idee, von der weder sie noch er begeistert ist. Kein Wunder, dass zunächst die Fetzen fliegen. Doch als ein mörderischer Gegner nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Leben unschuldiger Menschen bedroht, müssen Sophia und Tyler das Kriegsbeil begraben und Seite an Seite für das kämpfen, was beiden das Wichtigste ist: die Firma und die Familie.
Die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Silver Spring, Maryland, geboren. Durch einen Blizzard entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben: Tagelang fesselte sie 1979 ein eisiger Schneesturm in ihrer Heimat Maryland ans Haus. Um sich zu beschäftigen, schrieb sie ihren ersten Roman. Zum Glück - denn inzwischen zählt Nora Roberts zu den meistgelesenen Auorinnen der Welt. Unter dem Namen J. D. Robb veröffentlicht sie seit Jahren ebenso erfolgreich Kriminalromane. Auch in Deutschland sind ihre Bücher von den Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Ehemann lebt sie in Keedysville, Maryland und hat zwei erwachsene Söhne.
Inhaltsverzeichnis
Für die Familie, die die Wurzeln bildet.Für die Freunde, die die Blüten sind.
Prolog
An dem Abend, als er ermordet wurde, nahm Bernardo Baptista eine einfache Mahlzeit aus Brot, Käse und einer Flasche Chianti zu sich. Der Wein war noch etwas jung, Bernardo nicht. Keiner von beiden hatte die Chance, älter zu werden.
Wie Brot und Käse war Bernardo ein einfacher Mann. Seit seiner Hochzeit vor fünfundfünfzig Jahren wohnte er noch immer im selben kleinen Haus in den sanften Hügeln nördlich von Venedig. Seine fünf Kinder waren hier aufgewachsen. Seine Frau war hier gestorben.
Mittlerweile war Bernardo dreiundsiebzig und lebte allein. Die meisten Mitglieder seiner Familie wohnten nur einen Steinwurf entfernt, am Rand des großen Weinbergs von Giambelli, wo Bernardo seit seiner Jugend gearbeitet hatte.
Er kannte La Signora seit ihrer Kindheit, und man hatte ihm beigebracht, die Mütze zu ziehen, wann immer sie vorbeikam. Und wenn Teresa Giambelli jetzt aus Kalifornien zum Castello und dem Weinberg zurückkam, blieb sie immer noch stehen, wenn sie ihn sah. Dann redeten sie von den alten Zeiten, als ihr Großvater und er im Weinberg gearbeitet hatten.
Signore Baptista nannte sie ihn. Respektvoll. Er mochte La Signora, und er war ihr und den Ihren sein ganzes Leben lang treu ergeben gewesen.
Mehr als sechzig Jahre lang war er an der Bereitung von Giambelli-Wein beteiligt gewesen. Es hatte zahlreiche Veränderungen gegeben – manche zum Guten, nach Bernardos Meinung, andere nicht. Er hatte viel gesehen.
Manche fanden, zu viel.
Die Weinstöcke, die jetzt noch im Winterschlaf lagen, mussten bald beschnitten werden. Wegen seiner Arthritis konnte Bernardo nicht mehr so viel mit den Händen arbeiten wie früher, aber trotzdem würde er jeden Morgen hinausgehen, um zuzusehen, wie seine Söhne und Enkel die Tradition fortführten.
Immer hatte ein Baptista für Giambelli gearbeitet. Und in Bernardos Vorstellung würde das auch immer so bleiben.
An diesem letzten Abend seiner dreiundsiebzig Jahre blickte er hinaus über die Weinstöcke – seine Weinstöcke, um zu sehen, was bereits getan worden war und was noch getan werden musste, und er lauschte dem Dezemberwind, der durch die dürren Äste raschelte.
Sie zogen sich in gleichmäßigen Reihen die Hänge hinauf. Mit der Zeit würden sie zu neuem Leben erwachen. Sie vergingen nicht wie der Mensch. Das war das Wunder der Traube.
Er konnte die Schatten und die Umrisse des großen Castello erkennen, das die Weinberge überragte und über diejenigen wachte, die darin arbeiteten.
Jetzt lag es verlassen in der Winternacht. Nur die Dienstboten schliefen im Castello, und die Trauben mussten erst noch reifen.
Bernardo sehnte sich nach dem Frühling und dem langen Sommer, der darauf folgte, wenn die Sonne wieder seinen Leib wärmen würde und die junge Frucht reif werden ließ. Wie jedes Jahr wollte er wenigstens noch eine Ernte erleben.
Die Kälte machte Bernardo zu schaffen, schmerzte tief in seinen Knochen. Er überlegte, ob er die Suppe warm machen sollte, die seine Enkelin ihm gebracht hatte, aber seine Annamaria war keine besonders gute Köchin. Mit diesem Gedanken aß er den Käse auf und trank, an seinem kleinen Kamin sitzend, von dem guten, vollmundigen Wein.
Er war stolz auf sein Lebenswerk. Das Glas enthielt einen Teil davon. Im Schein des Feuers schimmerte es tiefrot. Der Wein war ein Geschenk gewesen, eins von vielen, die er zu seiner Pensionierung bekommen hatte, obwohl jeder wusste, dass er sich nur auf dem Papier zur Ruhe setzte. Trotz seiner schmerzenden Knochen und seines altersschwachen Herzens ging Bernardo immer noch zum Weinberg, prüfte die Trauben, beobachtete den Himmel und schnupperte die Luft.
Er lebte für Wein.
Und er starb dafür.
Er trank und nickte am Feuer ein, eine Decke über die dünnen Beine gelegt. Sonnenüberflutete Felder erschienen vor seinem inneren Auge, seine Frau, lachend, er selbst, wie er seinem Sohn beibrachte, eine junge Weinrebe zu stützen, eine reife zu beschneiden. La Signora stand neben ihm zwischen den Reihen, die ihre Großväter angelegt hatten.
Signore Baptista, sagte sie zu ihm, als ihre Gesichter noch jung waren, uns ist eine Welt geschenkt worden. Wir müssen sie behüten.
Und das hatten sie getan.
Der Wind pfiff um die Fenster seines kleinen Hauses. Das Feuer erlosch langsam.
Und als der Schmerz wie eine Faust nach ihm griff und sein Herz zu Tode drückte, war sein Mörder sechstausend Meilen weit weg, umgeben von Freunden und Partnern, und genoss einen perfekt gedünsteten Lachs und einen edlen Pinot Blanc.
TEIL EINS
Der Rebschnitt
Ein Mensch ist ein Bündel von Beziehungen, ein Klumpen Wurzeln, und die Welt ist seine Blüte und Frucht.
RALPH WALDO EMERSON
1
Die Flasche Castello di Giambelli Cabernet Sauvignon, Jahrgang ’02, erreichte auf der Auktion einhundertfünfundzwanzigtausendfünfhundert amerikanische Dollar. Viel Geld, dachte Sophia, für Wein, der so mit Gefühl durchsetzt ist. Der Wein in dieser schönen alten Flasche war aus Trauben gemacht worden, die in dem Jahr geerntet worden waren, als Cesare Giambelli das Weingut Castello di Giambelli in den Hügeln nördlich von Venedig gegründet hatte.
Damals konnte Castello beides bedeuten, einen Schwindel oder übergroßen Optimismus, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtete. Cesares bescheidenes Haus und seine aus Stein gebaute Kellerei waren alles andere als schlossähnlich, aber seine Weinstöcke waren königlich, und er hatte ein Imperium mit ihnen begründet.
Nach fast einem Jahrhundert war vermutlich auch ein hervorragender Cabernet Sauvignon nur noch als Salatsauce verwendbar und nicht mehr zum Trinken geeignet, aber es war nicht Sophias Aufgabe, sich mit dem Mann mit dem Geld zu streiten. Ihre Großmutter hatte Recht gehabt, wie immer. Für das Privileg, ein Stück Geschichte der Giambellis zu besitzen, würden sie bezahlen, und zwar reichlich.
Obwohl sie wahrscheinlich beides sowieso nicht vergaß, notierte sich Sophia das letzte Gebot und den Namen des Käufers, um ihrer Großmutter nach der Auktion eine Mitteilung zu schicken.
Sie nahm an diesem exklusiven Jahrhundertereignis nicht nur als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit teil, die die Werbung und den Katalog für die Auktion gestaltet und herausgebracht hatte, sondern auch als Vertreterin der Familie Giambelli.
Und in dieser Eigenschaft saß sie still hinten im Raum und beobachtete den Verlauf der Auktion.
Sophia hatte die Beine graziös übereinandergeschlagen. Den Rücken hielt sie gerade, wie sie es in der Klosterschule gelernt hatte. Sie trug ein schwarzes Nadelstreifenkostüm, von einem italienischen Designer maßgeschneidert, das sowohl geschäftsmäßig als auch äußerst weiblich wirkte. Genauso sah Sophia sich auch selbst.
Ihr Gesicht war scharf geschnitten, ein blassgoldenes Dreieck, das beherrscht wurde von tief liegenden braunen Augen und einem großzügig geschnittenen Mund. Ihre Wangenknochen standen deutlich hervor, und sie hatte ein energisches Kinn. Immer schon hatte sie skrupellos ihr Gesicht als Waffe eingesetzt, wenn es ihr angebracht erschien.
Vor einem Jahr hatte sie ihre taillenlangen Haare zu einem kurzen schwarzen Bob mit Stirnfransen abschneiden lassen. Es stand ihr gut. Sophia wusste genau, was ihr stand.
Sie trug die alte Perlenkette, die ihre Großmutter ihr zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag geschenkt hatte, und ihr Gesicht zeigte einen Ausdruck höflichen Interesses. Sie verglich diesen Gesichtsausdruck immer mit dem »Vorstandsblick« ihres Vaters.
Als das nächste Objekt ausgestellt wurde, hellte sich Sophias Miene auf, und sie verzog ihre Mundwinkel zu einem leichten Lächeln.
Es war eine Flasche Barolo, Jahrgang ’34, aus dem Fass, das ihr Urgroßvater zu Ehren der Geburt ihrer Großmutter Di Teresa genannt hatte. Auf dem Label der privaten Reserve prangte ein Bild von Teresa mit zehn Jahren, dem Jahr, in dem der Wein lange genug in dem Eichenfass gereift und auf Flaschen gezogen worden war.
Jetzt, mit siebenundsechzig, war Teresa Giambelli eine Legende, und ihr Ruf als Winzerin übertraf sogar den ihres Großvaters.
Dies war die erste Flasche dieses Labels, die jemals zum Verkauf angeboten wurde, und wie Sophia erwartet hatte, überschlugen sich die Angebote.
Der Mann neben Sophia tippte auf seinen Katalog, in dem das Foto von dem Label abgebildet war. »Sie sehen ihr ähnlich.«
Sophia rutschte ein wenig zur Seite und lächelte dem Mann zu. Er war ein distinguierter Herr um die sechzig. »Danke.«
Marshall Evans, fiel ihr ein. Makler in der zweiten Generation. Vermögen 500. Sie war stolz darauf, die Namen und statistischen Daten der Weinkenner und -sammler mit tiefen Taschen und teurem Geschmack auswendig zu kennen.
»Ich hatte gehofft, La Signora würde an der Auktion heute teilnehmen. Geht es ihr gut?«
»Ja. Aber sie ist anderweitig beschäftigt.«
Der Piepser in ihrer Tasche vibrierte. Leicht verärgert über die Unterbrechung ignorierte Sophia ihn, um weiterhin die Auktion beobachten zu können. Sie ließ die Augen durch den Raum schweifen. Ein beiläufig gehobener Finger in der dritten Reihe bewirkte, dass der Preis um weitere fünfhundert anstieg. Ein leises Nicken aus der fünften Reihe überbot die Summe.
Am Ende schlug der Barolo den Cabernet Sauvignon um fünfzehntausend. Sophia wandte sich zu dem Mann neben ihr und streckte ihm die Hand entgegen.
»Herzlichen Glückwunsch, Mr. Evans. Ihr Beitrag für das Internationale Rote Kreuz wird eine gute Verwendung finden. Und namens der Familie und des Unternehmens Giambelli hoffe ich, dass Sie Ihren Preis genießen.«
»Daran zweifle ich nicht.« Er ergriff ihre Hand und führte sie an die Lippen. »Ich hatte vor vielen Jahren einmal das Vergnügen, La Signora kennen zu lernen. Sie ist eine außergewöhnliche Frau.«
»Das ist sie.«
»Möchte ihre Enkelin mir vielleicht die Freude machen, heute mit mir zu Abend zu essen?«
Er war alt genug, um ihr Vater zu sein, aber Sophia war zu sehr Europäerin, um sich davon abschrecken zu lassen. Ein anderes Mal hätte sie zugestimmt und wahrscheinlich seine Gesellschaft genossen. »Es tut mir Leid, aber ich habe einen Termin. Vielleicht bei meiner nächsten Reise an die Ostküste, wenn Sie dann nichts vorhaben.«
»Ich werde dafür sorgen.«
Mit einem freundlichen Lächeln erhob sie sich. »Wenn Sie mich bitte entschuldigen möchten ...«
Sie schlüpfte aus dem Raum, zog den Piepser aus der Tasche und warf einen prüfenden Blick darauf. Nach einem Abstecher auf die Damentoilette blickte sie auf ihre Uhr und holte ihr Telefon aus der Tasche. Sie setzte sich auf eines der Sofas, gab die Nummer ein und platzierte ihr Notebook und ihren elektronischen Organizer auf dem Schoß.
Nach der langen, anstrengenden Woche in New York war sie immer noch aufgedreht, und als sie jetzt ihre Termine durchsah, stellte sie erfreut fest, dass sie noch Zeit hatte, um ein wenig einkaufen zu gehen, bevor sie sich fürs Abendessen umziehen musste.
Jeremy DeMorney. Das bedeutete einen eleganten, geistreichen Abend in einem französischen Restaurant, Gespräche über Essen, Reisen und Theater. Und natürlich über Wein. Da er einer der DeMorneys vom Weingut Le Coeur und einer der Topmanager dort war, und sie zu den Giambellis gehörte, würde es sicher einige spielerische Versuche geben, einander Unternehmensgeheimnisse zu entlocken.
Und es würde Champagner geben. Gut, sie war in der Stimmung dafür.
Und am Schluss gab es garantiert einen romantischen Versuch, sie ins Bett zu locken. Nachdenklich fragte sie sich, ob sie wohl auch dazu in der Stimmung war.
Er war attraktiv und konnte amüsant sein. Wenn sie beide nicht gewusst hätten, dass ihr Vater mit seiner Frau geschlafen hatte, dann wäre die Vorstellung einer kleinen Romanze zwischen ihnen nicht ganz so peinlich und irgendwie inzestuös gewesen.
Allerdings war das schon einige Jahre her ...
»Hallo Maria.« Sophia verdrängte den Gedanken an Jeremy und den bevorstehenden Abend. Die Haushälterin der Giambellis war ans Telefon gegangen. »Ich habe einen Anruf vom Apparat meiner Mutter bekommen. Ist sie zu sprechen?«
»O ja, Miss Sophia. Sie hat schon auf deinen Anruf gewartet. Einen Moment.«
Sophia stellte sich vor, wie Maria durch den Flügel des Hauses eilte und dabei prüfte, ob es nicht noch irgendetwas aufzuräumen gab, was Pilar Giambelli Avano nicht schon selbst aufgeräumt hatte.
Mama wäre glücklich in einem kleinen, rosenbewachsenen Cottage, wo sie Brot backen, stricken und ihren Garten pflegen konnte, dachte Sophia. Sie hätte besser ein halbes Dutzend Kinder gehabt. Stattdessen musste sie sich mit mir begnügen.
»Sophie, ich war gerade auf dem Weg ins Gewächshaus. Warte, lass mich erst mal wieder zu Atem kommen. Ich habe nicht erwartet, dass du so schnell zurückrufst. Ich dachte, du seiest mitten in der Auktion.«
»Sie ist beendet. Und ich glaube, wir können sagen, sie war ein unglaublicher Erfolg. Ich faxe dir heute Abend oder morgen früh die Einzelheiten. Ich muss gleich wieder zurückgehen und mich um den Rest kümmern. Ist zu Hause alles in Ordnung?«
»Mehr oder weniger. Deine Großmutter hat ein Gipfeltreffen anberaumt.«
»Oh, Mama, sie stirbt doch nicht schon wieder? Das hatten wir doch erst vor sechs Monaten.«
»Acht«, korrigierte Pilar sie. »Aber wer zählt das schon nach? Es tut mir Leid, Liebes, aber sie besteht darauf. Ich glaube nicht, dass sie dieses Mal vorhat zu sterben, aber sie plant irgendetwas. Die Anwälte müssen das Testament noch mal ändern. Und sie hat mir die Kamee ihrer Mutter gegeben ...«
»Ich dachte, die hättest du schon letztes Mal bekommen?«
»Nein, letztes Mal war es die Bernsteinkette. Sie möchte alle bei dem Treffen sehen. Du musst zurückkommen.«
»Na gut, na gut.« Sophia blickte auf ihren Organizer und schickte Jerry DeMorney in Gedanken einen Abschiedskuss. »Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Aber wirklich, Mama, ihre neue Gewohnheit, alle paar Monate zu sterben oder ihr Testament zu ändern, ist ziemlich lästig.«
»Du bist ein gutes Mädchen, Sophie. Ich werde dir die Bernsteinkette hinterlassen.«
»Vielen Dank.« Lachend legte Sophia auf.
Zwei Stunden später saß sie im Flugzeug und dachte darüber nach, ob sie in vierzig Jahren wohl auch nur mit dem Finger zu wackeln brauchte und jeder käme angeflogen.
Die Vorstellung brachte sie zum Lächeln. Sie lehnte sich mit einem Glas Champagner in ihrem Sitz zurück und hörte über die Kopfhörer Verdi.
Nicht jeder kam direkt angeflogen. Tyler MacMillan mochte es zwar nicht weit zur Villa Giambelli haben, aber er hielt die Weinstöcke für wesentlich wichtiger als einen Besuch bei La Signora.
Und das sagte er auch.
»Hör zu, Ty. Ein paar Stunden wirst du wohl erübrigen können.«
»Nein.« Ty lief in seinem Büro hin und her. Am liebsten wäre er sofort wieder in die Weinberge gegangen. »Es tut mir Leid, Großpapa. Du weißt doch, wie wichtig der Winterschnitt ist, und Teresa weiß das auch.« Er presste sein Handy ans Ohr. Er hasste es, weil er es ständig verlor. »Die Weinstöcke der MacMillans brauchen genauso viel Pflege wie die der Giambellis.«
»Ty ...«
»Du hast mir hier die Verantwortung übertragen. Ich tue nur meine Arbeit.«
»Ty«, wiederholte Eli. Er wusste, dass man mit seinem Enkel solche Dinge ausführlich besprechen musste. »Teresa und ich fühlen uns den MacMillan-Weinen genauso verpflichtet wie den Giambelli-Weinen, und das schon seit zwanzig Jahren. Ich habe dir die Verantwortung übertragen, weil du ein außergewöhnlich guter Winzer bist. Teresa hat Pläne. Pläne, die dich betreffen.«
»Nächste Woche.«
»Morgen.« Eli kehrte nicht oft den Chef heraus, das war normalerweise nicht seine Art. Wenn es jedoch nötig war, konnte er sehr bestimmend sein. »Ein Uhr. Zum Mittagessen. Zieh dich passend an.«
Tyler blickte finster auf seine alten Stiefel und den ausgefransten Saum seiner dicken Hose. »Das ist mitten am Tag!«
»Bist du der Einzige bei MacMillan, der Rebstöcke beschneiden kann, Tyler? Du hast offenbar in der letzten Saison zahlreiche Angestellte verloren.«
»Ich komme. Sag mir nur noch eins ...«
»Natürlich.«
»Ist es wenigstens für eine Zeit lang das letzte Mal, dass sie stirbt?«
»Ein Uhr«, erwiderte Eli. »Sei pünktlich.«
»Ja, ja, ja«, murrte Tyler, nachdem er aufgelegt hatte.
Er betete seinen Großvater an. Er betete auch Teresa an, vielleicht gerade weil sie so lästig war. Als sein Großvater die Giambelli-Erbin geheiratet hatte, war Tyler elf Jahre alt gewesen. Er hatte sich sofort in die Weinberge, in die sanften Hügel, die dunklen Keller und die riesigen Gewölbe verliebt.
Und er hatte sich äußerst real in Teresa Louisa Elana Giambelli verliebt, diese bleistiftdünne, aufrechte und irgendwie Angst einflößende Gestalt, die er das erste Mal sah, als sie in Stiefeln und Hosen, die seinen nicht unähnlich waren, durch die Senfsaat zwischen ihren Weinstockreihen streifte.
Sie hatte einen Blick auf ihn geworfen, eine Augenbraue hochgezogen und ihn als verweichlicht und verstädtert eingestuft. Wenn er ihr Enkel sein wollte, hatte sie ihm erklärt, dann müsse er erst einmal härter werden.
Sie hatte ihn für den Sommer in die Villa beordert. Niemand zog in Erwägung, ihr zu widersprechen. Ganz bestimmt nicht seine Eltern, die mehr als froh waren, ihn für so lange Zeit loszuwerden, damit sie Partys besuchen und ihre Affären pflegen konnten. Also war er dort geblieben.
Tyler trat ans Fenster. Er hatte Sommer für Sommer dort verbracht, bis er in den Weinbergen viel mehr zu Hause war als in dem Haus in San Francisco, und bis Teresa und sein Großvater ihm mehr Eltern waren, als seine Mutter und sein Vater jemals zuvor.
Teresa hatte ihn geformt, bis er zu dem wurde, der er heute war.
Aber er war nicht ihr Eigentum. Es ist eine Ironie des Schicksals, dachte er, dass gerade ich die Person in ihrem Umfeld bin, die ihre Forderungen am häufigsten ignoriert.
Es war natürlich schwieriger, die Forderungen zu ignorieren, wenn sie sich mit seinem Großvater zusammentat. Schulterzuckend eilte Tyler aus dem Büro. Er konnte durchaus ein paar Stunden erübrigen, und das wussten sie genauso gut wie er. Nur die besten Leute arbeiteten in den MacMillan-Weinbergen, und er hätte sogar in der Saison wochenlang wegbleiben und sich dennoch auf seine Leute verlassen können.
Es lag einfach nur daran, dass er die großen, ausgedehnten Zusammenkünfte der Giambellis verabscheute. Sie kamen ihm immer vor wie eine Zirkusvorstellung. Und da man seine Augen nicht überall haben konnte, bestand immer die Gefahr, dass einer der Tiger aus dem Käfig entwich und einem an die Kehle sprang.
All diese Leute, diese vielen Themen, all diese Anspielungen und unterschwelligen Strömungen ... Tyler fühlte sich wohler, wenn er durch seine Weinberge ging, die Fässer kontrollierte oder sich mit einem seiner Winzer irgendwo hinsetzte und über die Eigenschaften des diesjährigen Chardonnays diskutierte.
Gesellschaftliche Verpflichtungen waren eben nichts anderes als Verpflichtungen.
Tyler ging durch das Haus, das einmal seinem Großvater gehört hatte, in die Küche und füllte seine Thermoskanne mit frischem Kaffee. Geistesabwesend legte er das mobile Telefon, das er immer noch in der Hand hielt, auf die Küchentheke und ging im Geiste seinen Terminplan durch.
Er war kein verweichlichter Städter mehr. Er war über einen Meter achtzig groß, mit einem Körper, den die Arbeit in den Weinbergen und an der frischen Luft geprägt hatte. Seine Hände waren groß und schwielig, mit langen Fingern, die es verstanden, die Traube unter den Blättern ganz zart zu ertasten. Seine Haare waren lockig, wenn er vergaß, sie schneiden zu lassen, was oft passierte, und sie waren tiefbraun mit einem rötlichen Schimmer, wie alter Burgunder in der Sonne. Sein Gesicht war eher ausdrucksvoll als gut aussehend, mit ersten Fältchen um die Augen – Augen, die von einem klaren, ruhigen Blau waren, die jedoch auch hart wie Stahl werden konnten.
Die Narbe an seinem Kinn, die er einem Steinschlag verdankte, in den er mit dreizehn geraten war, fiel ihm nur auf, wenn er daran dachte, sich zu rasieren.
Das würde er morgen vor dem Essen tun müssen.
Seine Angestellten hielten ihn für einen gerechten, wenn manchmal auch ein wenig eigensinnigen Mann. Tyler hätte diese Einschätzung gefallen. Sie hielten ihn auch für einen Künstler, und das hätte ihn verblüfft.
Denn für Tyler MacMillan war die Traube die Künstlerin.
Er trat nach draußen in die frische Winterluft. In zwei Stunden ging die Sonne unter, und er musste sich um die Weinstöcke kümmern.
Donato Giambelli hatte gewaltige Kopfschmerzen und er wusste auch woher. Die Ursache hieß Gina, und sie war seine Frau. Als die Einladung von La Signora gekommen war, hatte er gerade mit seiner neuesten Geliebten im Bett gelegen, einer viel versprechenden, äußerst talentierten Schauspielerin.
Sie hatte Schenkel, mit denen man Nüsse knacken konnte. Im Gegensatz zu seiner Frau brauchte seine Geliebte nur gelegentlich ein kleines Geschenk und dreimal die Woche schweißtreibenden Sex. Sie brauchte keine Gespräche.
Manchmal dachte er, Gina brauche nur Gespräche.
Jetzt redete sie auf ihn ein. Redete auf jedes ihrer drei Kinder ein. Redete auf seine Mutter ein, bis die Luft im Firmenjet erfüllt war von endlosem Geplapper.
Umringt von ihr, dem schreienden Baby, dem Trampeln des kleinen Cesare und Teresa Marias Gehüpfe überlegte Don ernsthaft, ob er nicht die Tür öffnen und seine ganze Familie in den Orkus schicken sollte.
Lediglich seine Mutter war still, und das auch nur, weil sie eine Schlaftablette, eine Tablette gegen Reisekrankheit, eine Allergietablette und was sonst nicht noch alles genommen und sie mit zwei Gläsern Merlot hinuntergespült hatte, bevor sie ihre Augenmaske aufgesetzt hatte und süß entschlummert war.
Sie hatte die meiste Zeit ihres Lebens – zumindest, soweit er sich erinnern konnte – vollgepumpt mit Medikamenten verdämmert. Im Augenblick empfand er das als ganz besonders klug.
Er konnte nur mit pochenden Schläfen dasitzen und seine Tante Teresa zur Hölle wünschen, weil sie darauf bestanden hatte, dass die ganze Familie die Reise antrat.
Er war doch schließlich Vizepräsident von Giambelli, Venedig, oder etwa nicht? Geschäfte erforderten seine Anwesenheit, nicht die seiner Familie.
Warum hatte Gott ihn nur mit einer solchen Familie gestraft?
Es war ja nicht so, dass er sie nicht liebte. Natürlich liebte er sie. Aber das Baby war so fett wie ein Truthahn, und jetzt zog Gina auch noch eine Brust für seinen gierigen Mund heraus ...
Früher einmal war diese Brust ein Kunstwerk gewesen, dachte Don. Golden und fest und mit Pfirsichgeschmack. Jetzt war sie überdehnt wie ein aufgeblasener Ballon, aus dem anschließend die Luft entwichen war, und schmeckte nach Babysabber.
Und die Frau gab schon wieder irgendwelche Geräusche von sich.
Die Frau, die er geheiratet hatte, war reif, üppig, sexuell erfahren und leer im Kopf gewesen. Einfach perfekt gewesen. Doch in nur fünf Jahren war sie fett und schlampig geworden und hatte nichts als Babys im Kopf.
War es da ein Wunder, dass er anderswo Trost suchte?
»Donny, ich glaube, Zia Teresa wird dich befördern, und wir ziehen alle ins Castello.« Gina gierte nach dem prächtigen Haus der Giambellis – all diese schönen Zimmer, die vielen Dienstboten! Ihre Kinder würden in Luxus und privilegiert aufwachsen.
Feine Kleider, die besten Schulen – und eines Tages würde ihnen das ganze Giambelli-Vermögen gehören.
Sie war schließlich die Einzige, die La Signora Babys schenkte, oder etwa nicht? Das musste doch zählen!
»Cesare«, sagte sie zu ihrem Sohn, als er der Puppe seiner Schwester den Kopf abriss, »hör damit auf! Jetzt hast du deine Schwester zum Weinen gebracht. Hier, komm, gib mir die Puppe. Mama macht den Kopf wieder fest.«
Klein-Cesare warf mit funkelnden Augen fröhlich den Kopf herum und begann, seine Schwester zu ärgern.
»Sprich englisch, Cesare!« Gina drohte ihm mit dem Finger. »Wir fliegen nach Amerika. Du musst mit deiner Zia Teresa englisch reden und ihr zeigen, was für ein kluger Junge du bist! Komm, komm.«
Teresa Maria brach angesichts der zerstörten Puppe in lautes Geschrei aus, ergriff den beschädigten Kopf und rannte wütend in der Kabine herum.
»Cesare! Tu, was Mama dir sagt!«
Statt einer Antwort ließ sich der Junge fallen und hämmerte mit Füßen und Fäusten auf den Boden.
Don erhob sich, schwankte davon und schloss sich in seinem Flugzeugbüro ein.
Anthony Avano liebte die schönen Dinge. Er hatte sein zweistöckiges Penthouse in der Back Bay in San Francisco ganz bewusst ausgesucht, und dann hatte er den besten Innenarchitekten der Stadt damit beauftragt, es für ihn auszustatten. Status und Stil standen für ihn an erster Stelle, und er wollte schöne Dinge besitzen, ohne sich dafür anstrengen zu müssen.
Seine Zimmer waren so eingerichtet, wie er sich klassischen Geschmack vorstellte – von den mit Seidenmoiré bespannten Wänden über die Orientteppiche bis hin zu den glänzenden Eichenmöbeln. Er, oder vielmehr sein Innenarchitekt, hatte schwere Stoffe in neutralen Farbtönen mit ein paar kühn gesetzten Farbakzenten gewählt.
Die modernen Kunstwerke – die ihm übrigens nichts sagten – waren nach Aussage seines Beraters ein faszinierender Kontrapunkt zu der ruhigen Eleganz.
Anthony verließ sich vollständig auf die Dienste von Raumausstattern, Schneidern, Brokern, Juwelieren und Händlern.
Einige seiner Kritiker hatten über ihn gesagt, er sei schon mit Geschmack geboren worden – aber nur in seinem Mund. Er hätte ihnen nicht widersprochen, wenn er davon erfahren hätte. Geld jedoch, so sah Tony es jedenfalls, erkaufte einem all den Geschmack, den man brauchte.
Nur von einem verstand er etwas, und das war Wein.
Sein Keller gehörte unwidersprochen zu den besten in ganz Kalifornien. Jede Flasche hatte er persönlich ausgesucht. Er konnte zwar am Rebstock einen Sangiovese nicht von einem Sémillon unterscheiden und hatte kein Interesse am Reifen der Traube, aber er besaß eine hervorragende Nase. Und mit dieser Nase war er die Karriereleiter bei Giambelli, Kalifornien, unaufhaltsam emporgestiegen. Vor dreißig Jahren hatte er dann Pilar Giambelli geheiratet.
Es dauerte allerdings noch nicht einmal zwei Jahre, bis seine Nase anfing, an anderen Frauen zu schnüffeln.
Tony gab bereitwillig zu, dass Frauen seine Schwäche waren. Er hatte Pilar so sehr geliebt, wie er nur in der Lage war, ein anderes menschliches Wesen zu lieben. Und sicher hatte er auch seine privilegierte Situation als Ehemann der Tochter von La Signora und Vater ihrer Enkelin geliebt.
Deshalb versuchte er viele Jahre lang, sehr diskret mit seiner Schwäche umzugehen. Er versuchte sogar mehrere Male, sich zu bessern.
Aber dann lernte er wieder eine neue Frau kennen, weich und duftend oder erotisch und verführerisch. Was sollte ein Mann da machen?
Schließlich hatte die Schwäche ihn seine Ehe gekostet, zwar nicht in rechtlicher, jedoch in technischer Hinsicht. Er und Pilar lebten nun seit sieben Jahren getrennt. Keiner von ihnen hatte bislang die Scheidung angestrebt. Pilar nicht, das wusste Tony, weil sie ihn liebte. Und er nicht, weil er den Ärger fürchtete und weil er ahnte, dass es Teresa ernsthaft missfallen würde.
Seiner Meinung nach war es so für alle das Beste. Pilar wohnte lieber auf dem Land, er in der Stadt. Sie hatten eine höfliche, sogar relativ freundliche Beziehung zueinander. Und er behielt seinen Posten als Präsident der Verkaufsabteilung von Giambelli, Kalifornien.
Seit sieben Jahren verlief sein Leben in diesen ruhigen Bahnen. Doch jetzt hatte er Angst, dass er möglicherweise aus der Bahn geworfen werden könnte.
René bestand darauf, ihn zu heiraten. Wie eine seidene Dampfwalze strebte sie auf ihr Ziel zu und walzte alle Barrieren nieder. Nach Diskussionen mit ihr war Tony stets benommen und wie erschlagen.
Sie war äußerst eifersüchtig, dominant und fordernd und schmollte leicht.
Er war verrückt nach ihr.
Sie war zweiunddreißig, siebenundzwanzig Jahre jünger als Tony, eine Tatsache, die seinem Ego schmeichelte. Es störte ihn nicht, dass sie an seinem Geld mindestens genauso interessiert war wie an ihm selbst. Im Gegenteil, er achtete sie dafür nur umso mehr. Allerdings machte er sich Gedanken darüber, ob er sie wohl verlieren würde, wenn er ihr gab, was sie wollte.
Es war wirklich verteufelt kompliziert. Um das Problem zu lösen, tat Tony, was er immer tat, wenn er in Schwierigkeiten steckte: Er ignorierte das Problem, so lange es ihm möglich war.
Jetzt blickte er aus dem Fenster und trank einen Schluck Vermouth, während er darauf wartete, dass René sich zum Ausgehen fertig machte. Und er dachte darüber nach, dass seine Zeit ablief.
Als es an der Tür läutete, runzelte er die Stirn. Sie erwarteten niemanden. Da der Majordomus seinen freien Abend hatte, ging er selbst zur Tür. Sein Stirnrunzeln verschwand, als er seine Tochter sah.
»Sophie, was für eine reizende Überraschung!«
»Hallo Dad.«
Sie stellte sich leicht auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen. Attraktiv wie immer, dachte sie. Gute Gene und ein hervorragender Schönheitschirurg konservierten ihn prächtig. Sie bemühte sich, den kurzen, vorwurfsvollen Stich zu unterdrücken und sich stattdessen auf das instinktive Gefühl der Zuneigung zu konzentrieren, die sie für ihn verspürte.
»Ich komme gerade aus New York und wollte dich rasch sehen, bevor ich zur Villa fahre.«
Sie musterte sein Gesicht – glatt, fast ohne Falten und mit völlig unbesorgtem Ausdruck. Seine dunklen Haare waren an den Schläfen attraktiv grau, die tiefblauen Augen blickten klar. Er hatte ein gut geschnittenes, energisches Kinn mit einem Grübchen in der Mitte. Als Kind hatte sie es immer mit dem Finger angestupst und ihn damit zum Lachen gebracht. Liebe und Ressentiment stritten sich wie immer in ihr, sobald sie ihn ansah.
»Ich sehe, du willst ausgehen«, sagte sie, als sie seinen Smoking bemerkte.
»Gleich.« Er ergriff ihre Hand und zog sie hinein. »Aber ich habe noch viel Zeit. Setz dich, Prinzessin, und erzähl mir, wie es dir geht. Was möchtest du trinken?«
Sie zog sein Glas zu sich heran, schnüffelte daran und erwiderte: »Das Gleiche wie du.«
Während er an den Barschrank trat, blickte sie sich im Zimmer um. Ein teurer Schein, dachte sie. Nur Show und keine Substanz. Genau wie Vater selbst.
»Fährst du morgen hoch?«
»Wohin?«
Sie legte den Kopf schräg. »Zur Villa.«
»Nein, warum?«
Sie nahm das Glas entgegen. »Hast du keinen Anruf bekommen?«
»Weswegen?«
Widerstreitende Loyalitäten kämpften in ihr. Er hatte ihre Mutter betrogen, hatte sein Ehegelübde sorglos gebrochen, solange Sophia zurückdenken konnte, und schließlich hatte er sie beide verlassen, ohne ernsthaft einen Gedanken an sie zu verschwenden. Aber er gehörte immer noch zur Familie, und die Familie war in die Villa zusammengerufen worden.
»La Signora. Eins ihrer Gipfeltreffen mit Anwälten, hat man mir gesagt. Vielleicht willst du ja auch kommen.«
»Ach, nun, ich war ...«
Er brach ab, als René eintrat.
Wenn es ein Pin-up-Girl für Geliebte gäbe, die wie Trophäen gesammelt wurden, dachte Sophia wütend, dann wäre René Foxx es. Groß, kurvenreich und äußerst blond. Das Valentino-Kleid umschmeichelte einen wunderbar geformten Körper und sah unaufdringlich und elegant aus.
Sie hatte die Haare hochgesteckt, um ihr hübsches Gesicht mit dem vollen, sinnlichen Mund – Collagen, dachte Sophia gehässig – und den grünen Katzenaugen zur Geltung zu bringen.
Passend zu Valentino hatte sie Diamanten gewählt, die auf ihrer makellosen Haut funkelten und glitzerten.
Wie viel mochten diese Klunkern ihren Vater wohl gekostet haben?, fragte sich Sophia.
»Hallo.« Sophia nahm noch einen Schluck von ihrem Vermouth, um die Bitterkeit aus ihrem Mund zu spülen. »René, nicht wahr?«
»Ja, schon seit fast zwei Jahren. Und immer noch Sophia?«
»Ja, seit sechsundzwanzig Jahren.«
Tony räusperte sich. Nichts war seiner Meinung nach gefährlicher als zwei Frauen, die sich angifteten. Der Mann zwischen ihnen war immer in einer schlechten Position.
»René, Sophia ist gerade aus New York gekommen.«
»Tatsächlich?« René ergriff Tonys Glas und trank einen Schluck. »Deshalb siehst du so reisegeschädigt aus! Wir wollen gerade auf eine Party gehen. Du kannst uns gern begleiten«, fügte sie hinzu und hakte sich bei Tony ein. »Ich habe bestimmt noch etwas in meinem Schrank, das dir stehen würde.«
Wenn sie sich mit René auseinander setzen wollte, dann würde das bestimmt nicht in der Wohnung ihres Vaters und nach einem so langen Flug geschehen. Den Zeitpunkt und den Ort wollte Sophia schon selbst bestimmen.
»Das ist ganz reizend, aber ich möchte nicht gern etwas anziehen, das mir viel zu groß ist. Und«, fügte sie mit zuckersüßer Stimme hinzu, »außerdem bin ich auf dem Weg in den Norden. Familienangelegenheit.« Sie stellte ihr Glas ab. »Ich wünsche euch einen schönen Abend.«
Als sie zur Tür ging, eilte Tony ihr nach und tätschelte ihr beruhigend die Schulter. »Warum kommst du nicht mit, Sophia? Du bist auch so passend angezogen. Du bist wunderschön.«
»Nein, danke.« Sie drehte sich um und sah ihn an. Er blickte sie um Entschuldigung heischend an. Sie war diesen Gesichtsausdruck zu sehr gewöhnt, als dass er noch auf sie gewirkt hätte. »Ich bin nicht zum Feiern aufgelegt.«
Er fuhr zusammen, als sie ihm die Tür vor der Nase zuschlug.
»Was wollte sie?«, fragte René.
»Sie ist nur mal so vorbeigekommen, wie ich schon gesagt habe.«
»Deine Tochter tut nie etwas ohne Grund.«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie hat vielleicht gedacht, wir könnten morgen früh zusammen nach Norden fahren. Teresa hat eine Einladung herumgeschickt.«
René kniff die Augen zusammen. »Davon hast du mir ja gar nichts erzählt.«
»Ich habe auch keine bekommen.« Er ließ das Thema fallen und dachte stattdessen an die Party, und wie sehr er und René bei ihrer Ankunft auffallen würden. »Du siehst fabelhaft aus, René. Es ist eine Schande, dieses Kleid zu verstecken, selbst unter einem Nerz. Soll ich deine Stola holen?«
»Was heißt das, du hast keine bekommen?« René stellte das leere Glas heftig auf einem Tisch ab. »Deine Stellung bei Giambelli ist doch viel wichtiger als die deiner Tochter!« René wollte gern, dass das so blieb. »Wenn die alte Frau die Familie zusammenruft, dann gehst du hin. Wir fahren morgen früh.«
»Wir? Aber ...«
»Das ist eine perfekte Gelegenheit, um deinen Standpunkt zu vertreten, Tony, und Pilar endlich zu sagen, dass du die Scheidung willst. Wir gehen heute Abend früh nach Hause, damit wir morgen einen klaren Kopf haben.« Sie trat zu ihm und strich ihm mit den Fingern über die Wange.
Tony, das wusste sie, konnte man am besten mit einer geschickten Mischung aus eindeutigen Forderungen und körperlichen Belohnungen manipulieren.
»Und wenn wir heute Abend wieder hier sind, zeige ich dir, was dich erwartet, wenn wir erst einmal verheiratet sind.« Sie lehnte sich an ihn und biss neckend in seine Unterlippe. »Du kannst alles tun, was du willst.«
»Lass uns einfach gar nicht erst auf die Party gehen.«
Sie lachte und entwand sich ihm. »Sie ist aber wichtig. Und du hast Zeit, dir schon einmal auszudenken, was du von mir willst. Hol mir meinen Zobel, ja, Liebling?«
Heute Abend ist mir nach Zobel, dachte René, während Tony ihrer Bitte nachkam.
Heute Abend fühlte sie sich reich.
2
Im Tal und auf den Hügeln, die es umgaben, lag eine dünne Schneedecke. Die Weinstöcke, die wie Soldaten aufgereiht dastanden, reckten ihre kahlen Äste in den Nebel, der ringsum alles in sanfte Schatten hüllte. In der kühlen Dämmerung erschauerten die schlafenden Weinberge.
Diese friedliche Szene hatte ein Vermögen begründet, ein Vermögen, das Saison für Saison immer wieder neu eingesetzt wurde, mit der Natur als Partner und als Gegner zugleich.
Für Sophia war Wein zu keltern eine Kunst, ein Geschäft und eine Wissenschaft gleichermaßen, aber auch ein großes Spiel.
Von einem Fenster in der Villa ihrer Großmutter aus betrachtete sie das Spielfeld. Die Weinstöcke mussten jetzt beschnitten werden. Während sie auf Reisen gewesen war, waren sie bereits geprüft und ausgemustert worden, und damit hatten die ersten Phasen im Hinblick auf die neue Ernte bereits begonnen. Sophia war froh darüber, dass sie hergerufen worden war, sodass sie diese Phase selbst miterleben konnte.
Wenn sie unterwegs war, beanspruchte das Geschäft all ihre Energie. Sie dachte selten an die Weinberge, wenn sie für das Unternehmen tätig war. Aber wenn sie zurückkam, so wie jetzt, dann dachte sie kaum an etwas anderes.
Sie konnte jedoch nicht lange bleiben. Sie hatte Verpflichtungen in San Francisco, musste einer neuen Werbekampagne den letzten Schliff verleihen. Das hundertjährige Firmenjubiläum stand bevor. Und nach dem Erfolg der Auktion in New York erforderten die nächsten Unternehmungen jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit.
Ein alter Wein für ein neues Jahrtausend, dachte sie. Villa Giambelli: Das nächste Jahrhundert vorzüglicher Leistungen beginnt.
Aber sie brauchten etwas Frisches, etwas Frecheres für den jüngeren Markt. Für diejenigen, die ihren Wein im Vorbeigehen kauften – ein rascher, spontaner Griff, um etwas zu einer Party mitzunehmen.
Nun, sie würde darüber nachdenken. Das war schließlich ihr Job. Und wenn sie sich darauf konzentrierte, würde sie nicht an ihren Vater und die berechnende René denken müssen.
Das geht mich nichts an, ermahnte Sophia sich. Es ging sie überhaupt nichts an, wenn ihr Vater sich unbedingt an ein früheres Unterwäschemodell mit einem Herzen so groß und so vertrocknet wie eine Rosine hängen wollte. Er hatte schon häufiger einen Narren aus sich gemacht und er würde es zweifellos wieder tun.
Sie wünschte, sie könnte ihn dafür hassen, für seine jämmerliche Charakterschwäche und dafür, dass er sie immer vernachlässigt hatte. Aber ihre heimliche Liebe zu ihm blieb beständig. Darin war sie vermutlich genauso dumm wie ihre Mutter.
Sie bedeuteten ihm beide nicht mehr als der Schnitt seines Anzugs. Und kaum waren sie aus seinem Blickfeld verschwunden, verschwendete er nicht einen Gedanken mehr an sie. Er war ein Bastard. Egoistisch, nur sporadisch liebevoll und immer gedankenlos.
Sophia wünschte, sie wäre am Abend zuvor nicht bei ihm vorbeigefahren, hätte nicht das Band zwischen ihnen wieder erneuert. Es war besser für sie, so zu leben, wie sie es die letzten Jahre getan hatte. Reisen, arbeiten, ihre Zeit und ihr Leben mit beruflichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen anfüllen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























