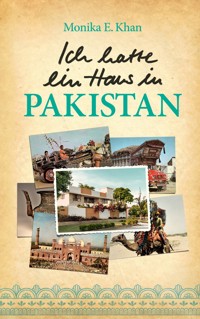Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Im Taumel der Begeisterung - Erinnerungen meines Lebensweges" ist ein autobiografisches Werk von Monika E. Khan, der Expertin für Single- & Solotouristik. Es setzt die Erzählung über ihr bewegtes und bewegendes Leben im Anschluss an Ihre im Heimatdorf Kollow im Süden Schleswig-Holsteins verbrachte Kindheit fort und schildert die teils abenteuerlich anmutenden Wege in ihrem beruflichen und privaten Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Eiscreme-Paradies
Die Schweiz ruft!
Atemberaubendes Panorama
Ein gefährliches Spiel
Hurra! London wartet auf mich!
Das (Ver)sprechen
Die Bretterbude
Ein falsches Spiel
Väterlicher Freund
Wahre Freunde!
Bei Nacht und Nebel:
Auf zu neuen Ufern
Ewig lockt das Abenteuer
Männer im Pub
Willkommen in meine Heimat
Auszeit – Babypause
Kreative Ader
Hühnerposten
Pillen, Salben und Zäpfchen
Panzer, Betten und Matratzen
Rotwein mit Ei
Achtung! Die Neue kommt!
Feierlaune
Hotel- Geschichten
Stars und Sternchen
Blauer Satellit
Ein Unglück kommt selten allein
Das Fest der Feste
Malheur – Stolperfalle!
Sekt und Moneten
Die Nassauer!
Hamstern
Statt Sushi – Brötchenschwemme
Schmuggelware!
Ertappte Diebin
Freibier
Große Ereignisse und wichtige Leute
A propos Fußballstars
Auf dem Campus
Aller Anfang ist schwer!
Nichts als die Wahrheit!
Glückspilze
Die Büroflüsterer
Mit Schimpf und Schande
Standesdünkel
Mit Leib und Seele
Singapur und die Wunderheiler
Dreh – Schwindel
Prüfungsschock
Kurschatten
Liebesgerangel!
Wenn`s dem Esel zu wohl geht
Zur Abwechslung gab`s noch `ne Bar…
Im Taumel des Eröffnungsrausches
Auf zum Kiez!
Undank ist der Welt Lohn
Dumm gelaufen!
Eine Frau will nach oben!
„Hamburger Modeberatung“
Vergoldeter Abschied
Eine Modeschule meldet sich
Kleiderschrank-Inspektion
Reisen und Schreiben
Die glorreiche Idee
Vorwort
Viele Wege habe ich in all den Jahren beschritten. Ob ich auf einer Einbahnstraße oder Sackgasse, auf einer Überholspur oder auf einem holprigen Feldweg unterwegs war, stets hatte ich dabei ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Mut und Begeisterung waren meine Begleiter. Ängste waren mir fremd. Bin ich dann mal auf einem Irrweg gelandet, habe ich ihn nach kurzer Strecke wieder verlassen, auch ohne mein Ziel erreicht zu haben. Anstatt enttäuscht zu sein, habe ich den Weg in vollen Zügen genossen. Darauf kommt es ja letztendlich an. Wie oft hatte ich dabei das Gefühl meine Arme auszubreiten, um davonzufliegen...
Ohne meine verrückten Ideen sowie meine ständige wiederkehrende Begeisterung für Neues, hätte ich wohl kaum so viele Geschichten zu erzählen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Auch möchte ich mich hiermit einmal bei meinen vielen Arbeitskollegen und -kolleginnen sowie meinen Freunden und meiner Familie dafür bedanken, dass sie mich stets so akzeptiert haben wie ich bin und mich oft genug bei meinen verrückten Unternehmungen unterstützt haben. Ganz lieben Dank!
Die vielen Zitate im Buch hat mir Heidi Windeit, eine frühere, liebe Arbeitskollegin, zur Abschiedsfeier mit auf dem Weg gegeben. Auch, wenn Heidi nicht mehr unter uns weilt, möchte ich ihr im Nachhinein noch für diese Zitate danken.
Eiscreme-Paradies
Eiscreme war in meinem bisherigen Leben eine seltene Kostbarkeit. Nun hatte ich die besten Aussichten, diese süßen, bunten Schleckereien so oft zu genießen, wie ich wollte.
Drei Stufen führten hinunter in mein zukünftiges Zuhause. Blaue und gelbe Stiefmütterchen zierten links und rechts die halbhohe Mauer am Eingang. Kostbarer Florentiner Tüll schmückte das Schaufenster. Ziemlich aufgeregt betrat ich in Begleitung meiner Mutter das hübsche Eis-Café. Eine große, schlanke Frau mit dunklen, dauergewellten Haaren sowie freundlich dreinschauenden Augen begrüßte uns aufs herzlichste. Doch plötzlich verschränkte sie ihre Arme vor der Brust, musterte mich von oben bis unten, bis sie schließlich meinte:
„Ich weiß nicht, Frau May, ob Moni mir eine Hilfe sein kann, sie ist ja noch so zierlich, sie sieht überhaupt nicht wie ein vierzehnjähriges Mädchen aus. Wir müssen hier alle hart anpacken, das wird sie doch niemals schaffen.“ Ungläubig schüttelte sie ihren Kopf, so, als wolle sie damit ihre Aussage bekräftigen. Am liebsten wär ich im Erdboden versunken. Ich war nicht nur klein und zierlich, meine langen Zöpfe machten mich auch nicht gerade erwachsener. Doch Mutter lobte mich in den höchsten Tönen:
„Das sieht nur so aus, da lassen Sie sich man nicht täuschen, was meinen Sie, Frau Steckmeister, wie die Moni schon arbeiten kann.“ Ich traute meinen Ohren nicht, wie kam Mutter nur darauf? Ich konnte mich gar nicht erinnern, je in meiner Kindheit geschuftet zu haben. Und was den Haushalt betraf, so machte meine Mutter ihn sowieso lieber selber. Komischerweise war ich ganz still, ich ließ alles über mich ergehen. So, als wäre ich nicht anwesend. Meine Mutter redete und redete, bis Frau Steckmeister sich schließlich breitschlagen ließ. Ich durfte bleiben, und meine Mutter zog glücklich von dannen. In diesem Moment fühlte ich mich noch kleiner und ziemlich unsicher.
Kindheit ade: Im zarten Alter von vierzehn Jahren und vier Monaten begann für mich der Ernst des Lebens: Für zwanzig Mark im Monat, Kost und Logis frei – in der Gärtner Straße 107 in Hamburg.
Liebevoll wurde ich im Kreise der Familie aufgenommen, und wie es in einer Familie Sitte ist, durfte ich sie auch duzen. Ab sofort waren es Tante Käthe und Onkel Hans für mich. Durch einen langen Flur war die hintere Zwei-Zimmerwohnung vom vorderen, hübschen Eiscafé mit seinen kleinen nierenförmigen Tischchen und den Florentiner Kaffeehausgardinen getrennt. Hannelore, die sechsjährige Tochter, schlief bei ihren Eltern im Schlafzimmer. Ein kleines Zimmer, etwas größer als eine Besenkammer, lag neben der Küche. Hier schlief die zwanzigjährige Tochter des Hauses, Trauti. Ich landete vorerst auf dem roten Plüschsofa im Wohnzimmer.
„Ein eigenes Zimmer hast du auch“, hatte Mutter mir vorgeschwärmt, als sie vom Onkel Ewald kam. Er war Tante Käthes Bruder und besaß in Schwarzenbek eine Eisdiele. Mutter war mit ihm und seiner Frau befreundet, deshalb nannten wir ihn auch Onkel Ewald. Während ich im Frühjahr 1953 die Schule beendete, schmiedeten die beiden diesen Plan.
„Kind, warum erst lange lernen, im Eiscafé verdienst du gleich Geld“, überredete meine Mutter mich.
Das Wohnzimmer, meine vorübergehende Schlafstatt, war der einzige Raum, in dem sich das gesamte Familienleben abspielte. Es war nicht nur das Besucherzimmer für Bekannte und Verwandte, hier wurde auch nach Strich und Faden gequalmt. Naja, da es in einem Geschäftshaushalt keine Langeweile gab, fiel ich ohnehin erst gegen elf Uhr abends todmüde aufs Sofa und sofort in einen Tiefschlaf. Schlafprobleme kannte ich nicht, im Gegenteil, wenn morgens zwischen sieben und acht Uhr der Wecker klingelte, wunderte ich mich, dass die Nacht schon wieder vorbei war. Heute wundere ich mich, wie ich den Qualm vertrug, der sich zeitweise wie Nebelschwaden überall im Zimmer verteilte. Denn beide, Tante Käthe und Onkel Hans, waren starke Raucher.
In meiner Familie wurde zwar auch geraucht, aber nicht so stark, denn meine Mutter rauchte nur ganz wenig, außerdem war ich ja als Kind die meiste Zeit draußen an der frischen Luft.
Zwischen Küche und Schlafzimmer befand sich die Toilette mit einem kleinen Handwaschbecken für alle – auch für die Kunden. Ein Bad oder Dusche gab es nicht. Gewaschen wurde sich in der Küche. Aber das kannte ich ja schon alles von zu Hause, doch da hatten wir nicht mal fließendes Wasser, sondern mussten es vom Dorfbrunnen holen.
Auch wenn wir auf engstem Raum lebten, so hatte ich ab sofort wieder eine richtige Familie. Denn, nachdem mein Vater vor eineinhalb Jahren verstorben war, zog meine Mutter bereits nach neun Monaten zu einem anderen Mann und seinen beiden Knaben nach Geesthacht. Dort fühlte ich mich nicht mehr wie in einer Familie. Meine Familie waren meine fünf Brüder, als sie noch zu Hause waren sowie meine Mutter und mein Vater, als er noch lebte, und wir alle gemeinsam noch in der Mooskate im Dorf Kollow wohnten. Obwohl ich dem Onkel Walter, wie wir Mutters neue Beziehung nannten, Unrecht tue, wenn ich sage: Ich mochte ihn nicht. Er war ein netter Mensch. Sein Sohn Dieter dagegen, der war ein arroganter, verwöhnter Knabe, mit dem ich nur Streit hatte, nee, was war ich froh, dass ich jetzt weit von ihm weg war und hier im Eiscafé ein neues Zuhause gefunden hatte.
Schön getrennt nach Weiß- und Buntwäsche versuchte Tante Käthe bei der nächsten Wäsche, den Einheitsgrauschimmer aus meinen Klamotten rauszuwaschen. Meine Mutter nahm es eben nicht so genau mit dem Waschen. Sie war froh, wenn sie damit fertig war. Außerdem mussten wir im Dorf ja auch noch das Wasser ‘ranschleppen und es auf einem Kohlenherd heiß machen. Hier in der Gärtnerstraße hatten wir fließendes Wasser und einen Gasherd. Das war schon mal eine große Erleichterung.
War ich im Dorf ein braungebranntes Naturkind, so wurde ich jetzt von Tag zu Tag blasser. Wie sollte ich denn braun werden? Wenn die Sonne schien, sah ich sie ja nur von drinnen. Als meine Mutter mich besuchte, sagte sie: „Kind, was bist du nur blass geworden.“
Keine drei Monate waren ins Land gegangen, da wurde ich krank. Eine saftige Angina schnürte mir den Hals zu. Schweißgebadet und mit hohem Fieber lag ich auf der Couch. Der Arzt kam und gab mir Penicillin. Mit sorgenvoller Miene stand Tante Käthe vor mir und sagte:
“Mädchen, werde bloß schnell wieder gesund, ich bin ja so froh, dich hier zu haben.
Nie hätte ich gedacht, dass du mir eine so große Hilfe sein würdest.“ In ihrer Hand hielt sie ein wunderschönes weißes Nachthemd aus weicher fließender Baumwolle mit roten Punkten und Rüschen am Ausschnitt. So ein schönes Nachthemd hatte ich noch nie besessen.
Nicht nur Schuften lernte ich schnell, auch gute Umgangsformen brachten Tante Käthe und Onkel Hans mir bei. Ständig verbesserten sie mein Deutsch. Hier gab es alles im Überfluss, nicht nur die Arbeit, auch gutes Essen. Wie ein kleines Kind freute ich mich jeden Tag aufs Mittagessen. Für mich war Tante Käthe die beste Köchin. Mit Butter und Sahne verfeinerte sie jedes Essen. Ich konnte essen, was ich wollte, nichts wurde eingeteilt. Schon beim Kochen lief mir das Wasser im Mund zusammen – kein Wunder bei der Küche.
Einkaufen gehörte zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Wie im Schlaraffenland gab es rund um das Eiscafé kleine Lebensmittel-Fachgeschäfte, in denen man alles kaufen konnte, was das Hungerherz begehrte, und ein prallgefülltes Portemonnaie lag stets griffbereit in der Küchenschrankschublade. War mal nicht genug Geld drin, holte ich Nachschub aus dem Wäscheschrank, unter der Bettwäsche lagen genug Geldscheine aus der jeweiligen Tageskasse. Der einzige Haken der ganzen Geschichte, ich wurde einfach nicht dicker. Kein Gramm nahm ich zu. Bis Tante Käthe mich zum Hausarzt schickte. „Alles in Ordnung bei dir, versuch es mal mit ein viertel Pfund Schlagsahne pro Tag.“ Auch das half nicht. Es war die Schufterei. Ich glaube, in keiner Lehrstelle lernt man so viel verschiedene Arbeiten kennen wie in einem Geschäftshaushalt. Alles wurde selbst gemacht, keine Fertigware wurde fürs Kochen oder fürs Eis gekauft.
Das muss man sich mal vorstellen: Die Sonne scheint, der Laden ist gerammelt voll, die Kunden stehen bis draußen vor der Tür Schlange, und die Erdbeeren sind reif. Körbeweise Erdbeeren mussten nicht nur für den täglichen Eisbedarf geputzt und eingezuckert werden, nein, wir mussten nebenher noch zentnerweise einwecken, denn die Erdbeerzeit, in der man frische Erdbeeren kaufen konnte, war noch sehr begrenzt. Waren dann später die Schattenmorellen reif, wurden auch sie fürs Fürst-Pückler-Eis eingeweckt, (Halbgefrorenes wurde aus Schlagsahne, in drei Schichten hergestellt:
Eine Schicht war aus Sahne, echter Vanille, Zucker und Eigelb, die zweite Schicht mit Sahne und Kirschen und die dritte Schicht wurde mit Sahne und Kakao hergestellt). Denn das verkauften wir ja auch im Winter. Zum Glück hatten wir noch Tante Jark, die im Geschäft half sowie Tante Grete, Tante Käthes Schwester, die uns beim Einmachen unterstützte.
Kennen Sie Powerschlaf? Hier lernte ich ihn. Egal, wie voll der Laden auch war, Tante Käthe sagte nur: „Los Moni, verzieh dich und leg dich einen Augenblick hin.“ Ich band mir die weiße Schürze ab und legte mich auf die Couch. Sofort schlief ich ein und garantiert nach zehn bis zwanzig Minuten wachte ich automatisch nach einem Tiefschlaf wieder auf. Frisch und munter erschien ich dann wieder im Laden. Nur Onkel Hans, der übertrieb es ständig mit seinem Powerschlaf, setzte er sich erst einmal auf den gemütlichen Sessel im Wohnzimmer, mussten wir ihn nach einer Stunde mindestens zweimal wecken, damit er wieder zu sich kam.
Am liebsten stand ich hinter der Eistheke, wenn Onkel Hans abends und am Wochenende auch mitmischte, denn am Tage arbeitete er im Büro. Er war etwas kleiner als Tante Käthe, ein gemütlicher, rundlicher Mann mit lichtem Haar. War der Laden noch so voll, er war die Ruhe in Person. Mit Späßen hielt er stets die Kunden bei Laune oder zeigte seinen Heiermann-Trick, den er aus seinem linken Jackenärmel zu zaubern pflegte. Wir hatten das beste Speiseeis in der Gegend! Die Arbeit nahm kein Ende. Zwar musste ich das alles erst lernen, aber wie gesagt, ich lernte schnell. Sehr bald durfte ich auch den Knüppel der großen Eismaschine in die Hand nehmen, um das Eis von den Wänden zu streichen, wenn die Trommel rotierte. Trotz meiner dünnen Arme hatte ich viel Kraft. Kein Wunder bei dem guten Essen. So rackerten wir von morgens bis in die späten Abendstunden. Als Trauti heiratete, zog sie aus.
Überglücklich zog ich ins kleine Zimmer. Endlich hatte ich mein eigenes Reich. Es war zwar klein jedoch urgemütlich mit seinem großen Fenster, den bunten Übergardinen sowie dem schmalen Eckschrank, die Frisierkommode und das kuschelige Bett.
Komischerweise empfand ich die viele Arbeit gar nicht als Schufterei. Wir saßen ja alle im selben Boot. Wenn ich dann um 23 Uhr todmüde ins Bett fiel, war für Tante Käthe der Tag noch lange nicht zu Ende. Dann nahm sie sich die Bügelwäsche vor.
Die sechsjährige Hannelore war ja auch noch da, sie war wie eine jüngere Schwester für mich. Meistens brachte ich sie abends ins Bett. Egal wie voll der Laden auch war, sie kannte kein Erbarmen, sondern brüllte solange aus dem Schlafzimmer meinen Namen, bis ich kam und ihr eine meiner ausgedachten Geschichten erzählte. Stets begann ich mit den Worten: „Es war einmal ein kleiner Klaus, der hatte eine kleine, weiße Maus…“
Im Winter ging es beschaulicher zu. Da kamen in der Woche nur ein paar Kaffeetrinker, die gemütlich die Büchermappe lasen. Die Tasse Kaffee oder das Kännchen wurden in Handarbeit stets frisch gebrüht. Zuerst wurde der Kaffee mit der Hand portionsweise frisch in der Kaffeemühle per Hand gemahlen, ein gehäufter Messlöffel kam in den Tassenfilter und wurde mit etwas kochendem Wasser übergossen, damit das Kaffeepulver quillt und sein Aroma entfaltet. Nach und nach wurde dann kochendes Wasser nachgegossen, bis die Tasse voll war. Auf einem kleinen ovalen Silbertablett mit Sahnekännchen und Zuckerdöschen brachten wir sie dem Kunden. Diese Wertarbeit gab es für 30 Pf. Meistens hielten einen die Kunden auch noch mit einem Klönschnack von der Arbeit ab. Samstags wurde den ganzen Tag Kuchen, für den Außer- Haus-Verkauf am Sonntag, gebacken. Genau eine Stunde lang mussten die Zutaten mit dem Holzlöffel zu einem geschmeidigen Teig verrührt werden, sodass der Puffer schön saftig und locker wurde, damit er wie zarter Schokoladenschmelz auf der Zunge zerging. Außerdem stellten wir Buttercremetorte und Hamburger Speck, auch ‚Kalter Hund‘ genannt, – in Schokoladenguss eingebettete Kekse – sowie den beliebten Apfelstreusel her. Pfundweise verkauften wir frisch geschlagene Sahne. Die schlug Onkel Hans mit einem riesigen Schneebesen in einer großen halbelektrischen Sahnemaschine so lange, bis sie steif und flockig wurde. An manchen Sonntagen kam er so auf vierzig Liter. Das war noch richtige Handarbeit. Wie gut, dass er so kräftige Arme hatte.
Entspannt ging ich zweimal die Woche auf die Gewerbe- und Haushaltsschule in der Uferstraße. Manchmal, je nach Wetter, brauchte ich danach nicht zurück ins Geschäft. So schuftete ich mich in meinen ersten drei Berufsjahren durchs Leben.
Mein Abschlusszeugnis der Gewerbe- und Haushaltschule hatte ich in der Tasche, da wurde es Zeit für mich, was Neues anzufangen. Nun suchte ich einen plausiblen Grund, meine neue Familie zu verlassen, ohne sie zu kränken. Am Wochenende studierte ich die Samstagsausgabe des Hamburger Abendblattes und zwar die Seiten mit den Stellenausschreibungen fürs Ausland. Eine besonders große Annonce stach mir ins Auge.
„Haustochter für Privathaushalt, außerhalb Zürichs, Schweiz, gesucht“.
‚Das ist es! Ich gehe ins Ausland! Endlich werde ich mir meinen Kindheitstraum erfüllen‘, schoss es mir durch den Kopf. Nun musste ich nur noch meine Mutter überreden, denn ich war ja noch nicht volljährig. Tante Käthe und Onkel Hans, wollten mir natürlich keinen Stein in den Weg legen und freuten sich für mich. Und so machte ich mich mit wehenden Fahnen auf den Weg ins ferne Land. Bisher war ich nicht weiter als fünfzig Kilometer im Umkreis von Hamburg gekommen.
Die Schweiz ruft!
„Beeil dich Moni, wir müssen los, der Bus fährt in einer viertel Stunde!“
“Ja, Mama, ich bin sofort fertig.“ Strahlender Sonnenschein empfing uns, als wir ins Freie traten. „Was für ein schöner Spätsommertag, gerade richtig um meine Heimat in bester Erinnerung zu behalten“, sagte ich zu meiner Mutter. Der Ort schien wie ausgestorben. Die paar Seelen die hier in der kleinen Ortschaft, Burgstall wohnten, waren fast alle auf dem Feld Kartoffeln sammeln. Da brauchte ich wenigstens nicht jedem Einzelnen ‚Tschüss‘ zu sagen. Ich brach auf, um in der Schweiz für ein Jahr zu arbeiten. Auch, wenn ich nur selten hier bei meiner Mutter auf Besuch war, so kannte mich doch jeder.
Auf halber Strecke zur Hauptstraße, von wo aus der Bus nach Hamburg fuhr, setzte ich für einen Moment den Koffer auf den staubigen Feldweg ab und blickte zurück. Nur zwei langgestreckte Reihenhäuser standen mitten in der Feldmark. Links und rechts der Häuser standen eine Scheune und ein Kuhstall. Verschnörkelte gusseiserne Wasserpumpen vor jedem Haus versorgten die Einwohner mit frischem Grundwasser. Windschiefe Holzschuppen mit integrierten Plunmpsklos bildeten eine natürliche Grenze zwischen den familieneigenen Gärten und den Feldern.
Strohgelbe Stoppelfelder leuchteten in der Nachmittagssonne. In der Ferne sahen die Menschen, die mit Kartoffelsammeln beschäftigt waren, wie Spielzeugfiguren aus. Kein einziger Knick versperrte mir den Blick bis zum Sachsenwald. Träge plätscherte die Bille dahin, sie schlängelte sich zwischen den Feldern und dem Sachsenwald. Hierher hatte es meine Mutter mit Onkel Walter verschlagen, der neuerdings auf dem Gutshof Sachsenwaldau, als Vorarbeiter beschäftigt war. Und hier hatte ich noch ein paar Tage Urlaub gemacht, bevor ich loszog, um in der Ferne zu arbeiten. Kaum waren wir auf der Hauptstraße angekommen, kam auch schon der Bus. Er brachte uns zum Hamburger ZOB. Von dort waren es nur noch ein paar Schritte bis zum Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig drückte meine Mutter mir etwas Kleines relativ Schweres mit den Worten in die Hand:
„Pass gut auf ihn auf, damit er dir stets auf deinen Wegen Glück bringt!“ Ihr wurde schwer ums Herz. Ungern ließ sie mich mit meinen siebzehn Jahren allein in die Fremde ziehen. Ich öffnete meine Hand und freute mich riesig über die kleine bronzene Hummelfigur – ein Hamburger Wasserträger. Wenig später stand ich im Zugabteil am offenen Fenster und winkte meiner Mutter mit dem Taschentuch zu, bis sie immer kleiner wurde und aus meinem Blickfeld verschwand.
Nun machte ich es mir auf meinem Sitzplatz am Fenster bequem. Meinen braunen Lederkoffer, den mir Tante Käthe zum Abschied geschenkt hatte, verstaute ich im Gepäcknetz über mir.
Allmählich nahm der Zug Fahrt auf und ich staunte über Landschaften, die ich noch nie vorher gesehen hatte, bis die Dunkelheit alles in sich verschlang. Ich nahm mein Reiseplaid aus meiner Reisetasche, kuschelte mich damit ein und versuchte zu schlafen. Laut quietschende Räder bei jeder Bahnhofseinfahrt ließen mich wach werden. Verschlafen schaute ich auf den Bahnsteig, bis die Trillerpfeife des Schaffners zu hören war, und der Zug sich wieder in Bewegung setzte. An der Schweizer Grenze mussten wir ‘raus und nicht nur unsere Pässe dem Zoll vorlegen, sondern auch eine Leibesvisitation über uns ergehen lassen. In meiner Aufenthaltsbewilligung, die ich dem Zoll vorlegen musste, hieß es wörtlich:
„Beim Grenzübertritt hat der Ausländer den Grenzkontrollorganen diese Zusicherung, sowie einen gültigen Pass vorzuweisen. Der Inhaber dieser Zusicherung hat sich, sofern er zum Stellenantritt einreist, beim Grenzübertritt der grenzsanitarischen Untersuchung zu unterziehen. Die Zurückweisung aus gesundheitlichen Gründen macht diese Zusicherung ungültig. Bedingungen – ledig und kinderlos“
„Achtung! Hausangestellte haben weder Anspruch noch Aussicht auf Bewilligung eines nachträglichen Berufswechsels“ Fremdenpolizei Kanton Zürich
Gesund, ledig und kinderlos erfüllte ich diese Bedingungen und konnte entspannt die Zugfahrt fortsetzten.
Endlich rollte der Zug am anderen Morgen in Zürich ein. Laut kreischten die Räder noch einmal auf, bevor der Zug zum Stehen kam. Kaum hatte ich den Bahnsteig betreten, erblickte ich zwischen dem geschäftigen Treiben auf dem Bahnsteig einen besonders großen kräftigen Mann, der ein Schild mit meinem Namen hoch hielt. Da er bereits ein Bild von mir hatte, kam er gleich auf mich zu. Sehr förmlich, mit einem knappen Lächeln, begrüßte er mich mit den Worten:
„Grüezi, Frl. May, kommen Sie, meine Familie freut sich schon auf Sie.“
Das klang ja schon mal ganz nett. Trotzdem schien er kein Mann von großen Worten zu sein.
Stillschweigend fuhren wir in seinem Auto entlang des Zürichsees. Herrliberg las ich auf einem Schild am Ortseingang.
Langsam fuhr er durch den hügeligen Ort, bis kaum noch Häuser auftauchten. Tief unter uns schaute ich auf den Zürichsee. Vor uns tauchte ein kleiner Wanderweg auf, der bergan auf einen Hügel führte. Das war das Ortsende. Links bog er in einen schmalen Sandweg und hielt vor der Garageneinfahrt eines schmucken Einfamilienhauses, das auf einem kleinen Hügel stand. Als ich ausstieg, wurde die Haustür von innen geöffnet. Drei Menschen schienen sich sichtlich über mein Erscheinen zu freuen. Frau Reinhard, ihr Vater und die kleine zweijährige Ragili, denn sie lächelten mir schon entgegen, als ich die zehn steinernen Treppenstufen empor stieg. Ich atmete auf. Nachdem ich allen vorgestellt worden war, zeigte Frau Reinhard mir mein Zimmer im ersten Stock. Ich konnte es kaum glauben, noch nie hatte ich in einem so großen, hübsch eingerichteten Raum, mit Panoramablick über die Schweizer Berglandschaft, geschlafen. Für heute sollte ich mich man in Ruhe einrichten und von der langen Fahrt erholen, meinte Frau Reinhard.
Am nächsten Tag klärten mich beide, Herr und Frau Reinhard, über den Status als Haustochter auf. Als Erstes erfuhr ich, dass Herr Reinhard Banker sei.
„Alles muss seine Ordnung haben“, begann er, „wissen Sie, wir haben ihrer Mutter gegenüber eine große Verantwortung übernommen und möchten, dass Sie nach einem Jahr wieder wohlbehalten nach Hamburg zurückkehren. Das sehen wir als unsere oberste Pflicht!“ ‚Sind die aber fürsorglich‘, dachte ich.
Frau Reinhard übernahm nun das Wort und klärte mich über meine zukünftigen Aufgaben und Arbeitszeiten auf, außerdem nannte sie mir ein Monatsgehalt von Einhundertzwanzig Schweizer Franken. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Um acht Uhr gab es Frühstück, danach sollte ich der Hausfrau zur Hand gehen. Nach dem Mittagessen hatte ich eineinhalb Stunden Mittagspause. Anschließend brauchte ich dann nur noch bis zum Abendbrot arbeiten. Einen halben Tag in der Woche und jeden zweiten Sonntag hatte ich frei. Und dafür sollte ich auch noch Einhundertzwanzig Schweizer Franken, in bar bekommen. Ich musste mich kneifen, ob das hier Wirklichkeit war. Am Ende nahm Herr Reinhard wieder das Wort und sagte: „Das Allerwichtigste jedoch ist, Sie müssen stets um 22 Uhr zu Hause sein, sonst können wir keine Verantwortung für sie übernehmen!“
Ich schwebte im siebenten Himmel und antwortete völlig überzeugt: „Selbstverständlich!“
Viel Freiheit und Freizeit hatte ich in meinem bisherigen Arbeitsleben ja auch noch nicht. Außerdem besaß ich zu derzeit noch ein sehr kindliches Gemüt. Doch das sollte sich unter diesen Umständen schnell ändern.
Atemberaubendes Panorama: Der Wecker klingelte. Schnell sprang ich aus den Federn, zog die Vorhänge auf, öffnete das Fenster und schob die beiden Holzläden zur Seite, um sie an der Außenwand zu befestigten. Und? Starrte auf ein Bergpanorama, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Ich schloss meine Augen, um mich zu vergewissern, dass ich nicht träumte. Nachdem ich sie wieder öffnete, waren sie immer noch da, die schneebedeckten Gletscher, so schön und gewaltig, zum Greifen nah. Als stünden sie direkt am anderen Ufer des Zürichsees. Wie angewurzelt stand ich da. Bis mich die kleine Ragili mit ihrer hellen Stimme aus meinem Traum weckte.
Sie war mit ihrem Großvater auf dem Weg nach unten und plapperte lustig vor sich hin. Ihr Zimmer sowie das Zimmer ihres Großvaters lagen auf der anderen Seite des Flures. Schnell machte ich mich fertig und ging auch nach unten, um den Frühstückstisch zu decken. Geblümte französische Frühstücktassen, so groß wie Suppentassen, schmückten bereits den Frühstückstisch. Wir tranken Milchkaffee daraus. Frau Reinhard hatte bereits den Topf mit der Milch für den Milchkaffee auf den Herd gestellt. Es duftete nach frischem Filterkaffee. Der Spruch „Frühstücke wie ein König“ brauchte man mir nicht zweimal sagen. Dieses Schweizer Feinbrot mit der knusprigen Kruste und dem lockeren, weichen Innenleben, die selbstgemachte Marmelade sowie die Schweizer Käsesorten, die stets in Pfundstücken auf einem Tortenteller mitten auf dem Tisch standen und stückweise abgeschnitten und verzehrt wurden – ein Genuss. Keiner kam auf die Idee, Käse scheibchenweise zu kaufen. Während des Frühstücks erzählte ich von meinem traumhaften Ausblick.
„Das meinte ich damit, als ich Ihnen am ersten Tag sagte, Sie haben das Zimmer in diesem Haus mit dem schönsten Ausblick!“
Zweimal habe ich mich noch an diesem Morgen in mein Zimmer geschlichen. Mittags war dann dieser Weitblick, der so nah schien, wieder vorbei.
Nachdem, was ich im Eiscafé an Arbeit stemmen musste, war das hier geradezu lächerlich. Ständig versuchte ich Frau Reinhard zu überreden:
„Ich kann das Haus auch allein sauber halten, Sie sollten sich ruhig ein wenig schonen!“ Sie war schwanger. Nach und nach übernahm ich so die meiste Hausarbeit. Und das tat ich in diesem modernen Haushalt sehr gern. Alles war noch so neu, so pflegeleicht. Selbst die Wäsche wurde nicht wie im Eiscafé üblich, im Waschtopf auf dem Gasherd gekocht und hinterher auf dem Waschbrett mit den Händen geruffelt und gespült. Hier gab es eine der ersten vollautomatischen Waschmaschinen. Im Garten stand eine Wäschespinne, auf die ich die Wäsche hing. Einmal die Woche kam eine Frau, um die Wäsche zu bügeln. Nur an den Kochtopf, da ließ mich Frau Reinhard nicht ran. Zumindest am Anfang nicht. Mit Recht! War ich bei Tante Käthe die gute norddeutsche Hausmannskost mit viel Sahne und Butter gewöhnt, so lernte ich hier eine ganz andere Kochkunst kennen. Ein Gemisch aus italienischer, französischer sowie schweizdeutscher Küche. Hier wurde stets in aller Ruhe gearbeitet. Für mich eher eine Beschäftigung – wie ein Zeitvertreib – wofür ich auch noch sehr gutes Essen, eine Traumunterkunft sowie viel Geld bekam. Das hatte Folgen. Endlich nahm ich zu.
Innerhalb von acht Wochen neun Pfund. Hatte Tante Käthe verzweifelt versucht, all die Jahre neben der deftigen deutschen Hausmannkost mich mit Butter und Sahne, Eis und Kuchen vollzustopfen, um meine zarte Figur mit weiblichen Rundungen aufzupolstern, hier am Zürichsee konnte ich dabei zugucken, wie sich endlich auch bei mir die Weiblichkeit entwickelte. Selbst Tante Käthe staunte, als ich es ihr schrieb. Postwendend schrieb sie zurück: „Dass du in so kurzer Zeit schon neun Pfund zugenommen hast, ist ja allerhand. Ich glaube, wir kennen Dich gar nicht wieder, wenn du mal kommst. Ja, die Luftveränderung und die Mehlspeisen machen das schon. Na, etwas kannst du auch gebrauchen.“Für die kleine Ragili wurde das Essen stets mit Vollwertprodukten zubereitet, zum Beispiel wurde ihr Risotto mit Vollkornreis gekocht. Ich glaube, damit hat Frau Reinhard auch bei mir den Grundstein für meine spätere Vollwerternährung gelegt, wobei meine Kindheit auf dem Lande auch nicht unbeteiligt war.
Während des Mittagsessens erzählte Frau Reinhard:„Übrigens, Moni, kürzlich hat ein deutsches Mädchen bei der Familie Huber auch als Haustochter angefangen, vielleicht hätten Sie ja Lust, Kontakt mit ihr aufzunehmen.
Dann könnten Sie mit ihr gemeinsam in ihrer Freizeit etwas unternehmen, oder?“
‚Genau, das war es, was mir hier noch fehlte‘, schoss es mir durch den Kopf. Freudig überrascht antwortete ich:
„Danke für den Tipp, super Idee!“
„Soll ich dort mal für Sie anrufen?“
„Nein brauchen Sie nicht, vielen Dank, ich geh gleich in der Mittagspause selbst hin.“ Ich ließ mir die Adresse geben.
„Es ist das hübsche moderne Holzhaus hinter der katholischen Kirche, dort steht nur das eine Haus, das können Sie gar nicht verfehlen“, erklärte mir Frau Reinhard, bevor ich losging.
Bereits zehn Minuten später stand ich vor dem Haus und klingelte. Kurz darauf öffnete ein Mädchen in meinem Alter mit kurzem, glatten, blondem Haar, die Tür und begrüßte mich mit: „Gruezi!“ Ein wenig überrascht schaute sie mich mit ihren freundlichen grauen Augen fragend an. Ich fiel gleich mit der Tür ins Haus:
„Schönen Guten Tag, mein Name ist Moni May, ich komme aus Hamburg. Seit Kurzem arbeite ich bei der Familie Reinhard im Hummrigen am Ende des Dorfes. Meine Chefin erzählte mir heute, dass du auch aus Deutschland kommen würdest.“
„Ja, übrigens ich heiße Walburga, Walburga Namislo“, sie gab mir die Hand. „Da ich hier noch niemanden kenne, möchte ich dich fragen, ob wir uns nicht mal in unserer Freizeit treffen könnten.“
Erstaunt über so viel Mut, einfach zu klingeln – wie Walburga mir später einmal erzählte – wusste sie im ersten Moment gar nicht, was sie sagen sollte. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie spontan sagte:
„Ja, warum nicht?“
Mut, wie Walburga meinte, war es für mich nicht. Ich kam ja auch aus einer Großstadt, sie dagegen aus dem kleinen Städtchen Kreuztal bei Siegen.
Wir verabredeten uns. Leichten Fußes ging ich zurück nach Hause. Ab sofort bummelten wir in unserer Freizeit gemeinsam durch Zürich, kauften uns hübsche Sachen und gingen in der berühmten Bahnhofsstraße Kaffeetrinken.
Eine lebenslange innige Freundschaft begann hier in Herrliberg am Zürichsee.
In einer Kneipe für junge Leute lernten wir hiesige Jungs kennen. Sie nahmen uns in ihre Clique auf. Zweimal die Woche trafen wir uns abends dort. Wir tranken Cola, das Modegetränk, spielten Karten und redeten über Gott und die Welt. Es waren hauptsächlich Jungs in unserem Alter. Schnell waren wir eine Clique. Ich freundete mich mit Hans-Ulli an, der noch studierte. Wenn Walburga keine Zeit hatte, zog ich mit ihm los.
Es wurde brenzlig – für mich! Ständig ging ich abends noch auf einen Sprung ‘raus und versicherte meinen Herrschaften: „Bin rechtzeitig zurück.“ Jedoch die Zeit zerrann wie im Fluge. Dauernd war was los, dass ich mich gar nicht loslösen konnte. Die Uhr schlug zehn, dann halb elf. Nun wurde es allerhöchste Zeit, mich auf den Heimweg zu machen. Längst wusste ich, dass meine Herrschaften stets sehr früh ins Bett gingen. Noch lange vor zehn Uhr. Ich war die Einzige, die am Rande von Herrliberg wohnte. Doch Angst kannte ich schon aus meiner Kindheit nicht.
Kaum war ich auf der Hälfte der Treppenstufen angelangt, bemerkte ich, wie sich plötzlich ein schwarzer Schatten unterm Apfelbaum bewegte und mit Riesenschritten auf mich zukam. Es war ein männliches Wesen. Mehr konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen, es war bewölkt. So schnell ich konnte, nahm ich die letzten Stufen und steckte mit zittrigen Händen den Schlüssel ins Schloss, dreht ihn um, schob die Tür auf und schaffte es noch rechtzeitig hindurch-zuschlüpften. Bevor ich die Tür zumachen konnte, hatte er bereits seinen Fuß dazwischen gestellt. Mir rutschte das Herz in die Hose. Anstatt zu schreien legte ich meinen Finger auf meinen Mund und flüsterte ganz leise:
„Was willst du von mir?“ So leise, das auch er flüsterte:
„Du mich treffen, ich dich sehen jeden Tag, ich verliebt in dich!“
Nun wurde mir heiß und kalt. Was wollte der denn von mir. Den kannte ich ja gar nicht. Schien italienischer Fremdarbeiter zu sein.
Schnell besann ich mich auch ja das Richtige zu sagen, denn ich musste ihn, bevor meine Herrschaften was merkten, so schnell wie möglich loswerden und flüsterte: „Wann?“ „Morgen Abend.“ „Morgen Abend kann ich nicht!“ „Dann morgen Mittag, ich dich gesehen, du oft gehen mittags spazieren.“ Auch das noch.
„In Ordnung! Morgen Mittag um zwei Uhr beim Wanderweg!“ „Du ganz bestimmt kommen?“, wollte er sich noch einmal vergewissern. „Ja, ja, ich komme.“ Er nahm seinen Fuß aus der Tür. Ich atmete auf. Ganz leise schloss ich die Tür. Alles war still im Haus, keiner schien etwas gemerkt zu haben.
Natürlich ging ich am nächsten Tag nicht zur Verabredung, sondern erzählte es beim nächsten Treffen der Clique. Ab sofort brachte mich dann stets einer von den Jungs nach Hause. Gesehen habe ich den komischen Typen nie wieder. Aber ich kannte ihn ja auch nicht. War ja dunkel.
In Zürich war ein ganz besonderer Ball, zu dem die Clique Walburga und mich unbedingt mithaben wollten.
„Schade, da kann ich leider nicht mitkommen“, sagte ich mit enttäuschter Stimme zu den Jungs, „ ich muss doch um 22 Uhr zu Hause sein.“
Sie überlegten, wie sie mich mitnehmen könnten. Hans-Ulli hatte einen ganz besonderen Einfall, er schlug vor:„Moni, sag deinen Herrschaften, die sollen meine Mutter anrufen, die wird deinen Leuten dann erklären, dass wir anständige Jungs sind, und alle auf dich aufpassen! Außerdem wird die Tanzveranstaltung vom hiesigen Wanderverein veranstaltet.“
„Super Idee, das mach ich.“ Tatsächlich Frau Reinhard rief bei Frau Tobler an und erkundigte sich genau nach dem Verein, dem die Clique angehörte. Ich durfte mit, ebenso Walburga, denn ihre Chefin kannte die jungen Leute, sie wohnten alle mitten im Dorf. Ausgerechnet bekam ich noch am selben Tag, als wir los wollten, Halsschmerzen. Ich versuchte sie einfach zu ignorieren. Als ich es im Zug Hans-Ulli erzählte, sagte er:
„Weißt du was, du musst gleich, wenn wir da sind, mit Cognac gurgeln, wirst sehen, das hilft.“ So tanzte ich nicht nur sondern gurgelte mich durch die Nacht. Gegen zwei Uhr fiel ich todmüde und ganz schön beschwipst mit Schüttelfrost und Fieber ins Bett, drehte noch vorher die Heizung voll auf und schlief sofort ein.
Plötzlich stand Walburga im Zimmer und weckte mich mit den Worten:
„Puh, was für eine schreckliche Luft, es ist hier ja heiß wie im Backofen. Was ist los mit dir?“ Sie zog die Vorhänge zurück und öffnete das Fenster.
„Was machst du noch im Bett? Wir wollen doch nach Männedorf ins Kino gehen?“ Verschlafen schaute ich sie an. „Wie spät ist es denn?“ „Gleich vier Uhr nachmittags, die Jungs warten schon unten.“ In Sekundenschnelle sprang ich aus dem Bett. Halsschmerzen, Fieber alles war verschwunden. Ich war gesund. Nur in meinem Kopf drehte es sich noch ein wenig, hab wohl doch zu oft gegurgelt. Schnell machte ich mich fertig. Entlang des Wanderweges auf der Herrliberg Hügelkette wanderten wir ins vier Kilometer entfernte Männedorf.
Danach bremste Herr Reinhard meinen Tatendrang. Er meinte, wieder mehr auf mich aufpassen zu müssen.
Weihnachten stand vor der Tür. Frau Reinhard machte sich viel Arbeit mit den Vorbereitungen, alles sollte möglichst perfekt sein. Ich half ihr, wo ich nur konnte. Denn inzwischen war sie hochschwanger. Jederzeit konnte das Kind kommen. Meiner Meinung nach sollte sie jetzt endlich kürzer treten, doch in diesem Haushalt war und blieb alles sehr konservativ sowie straff durchorganisiert. Dafür hatten wir ein wundervolles Weihnachtsfest. Heiligabend saßen wir im Halbkreis unterm Tannenbaum. Nach und nach wurden die Geschenke ausgepackt, nicht wie bei uns, alle wild durcheinander. Nein, es ging reihum. Auch ich bekam schöne Geschenke, von Herrn Reinhard selbst einen wertvollen Waterman Füllfederhalter mit goldener Feder. Nur an Fest- und Feiertagen wurde im großen Esszimmer festlich eingedeckt und gespeist. Ansonsten aßen wir in der gemütlichen Essecke in der breiten Wohndiele zwischen Küche und Wohnzimmer.
Übrigens, sonntags wurde nie gekocht. Um elf Uhr gab es ein großes Frühstück mit Speck, Eiern und allem Drum und Dran, nachmittags Kaffee und Kuchen und abends dann das normale Abendbrot. War das entspannt! Auch wenn Frau Reinhard viel Arbeit hatte, aber sie machte es mit so viel Liebe und Können. Genau wie bei Tante Käthe war das Essen stets ein Genuss.
Die selbstgemachte Maronentorte war beim Weihnachtskaffee der Höhepunkt. Nie wieder habe ich eine derartig leckere Maronentorte gegessen. Selbst die berühmte Maronentorte im Angelina Café in Paris, die ich später mal probierte, hielt dem Vergleich nicht stand. Dafür standen wir auch stundenlang in der Küche, nur für die Torte.