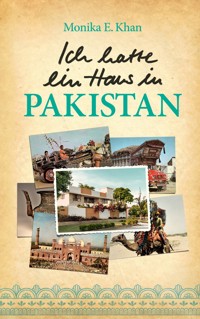Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In „Die Mooskate am Jungfernstieg“ beschreibt Monika E. Khan authentisch die bewegten und bewegenden Lebensgeschichten von 1938-1953 ihrer durch den zweiten Weltkrieg geprägten Generation in Ihrem Heimatdorf Kollow . Dabei gelingt es ihr, trotz der zeitgeschichtlichen Härte und zahlreich durchlebter sowie erlittener persönlicher Schicksale den Blick für die Besonderheiten Ihrer Mitmenschen und deren Lebensumstände in liebenswürdiger und unterhaltsamer Weise erzählerisch nachzuzeichnen. Somit hat Monika E. Khan aus der Perspektive unmittelbar betroffener Zeitzeugen aus dem Herzogtum Lauenburg eine Autobiografie der besonderen Art geschrieben, die Geschichte durch Lebensgeschichten anschaulich, berührend und menschlich erlebbar macht - auch über die Regionalgrenzen ihrer norddeutschen Heimat hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In geselliger Runde im Dorfkrug „Mückenbach“ gab Klaus Döntjes aus seiner Kindheit in Kollow zum Besten. Ein schwedischer Gast amüsierte sich köstlich und wollte wissen:
„Ja, wo gibt es denn diese seltsamen Leute?“
„Diese seltenen Exemplare gibt es nicht mehr – sie treten nicht mehr auf.“
(Zitat: Klaus Kottler)
Schade!!!
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Franz und Franziska
Ein Bauernhaus in Kleinformat
In den Wirren des Krieges
Endlich Frieden
Die Beschaffungskünstler
Unsere Schusterwerkstatt
Pfiffige Selbstversorger
Dorftratsch
Ewiger Trotzkopf
Musik liegt in der Luft
Plagegeister und Hundeterror
Lausbubengeschichten
Kinderarbeit und Prügelstrafe
Der Donnerbalken
Ab in die Ferien
Halbnackte Überraschungen
Unfassbare Geschehnisse
Swattenbeek (Schwarzenbek)
Lust auf Schule
Karpfenteich - Schicksalsteich
Das Bad auf der Tenne
Polterabend
Lilla und Emil
Karnickel auf der Flucht
Abschied vom Vater
Konfirmation
Ewald taucht auf
Einmalige Kollower
Abschied von Kollow
Ein Dorf im Wandel der Zeit
Bildnachweis
Leseprobe
Vorwort
Bereits seit vielen Jahren spielte ich mit dem Gedanken, ein Buch über meine erlebnisreiche Kindheit im schönen Dorf Kollow zu schreiben.
Doch nur allein der Gedanke schafft ja noch kein Buch. Ein Zufall kam mir zu Hilfe: Auf der Internetseite Kollow.de suchte Heike-Maria Trabert, die den Arbeitskreis der Chronik „Kollow, unser Dorf“ leitete, noch ehemalige Kollower, die bereit waren, mit ihren eigenen Erlebnissen und Geschichten aus ihrer Kollower Zeit, die Chronik zu ergänzen. Mit viel Freude habe ich mich den Chronisten angeschlossen.
Nachdem die Chronik „Kollow unser Dorf“ im Viebranz-Verlag im August 2013 erschienen war, machte ich mich an die Arbeit, um mein eigenes Buch über Kollow zu schreiben.
Was bin ich nur all den Binnen- und Buten-Kollowern dankbar, dass sie mir ihre eigenen großen und kleinen Geschichten erzählten und mir stets mit Rat und Tat zur Seite standen. Zwei von ihnen, Herbert Schnackenbeck und Hans-Wilhelm Jenß weilen inzwischen nicht mehr unter uns. Im Nachhinein noch vielen Dank!
Dieses Buch habe ich auch als Andenken an meine verstorbene Familie geschrieben: An meine Eltern, Franz und Franziska Meyer sowie an meine Brüder, Ewald und Nauke, Butz und Lilla sowie Rolfi. Bevor ich mein Manuskript zur weiteren Bearbeitung weggeben wollte, lernte ich den Karikaturisten Günther Bema kennen. In letzter Minute zeichnete er mir noch passende Bilder für so manche skurrile und lustige Geschichte.
Ich wünsche allen Lesern viel Spaß beim Lesen! Tauchen Sie ein in die Welt des vergangenen Jahrhunderts und erleben Sie das quirlige, witzige, aber auch so manches Mal tragische Leben zwischen Krieg und Frieden – 1938 bis 1953 – in dem kleinen hübschen Dorf Kollow.
Franz und Franziska
Ziemlich dramatisch begann die Geschichte meiner Mutter!
Wer ihr leiblicher Vater war, wusste niemand außer meiner Oma, ihre Mutter.
Dieses Geheimnis nahm meine Oma, als sie 1918 das Zeitliche gesegnet hatte, mit ins Grab. Obwohl, ein gesegnetes Ende hatte sie wahrscheinlich nicht bekommen, denn sie hatte sich das Leben genommen – nach der christlichen Lehre war es eine große Sünde. Sie hatte sich einfach erhängt, das Leiden hatte für sie ein Ende.
Viel weiß ich nicht über meine Oma, denn meine Mutter hat nicht gern über diese Zeit gesprochen. Überhaupt wurde in meiner Verwandtschaft mütterlicherseits nur ganz selten über meine Oma geredet. Meine Großtante Henny, die Schwester meiner Oma, hat mir später, als ich erwachsen war, erzählt, dass meine Oma sehr unglücklich mit ihrer Lebenssituation war. Sie wollte stets etwas Besseres sein. Seit frühester Jugend träumte sie von einem Edelmann, der sie aus ihrer Armut befreien sollte. Wahrscheinlich hatte sie auch so einen Typen kennen gelernt. Doch vom Edelmann konnte nicht die Rede sein. Nachdem sie von ihm schwanger wurde, ließ dieser begüterte Herr sie einfach sitzen. Eine unvorstellbare Schande für die damalige Zeit.
Neunzehnhundertneun erblickte Franziska Bertha Christine Gewe, meine Mutter, im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst, zweite Reihe Außenalster, das Licht der Welt. Wenn auch unehelich geboren, so doch wenigstens in einem vornehmen Stadtteil.
Jedenfalls steht die Adresse in der Geburtsurkunde meiner Mutter. Dazu passen die Fotos aus der damaligen Zeit, auf denen meine Oma und meine Mutter abgebildet sind.
Wunderschön sah meine Mutter als Achtjährige in ihrem weißen Kleid aus, das mit einer Spitzenbordüre am Saum und den Ärmeln eingefasst war. Passend dazu trug sie weiße Schuhe und weiße Söckchen. Ihre Naturlocken, die ihr bis auf die Schulter fielen, wurden mit einer Schleife gebändigt. Lässig hielt sie in ihrer linken Hand einen mit buntem Blumenbukett verzierten weißen Strohhut. Auch meine Oma trug ein elegantes, bodenlanges weißes Kostüm und den passenden Hut dazu, als sei sie die Unschuld in Person. Doch ein wenig schwermütig schaute sie schon drein.
Als meine Mutter zehn Jahre alt war, hatte meine Oma endlich einen Mann fürs Leben gefunden. Zumindest dachten die lieben Verwandten es. Er war zwar kein Edelmann, aber ein edler Mensch, denn er adoptierte meine Mutter vom Fleck weg, und so hieß sie fortan Schmüser mit Nachnamen. Zwar war er ein rechtschaffener Vermessungstechniker mit gutem Charakter, aber eben kein Edelmann aus vornehmem Hause. Das Glück hätte nun perfekt sein können. Sie waren doch jetzt eine richtige Familie. Glücklich fühlte sich meine Oma trotzdem nicht. Leider, denn kurze Zeit später machte meine Oma Schluss mit ihrem Leben.
Oder hatte meine Oma ihr Ableben von langer Hand geplant? Wollte sie lediglich einen Versorger für ihre uneheliche Tochter finden? War danach ihr persönliches Leiden zu Ende? Hatte sie womöglich bis zu ihrem selbstgewählten Tod den Vater ihres Kindes unsterblich geliebt?
Kurze Zeit später heiratete Opa Schmüser, der Adoptivvater meiner Mutter, wieder. Mit seiner neuen Frau bekam er zwei eigene Kinder. Künftig musste Mutter sich neben ihrer Schule um ihre Stiefgeschwister kümmern. Eine harte Zeit für Mutter. Als Franziska dann ihre Schule beendet hatte, arbeitete sie im Geschäftshaushalt ihrer Tante Henny, die in der Osterbekstraße einen Kolonialwarenladen besaß. Das war alles andere als ein Zuckerschlecken: schuften für wenig Geld, wahrscheinlich wie alle in der damaligen Zeit.
Doch dann wendete sich das Blatt für Franziska schlagartig zum Guten.
Mit ihrer Freundin Martha machte sie sich auf den Weg, um am sommerlichen Dorffest in Kasseburg teilzunehmen. Bereits beim ersten Atemzug auf dem Lande fühlte sie sich befreit und pudelwohl.
Kurzum entschied sie sich fürs Landleben. Schnell fand sie bei einer aufgeschlossenen Bäuerin eine Anstellung als Köcksch (Magd beim Bauern). Vom Äußeren her war Franziska eine moderne Großstadtfrau und passte so gar nicht in die ländliche Gegend. Ihr dickes Lockenhaar hatte sie sich zum Bubikopf schneiden lassen. Auch ihre Kleider waren nach dem letzten Schrei gefertigt. Franziska ließ so leicht keine Suppe anbrennen und verdrehte fortan den jungen Männern im Dorf den Kopf. Bei den Müttern und Bäuerinnen des Dorfes läuteten die Alarmglocken. Kurzerhand verboten sie ihren Söhnen den Umgang mit Franziska.
Ja, manche Bäuerin soll sogar ihren Sohn sofort ‘reingerufen haben, wenn sie Franziska auf der Dorfstraße erblickte. Doch Franz Johann Heinrich Meyer, der jüngste Sohn eines Bauern, verliebte sich in Franziska und war mutig genug, sich mit ihr einzulassen. Sie wurde schwanger. Wenig später heiratete Franz seine Franziska.
Ewald, mein ältester Bruder, wurde geboren. Nach vier Jahren ging es dann Schlag auf Schlag, wie die Orgelpfeifen, jedes Jahr ein Kind. Es folgte der Walter, der Butz genannt wurde. Wieder ein Jahr später wurde Erich geboren, den Vater Nauke nannte. Genau ein Jahr und einen Monat später kam der Gerhard, der den schönen Spitznamen Lilla vom Vater bekam. Es war eine Marotte meines Vaters, seinen Söhnen nach der Taufe ungewöhnliche Namen zu verpassen. Danach zogen meine Eltern weg aus Kasseburg.
Ein Bauernhaus in Kleinformat
Die Mooskate – Unser neues Zuhause im schönen Dorf Kollow.
Viele Jahre hatte die Mooskate am Jungfernstieg bereits auf dem Buckel, als meine Eltern im Sommer 1937 dort einzogen.
Nicht der Jungfernstieg zwischen den vornehmen Geschäften und der Binnenalster in Hamburg, nein, unser Jungfernstieg lag zwischen Bauernhäusern, Koppeln, Viehställen und Misthaufen.
Aus grauer Vorzeit besaß unsere Küche noch die Abzugsvorrichtung unter der die damaligen Bewohner ihr Essen über dem offenen Feuer gekocht haben. Nur die breite Öffnung nach oben war bereits zugemauert. Stattdessen stand nun unsere Wasserbank mit den beiden Wassereimern darunter. Unser ganzer Stolz in der Küche war der Feuerherd, dessen Grundgerüst aus Ziegelsteinen gemauert und mit Eisenblech ummantelt war. Blankgeputzte Messingbeschläge an den Türen und eine Messingstange, die vorn vor der Herdplatte befestigt war, schmückten den Kochherd.
Über dem Feuer hatte der Herd eine große, runde Öffnung, die man mit angepassten Ringen jederzeit verkleinern konnte, je nachdem, welche Kochtopfgröße man benutzen wollte. Wenn Feuer im Herd war, wurde die gesamte Herdplatte heiß, so dass das Essen auch in mehreren Töpfen gleichzeitig weiter garte.
Die Mooskate bot nicht nur ein Zuhause für meine Familie sondern auch für die Familie meiner Freundin Gisela Gaubatz sowie für unser liebes Vieh.
Unterm vorderen Giebel lag die große Diele, darüber der Heuboden, und links und rechts der Diele waren die Viehställe. Links hatten Gaubatz ihren Viehstall und rechts wir Meyers. Unterm hinteren Giebel befanden sich die beiden Wohnungen mit je zwei Zimmern und der Wohnküche.
Um sich ihr Glück zu vervollkommnen, wünschten sich Franz und Franziska ein Mädchen und so wurde meine Mutter abermals schwanger.
Kaum hatten meine Eltern sich neu eingerichtet, erschien ich in einer eiskalten Winternacht im Jahre 1938 in dieser verwunschenen uralten Mooskate auf der Bildfläche.
Wer kann schon von sich behaupten, in einer Mooskate – einem Bauernhaus in Kleinformat – geboren zu sein.
In Kollow gab es viele Bauernhäuser, aber nur eine einzige Mooskate. Heute trifft man soetwas nur noch in Museumsdörfern. Noch während der Geburt bescherte ich meiner Mutter Unannehmlichkeiten.
Mit einer schweren Thrombose musste sie mitten in der Nacht bei klirrender Kälte ins Lauenburger Krankenhaus eingewiesen werden, natürlich mit mir im Schlepptau.
Benannt wurde ich nach Mutters Adoptivschwester ‚Erika‘! Eine dunkle Lockenpracht schmückte mein Haupt. Nicht nur Mutters Bettnachbarin schwärmte unentwegt von mir, auch die Krankenschwestern sollen ganz verrückt nach mir gewesen sein. Aus lauter Angst, ich könne mit einem anderen Baby vertauscht werden, band Mutter mir vorsorglich eine rote Schleife ins Haar.
Schnell wurde Mama wieder gesund und konnte freudestrahlend mit mir im Arm nach Hause. Schließlich warteten vier weitere Geschwister auf uns.
In den Wirren des Krieges
Kaum war ich zehn Monate alt, brach der zweite Weltkrieg aus.
Kurze Zeit später hieß es für meinen Vater Abschied nehmen von seiner geliebten Familie. Er hatte Glück und kam zunächst nach Wismar, um dort in einer Wehrmachtswerkstätte die Schuhe der Soldaten in Ordnung zu bringen.
Mutter musste allein zusehen, wie Millionen andere Mütter auch, wie sie mit ihren Kindern über die Runden kam.
Aber wenigstens mussten wir weder flüchten, noch wurden wir ausgebombt. Und was zu Essen – egal was – hatten wir auch.
Solange Vater in Wismar stationiert war, kam er öfter mal am Wochenende auf Heimatbesuch nach Hause. Auf einem dieser Besuche verpasste Vater mir den Namen „Monika“. Wahrscheinlich hatte ihn das neue Marschlied „Lebe wohl, du kleine Monika“ inspiriert.
Meinen Namen Erika, den Mama mir zu Ehren ihrer Stiefschwester gegeben hatte, mochte Vater nicht, weil er meine Tante Erika nicht mochte.
„Ab heute nenne ich unser kleines Mädel Monika! Basta!“, sagte Franz beim Abschied zu Franziska.
Zukünftig nannten mich nicht nur meine Familie, sondern das ganze Dorf: Moni. Erika stand nur noch auf dem Papier.
Moni brüllt: War ich ein Dickkopf! Ständig nervte ich meine Mutter. Von klein auf nahm Mutter mich überall mit hin, ich liebte es mit zu marschieren, egal, wie weit und wohin. Auch wenn meine kleinen Beinchen schon weh taten und mir die Füße brannten, trotzdem lief ich tapfer weiter. Die große weite Welt lockte mich schon als ganz kleines Mädchen.
Wollte oder konnte Mutter mich mal nicht mitnehmen, terrorisierte ich meine Umwelt.
Weil ich noch zu klein war, um allein zu Hause zu bleiben, brachte Mama mich zu ihrer besten Freundin, Tante Gertrud, zwei Häuser weiter. Kaum war Mutter weg, brüllte ich ununterbrochen! Sturzbäche von Tränen liefen mir übers Gesicht. Mit meinen schmutzigen Händen wischte ich sie zwischendurch immer wieder fort.
„Wie siehst du denn aus? Du bist ja völlig verschmiert, so nehme ich dich nicht mit ins Haus!“, meinte Tante Gertrud forsch. Sie hatte keine Kinder, noch nicht. Sie war den ganzen Tag zu Hause, alles blitzte und blinkte bei ihr.
„Warte, bleib hier, ich hol nur schnell die Waschschüssel.“
Sie verschwand im Haus und ich brüllte draußen im Garten weiter. Bewaffnet mit einer Waschschüssel, Seife und einem Waschlappen tauchte sie wenig später wieder auf. Sie ging zur Wasserpumpe, die in ihrem Garten stand, nahm den eisernen Hebel und pumpte Wasser in die Schüssel.
„Komm Moni, jetzt machen wir ein hübsches, sauberes Mädchen aus dir.“ Sie stellte die Schüssel auf die Bank, die neben der Eingangstür stand, nahm den Waschlappen und schrubbte mich, als wolle sie mir die Haut entfernen. Ich brüllte noch mehr. Zum Schluss wrang sie den Waschlappen aus und trocknete mich damit ab. Es nützte nichts, ich brüllte weiter.
„Hör jetzt endlich auf zu brüllen, was sollen bloß die Nachbarn denken? Komm wir gehen ins Haus!“ Sie zerrte mich ins Haus.
„Soll ich dir ein leckeres Brot schmieren?“, versuchte sie mich zu beruhigen. Statt einer Antwort weinte ich weiter. Krampfhaft überlegte sie, was sie nur mit mir machen könne, damit ich mit diesem entsetzlichen Krach aufhörte.
Endlich kam Mama zurück, schlagartig hörte ich auf zu schreien! Wütend empfing Tante Gertrud Mama mit den Worten:
„Auf dein verzogenes Gör passe ich garantiert nicht wieder auf!“ Es war nicht Mama, die mir fehlte. Es war, weil ich nicht mitdurfte!
Liebesbrief aus Wismar
Mein Liebling!
Muss mich mal wieder zusammenreißen und Dir ein paar Zeilen schreiben. Komme gerade von der Arbeit. Habe Ewalds Stiefel jetzt ziemlich fertig. Es wird aber auch Zeit, denn die Tage laufen jetzt wie doll. Heute war ich nochmal in der Stadt, um eine Kleinigkeit für Dich zu kaufen, aber leider nicht zu machen, mein Liebling.
Du musst dieses Jahr mit meiner Liebe vorlieb nehmen. Es tut mir furchtbar leid, denn ich hätte Dir sehr gerne eine Freude bereitet, aber Sachen, die ich wohl kaufen möchte sind zu teuer und irgend etwas anderes kriegt man ohne Kleiderkarte oder Stammkarte hier nicht. Dir wird es wohl genau so mit mir ergangen sein und denn ist ja auch alles in Ordnung. Ich glaube das Beste ist, wir freuen uns mit den Kleinen und haben uns recht, recht, doll lieb, denn genügt es auch. So, ich schreibe es Dir, damit Du Dich darauf einstellen kannst und keine zu große Enttäuschung erlebst. Denn, das ist doch nicht gut zu Weihnachten. Ich werde mir Mühe geben, was mir nicht schwerfällt, um Dir den Heiligenabend so angenehm wie nur irgend möglich zu machen.
Das Beste ist wohl, wenn Ewald mich mit dem Fahrrad abholt. Der Zug ist um vier Uhr in Schwarzenbek. Wenn Du zu Schult gehst, bring bitte vier bis fünf Flaschen Bier mit und sage ihm, er dürfte mich nicht vergessen, ich käme bei ihm vorbei und hätte es fertig. Weiter brauchst du ihm nichts zu sagen. Du brauchst nun aber nicht gleich Angst zu haben, dass ich mich da lange aufhalte. Ich komme sofort nach Hause, er hat mir nämlich eine Flasche Weinbrand versprochen. Allerdings für Gegenleistung, die ich auch fertig habe, aber Du darfst das nicht erzählen. Heute haben wir Geld gekriegt, 10 Mark. Ich hoffe das ich Montag die Hose für Ewald kriege und dann noch die Fahrkarte, dann ist es wieder aus im Dom. Also zerrinnt das Geld hier genau so wie bei Dir. So mein Liebling, das wär alles für heute. Hoffentlich hat dieser Brief Dich nicht zu sehr enttäuscht. Aber ändern kann ich es auch nicht, wenn Deine Liebe groß genug ist, kann es keine Enttäuschung geben. Die besten Grüße und tausend Küsse, mündlich kriegst Du zweitausend Küsse.
Dein Franz! Jetzt wird geschlafen und von Dir geträumt.
(Feldpostbrief vom 20.12.41 aus Wismar)
Schwesterchen Gerda: Mutter wurde schwanger, und wir bekamen ein Schwesterchen, Gerda mit Namen. Nur leider war es Gerda nicht vergönnt, auf dieser schönen Erde zu bleiben. Der Keuchhusten grassierte in Kollow. Auch ich hatte mich angesteckt. Kurze Zeit später bekam auch Gerda Keuchhusten. Sie hatte keine Chance, der Husten war zu viel für ihren kleinen Körper. Mitten in einer Bombennacht auf Hamburg, wir saßen in unserem feuchten kaltem Erdreichbunker, da verabschiedete sie sich für immer von uns.
Männer kamen im schwarzen Anzug und trugen den kleinen Sarg zur Straße. Vorsichtig schoben sie den Sarg in einen schwarzen verschnörkelten, kutschenähnlichen Leichenwagen, an dessen hohem Gestell schwarze Vorhänge hingen, die mit einer schweren Kordel zusammengehalten wurden. Ein Mann setzte sich vorn auf den Kutschbock, nahm die Zügel in die Hand und trieb die beiden Pferde zu einer langsamen Gangart an. Die Trauergesellschaft folgte der Kutsche. Ich hatte mich in der Diele hinter dem Tor halbwegs versteckt. Mein Herz krampfte sich zusammen. So richtig verstand ich nicht, was da ablief. Der Leichenwagen und die Trauergesellschaft wirkten sehr düster auf mich.
Noch fühlten sich die Kollower, dreißig Kilometer östlich von Hamburg gelegen, ziemlich sicher. Doch als in den nächsten Jahren, die Bombenangriffe auch auf andere Stadtteile Hamburgs ausgedehnt wurden, buddelte Vater gemeinsam mit Ewald hinten in unserem Garten zwischen den Büschen der roten und schwarzen Johannisbeeren eine tiefe längliche Kuhle. Danach zimmerten sie zwei Holzbänke. Mit Stroh bedeckten sie den Boden der Kuhle, damit sie nicht so fußkalt war, stellten die Holzbänke an die Längsseiten der Erdwände, und fertig war unser Bunker. Wenn es dann nachts mit den Bombenangriffen auf Hamburg losging, krabbelten wir mit Decken ausgerüstet ins feuchte Erdreich.
Verlaufen in Wismar: Mama wollte Papa in Wismar besuchen, ich durfte mit. Während Papa am Tage in der Wehrmachts-Schusterwerkstatt die Soldatenstiefel reparierte, ging Mama mit mir in Wismar spazieren. Plötzlich blieb sie mitten auf einem Bürgersteig stehen, beugte sich zu mir runter und sagte:
„Moni, du musst jetzt für einen Moment ganz brav hier stehen bleiben. Ich gehe nur mal schnell da drüben ins Haus, eine Tante besuchen. Leider kann ich dich da nicht mitnehmen.“
„Ich will aber mit!“
„Ich verspreche dir, es geht ganz schnell. Ruck, zuck bin ich wieder da! Du bleibst solange hier stehen, hörst du? Nicht weglaufen! Dort in den Eingang gehe ich rein.“
Sie zeigte mit dem Finger auf einen der Hauseingänge, die sich in dem Wohnblock entlang der Straße befanden.
„Mama, ich will aber nicht allein hier stehen bleiben!“
„Kind, es geht wirklich nicht, ich habe etwas Wichtiges mit einer Frau zu besprechen, die mag keine Kinder, bitte sei ganz lieb. Hast du mich verstanden? Und, du darfst mit niemanden mitgehen, versprichst du mir das?“
„Ja“, sagte ich unsicher. Aber nur, weil meine Mutter sagte, dass die Frau keine Kinder mochte.
Sie verschwand und ließ mich doch tatsächlich allein in einer fremden Stadt auf der Straße stehen.
Es dauerte und dauerte, es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Mama kam und kam nicht. Kurzentschlossen machte ich mich auf den Weg, um sie zu suchen. Ein Eingang sah aus wie der andere. Krampfhaft überlegte ich, in welchen Eingang sie wohl ‘reingegangen ist? Verzweifelt wartete ich vor irgendeinem Hauseingang. Aber sie kam nicht. Ich ging zum nächsten, sie kam immer noch nicht. Langsamen Schrittes ging ich weiter und weiter, bis ich mich im Häusermeer von Wismar verlor. Irgendwann kamen keine Häuser mehr, ich hatte mich verlaufen. Endlos zog sich eine hohe Hecke an der Straße entlang. An einer Stelle konnte ich hindurchschauen. Es war ein Friedhof. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Angst kroch in mir hoch. Tränen liefen mir übers Gesicht. Da tauchte plötzlich eine Frau mit einem kleinen Mädchen auf. Verdutzt blieb sie stehen:
„Was machst du denn hier allein auf weiter Flur, warum weinst du?“
„Ich suche meine Mutter!“, sagte ich schluchzend
„Wo soll sie denn sein?“
„Weiß ich nicht, sie ist in ein Haus gegangen.“
Ich erzählte ihr, was Mama mir, bevor sie gegangen ist, gesagt hat.
Unschlüssig wartete sie noch eine Weile, wahrscheinlich überlegte sie, was sie mit mir machen sollte. Dann fragte sie mich:
„Wie heißt du denn?“
„Moni.“
„Und weiter, wie heißt du mit Familiennamen?“
„Meyer!“
„Weiß du was, Moni, wir gehen jetzt zur Polizei, die suchen dann deine Mutter.“
Annegret, ihre Tochter, fasste ihre Mutter links und mich rechts an der Hand. Gemeinsam zogen wir los. Auf der Wache überraschte Annegrets Mutter die Polizei mit folgendem Vorschlag:
„Herr Wachmeister, was halten sie davon, wenn ich Moni in der Zwischenzeit mit zu mir nach Hause nehme. Wenn ihre Mutter dann hier auftaucht, kann sie das Kind bei mir abholen.“
Der Polizeihauptmeister nickte bejahend.
Annegret und ich tanzten vor Freude.
So eine schöne Wohnung hatte ich noch nie gesehen. Dicke bunte Teppiche lagen auf dem blank gewienerten Holzfußboden. Ich wagte gar nicht aufzutreten. Annegret, war genauso alt wie ich, vier Jahre. „Komm“, sagte sie nur und nahm mich wieder an die Hand. Über einen langen Flur führte sie mich in ihr Kinderzimmer: ein eigenes Zimmer, für sie ganz alleine, voller bunter Spielsachen! Es verschlug mir die Sprache. „Moni, was wollen wir spielen?“, unterbrach sie meine überschäumenden Gedanken. Sie schien sich genau so zu freuen wie ich. Sie war ein Einzelkind. In einer Ecke entdeckte ich einen Spielzeugladen. Ein wenig schüchtern sagte ich: „Vielleicht Kaufmannsladen?“
„Gut, aber warte, ich will meine Mama noch was fragen.“ Sie verschwand im langen endlosen Flur. Laut hörte ich sie fragen:
„Mama, darf Moni heute Nacht bei mir schlafen, wenn ihre Mutter heute nicht kommt?“ „Ja, natürlich!“, antwortete sie.
Ich wünschte mir, meine Mutter würde nicht auftauchen: heute nicht, und die nächsten Tage auch noch nicht.
Annegret reichte mir gerade ein Paket Waschpulver rüber, da klingelte es. Schade, Mutter stand vor der Tür.
Ich musste mit, ob ich wollte oder nicht.
„Moni, was meint du, was Papa sagt, wenn er dich heute Abend nicht sieht? Morgen fahren wir doch wieder nach Hause!“
Wahrscheinlich hätte sie dann Vater beichten müssen, warum sie mich allein auf der Straße gelassen hatte.
Ein Himmel voll riesengroßer Ballons schwebte über Wismar, als wir am nächsten Tag auf dem Weg zum Bahnhof waren. Mal wieder erstaunt blieb ich stehen. Doch Mama hatte es auf einmal furchtbar eilig, sie nahm meine Hand und zerrte mich hinter sich her, um schnell zum Bahnhof zu kommen.
„Komm, bloß raus aus Wismar!“, murmelte sie vor sich hin.
(Unter der “Operation Outward“ hatten die Briten zwischen 1942 bis 1945 tausende Ballonbomben von der Britischen Ostküste auf den Weg nach Deutschland geschickt. Sie sollten die Aktivitäten der Deutschen Luftwaffe behindern. Quelle: Wikipedia, Ballonbombe)
Feuerhölle Hamburg: Bereits im Mai 1940 warfen Kampfflugzeuge der Royal Air Force 400 Brand- und 80 Sprengbomben über Hamburgs Süden ab. Häuser gingen in Flammen auf. 34 Menschen starben, 72 wurden verletzt. Das war erst der Anfang. „Hamburg wird zur Frontstadt“, schreibt Hans Brunswig, in seinem Standardwerk „Feuersturm über Hamburg“.
Lautes Gepolter im Treppenhaus ließ die Bewohner des letzten Hauses in der Süderstraße in Hamburg jedes Mal hochschrecken. Es waren Soldaten, die sogenannten Späher, die dieses markerschütternde Geräusch von sich gaben, wenn sie die Stufen des Treppenhauses zum Dach hinaufstiefelten. Genauer gesagt: ihre Soldatenstiefel, deren Sohlen mit Nägeln bestückt waren, verursachten dieses angsteinflößende Geräusch. Oben auf dem Dach war die Spähstation aufgebaut. Sie stand im Funkkontakt mit der Flak-Abwehr am Aschberg und der Vierlinksflak, die oben auf dem Dach des fünften Stockwerks eines Miethauses in der Eiffestraße stationiert war. In diesem Haus befand sich eine Bäckerei. Beide Flak-Stationen waren nur ein paar Meter von der Spähstation entfernt.
Auf der anderen Seite war es ja auch ein Vorteil für die Familien in diesem Hauseingang, die Späher hier zu haben.
Meistens warnten sie die Hausbewohner schon, bevor die Sirenen heulten mit den Worten:
„Seht zu, dass ihr in den Luftschutzkeller kommt!“ oder:
„Diesmal wird es für euch nicht so schlimm, die Bomber fliegen eine andere Route!“
Mit der Zeit wurden die Bombenanschläge nicht nur heftiger, sondern kamen auch in immer kürzeren Abständen. Einmal riss eine Bombe im gegenüberliegenden Haus die gesamte hintere Hauswand fort. Verdutzt schauten die Bewohner auf den Kanal, der unten entlangfloss. Passiert war ihnen gottlob nichts.
Als mehrere Bomben, die tiefe Krater hinterließen, zwischen den Häusern direkt vor ihren Augen einschlugen, entschied Gertrud Marbs, ihre beiden kleineren Kinder, die dreijährige Elfriede und den neunjährigen Arnold, zu ihren Schwiegereltern auf deren Bauernhof nach Wangelau zu bringen. Es war abzusehen, wann die nächsten Bomben ihr Haus treffen würden. Sie selbst musste noch hier in der Süderstraße bis zum Schluss ausharren, denn seit ihr Mann Otto an der Front war, hatte sie als Hausmeisterin die alleinige Verantwortung für sechs Häuserblocks.
Ihr siebzehnjähriger Sohn Otto Junior, liebevoll Otti genannt, wollte seine Lehrstelle nicht aufgeben, außerdem wollte er unbedingt bei seiner Mutter bleiben, um sie zu unterstützen.
Gerade noch rechtzeitig hatte sie ihre beiden Kinder in Sicherheit gebracht! Kurze Zeit später war in Hamburg die Hölle los. Ende Juli bis Anfang August 1943 startete die Royal Air Force gemeinsam mit den US-Amerikanern, die mit hunderten von Bombeneinsätzen die Stadt bombardierten, die „Operation Gomorrha“. Die US-Amerikaner peilten am Tage die Hafenanlagen im Hamburger Hafen an, denn dort befand sich eine der größten Waffenschmieden Deutschlands. Die Briten flogen nachts über die dichtbesiedelten Stadtgebiete. Zunächst nahmen sie sich die Innenstadt vor, um zwei Nächte später gezielt aus einer Mischung von Luftminen, Spreng-, Phosphor- und Stabbrandbomben im dichtbesiedelten Wohnviertel der Arbeiter im Osten Hamburgs ein alles zerstörendes Inferno in Gang zu setzen.
In nur einer einzigen Nacht flogen mehr als 700 Bombenflugzeuge der Royal Air Force über Hamburg hinweg. Tausende Bomben heulten und prasselten auf die Häuser nieder. Luftminen und Sprengbomben sollten nicht nur die Dächer wegsprengen, sondern auch die Fensterscheiben der Gebäude zerbersten lassen.
Danach hatten die abgeworfenen Phosphor- und Stabbrandbomben ein leichtes Spiel, die überwiegend aus Holz bestehenden Treppenhäuser in Brand zu setzen. Nicht nur einzelne Wohnhäuser und Wohnblocks, nein, ganze Stadtviertel gingen in Flammen auf. Aus den unzähligen verschiedenen Brandherden entwickelte sich plötzlich durch den Sauerstoffsog eine einzige Feuerbrunst über eine geballte Fläche von zehn km². Wie in einem einzigen riesigen Kamin wurde die Luft mit der Stärke eines Orkans angesogen und in eine 7000 Meter hohe Rauchsäule gepresst. Begünstigt wurde diese alles vernichtende Feuersbrunst durch eine wochenlange Hitzewelle und Trockenheit: Selbst nachts kühlte es sich nicht ab. In dieser Nacht wurde der Begriff „Feuersturm“ geprägt.
Ganze Stadtteile wurden in nur fünf Bombennächten in Schutt und Asche gelegt. Es war bis dahin die größte Brandkatastrophe, die eine deutsche Stadt je getroffen hatte. Eine derartige Katastrophe, mit einem so verheerenden Ausmaß hatten selbst die Planer des „Bombercommand“ nicht für möglich gehalten.
Es waren die bis dahin schwersten Luftangriffe der Geschichte. Die Alliierten nannten diese Technik später Hamburgisierung. Danach wendeten sie diese Technik auch auf andere deutsche Städte an.
In letzter Minute: Mit angsterfüllten Augen schaute der kleine neunjährige Arnold vom Bauernhof seiner Großeltern aus in den Himmel. In nordwestlicher Richtung, dort wo Hamburg lag, zog sich ein blutrotes Band über den gesamten Horizont, begleitet vom schrecklichen Donnern der Explosionen. Arnold zitterte um das Leben seiner Mutter und seines älteren Bruders, Otti.
Millionen von Stanniolpapierstreifen, genannt Düppel, wurden von den Briten bei ihrer Operation Gomorra aus ihren Flugzeugen abgeworfen. Auf den Radarschirmen sahen sie wie ein Blitzgewitter aus. So wurde die Flak außer Kraft gesetzt. Es war für sie unmöglich die Bomber zu erkennen.
Noch etwas Merkwürdiges rieselte vom Himmel auf die umliegenden Felder: Papiere und Reichsmarkscheine, die vom Feuersturm in die Höhe gerissen worden waren.
In letzter Minute schafften es Mutter Marbs und Otti, dem brennenden Inferno zu entkommen. Nicht nur sich selbst rettete Otti, sondern er barg auch noch einen alten Mann, der dort im Rauch zusammengebrochen war, aus dessen brennender Wohnung im vierten Stock,. Danach geriet Otti total in Panik geraten und rannte noch einmal in die eigene Wohnung und holte unter höchster Lebensgefahr eine Jacke, ein Paar Stiefel und Kartoffeln. Vom Hinterhof holte er sein Fahrrad, dessen Bereifung bereits abgebrannt war, und sie machten sich auf dem Weg zur Hammer Landstraße, wo ein LKW sie gemeinsam mit anderen zu einer Auffangstation nach Vierlanden brachte. Glücklich, der Hölle von Hamburg entronnen zu sein, schloss Frau Marbs einige Tage später ihre beiden Kinder, Arnold und Elfriede, auf dem Hof ihrer Großeltern in die Arme.
Nur, hier waren sie nicht willkommen. Die Großeltern lebten zwar noch auf dem Hof, aber zu bestimmen hatten sie nichts mehr. Heinrich, Arnolds Onkel, bewirtschaftete inzwischen mit seiner Frau den Hof, den er bereits 1930 als ältester Sohn geerbt hatte.
Und diese beiden, Tante und Onkel von Arnold, wollten auf gar keinen Fall, dass sie dort blieben. Der Grund: Sie hatten Angst, dass Arnolds Vater, der an der Ostfront kämpfte, jederzeit fallen könnte. Das hieße, sie würden dann ihre Schwägerin und ihre drei Kinder nicht mehr loswerden.
Arnolds neue Heimat: Kurzentschlossen suchte sich Arnolds Mutter selbst eine Wohnung für ihre Familie. In Kollow wurde sie fündig. Beim Bauern Otto Schmidt durfte sie sich im Altenteil eine Wohnung einrichten.
Nicht Arnolds Vater fiel im Krieg, so wie Onkel Heinrich und seine Frau es befürchtet hatten, sondern Heinrich selbst kam vom Krieg nicht zurück.
Noch im Jahre 1944 wurde Heinrich zum Wehrdienst abkommandiert. Nach dem Kriegsende kam er in russische Gefangenschaft und starb dort, während Mutter Marbs` Mann zwar wohlbehalten – jedoch völlig ausgezehrt – nach dem Krieg zurückkam.
Die Kollower Jungs waren platt, als der Hamburger Buddje, Arnold Marbs, auftauchte und wie selbstverständlich mit ihnen ihr Plattdeutsch sprach. Das hatte er bei seinen Großeltern in Wangelau gelernt. Denn seit seiner frühesten Kindheit, hatte er sie ständig besucht. Sofort wurde er von den Jungs in ihre Mitte aufgenommen.
Andächtig lauschten seine neuen Freunde seinen Erzählungen aus der Weltstadt Hamburg. Ob er ihnen von den Straßenbahnen, die auf Hamburger Straßen fuhren, von den öffentlichen Schwimmhallen, in denen er im Winter zum Schwimmen ging, erzählte, sie wurden nicht müde, seinen vielen Geschichten zu lauschen. Die meisten Kollower Jungs waren noch niemals in Hamburg gewesen; einige waren nicht einmal mit dem Zug gefahren. Alles klang so geheimnisvoll, was Arnold ihnen erzählte. Bedingt durch seinen größeren Bruder Otti, hatte er seit frühester Kindheit schon viel erlebt.
Mein erster Schultag: Ich war anders, ganz anders als die meisten Erstklässler, die mit mir im August 1944 eingeschult wurden. Schon bevor ich in die Schule ging, wunderte ich mich, wieso sich die anderen Kinder auf ihren ersten Schultag freuten. Sie konnten es kaum abwarten, bis es endlich losging. Ich nicht! Ich war ja auch noch nicht mal sechs Jahre alt. Vom Vater bekam ich einen neuen Schulranzen, den er selbst angefertigt hatte und mir am ersten Schultag auf den Rücken schnallte, um zu sehen, ob die Riemen passten. Sie passten nicht! Er nahm die Lochschere und knipste zwei weitere Löcher hinein. Mutter hatte mir eine Schiefertafel, einen Griffelkasten aus Holz nebst zwei Griffeln sowie eine kleine Dose mit einem Schwamm gekauft. Ein Lappen zum Trocknen der Tafel hing an einer Kordel, die an der Tafel befestigt war und aus dem Ranzen baumelte. Das war mein zukünftiges Arbeitszeug.
Mitten im Dorf, umgeben von Bauernhäusern, dem Buckpolteich sowie dem Kolonialwarenladen Hümpel, lag unsere Dorfschule mit nur einem einzigen Unterrichtsraum. Ab sofort musste ich gemeinsam mit acht Schulklassen schön artig in einem Raum sitzen, still sein, und das tun, was der Lehrer sagte, was mir sehr schwer fiel. Viel habe ich nicht kapiert von dem, was der Lehrer von uns wollte. Es ging ja alles so schnell. Nachfragen durfte ich nicht, denn er war ja längst mit den Kindern der anderen Klassen beschäftigt.
Meine neue Schulfreundin, die neben mir saß, durfte ich auch nicht fragen, das war Schwatzen, und schwatzen durften wir auch nicht. Trotzdem habe ich es getan.
Mit der Konzentration hatte ich auch Schwierigkeiten. Wie sollte ich mich auch auf meine Aufgaben konzentrieren, denn was der Lehrer Hermann Becker mit den anderen Klassen durchnahm, war ja auch interessant. Wenn ich dann nach Hause kam, und Mutter sollte mir bei den Hausaufgaben helfen, hatte sie keine Zeit. Sie schaute nur mal kurz drauf, erklärte es mir, und weg war sie schon wieder. Meine Brüder waren auch ständig unterwegs. So quälte ich mich durch die ersten Schuljahre mit dem Erfolg, dass ich sitzen blieb.
Als ich im Dezember endlich sechs Jahre alt wurde, gab es kein Heizmaterial. Dauernd fiel deswegen die Schule aus. Der nächste Winter 45/46 war noch kälter. Da gab es wegen Feuerungsmangel dann Kohleferien. Kein Wunder, dass ich mit der Schule nicht vorankam.
Wollte Lehrer Becker in seiner Wohnung nicht erfrieren, musste er sich etwas einfallen lassen und durchsuchte das Haus nach brennbarem Heizmaterial. Auf der großen Diele wurde er fündig. Kurzerhand nahm er die Säge in die Hand und sägte alles, was nicht niet- und nagelfest war, zu Feuerholz. Balken und Latten sowie die Bretter, die quer über dem früheren Viehstall als Dachbegrenzung lagen, sägte er tagelang kurz und klein. Frieda Ring, die von 1944 bis 1948 bei Herrmann Becker wohnte, wunderte sich über diese ständig wiederkehrenden Sägegeräusche im Haus. Sie war neugierig und hakte nach. Daraufhin zeigte Lehrer Becker ihr sein Werk.
Otti – zum Sterben verurteilt: