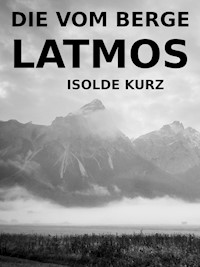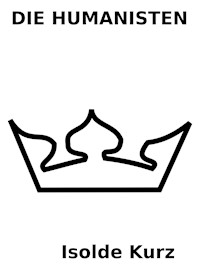Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Im Zeichen des Steinbocks
Aphorismen
Isolde Kurz
Im Zeichen des Steinbocks
Aphorismen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-30-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Im Zeichen des Steinbocks
Allgemeines vom Menschendasein
Mann und Weib
Aus der Welt des Herzens
Vom Kinde
Ethik und Rhythmus
Geheimnisse
Von der Sprache
Aus Völkerseelen
Vom Genius
Poesie
Kunst und Künstler
Unter Menschen
Allerlei Heilige
Aus der Zeit
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Im Zeichen des Steinbocks
Ein Flockensturm, als ging’ die Welt zu Ende, Die lange Nacht der Wintersonnenwende! Und morgen tritt durchs winterliche Haus Des Steinbocks die verjüngte Sonn’ heraus. Alteil’ges Juelfest, Urväterwonne, Des Lichts Triumphtag, die Geburt der Sonne, Dich ehr’ ich zwiefach, alter Weihebrauch: Der Sonne Wiegenfest ist meines auch. Ja, ich betrat die Welt beim Sonnensiege, Und unterm Steinbock stand auch meine Wiege, Zum Sinnbild nahm ich ihn, zum Wappentier, Sein hohes Zeichen, was bedeutet’s mir? In reinster Luft, am Rande der Moränen, Hoch über Fernen, die sich endlos dehnen, Der Gottheit näher ist des Steinbocks Welt, Den Adlern und den Sternen zugesellt, Vertraut dem Abgrund und der Wetterwolke, Ein Märchen fast dem talgebornen Volke, Der Berge König, tausendfach bedroht, Lebt er – und Niederungen sind sein Tod. So weist er aufwärts: wer in seinem Zeichen Geboren ist, der wag’ es, ihm zu gleichen, Ihn muss die weglos raue Höhe locken, Nicht vor dem Sturze bangend darf er stocken, Auf Gipfeln ist sein Reich und seine Ruh’, Er muss den ewigen Einsamkeiten zu. Denn nur in öden, starren, unfruchtbaren, Kann er als Sonnenheld sich offenbaren, Auf heil’ger Höh’ die Juelfeuer zünden, Das Licht, das neu geboren ward, verkünden. Und huldreich ist die Sonne sein gedenk, Wie Königskinder, die mit Festgeschenk Die Mitgebornen ihres Tages ehren, Sie aber gibt, was Fürsten nicht bescheren: Das Haupt zu jeder Lichtgeburt bereit, Mit Träumen, wahrer als die Wirklichkeit, Den leichten Fuß, der rasch zum Gipfel trägt, Die Hand, die wie zum Spiel den Drachen schlägt. Mit solcher Gaben lustvoll strengem Zwange Schickt ihren Streiter sie zum Siegesgange. Und tausendfältig strahlt er Glanz zurück, Dass wer ihn sieht, erkennt, er sah das Glück. Und wo er wandelt, grünen Lenzesfluren, Und wo er schied, da lässt er Sonnenspuren, Ihm weicht die Finsternis, und nur im Grab Erlischt die Glut, die allen Wärme gab. Die Dichter, die Propheten und Erfinder, Die Lichtgebornen all, die Sonnenkinder, Des Steinbocks hohes Zeichen schwingen sie, Ein Juelfest der Geister bringen sie. Zum Dienst der Sonne kam auch ich. Doch weh’, Ein schwerer Nebel liegt, wohin ich seh’, Es dringt kein Strahl hinab zu jenen Gründen, Wo Irrwischflammen sich am Sumpf entzünden, Wo unterm Alp die Welt sich stöhnend quält, Und eins dem andern schweren Traum erzählt. Wie Kranke schleichen sie mit müdem Blicke, Der schleppt ein Kreuz und jener eine Krücke, Die Jugend träumt, sie geh’ im weißen Haare, Der Lenz sei krank, die Liebe auf der Bahre, Ein jeder zittert um sein Erdenheil, Und jeder kürzt dem andern seinen Teil, Die Muse kam und schloss das letzte Fenster, Und sprach mit irrem Ton: Hier sind Gespenster. In Winkel kroch sie, wo die Fratzen lauern, Und trieb das Nachtgezüchte von den Mauern, Des Alpdrucks Wahn, das ängstliche Gegrübel Vergess’ner Frevel und vererbter Übel, Dass Hoffnung selbst vor ihrem Blick versteint, Und jedes Haus das Haus des Atreus scheint. O Menschheit hobst du jeden Schatz der Erden, Um ärmer nur und ärmer stets zu werden? Wardst du so groß, vertratst die Kinderschuh’, Und deine Kinderseligkeit dazu? Was kannst du nicht? Dein rollender Planet Ist kaum noch Schranke, die dir widersteht. Den Raum bezwingst du, raubst der Zeit die Beute, Der Blitz, einst Bote Zeus’, dir dient er heute, Ringst mit dem Vogel um sein luftig Reich, Ein Schritt noch, und du bist den Göttern gleich. Und doch voll Gram an deines Tages Rüste Blickst du nach der verlass’nen Jugendküste, Wo du noch spieltest und die Fantasie Dir ihre farbigen Bilderbücher lieh! O, über alle Lande möcht ich’s rufen: Kehrt heim zu unsrer Lichtaltäre Stufen! Ein Traum war alles, wollet nur genesen, Noch ist die Erde, was sie je gewesen. Noch kehrt der Lenz und seine tausend Triebe, Noch glänzt die Freude und noch lebt die Liebe. Kommt nur aus eurer Märkte Drang und Jagen, Heraus, wo stille, grüne Tempel ragen, Hört einmal wieder aus des Märchens Munde, Dem süßen, unberedten, ewige Kunde, Nur einmal seht von freien Bergeshöh’n Die junge Sonne siegreich aufersteh’n, Werft hinter euch die Angst, vergesst des Neids, Nennt euch der Sonne Kinder, und ihr seid’s! Umsonst, sie hören nicht. Noch immer walten Des abgestorbnen Jahres Spukgestalten. Der Sonnenheld, noch ist er nicht erstanden, Der seine Brüder reißt aus Winters Banden. Noch tiefer muss das Dunkel uns umstricken, Der lange Frost die letzten Blüten knicken, Ein Abend bang wie Weltenabend kommen, Ein Brand, wie auf dem Idafeld entglommen, Bis eine Wintersonnwend rau und kalt Gleich dieser bringt des Retters Lichtgestalt. O Heil dir, Göttersohn, von Kraft entzündet, Komm, wie die Sage dich vorausverkündet, Wie Wali, Wotans jüngster Ruhmesspross, Schwing du einnächtig schon dein Siegsgeschoss, Die Hand nicht wasche, sollst das Haar nicht schlichten, Eh du’s vollbracht, dein Retten, Rächen, Richten. Das Wort, das keiner weiß, du wirst es sagen, Siegvaters Wort aus grauen Göttertagen, Dem toten Balder einst ins Ohr geraunt. Dann hebt die Erde sich vom Grab und staunt, Denn Wunder sind gescheh’n: wo Gletscher starrten, Ergrünt ein Feld, erblüht ein Rosengarten, Die Ströme brechen aus kristallnen Särgen, Und heilige Feuer glühn von allen Bergen, Aus Näh und Ferne ziehn geschmückte Gäste Zu einem Jubel- und Vermählungsfeste: Es wird Natur, die dunkeläugige Braut, Dem Geist, des Lichtes hohem Sohn, getraut. Dann wird das Leben wonnig sein, es werden Verjüngte Götter heimisch gehn auf Erden, Beglückt wer dann mit ihnen wohnt und wer Zum großen Feste kam der Wiederkehr! Doch weil das Heil noch fern der kranken Welt, Und weil mein Licht nur meinen Pfad erhellt, Will ich von ihren Festen fern und Fehden Mich mit der Zukunft einsam unterreden. In ätherleichte Luft, zum Alpenfirn Trägt mich der Geist, ich fühl’ um meine Stirn Das Wehen schon der ungebornen Tage, Mein Sein leg’ ich getrost auf ihre Wage, Und leb’ ein Stündchen, wo die Zukunft webt, Indes die längste Nacht vorüberschwebt, Bis mir der Sonne neugeborne Pracht Aus Windeln frischen Schnees entgegenlacht. Wohlauf! Der Steinbock tritt die Herrschaft an, So steige, Seele, mit der Sonnenbahn!
*
Allgemeines vom Menschendasein
Die Welt ist ein Spiegel, worin ein jeder nur die eigene Seele sieht.
*
Redet mir nicht vom Zufall der Geburt! Ist denn die Geburt ein Zufall? Sie ist das Ergebnis der leidenschaftlichsten Wahl durch viele Jahrhunderte, und immer auch ein entsprechendes Ergebnis.
*
Ahnenkult und Ahnenstolz haben ihren tiefen Sinn. Es ist nicht gleichgültig, aus welchem Blut wir stammen, denn unsere Vorfahren gehen immer leise mit uns durchs Leben und färben, uns selber unbewusst, all unser Tun.
*
In den großen Schicksalsstunden scharen sie sich als unsichtbare Leibwache um uns, wir fühlen ihre gemeinsamen Kräfte, die uns durchdringen, ohne zu wissen, woher diese Kräfte uns gekommen sind.
*
Jede menschliche Natur ist ein Widerspruch, aus zwei verschiedenen, häufig gegensätzlichen Naturen zusammengefügt. Zieht man noch die Ahnenreihe hinein, die sich aufwärts ins Unendliche verliert, so erkennt man, dass schon die ganze Menschheit zur Herstellung des Einzelnen verwendet worden ist, wie sich sein Ich abwärts ins Unendliche spalten und sich am Ende wieder über die ganze Menschheit verteilen muss, denn Blutsverwandte sind wir alle. Wo sollte da Einheit des Charakters noch herkommen? Die gab es im Altertum, wo die Lebensbedingungen ähnlicher und wo die Völker weniger gemischt waren oder das Gemischte gleichmäßiger assimiliert.
*
Die Abhängigkeit von der Umgebung ist nur unbedingt wahr für den gemeinen Menschen. Unser »Milieu« sind nicht die Spießbürger, die in einer Stadt mit uns leben, sondern der geistige Boden, aus dem wir unsere Nahrung ziehen. Die großen Menschen aller Zeiten, mit denen wir von klein auf verkehren, die sind’s.
*
Aufgabe der verfeinerten Selbstsucht: soviel Schmerz wie möglich aus der Welt schaffen, alles Lebende in seinen Egoismus einschließen. Wer Glück zerstört, wer die Last des Jammers auf der Erde vermehrt, der darf nicht hoffen, dass der Luftdruck über seinem eigenen Haupt geringer werde.
*
Wahrhaft großes Empfinden zeigt sich nicht darin, dass man sich ausschließlich mit großen Dingen beschäftigt, sondern dass man auch das Kleinste dem Großen anzugliedern weiß.
*
Das Gros der Menschen ist nur in der Jugend genießbar, nach fünfundzwanzig hört bei den meisten die Entwicklung auf, und sie beginnen zu schrumpfen. Deshalb sehen sie auf ihre Jugend zurück, als auf eine Zeit höherer Fähigkeiten, ein geschwundenes Paradies. Bei dem begabten Menschen steht der Fluss des Werdens niemals stille, und er empfindet sein Ich nicht anders, als in der Jugend, daher ihm der Flug der Zeit nicht zum Bewusstsein kommt.
*
Die meisten Menschen sind wie schlecht konstruierte Lampen, jene billige Fabrikware, die gleich trübe brennen, sobald das Öl ein wenig gesunken ist. Dagegen gibt es einige wenige vom Schöpfer so vortrefflich ausgearbeitete Mechanismen, dass sie durch nichts verdorben werden können und das gleiche Licht verbreiten, bis der letzte Tropfen Öl verzehrt, ja bis die letzte Feuchtigkeit aus dem Dochte gesogen ist. Solche Menschen sind Gottes Handarbeit.
*
Das Individuum will sich einmal manifestieren, ehe es in den Schoß der Allgemeinheit zurückkehrt. Bleibt ihm gar kein Mittel, sich auszuzeichnen, so schreibt der Alltagsmensch wenigstens seinen Namen mit einer geschmacklosen Bemerkung ins Fremdenbuch, damit die Nachfolgenden wissen, dass er auch dagewesen.
*
Geistlose Menschen können nicht freudig sein, die Materie lastet mit zu schwerem Druck auf ihnen.
*
Auf törichte Wünsche wartet zuweilen eine grausame Strafe: ihre Erfüllung.
*
Der gefährlichste Sturz ist der von einem Luftschloss herunter. Stark ist, wer sich davon wieder erholen kann. Die meisten kriechen mit zerschmetterten Gliedern noch eine Strecke weiter, bis sie elend liegen bleiben.
*
Das Leben ist ein fortgesetzter, unfreiwilliger Tauschhandel. Wir glauben unser liebstes Gut auf immer festzuhalten, und schon landet, von uns unbeachtet, das Schiff, das es uns entführen wird. Und während wir ihm hoffnungslos nachstarren, taucht am fernen Horizont ein Segel auf, das den Ersatz bringt.
*
Es kommt ein Augenblick, wo auch der Glücklichste vollkommen allein ist, denn das letzte Wort auf Erden hat jeder mit dem eigenen Körper zu reden.
*
Nichts charakterisiert den Menschen mehr, als das, wofür er niemals Zeit findet.
*
Jeder edle Mensch muss vorher alt werden, ehe er jung wird.
*
Überlegung kann Schurken machen, unbedachtes Handeln macht sie nie. Darum fliegen den impulsiven Naturen alle Herzen entgegen.
*
Den Ehrgeizigen soll man nicht schelten. Der Erfolg kann den Menschen innerlich weiter machen. Verkanntes Verdienst fällt oft auf eine plumpe Schmeichelei herein, die das verwöhnte Glückskind verachtet.
*
Ein hässliches Mädchen wird durch ein Kompliment verführt, das an einer gefeierten Schönheit unbeachtet niedergleitet.
*
Es ist nicht zu verwundern, dass beschränkte Menschen so eigensinnig sind. Wem das Denken große Mühe macht, der weiß wohl, warum er das einmal Aufgenommene so lange wie möglich festhält, statt sich gleich einer neuen Mühe zu unterziehen.
*
Eitelkeit macht geziert und unruhig, Selbstgefühl gibt Natürlichkeit und Sicherheit.
*
Dem oberflächlichen Weltkind ist ein bisschen Eitelkeit nicht schädlich, es ist eben auch nur oberflächlich eitel; eitel auf kleine Talente oder äußere Vorzüge. Aber wehe, wenn die Eitelkeit sich der ernsthaften, pedantischen Naturen bemächtigt. Die nehmen es mit der Eitelkeit selber ernsthaft und beziehen sie auf die ernsthaften Dinge, wie Charakter, Kenntnisse usw. Deshalb steht keine Eitelkeit in so üblem Geruch, wie Gelehrteneitelkeit.
*
Die Zeit wird nicht nach der Länge, sondern nach der Tiefe gemessen.
*
Zeiten, in denen wir nichts erleben, sind endlos, wie ein langer, weißer, schattenloser Weg, worauf man keiner lebenden Seele begegnet.
*
Wer jeden Augenblick mit tiefem Gehalte erfüllen kann, hat seine Lebensspanne zur Unendlichkeit erweitert.
*
Weil die Zeit keine absolute, nur eine relative Länge hat, deshalb ist jedes starke Empfinden ewig, auch wenn es nur einen Tag gedauert hätte.
*
Es ist kein Mensch zu beneiden, er stehe so hoch und fest er wolle. Der unaufhaltsame Planet schwingt sich um die Sonne und vernichtet durch seinen bloßen Umlauf alles Erdenglück.
*
Widerspruch des Lebens.
Man hüte sich, die menschlichen Geschicke nach Regeln und Analogien zu berechnen. Jeder Fall ist der erste und der letzte seiner Art, denn nichts wiederholt sich jemals ganz auf Erden. Gerade die Erfüllungen, die die Alltagsweisheit am sichersten vorhersagt, treffen niemals ein. Im Augenblick der Entscheidung ist das ganze Spiel verschoben: der Mutige wird feig, der Egoist begeht eine großmütige Handlung, und von allem Erwarteten geschieht das völlige Gegenteil.
*
Das Leben führt uns ewig ad absurdum, und dieser ewige Widerspruch ist es gerade, was das Leben so interessant macht.
*
Die einzigen Menschen, die ein völlig ruhiges Gewissen haben, sind die großen Verbrecher.
*
Moral und Psychologie.
Wie viel freudiger lebte sich’s unter den Menschen, wenn unsere sittliche Überlegenheit über den Nächsten nicht wäre, das Richten nach idealen Forderungen, die in ihrer Gesamtheit nirgends auf Erden erfüllt werden.
Dieses moralische Besserwissen, dieses »er sollte«, »er müsste« des einen vom andern kann einen Menschen mit psychologischen Tastorganen in die Verzweiflung und von da in die Einsamkeit treiben. Wo ist denn der Sterbliche, der immer handelt, wie er sollte und müsste? Der heute diese Worte braucht, wird morgen selber durch sie gerichtet. Höchstens für Kinder oder für Matrosen, die auf einem Schiff beisammen leben, ist die Pflicht eine so einfache, gradlinige Sache. Unsere Verhältnisse zusammen mit unseren Anlagen bilden ein so unendlich kompliziertes Gewebe, dass in hundert Fällen neunzigmal dem »ich sollte« ein »ich kann nicht« gegenübersteht.
Wenn sich nun wenigstens die moralische Superklugheit auf den einzelnen Fall beschränkte! Aber wie wenige können dem Anreiz widerstehen, von da sofort einen Rückschluss auf den ganzen Charakter zu ziehen, und dann ist der Spruch der summarischen Justiz fertig. Wie groß, wie selbstgerecht, wie unantastbar ist der Herr Jedermann, so lang er das Gesetz im Munde führt. Wie hoch blickt er von den Schneegipfeln der idealen Forderungen auf den armen Teufel, der sie nicht erfüllen konnte, nieder. Aber bitte, Verehrtester, steigen Sie einmal von Ihrer abstrakten Höhe in die Ebene des Lebens herunter und messen Sie hier Ihren Wuchs mit dem seinigen. Das darf ich natürlich nicht laut sagen, deshalb decke ich mich in solchen Fällen durch eine klassische Autorität und erwidere mit Hamlet: »Gib jedem, was er verdient, so ist keiner vor Prügeln sicher.«
Die Menschheit hat wohlweislich ein höheres ethisches Ideal aufgestellt, als sie verwirklichen kann. Nach starrem Rechtsspruch ist der Mensch in jedem Augenblick an sich schon verdammlich, weil er
»In der Menschheit traurigen Blöße Steht vor des Gesetzes Größe«,
jenes ungeschriebenen Gesetzes, das jeder in der Brust trägt, dessen Erfüllung er aber zumeist – von den andern erwartet.
*
Es ist der Grundwiderspruch der menschlichen Natur, die wahre »Erbsünde«, dieser klaffende Riss zwischen dem, was der Mensch vom Menschen fordert, und dem, was er selber leisten kann. So gibt es ja nur in der Geometrie, aber nirgends in der Natur eine völlig gerade Linie. Und nur in der Arithmetik gehen die Rechnungen richtig auf, im Leben bleibt immer ein unlösbarer Rest zurück. Der Dichter kennt diesen Rest – er ist sein eigenstes Gebiet –, der Psychologe, der Erzieher kennt ihn, aber die große Menge derer, die sich denkende Menschen nennen, weiß nichts von ihm und schreit immer aufs neue, wo er ihr entgegentritt.
*
Nun ist zum Unglück auch unser geistiges Auge so eingerichtet, dass wir die Konturen der Dinge viel schärfer wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit sind. Wir sehen einen dicken, schwarzen Strich, wo in Wahrheit Licht und Schatten viel zarter ineinanderfließen.
*
Wir sind alle mehr oder minder unduldsam gegen Laster, die nicht in unserem eigenen Temperament liegen. Und das ist ganz natürlich. Wem der Wein nicht schmeckt, wie soll der den Trunkenen begreifen? Dagegen zeugt es von niedriger Gesinnung, wenn einer besonderes Ärgernis an solchen Sünden nimmt, die ihn gleichfalls reizen würden, zu denen ihm aber die Gelegenheit fehlt.
*
Die tugendhafte Frau, die sich mit ihrer Tugend langweilt, aber nicht den Mut zum Leichtsinn findet, die ist es, die den ersten Stein auf die gefallene Schwester wirft. Aber hier verlassen wir schon das Gebiet der falschen Moral und kommen in das des gemeinen Neides.
Wie manches Mal habe ich gewünscht, die juwelenstrahlende Weltdame möchte sich mit meinen Augen sehen, wenn sie, durch ein einziges Wort verwandelt, plötzlich mit dem Wasserkübel auf dem Kopf als Lischen am Brunnen vor mir stand.
*
Un errore, sagt der lebensweise Italiener, wo der harte, abstrakte Germane gleich von Schuld, Übertretung, Bruch des Gesetzes spricht. Richtig, denn die meisten Vergehungen sind Irrtümer – die Ate.
*
Ab und zu begegnet man Menschen, die ihre Grundsätze nicht nur auf die andern, sondern auch auf sich selber anwenden und deren Leben darum in einer schnurgeraden Linie verläuft. Diese genießen denn auch einen so großen moralischen Kredit, dass sie innerhalb ihres Kreises die Richter und Rater in allen Gewissensfragen spielen. Aber gerade sie sind dazu am wenigsten berufen, denn sieht man sie näher an, so sind es rechtschaffene, spießbürgerliche Leute, in deren Adern das Blut so langsam fließt und deren geistiger wie auch gesellschaftlicher Horizont so eng ist, dass sie das Leben ganz zum Rechenexempel gemacht und mit Prinzipien wie mit Wickelbändern umschnürt haben. Das imponiert dem Unerfahrenen, dem Autoritätsbedürftigen, der die Gedanken anderer zum Denken braucht. Aber wie schnell versagen diese Orakel vor den Konflikten einer bedrängten Seele. Wie sollte auch der Philister, der nichts erfahren hat und nie die Grenzen des Menschlichen abgetastet, mit seiner Buchweisheit und Buchmoral in die Abgründe des Lebens leuchten? Die Bravheit und Unbescholtenheit tun es nicht, und alles Erlernte steht hilflos dem Leben gegenüber. Wer den Gewissen ein Führer sein will, der muss selber mit Engeln und Dämonen gehaust haben und Verantwortungen getragen, aus denen die Erkenntnis fließt. So einem Renaissancemönch, der sich aus wilden Abenteuern in die Stille der Zelle zurückgezogen hatte, um nachzudenken, einem solchen mochte sichs gut beichten. Wessen Tugend aber von der negativen Art ist, der hat höchstens Licht genug, um seinen eigenen Weg zu finden.
*
Wer aus den moralischen Forderungen die letzten strengsten Konsequenzen ziehen will, dem bleibt nichts übrig, als in eine menschenleere Wüste zu fliehen. Und wenn er sich besinnt, so wird er vielleicht auch dort erkennen müssen, dass immer noch einer zu viel da ist.
In dieser schrecklichen Enge hat die Natur uns zwei Sicherheitsventile gegeben: die Nachsicht, die nichts ist, als die angewandte Gerechtigkeit im Gegensatz zur abstrakten, und den Humor.
*
Der Durchschnittsmensch sieht von seinem Gegenüber immer nur die eine, ihm jeweils zugekehrte Seite. Er kann sich in den Oszillationen des Tages kein klares und unverrücktes Bild der anderen erhalten. So entsteht das beständige Auf und Ab in der Beurteilung der Charaktere, das wechselnde Überschätzen und Verwerfen, das den unbefangenen Zuschauer mitunter fast seekrank macht.
Die seherisch angelegten Naturen tragen das Ganze eines Menschen als festes Bild mit Licht und Schatten in sich herum, das durch die wechselnden Erfahrungen nur leise modifiziert, nicht häuptlings umgestürzt werden kann. Widersprüche erstaunen sie nicht, denn sie wissen, dass diese zum Ganzen einer Individualität gehören. Sie kennen keinen sittlichen Eifer, und die richterliche Weisheit der andern ist ihnen ein Greuel; mehr noch als ihr Gemüt, empört sie ihren Intellekt. Das bringt sie in beständigen Gegensatz zu ihrer Umgebung, der solche Objektivität nicht selten als Kälte oder moralische Indifferenz erscheint. Gewiss ist ein Hauptgrund, weshalb so oft die Dichter und Seher sich in späteren Jahren ganz vom Verkehr der Menschen zurückziehen und ihr Leben in selbstgewählter Einsamkeit beschließen: die blinden Urteile der Schnellfertigen nicht mehr hören zu müssen.
*
Artig auch gegen sich selbst.
Wenn man seine Mängel nicht hätscheln soll, so hat man doch auch nicht nötig, sie mit Keulen auszutreiben. Man behandle sein Ich wie einen erprobten Freund, an dem man gelegentlich gern einen Fehler abstellen möchte. Man suche sich selbst durch freundlichen Zuspruch, allenfalls durch ein bisschen Schmeichelei, zum Besseren zu bereden. Man sage sich zum Beispiel in einem Moment der Verzagtheit:
»Komm! Ich kenne dich ja sonst als brav, hast schon manches Mal gut bestanden, wirst mir doch diesmal keine Schande machen.«
Das Gelobtwerden für eine Eigenschaft, die man nicht hat, wird häufig zum Sporn, sich diese Eigenschaft zu erwerben, und der wahrhaft Kluge muss auch verstehen, sich selber zu überlisten.
Das abstrakte Moralpredigen dagegen ist beim eigenen Ich so wirkungslos, wie beim fremden.
*
Der Dank ein Übel.
Dank soll man weder geben noch fordern. Er würdigt beide Teile herab. Durch einen Dienst, den man mir erweist, darf ich in nichts gehindert sein, sonst verwandelt sich die Wohltat in eine Übeltat, und nur aus dieser Gesinnung heraus darf ich anderen etwas Gutes erweisen. Wenn ihr mich nicht liebt für das, was ich bin, – für das, was ich tue, sollt ihr mich nicht lieben müssen, denn so halte ich’s auch mit euch.
*
Wer sich zur Dankbarkeit verpflichten lässt, der trägt eine Kette, gegen die er sich früher oder später empören muss, denn alle Liebe will Freiheit und Freudigkeit. Eine Wohltat, sei sie noch so groß, ist durch innere Abhängigkeit zu teuer bezahlt. Wer sie in dieser Absicht erweist, macht ein Geschäft, bei dem er den Freund übervorteilt, und bleibt dabei doch der Betrogene. Um gerecht und liebevoll zu bleiben, habe man den Mut, undankbar zu sein.
*
Das Danken ist eigens erfunden, um die Last der Dankbarkeit aufzuheben. Es ist eine Handlung, die sich mit einer anderen Handlung scheinbar ins Gleichgewicht setzt, was ein bloßes Gefühl nicht könnte. Sie macht denjenigen, der sie vollzogen hat, wieder zu einem freien Menschen.
*
Macht der Überzeugung.
Nichts auf Erden ist so unwiderstehlich wie Überzeugung, die aus tiefster Seele kommt. Sie ist der Strom, der alle Dämme bricht und alle Wasser mit sich reißt. Sie unterwirft sich sogar die Welt der Sinne. Eine hässliche Frau kann durch den felsenfesten Glauben, schön zu sein, ihre Umgebung so beeinflussen, dass diese nicht mehr wagt, sie hässlich zu sehen. Ja, dieser Glaube braucht nicht einmal ausgesprochen zu werden, er teilt sich von selbst der Umgebung mit und schlägt den Widerspruch der Augen nieder.
*
Der Große und seine Zeit.