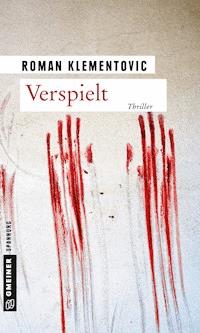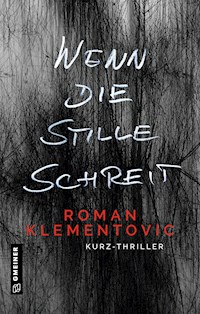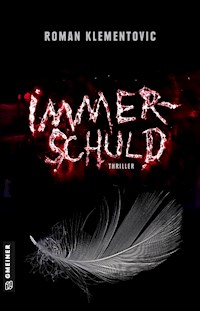
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: GMEINERHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller von Roman Klementovic
- Sprache: Deutsch
Sie fanden ihn am Waldrand in der Nähe des Dorfes. Die brütende Hochsommerhitze der letzten Tage hatte ihm schwer zugesetzt. Der Fäulnisgeruch war kaum zu ertragen. Hektisches Fliegensummen, überall Parasiten und Blut. Es sah so aus, als wäre er mit einem Messer massakriert worden, vielleicht auch mit einer Axt. Doch es war etwas anderes, das ihre volle Aufmerksamkeit auf sich zog. Etwas, das ihnen noch viel mehr Angst machte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman Klementovic
Immerschuld
THRILLER
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: Immerschuld (2017), Immerstill (2016), Verspielt (2015)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © chones/fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5430-1
Widmung
Für meine Eltern
Andrea & Karl Klementovic
Zitat
Wenn da nichts mehr ist, auf das du vertrauen kannst, hör, was deine Angst dir rät!
0
Der Sommer, in dem er sein Schweigen brach, war jener des Jahres 2015. Es war »Der extremste Sommer der Messgeschichte« titelte eine der größten Tageszeitungen des Landes. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmte. Tatsächlich aber überschritt die brütende Hitze an viel zu vielen Tagen das Maß des Erträglichen und strapazierte die Nerven und die Gesundheit der Menschen in weiten Teilen Europas. In Österreich waren Klimaanlagen vielerorts ausverkauft, Unternehmen gaben hitzefrei und nicht nur ältere Menschen litten unter Kreislaufproblemen. Ein Großteil der Arbeit ging langsamer vor sich als sonst, manche blieb gar liegen. Bauern beklagten schlechte Ernten, denn obwohl die Bewässerungsanlagen unaufhörlich liefen, dörrten ihre Felder zunehmend aus. Förster wiesen auf Waldschäden hin, im Asphalt der Straßen taten sich Risse auf, die bis heute nicht alle behoben wurden. Mancherorts wurde gar das Wasser knapp.
Inmitten all dieser Extreme passierte in Grundendorf etwas so Grauenvolles, dass es mir immer noch den Atem raubt, wenn ich nur daran denke. Alle dachten damals, dass es mit dem Schrecken endlich vorbei war. Sie glaubten sich in Sicherheit. Doch plötzlich, mit einem Schlag und über Nacht, kehrte die Angst in unser kleines Dorf zurück …
Ende März
1
Die Ampel sprang auf Grün. Endlich. Ich trat mit voller Kraft auf das Gaspedal. Die Reifen drehten durch, quietschten, der Motor heulte auf.
Ich raste wie ein Verrückter, durfte keine Zeit verlieren. Wechselte ständig die Spur, um im dichten Wiener Frühverkehr voranzukommen. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Ich war völlig panisch vor Sorge. Immerzu dröhnten mir die Sprachnachrichten durch den Kopf, die Verzweiflung in ihrer Stimme. Ich wusste, dass etwas Schreckliches passieren würde, wenn ich nicht rechtzeitig ankam.
Vor mir tauchte ein roter Golf älteren Baujahrs auf. Er schlich gemächlich dahin. Auf der rechten Spur ein Linienbus, noch langsamer.
Keine Chance zu überholen.
Oder doch?
Ich scherte kurzerhand nach links aus. Über den flachen Bordstein auf die Straßenbahngleise. Dort zog ich an den beiden Fahrzeugen vorbei. Schaffte es gerade noch rechtzeitig zurück auf die Fahrbahn, bevor mich die entgegenkommende Straßenbahn rammte.
Wildes Gebimmel. Schrilles Hupen.
Keine Zeit, mich darum zu kümmern.
Ein paar Wagenlängen vor mir sprang die nächste Ampel auf Rot. Ich hielt die Luft an und gab Vollgas.Aus dem Augenwinkel sah ich einen Wagen von rechts auf mich zurasen. Zu spät, um zu bremsen. Erneutes Gehupe. Reifenquietschen. Ich spannte jeden Muskel meines Körpers an, biss mit aller Kraft die Zähne zusammen. War mir sicher: Jeden Augenblick würde er mich rammen. Gleich. Jetzt.
Doch nichts passierte.
Ich schaffte es tatsächlich heil über die Kreuzung.
Ich schrie. Musste lachen. Für den Bruchteil einer Sekunde stieg so etwas wie Euphorie in mir hoch. Doch sofort kam die Anspannung zurück. Die Angst.
Ich lenkte den Wagen mit einer Hand. Griff mein Handy und wählte erneut ihre Nummer. »Komm schon!«, murmelte ich vor mich hin. »Bitte geh ran!«
Doch sie hob nicht ab. Nach ein paarmal Läuten erklang schon wieder nur die metallische Stimme am anderen Ende der Leitung: Willkommen in der Mobilbox der Nummer Null, Sechs, …
Ich legte auf. Wollte sie noch einmal anrufen, vertippte mich jedoch, und das Feld zum Schreiben einer SMS öffnete sich. Das konnte doch nicht wahr sein! Ich wurde immer hektischer, vertippte mich wieder, dann schaffte ich es endlich.
Erneut läutete es. Einmal, zweimal, dreimal … Es kam mir wie eine Ewigkeit vor.
»Bitte nimm ab!«
Willkommen in der Mobilbox der Nummer Nu…
»Verdammt!«
Ich warf das Handy auf den Beifahrersitz und schlug immer wieder mit der flachen Hand auf das Lenkrad ein. Dabei driftete ich mit dem Wagen nach links und schlitterte beinahe in ein parkendes Auto. Ich riss das Steuer nach rechts um und überholte einen dunkelgrauen Family-Van in erster Spur.
Nach einer Rechtskurve war das Haus, in dem sie wohnte, in der Ferne zu sehen. Der fünfstöckige Altbau lag in der Sonne, die gelbe Fassade strahlte.
Doch vor mir stockte der Verkehr erneut. Schon wieder eine rote Ampel. Keine Chance, an den anderen Fahrzeugen vorbeizukommen. Ich sprang auf die Bremse. Mein Oberkörper drängte vor, der Gurt schnitt mir in die Brust, ich kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen.
Das Reifenquietschen hatte alle Blicke auf mich gezogen. Ein Kerl im Wagen neben mir zeigte mir den Vogel. Ich kümmerte mich nicht darum. Starrte immerzu auf das kreisförmige rote Licht, das einfach nicht erlöschen wollte.
Das Handy war vom Sitz gerutscht und lag irgendwo auf dem Boden. Ich streckte mich hinüber, tastete danach, doch ich konnte es nicht finden.
Die Ampel wurde grün.
Die Autos vor mir fuhren an, viel zu langsam. Ich hupte, niemand wich aus. Ich fluchte, drängte mich zwischen ihnen hindurch. Stieg aufs Gaspedal. Die nächste Kreuzung überquerte ich bei Orange.
Und dann hatte ich es endlich geschafft.
Vor ihrem Haus hielt ich in erster Spur. Ich stieß die Tür auf, ohne vorher in den Rückspiegel zu schauen. Ein vorbeirasender schwarzer Mercedes rammte beinahe die offen stehende Tür. Der Fahrer riss seinen Wagen aber gerade noch rechtzeitig nach links. Haarscharf entging er dabei einer Kollision mit einem anderen Auto. Alles ging so schnell. Ich bekam gar nicht mit, wie gefährlich es gewesen war.
Ich warf die Tür zu, drängte mich zwischen zwei parkenden Autos hindurch. Rannte fast eine Frau mit Hund an der Leine über den Haufen. Dann war ich endlich vor ihrer Eingangstür.
Gehupe in meinem Rücken. Flüche. Hundegebell.
Ich streckte die Hand aus, wollte gerade die Klingel drücken. Mein Finger nur wenige Zentimeter von diesem verdammten Knopf entfernt.
Da ertönte ein ohrenbetäubender Knall hinter mir. Metall knirschte. Glas splitterte. Die Alarmanlage eines Autos sprang an.
Ich fuhr zusammen. Riss instinktiv die Arme vors Gesicht und stemmte mich gegen die Hauswand.
Schreie um mich herum. Panik.
Ich öffnete die Augen. Wagte einen Blick hinter mich.
Da sah ich sie. Auf dem Dach eines parkenden Autos.
Montag, 13. Juli
2
Ich blickte zwischen den Baumwipfeln hindurch in den wolkenlosen Himmel empor. Obwohl es noch früh am Morgen war, strahlte die Sonne schon so kräftig, dass ich meine müden Augen mit der Hand abschirmen musste. Fünf, nein sechs Kondensstreifen, die einander wild kreuzten und sich langsam auflösten. Von irgendwo weit entfernt war das Brummen eines weiteren Flugzeugs zu hören. Schnell wurde es von dem Grillengezirpe übertönt, das immer lauter und aufgeregter zu werden schien. Es mussten sich Hunderte, wenn nicht Tausende von den Insekten um uns herum verschanzt haben.
Und dann war da noch das hektische Summen der Mücken und Fliegen.
Ich senkte meinen Blick, ließ ihn durch den Wald und all das regungslose, staubtrockene Gestrüpp streifen. Suchte nach einem Schatten, der da nicht hingehörte, einem Farbklecks, einer Bewegung. Nach irgendetwas. Denn je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich mir, dass wir nicht alleine da draußen waren. Ich glaubte, einen stechenden Blick auf meiner verschwitzten Haut zu spüren. Doch ich konnte niemanden ausfindig machen.
Die kratzige Stimme des alten Horvat drang allmählich wieder zu mir durch und riss mich aus meinen Gedanken: »Patrick?«
Der örtliche Förster hatte meinen Namen in die Länge gezogen und fuchtelte mit seinen Händen vor meinem Gesicht herum, um mich aus meiner Lethargie zu reißen. Doch er wurde von einer lästigen Fliege abgelenkt, die er nun zu verscheuchen versuchte. Ein hoffnungsloses Unterfangen.
Ich begann gedanklich wieder abzuschweifen.
Doch da klatschte der alte Horvat sich auf den nackten Unterarm und fluchte: »Verfluchtes Biest.« Eine Mücke hatte ihn gestochen und das zermatschte Tier klebte nun auf seiner Haut. Er versuchte es am Stoff seiner kurzen Hose abzuputzen, murmelte dabei weitere Flüche in sich hinein. Währenddessen schwirrte die Fliege weiter vor seinem Gesicht herum.
Sein Sohn Valentin, der etwa in meinem Alter war, also Anfang 30, stand einen Schritt hinter ihm. Er war in so ziemlich jedem äußerlichen Aspekt das genaue Gegenteil seines Vaters – also schlank, fast schon dürr, groß gewachsen, hatte dichtes blondes Haar und ein kantiges Gesicht mit leicht eingefallenen Wangen. Doch trotz der vielen Unterschiede konnte man auf den ersten Blick sehen, dass man Vater und Sohn vor sich hatte. Vermutlich lag das an ihren dunklen, tief sitzenden und eng zusammenliegenden Augen.
Valentin stand das Grauen ins Gesicht geschrieben.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte mich der alte Horvat.
Ich nickte kaum merklich, war geistig aber immer noch nicht ganz bei ihnen. Mir brummte der Kopf, meine Augen brannten und mein Verstand arbeitete nur sehr schwerfällig. Ich war hundemüde.
Die letzte Nacht war, wie so viele in den vergangenen Monaten, trotz der Schlaftabletten und des Alkohols ein einziger Albtraum gewesen. Immer wieder war ich aus meinem hauchdünnen Schlaf erwacht, weil ich geglaubt hatte, Geräusche zu hören und von Dämonen und sich bewegenden Schatten umzingelt zu sein. Dabei hatte es sich nicht wie richtiges Wachsein angefühlt, sondern viel mehr wie ein albtraumverklebtes Wandeln zwischen zwei Welten. Die Grenze zwischen Traum und Realität war schwammig und nicht eindeutig auszumachen gewesen. Bis auf einmal zumindest. Denn unter allen Geräuschen war da eines gewesen, von dem ich am ehesten dachte, dass es tatsächlich da gewesen war: Das Quietschen der Hintertür. Keine Ahnung, ob es durch das Öffnen oder Schließen ausgelöst worden war, aber ich war vor Schreck im Bett hochgefahren und hatte in die Dunkelheit gestarrt.
»Hallo?«, hatte ich gerufen, aber aus dem Haus war keine Antwort gekommen. »Ist da wer?«
Wieder nichts.
Ich hatte mich überwunden, war aus dem Bett gekrochen und barfuß durchs Haus geschlichen. Hatte die Hintertür inspiziert. Doch die war verschlossen gewesen. Danach hatte ich alle Räume abgesucht. Hatte die ganze Zeit über befürchtet, Konturen im Halbdunkel auszumachen, die da nicht hingehörten. Doch zum Glück hatte ich niemanden gefunden und zehn Minuten später war ich zur Überzeugung gelangt, dass ich mich wohl getäuscht und mir das Quietschen eingebildet haben musste. Ich war zurück ins Bett gekrochen, hatte jedoch lange Zeit nicht wieder einschlafen können. Eine seltsame Unruhe hatte sich in mir ausgebreitet und es hatte eine Stunde oder länger gedauert, bis sie sich so weit gelegt hatte, dass ich in einen weiteren verschwitzten Albtraum abgedriftet war.
Sehr wahrscheinlich hätte ich heute keinen Gedanken mehr an das Quietschen in der Nacht verschwendet, hätte ich kurz zuvor nicht feststellen müssen, dass mein Wagen verschwunden war. Ich konnte es mir beim besten Willen nicht anders erklären, als dass er gestohlen worden war. Ich versuchte mich zu erinnern, wann ich ihn zuletzt hinterm Haus gesehen hatte. Doch sosehr ich mich auch anstrengte, ich kam einfach nicht darauf. Es musste schon einige Wochen her gewesen sein.
»Patrick!« Der alte Horvat packte mich am Oberarm, rüttelte mich und erst jetzt war ich zurück im Hier und Jetzt. Zurück am Rande dieses kleinen Waldstücks nahe Grundendorfs. Augenblicklich stieg mir wieder der süßliche Fäulnisgeruch in die Nase und ich musste gegen die aufkommende Übelkeit ankämpfen.
»Geht’s dir gut?« Er schnaufte und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Sein Kopf war knallrot, eine dicke Ader, die wie ein fetter Wurm aussah, trat an seiner linken Schläfe hervor. Die Hitze machte dem schwer übergewichtigen 60-Jährigen ganz offensichtlich zu schaffen.
»Ja«, antwortete ich und hoffte, mit einer lässigen Handbewegung seine Sorgen wegwischen zu können.
Doch er wartete auf eine Fortsetzung.
»Ich … alles in Ordnung.« Ich seufzte und rieb mir mit beiden Händen das Gesicht.
»Du siehst nicht gut aus, wenn ich dir das sagen darf.«
Er wandte sich zu seinem Sohn um, der bestätigend mit dem Kopf nickte. Valentin sprach nicht, niemals. Weshalb, wusste ich nicht. Ich glaube, niemand in Grundendorf wusste es. Es war einfach so.
»Ich … ich hab nur wenig geschlafen letzte Nacht«, antwortete ich.
Der alte Horvat nickte, als ob er verstand.
Ich machte mir nichts vor, wusste ganz genau, dass sowohl in Grundendorf als auch im Nachbarort Obermarch getratscht wurde. Und mit Sicherheit auch in allen umliegenden Dörfern. Immerhin waren mein Name und mein Gesicht in ganz Österreich in den Fernsehnachrichten zu sehen gewesen. Die furchtbaren Ereignisse des letzten Winters hatten es sogar in Deutschland bis in die größten Tageszeitungen geschafft. Ganz bestimmt glaubten alle, über mich Bescheid zu wissen. Mich zu kennen. Zu wissen, wie es mir ging.
Doch sie hatten keine Ahnung!
»Wer zum Teufel tut so etwas?«, murmelte der alte Horvat und blickte kopfschüttelnd zu Boden.
Auf den Kadaver, den sein Sohn und er zuvor gefunden hatten, und der, obwohl er nur etwa einen Meter vom Wegrand entfernt lag, aufgrund des hohen Grases und des Gestrüpps leicht zu übersehen gewesen wäre. Unzählige Fliegen tummelten sich um ihn herum und ihr Summen wurde immer lauter – fast so, als wollten sie uns sagen: Verschwindet,wir haben ihn zuerst gefunden!
Der pechschwarze Hund – ich schätzte, dass es ein Labrador war – konnte noch nicht lange hier draußen liegen. Die Augen waren zwar von Parasiten befallen, allerdings noch nicht zu einem matschigen Brei geworden. Das Fell war schmutzig, verfilzt und blutverschmiert. Ungeziefer labte sich daran und immer mehr Tiere krochen über den ausgedörrten Waldweg, dessen Erde rissig war, heran. Am gesamten Körper des Tiers klafften weit offene Wunden, aus denen das verfaulte Innere quoll. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre es mit einem Messer massakriert worden, vielleicht auch mit einer Axt oder etwas Ähnlichem. Ein paar Bissspuren von anderen Tieren, die sich an dem Kadaver genährt hatten. Ein Bein stand in einem unnatürlichen Winkel ab, mit Sicherheit war es gebrochen.
Doch da war noch etwas, das mir erst jetzt auffiel.
»Was ist?«, fragte der alte Horvat.
Ich konnte spüren, wie Valentin und er sich in meinem Rücken neugierig nach vorne streckten.
Ich antwortete nicht. Die Schnauze des Tiers hatte meine volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich ging näher ran und in die Hocke. Meine Knie knacksten dabei.
»Was hast du, Patrick?«
»Wartet«, antwortete ich und brach einen Zweig von dem Busch gleich neben dem Hund.
Die Insekten drehten völlig durch, als ich dem toten Tier damit in der Schnauze herumstocherte. Hektisch hetzten sie in alle Richtungen, unzählige Viecher flogen mir um die Ohren. Ich versuchte sie mit der freien linken Hand zu verscheuchen, doch ich war machtlos, es waren einfach zu viele. Eine Mücke stach mich in den Nacken.
»Was zum Teufel machst du da, Patrick?«, fragte der Alte mit einer Mischung aus Neugierde und Ekel in seiner Stimme.
»Siehst du das nicht?«, antwortete ich und stocherte weiter.
»Nein, was …?« Er kam näher ran. »Um Gottes willen!«
Jetzt hatte auch er es gesehen und er gab einen Laut von sich, der vermuten ließ, dass er kurz davor war, sich zu übergeben. Er presste sich die flache Hand auf den Mund und wich ein paar Schritte zurück.
Dem armen Hund waren alle Zähne gerissen worden.
Ich warf den Zweig, so weit ich konnte, in den Wald hinein und hoffte, damit auch das grauenvolle Bild loszuwerden. Ich ahnte jedoch, dass es mir wohl für immer bleiben würde.
Ich erhob mich, begleitet von einem abermaligen Knacksen meiner Knie. Das aufkommende Schwindelgefühl versuchte ich zu verdrängen, indem ich tief durchatmete und mir Daumen und Zeigefinger auf die zusammengekniffenen Augen presste. Es half kaum.
Valentin war einen weiteren Schritt zurückgewichen und starrte zu Boden, auf irgendeinen Punkt vor seinen Schuhspitzen. Wahrscheinlich unbewusst tastete er mit der linken Hand die deutlich zu erkennenden Kratzspuren auf seinem rechten Unterarm ab.
Der alte Horvat hatte seinen Hut abgenommen und rieb sich seinen kahlen, verschwitzten Schädel. Seine Wangen leuchteten rot. Das olivgrüne Hemd war völlig verschwitzt, der dunkle Fleck unter seinen Armen reichte hinab bis zum Hosenbund, an dem ein abgewetztes Ledertäschchen mit seinem Handy steckte. Unter den Hosenbeinen, die ihm bis zu den Knien reichten, kamen zwei weiße, spindeldürre Waden hervor, die so gar nicht zu seinem restlichen voluminösen Körper passen wollten.
»Perverses Arschloch …«, murmelte er. »Wenn ich den in die Finger kriege, dann …« Er überließ die Konsequenz meiner Fantasie.
Sein Sohn starrte immer noch zu Boden. Als er zu mir aufsah und bemerkte, dass ich ihn dabei beobachtete, wie er an seinen Kratzern herumtastete, hörte er augenblicklich damit auf. Irgendetwas huschte über sein Gesicht, ich wusste es nicht zu deuten. Noch nicht.
Eine weitere Mücke stach mich und ich fragte mich, was ich hier überhaupt machte. Ich wollte einfach nur nach Hause. »Du hättest die Polizei rufen sollen«, sagte ich deshalb an den alten Horvat gewandt.
»Du bist die Polizei.«
»Nicht mehr, das weißt du ganz genau.«
»Blödsinn!«
»Du hättest den Wimmer …«
»Den Wimmer, ich bitte dich! Der kann doch froh sein, wenn er sich auf dem Weg zum Klo nicht verläuft.«
»Das ist nicht mein Problem.«
»Ist es wohl und das weißt du genauso gut wie ich.«
»Aber …«
»Die taugen doch alle nichts.«
»Das sind gute Männer …«
»Dass ich nicht lache.«
»Du solltest mit Lukas reden, er kann …«
»Patrick, ich bitte dich«, unterbrach er mich und brachte mich damit zum Schweigen. Mir fehlte die Kraft, ihm zu widersprechen. Außerdem hätte es keinen Zweck gehabt.
Seit dem letzten Winter war der Ruf der örtlichen Polizei nicht gerade der beste, das Vertrauen in meine ehemaligen Kollegen wohl für immer verloren. Selbst in Lukas, meinen ehemaligen Partner. Und das, obwohl er ein verdammt guter Mann war.
Man hatte Sündenböcke gebraucht, warf ihnen vor, über drei Jahre hinweg nicht die geringste Spur von den beiden vermissten Jugendlichen Linda und Markus gefunden zu haben. Man führte das auf Unfähigkeit, mangelnde Motivation und schlechte Führung zurück. Womit wir bei Herbert Wimmer wären – er leitete als Postenkommandant die Polizeiinspektion in Grundendorfs Nachbarort Obermarch. Das Versagen der Behörden war schnell zu seinem geworden. Ich hingegen war in den Medien als Held dargestellt worden, der einen der grausamsten und mysteriösesten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte hatte aufklären können. Dabei war ich nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und wünschte mir seitdem nichts sehnlicher, als dass alles ganz anders passiert wäre. Egal wie oft ich den Reportern zu erklären versucht hatte, dass es nicht mein Verdienst gewesen war, die Zeitungen, Fernseh- und Radiosender hatten in mir den Helden gefunden, den sie gebraucht, und nur das gehört, was sie gewollt hatten. Dementsprechend schlecht war Wimmer seitdem auf mich zu sprechen. Und so viel ich mitbekommen hatte, nach meinem Abgang auch auf Lukas – mitgehangen, mitgefangen.
Mittlerweile war Valentin erneut einen Schritt näher an uns herangekommen. Der alte Horvat hatte seinen Hut wieder aufgesetzt und die Hände in die Hüften gestemmt. Nachdenklich kaute er an seiner Unterlippe.
Ein paar Sekunden betrachteten wir das tote Tier schweigend.
Irgendwann sagte er: »Also, ich weiß nicht, aber … sieht der nicht aus wie der Hund von deinen Großeltern?«
Mein Blick glich wohl einem riesengroßen Fragezeichen. Vermutlich lag auch meine Stirn in Falten, so wie sie das immer tut, wenn ich grüble oder verwundert bin.
»Meinst du nicht?«, hakte er nach.
»Meine Großeltern haben einen Hund?«
»Mein Gott, Patrick«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Du gehst wirklich nicht mehr viel aus dem Haus, was?«
»Ich … na ja, weißt du …«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, er hatte absolut recht. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Großeltern sich einen Hund angeschafft hatten. Ich hatte sie, wie so viele andere Menschen, sicher schon seit Monaten nicht mehr gesehen – und das, obwohl sie ebenfalls in Grundendorf wohnten. Ich hatte es mir zwar öfter vorgenommen, doch irgendwie hatte ich mich bisher nicht dazu durchringen können, bei ihnen vorbeizuschauen oder ihnen die Tür zu öffnen. Ich hatte niemanden sehen, nichts hören und auch nicht reden wollen. Wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Aus den Tiefen des Waldes drang ein leises Knacksen. Ein Zweig oder ein kleinerer Ast, der gebrochen war.
Wahrscheinlich ein Tier, dachte ich mir.
Doch in mir hatte sich erneut das Gefühl geregt, dass wir nicht alleine da draußen waren. Ein Frösteln lag in der Luft, trotz der Hitze. Ich lauschte angespannt, suchte abermals den Wald nach irgendetwas oder irgendjemandem ab, der da nicht hingehörte. Doch wieder konnte ich niemanden entdecken.
Dem alten Horvat schien das Knacksen gar nicht aufgefallen zu sein. »Also, Patrick … wenn ich so darüber nachdenke … ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der Hund deiner Großeltern ist«, sagte er. »Schon einige Zeit her, vielleicht drei, vier Wochen oder so. Aber ich bilde mir ein, sie mit genau so einem Labrador im Ort gesehen zu haben.«
Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte. Konnte er recht haben?
»Was sagst du?«, wandte er sich an seinen Sohn. »Das ist doch ihr Hund, oder?«
Valentin antwortete mit einem schiefen Nicken, das man am ehesten als »Ich glaube schon« interpretieren konnte.
Ich blickte erneut auf den geschändeten Kadaver hinab und hoffte dabei inständig, dass die beiden sich täuschten. Es war wohl das Letzte, was ich nun gebrauchen konnte. Denn wer auch immer das Tier getötet hatte, er musste außer sich vor Wut gewesen sein. Kein normaler, gesunder Mensch hätte so etwas übers Herz gebracht. Es bedeutete nichts Gutes.
Während wir drei schwiegen, umgab uns das Fliegensummen. Hoch über uns erklang erneut das Brummen eines Flugzeuges, das einen weiteren Kondensstreifen über den Himmel zog.
»Und, was sagst du? Was sollen wir jetzt machen?«, unterbrach der alte Horvat das Schweigen und meinte damit: Also, Patrick, kümmere dich gefälligst darum!
»Die Polizei informieren!«, hätte ich ihm antworten sollen. »Auch wenn das tatsächlich der Hund meiner Großeltern sein sollte, ist das nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Polizist mehr!«
Ich fragte mich, weshalb ich seiner Bitte überhaupt nachgekommen und mit ihm mitgefahren war.Immerhin hatte ich selbst genügend Probleme am Hals. Ich hätte mit den Schultern zucken, mich zu Hause einschließen, die Jalousien hinunterlassen und ein paar von diesen weißen Wunderpillen nehmen sollen, mit deren Hilfe ich in der Regel zumindest ein wenig Schlaf fand. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören, mich um meinen geklauten Wagen kümmern und Anzeige erstatten sollen.
Vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen.
Vielleicht wäre im Verborgenen geblieben, dass der Teufel schon viel länger, als wir alle gedacht hatten, sein Unwesen in Grundendorf trieb.
Doch stattdessen seufzte ich und sagte: »Was soll’s, ich werd mich darum kümmern. Kannst du mich zu ihnen fahren?«
3
In der Werbung wird das sommerliche Marchfeld in etwa so dargestellt: Der Himmel tiefblau, kaum eine Wolke zu entdecken – und wenn doch, dann sind sie so klein und strahlend weiß, dass sie wie Wattebäusche aussehen. Die tief stehende Sonne strahlt und taucht die Landschaft in ein prächtiges Sommerbunt. Die Weizenfelder liegen golden da, durchzogen von feuerrotem Klatschmohn und Sonnenblumen in sattem Gelb. Ab und zu ein saftiger Windschutzgürtel in den verschiedensten Grüntönen, dessen Blätter im lauen Lüftchen rascheln. Unzählige Vögel zwitschern ihre fröhliche Melodie, zwei Hasen sprinten um die Wette, ein Reh sieht ihnen aus der Ferne dabei zu. Irgendwo tuckert ein orangefarbener Traktor auf einem Feldweg dahin und ein glücklicher, braun gebrannter Bauer winkt aus dem Führerhaus. Auf dem Acker daneben eine bäuerliche Großfamilie bei der Spargelernte – auch wenn die Erntezeit dafür schon längst vorüber ist. Sie lachen, sind stolz, haben eine schöne Zeit.
Lisa hatte bei solchen Bildern immer laut geseufzt.
Und mir ging es zunehmend wie ihr.
Es war doch alles bloß eine Lüge.
In der Werbung wird kein Wort über die Milliarden und Abermilliarden Mücken verloren, die jeden Sommer über die Region entlang der March, einem kleinen Fluss, der sich an der ostösterreichischen Grenze entlangschlängelt, hereinfallen. Davon, dass sie es einem an besonders schlimmen Tagen unmöglich machen, sich im Freien aufzuhalten. Auf den bunten Bildern sieht man das Gift nicht, das über den Äckern versprüht wird. Das sich im Gemüse und im Erdboden einnistet, vom Wind in die Gärten der Menschen getragen wird und in die Sandkisten der Kinder. Man erfährt nichts von den fehlenden Arbeitsplätzen, dem Aussterben der Bauern und Betriebe und der Abwanderung der jungen Menschen. Davon, dass es, als ich noch ein Kind gewesen war, vier Gast- und Kaffeehäuser in meinem Heimatort Grundendorf gegeben hatte und dass mittlerweile das offizielle gastronomische Monopol bei der Kantine des Fußballvereins lag, die nur an zwei Abenden in der Woche geöffnet hatte. Das Shopping-Angebot wurde von einem verbeulten Zigarettenautomat abgerundet, der sich nicht selten weigerte, die Glimmstängel trotz des korrekt eingeworfenen Betrags auszuspucken. Zum Glück war ich Nichtraucher. Der einzige Geldautomat Grundendorfs war aufgrund zu hoher Betriebskosten abmontiert worden und nun klaffte ein Loch in der Fassade des Bankhauses, das an nur zwei Nachmittagen in der Woche geöffnet hatte.
Auch wenn es niemand so recht wahrhaben wollte: Grundendorf lag im Sterben.
Wir hatten das kleine Wäldchen, in dem der tote Hund lag, hinter uns gelassen und fuhren eine schmale, holprige Schotterstraße entlang, die ins knapp einen halben Kilometer entfernte Grundendorf führte. Dabei strahlte die Sonne bereits so kräftig, dass sie den Himmel in ein gleißendes Weiß färbte, das nicht schön war, sondern einfach nur blendete.Ich fluchte in Gedanken und musste meine Augen zusammenkneifen, um überhaupt etwas erkennen zu können. Keine Ahnung, wo meine Sonnenbrille abgeblieben war. Den bisherigen Sommer hatte ich kaum das Haus verlassen und im abgedunkelten Wohnzimmer hatte ich keinen Gedanken an sie verschwendet.
Bald ging die Schotterstraße in eine schlecht asphaltierte Straße über, die mit Schlaglöchern übersät war. Über dem rissigen Asphalt flimmerte die aufgeheizte Luft. Das Display im bereits in die Jahre gekommenen olivgrünen Jeep des alten Horvat zeigte eine Außentemperatur von 32 Grad an – und das, obwohl es noch nicht einmal halb acht war. Ohne die klapprige Klimaanlage, die auf zweithöchster Stufe lief, wäre es wohl kaum auszuhalten gewesen. Im Wageninneren schwebte ein undefinierbarer, strenger Geruch. Ich konnte es kaum erwarten, ihm zu entfliehen. Draußen wehte nicht das leiseste Lüftchen und die Blätter in den Nuss- und Kirschbäumen zu beiden Seiten der Straße hingen völlig regungslos da. Keine Menschenseele war auf den Feldern zu entdecken, keine Hasen, Rehe oder andere Tiere, nur überdimensionale Bewässerungsanlagen, die unermüdlich gegen die Trockenheit ankämpften. Das ganze Land schien ausgedörrt und tot. Selbst die monströsen Rotorblätter der unzähligen Windräder, die monatlich mehr zu werden schienen, regten sich keinen Millimeter. Sie wirkten wie erstarrte Abgesandte einer fremden Welt.
Wir überquerten die Bahngleise und passierten das windschiefe Grundendorfer Ortsschild. Als wir das Dorf durchquerten, war nicht ein einziger Mensch zu entdecken.
Der alte Horvat, Valentin und ich hatten die bisherige Fahrt über kein Wort gesprochen. Jetzt machte er das Radio an. Es liefen gerade die ersten Akkorde von Bon Jovis »Always«. Er drehte eine Spur lauter. Vermutlich, um die drückende Stille zu verdrängen und weil er dachte, mir damit einen Gefallen zu tun, denn er wirkte auf mich nicht unbedingt wie der Typ Mann, dem Bon Jovi oder Rockschnulzen generell gefielen. Ich nahm es ihm nicht übel. Wie sollte er auch ahnen, dass mit jedem Ton des Songs das Loch in meinem Herzen immer größer wurde. Es war eines von Lisas absoluten Lieblingsliedern, sie liebte solche Rock-Balladen.
It’s been raining since you left me
Now I’m drowning in the flood
…
Ich vermisste sie.
So sehr.
Ich versuchte zu schlucken, doch der Kloß im Hals wurde immer größer. Meine Augen wurden wässrig. Ich schaute aus dem Fenster und versuchte mir nichts anmerken zu lassen.
Ich fragte mich, was ich hier eigentlich tat. Warum überließ ich die Angelegenheit nicht Wimmer und meinen ehemaligen Kollegen? Sollten sie sich doch darum kümmern. Weshalb mischte ich mich ein? Ich hatte doch wohl selbst genug Sorgen. Ich hätte mich vom alten Horvat nach Hause bringen lassen sollen und nicht zum Hof meiner Großeltern.
Gut, vielleicht war es tatsächlich ihr Hund gewesen, aber was sollte ich schon machen? Seit Monaten hatte ich sie nicht mehr gesehen und nun sollte ausgerechnet ich ihnen diese traurige Nachricht überbringen? Mein Großvater war so schon nie gut auf mich zu sprechen gewesen, weshalb, wusste ich nicht. Selbst damals nicht, als meine Mutter gestorben war und ich ein knappes Jahr lang bei meinen Großeltern gewohnt hatte. Sosehr ich mich auch bemüht hatte, ihm zu genügen, ich hatte stets den Eindruck gehabt, dass ihm die paar Monate, bis ich auf das 80 Kilometer entfernte Internat gehen würde, nicht schnell genug hatten vergehen können. Mit jeder Geste, mit jedem Blick, den er mir seit jeher zugeworfen hatte, hatte er mir vermittelt, mich nicht in seiner Nähe haben zu wollen. Und das würde sich mit dieser schlechten Nachricht wohl kaum ändern.
»Weißt du, Patrick, dein Opa ist halt, wie er ist«, hatte meine Oma mich immer zu trösten versucht, wenn sie gemerkt hatte, dass mir seine raue Art und die Kälte zu nahe gegangen waren. »Wir werden ihn nicht ändern können. Aber du musst wissen, dass er dich trotzdem lieb hat.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Doch, Patrick, das tut er. Ich weiß es.«
Jedes Mal aufs Neue hatte ich mich an die Worte meiner Oma geklammert – vermutlich, weil ich mir so sehr gewünscht hatte, dass ein Funken Wahrheit darin lag. Doch an seinem Verhalten mir gegenüber hatte mein Großvater niemals etwas geändert.
Jetzt fragte ich mich, ob er mir gleich eine Standpauke halten oder mich gar ignorieren würde. Der Gedanke an beides ließ meinen Magen verkrampfen. Garantiert würde es in einen erneuten Streit ausarten.
Dreh um!, brüllte ich in Gedanken den alten Horvat an. Ruf den Wimmer an, der soll sich der Angelegenheit annehmen.Ich hab, verdammt noch mal, genug durchgemacht! Ich wollte nach Hause.
Doch ich blieb stumm und wir fuhren weiter.
4
Vielleicht war es so, dass mir mein Beruf fehlte. Sehr wahrscheinlich sogar. Schon im Kindergartenalter hatte ich jedem erzählt, dass ich einmal Polizist werden wollte. Auf die Frage, was ich mir zum Geburtstag, zu Weihnachten oder irgendeinem anderen Anlass wünschte, kam es stets wie aus der Pistole geschossen: Ein Polizeiauto. Mein immer weiter wachsender Sinn für Gerechtigkeit, mein Harmoniebedürfnis, mein Verlangen, anderen zu helfen und darauf zu achten, dass es allen gut ging – das alles hätte wohl gar keine andere Berufswahl zugelassen.
Kitschig, ich weiß. Aber so war ich nun mal gewesen.
Polizist zu sein hatte mich immer mit einem gewissen Stolz erfüllt. Ich hatte meinen Beruf geliebt, ihn ernst genommen und einen Sinn darin gesehen.
Bis vor wenigen Monaten jedenfalls.
Seitdem war alles anders. Seitdem schien nichts mehr einen Sinn zu haben. Absolut nichts.
Komm schon, reiß dich zusammen!
Während Bon Jovi vor sich hin schmachteten, versuchte ich die trüben Gedanken abzuschütteln und die Tränen zu unterdrücken. Auf keinen Fall wollte ich den alten Horvat und Valentin sehen lassen, was für ein nervliches Wrack ich mittlerweile geworden war. Ich wollte keine Erinnerung mehr zulassen und mich auf die traurige Nachricht konzentrieren, die ich meinen Großeltern zu überbringen hatte – wenn es sich bei dem toten Tier tatsächlich um ihren Hund handelte.
»Ich sag’ dir, Patrick, das wird immer schlimmer«, durchbrach der alte Horvat das Schweigen zwischen uns, schielte kurz zu mir auf den Beifahrersitz und dann wieder vor auf die Straße.
Sein Sohn lehnte sich von der Rückbank aus zwischen die beiden Vordersitze, als wollte er damit zeigen, dass er trotz seiner Stille am Gespräch teilnahm. Mir fiel auf, dass er nicht angegurtet war.
»Was wird immer schlimmer?«, fragte ich.
»Das mit den Diebstählen.«
»Mh«, machte ich, weil ich gegenteiliger Meinung war, aber keine Lust auf dieses Gespräch hatte. Außerdem wäre ich klar in der Defensive gewesen, immerhin war ganz offensichtlich mein Wagen gestohlen worden.
»Ich meine, jetzt muss man schon Angst haben, dass einem das Auto vom eigenen Grundstück gestohlen wird.«
Ich sagte nichts.
»Wann hast du es denn zum letzten Mal gesehen?«
»Weiß nicht.«
»Nur ungefähr?«
Ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wusste nicht einmal, wann ich es zum letzten Mal verwendet hatte. Alles, was ich wusste, war, dass es heute Morgen, nachdem der alte Horvat mich aus den Federn geläutet und mich zum Mitkommen überredet hatte, nicht mehr da gewesen war. Da ich keine Garage hatte und die Straße vor meinem Haus schmal und aufgrund einer leichten Kurve unübersichtlich war, hatte ich meinen alten Golf seit jeher hinter der Gartenmauer auf dem schmalen Grünstreifen zwischen dem Feldweg und meinem Grundstück geparkt. Niemals hätte ich gedacht, dass er dort hinten Dieben ins Auge fallen würde. Außerdem war der Wagen alt und wirklich nicht mehr gut in Schuss. Wer stahl so ein Auto?
»Du solltest Anzeige erstatten, aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen«, sagte der alte Horvat.
Ich nickte.
Den Rest der Fahrt schwiegen wir.
Meine Großeltern lebten auf einem einsamen Hof, der etwa 100 Meter außerhalb Grundendorfs auf einer leichten Anhöhe lag. An die Rückseite grenzte ein Wald, an den übrigen Seiten war der Hof von hohem Mais und Weizenfeldern umgeben. Wenn das Korn den höchsten Stand erreichte, war aus der Ferne nur noch das Dach ihres Hauses zu sehen. Um das Gebäude herum standen unzählige wild wuchernde Büsche und Bäume in scheinbar völlig willkürlicher Anordnung – das Bild erinnerte mich an ein Pokerbrett, auf dem man die Würfel einfach hatte liegen lassen. Auf einem Ast der riesigen, uralten Eiche, die in einer der unteren Ecken des Grundstücks thronte, hatte mir mein Großvater, als ich noch ein Kind gewesen war, eine Schaukel montiert. Das vermoderte Brett hing dort immer noch an den rissigen Seilen und schaukelte im Wind. In den mächtigen Stamm der Eiche hatte ich damals mit einem Messer meinen Namen geritzt. Es war mein Platz auf dem Hof gewesen.
Abgegrenzt wurde das weitläufige Grundstück von einem morschen Holzzaun, dessen weiße Lackierung an allen Ecken und Enden abblätterte. Früher hatte mein Großvater solche Dinge instand gehalten, doch mittlerweile war er dazu nicht mehr in der Lage. Auch wenn er es niemals zugegeben hätte, so konnte man ihm den Frust darüber sehr wohl ansehen. Vielleicht war ich ja sein Ventil dafür.
Das Haus war so geräumig, dass es wohl ausreichend Platz für eine Großfamilie samt Angestellten geboten hätte. Doch Oma und Großvater lebten dort mit Julia alleine. Vor gut fünf Jahren hatten sie meine damals siebenjährige Cousine aufgenommen, nachdem deren Eltern bei einem Autounfall verstorben waren. Ein Mann, bei dem später 2,1 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen worden waren, hatte in einer Kurve nahe Obermarch die Kontrolle über seinen alten Opel verloren und den Wagen von Julias Eltern frontal gerammt. Ihre Eltern waren auf der Stelle tot gewesen, der betrunkene Unfallverursacher hatte schwer verletzt überlebt und saß seitdem im Gefängnis.
Während Bon Jovi sich nun dem herzzerreißenden Finale von »Always« näherten, drosselte der alte Horvat die Geschwindigkeit, setzte den Blinker, obwohl weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen war, und bog von der holprigen Landstraße in den noch holprigeren Feldweg ein, der hinauf zum Hof meiner Großeltern führte. Kies knirschte unter den Reifen und Steine knallten gegen den Unterboden des Wagens. Staubtrockene Erde wurde aufgewirbelt, wir zogen eine beträchtliche Wolke hinter uns her. Im Rückspiegel war kaum noch etwas zu erkennen.
Obwohl ich mir pausenlos einzureden versuchte, dass mich die Sache im Grunde nichts anging, merkte ich, dass Nervosität in mir hochstieg. Garantiert würde ich unzählige Fragen von Oma bezüglich meines Wohlbefindens über mich ergehen lassen müssen. Ich würde erklären müssen, weshalb ich in den letzten Wochen und Monaten nicht ans Telefon oder an die Tür gegangen war. Weshalb ich allem und jedem aus dem Weg gegangen war und nichts von mir hatte hören lassen, keine Mobilboxnachricht beantwortet hatte. Ich würde ihren gekränkten Blick kaum ertragen können. Mein Großvater würde mir Vorwürfe machen, würde mir sagen, dass Oma sich große Sorgen um mich gemacht hatte, dass sie nicht hatte schlafen können. Dass sie wegen mir geweint hatte. Wahrscheinlich würde er sogar schreien.
Ich wollte nach Hause.
Doch nun war es zu spät, um umzukehren. Wir hatten den Hof erreicht und ganz bestimmt hatten uns meine Großeltern längst den Weg hinauffahren sehen. Die Staubwolke war wohl schwer zu übersehen gewesen.
Der alte Horvat hielt auf einem unebenen Untergrund aus Erde, Kies und ausgedörrten gelben Grasbüscheln.
»Soll ich warten?«, fragte er.
»Nein, danke.« Ich würde mir den Wagen meiner Großeltern ausborgen oder im Notfall auch zu Fuß zurechtkommen.
Wir verabschiedeten uns und als ich die Tür öffnete und mich aus dem Sitz nach draußen stemmte, schlug mir viel zu heiße Luft entgegen. Es schien, als stieg ich in einen laufenden Backofen. Sofort traten Schweißperlen auf meiner Haut hervor. Ein leichtes Schwindelgefühl regte sich in mir und kurz wurde mir schwarz vor Augen. Ich stützte mich an der Wagentür ab und wartete ein paar Sekunden, bis ich mich gefangen hatte.
»Alles in Ordnung?«, wollte der alte Horvat wissen.
Valentin starrte mich vom Rücksitz aus an.
»Geht schon, danke.«
»Sicher?«
»Sicher.«
Ich versuchte mich zusammenzureißen, musste die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter mich bringen. Es war jetzt schon unerträglich und im Laufe des Tages würde es draußen wohl nicht mehr auszuhalten sein. In diesem Moment ahnte ich, wie sich ein Fisch außerhalb des Wassers wohl fühlen musste. Ich spürte immer größeres Unbehagen in mir aufsteigen, wollte zurück in den Wagen und so schnell wie möglich in mein abgedunkeltes Wohnzimmer. Wollte in den Polstern meiner Couch versinken, der Stille lauschen. Einfach nur alleine sein.
Doch stattdessen warf ich ohne ein weiteres Wort die Wagentür zu, rieb mir das verschwitzte Gesicht und atmete tief durch. Die Luft schmeckte staubig.
Der alte Horvat setzte mit seinem olivgrünen Geländewagen zurück und fuhr davon. Ich atmete noch viel mehr Staub ein und wurde von einem kräftigen Hustenanfall gebeutelt. Es dauerte eine Weile, bis ich mich gefangen hatte und auf das konzentrieren konnte, was vor mir stand.
Ich blickte zum Haus meiner Großeltern. Die weiße Fassade strahlte so kräftig im Sonnenlicht, dass ich meinen Großvater, der in seinem Rollstuhl auf der Veranda saß, zunächst gar nicht wahrnahm. Erst als er an seiner Zigarette zog und die Glut feuerrot aufleuchtete, bemerkte ich ihn. Ich zögerte. Dann hob ich die Hand etwas unbeholfen zu einem stillen Gruß und wünschte mich ganz weit fort.
Dreh um und geh heim!
Doch ich atmete erneut tief durch und ging auf ihn zu.
»Schon da?«, rief er mir zu und ich glaubte, neben der gewohnt schlechten Laune auch eine gewisse Überraschung in seiner Stimme gehört zu haben. Rauch umhüllte ihn und er nahm einen erneuten tiefen Zug von seiner Zigarette.
Ich verstand nicht, was er mir damit hatte sagen wollen. Fasste es sofort als Kritik auf, mich so lange nicht gemeldet zu haben. Während ich mich ihm weiter näherte, suchte ich nach Worten der Rechtfertigung, fand jedoch keine. Unbewusst spannte ich meinen Nacken an und stellte mich schon auf ein Streitgespräch mit ihm ein. Es würde eskalieren. Wieder einmal. Ganz bestimmt sogar.
Doch dazu sollte es nicht kommen. Denn plötzlich ging die Haustür auf und meine Oma kam hinausgestürmt.
»Patrick, Gott sei Dank!«, rief sie.
Schon in der allerersten Sekunde und aus der Entfernung sah ich ihr an, dass etwas nicht stimmte. Sie wirkte aufgelöst, war aber darum bemüht, die Fassung zu wahren – das Ergebnis war eine Grimasse, die schlagartig ein noch mieseres Gefühl in mir weckte. Als sie näher herankam, sah ich, dass ihre Augenlider geschwollen waren und das Weiß um ihre Iris herum rötlich gefärbt war.
Oma hatte geweint.
Diese Erkenntnis war wie ein Stich ins Herz.
Sie fiel mir um den Hals. »Wie bist du denn jetzt so schnell hergekommen?«
Ich verstand nicht, erwiderte ihre Umarmung und klopfte unsicher mit der flachen Hand auf ihren Rücken. Sollte auch das eine Kritik gewesen sein?
»Ich hab doch erst vor fünf Minuten angerufen«, fuhr sie fort.
»Wen?«
»Was, ›wen‹?«
Nun begriff sie nicht und löste sich aus der Umarmung. Ihre Augen glänzten wie gesprungenes Glas – jeden Moment würden die Tränen wieder zu fließen beginnen. Aber da war noch etwas in ihrem Blick. Ein Gefühl, das ich erst jetzt erkannte: Angst.
Mein Herz sackte mir in die Hose.
»Was ist denn los?«, fragte ich und meine Stimme hatte dabei gezittert. »Wen hast du angerufen?«
»Na, die Polizei.«
»Warum denn?«
»Na, wegen Julia.«
»Wieso, was ist mit ihr?«
»Sie ist verschwunden!«
5
Um uns Grundendorfer besser verstehen zu können, muss man unsere Vergangenheit kennen. Man muss wissen, was in den letzten dreieinhalb Jahren und vor allem im letzten Winter passierte. Und natürlich muss man die geografische Lage des Ortes in Betracht ziehen, die Isolation.
Grundendorf hat nur knapp 600 Einwohner und liegt am östlichsten Rand Österreichs, in einem scheinbar vergessenen Winkel des Marchfelds – als ich noch ein Kind war, hatte Grundendorf weit über 800 Einwohner. Die slowakische Grenze befindet sich in unmittelbarer Nähe und es gehört zum Alltag, dass die Mobiltelefone der Bewohner immer wieder versuchen, sich in ein slowakisches Netz einzuwählen. Früher hatte es die Bewohner verängstigt, wenn die slowakischen Nachbarn mit schrottreifen Ostblockkisten und klapprigen, verrosteten Anhängern durch den Ort gezogen waren, um brauchbaren Müll einzusammeln. Nun machte es den Grundendorfern Angst, dass die einst so armen Nachbarn mit maßgeschneiderten Anzügen und Seidenkrawatten oder in teuren Kostümen in ihren Mercedes oder BMWs durch den Ort rauschten, um nach Wien in die Arbeit zu pendeln. Zu der Angst um ihre Sicherheit hatte sich bei den Grundendorfern also jene um ihre finanzielle Zukunft gesellt. Und damit verbunden Wut und eine geballte Ladung Frust auf das Unbekannte, das sie überholt zu haben schien.
Die Grundendorfer sahen und sehen den Vorteil der nahen Großstadt Bratislava nicht. Nein, schlimmer noch: Sie sehen Bratislava nicht. Denn für sie hört hinter der March ihre Welt auf zu existieren. Das Unbekannte beginnt, das endlose Schwarz. Das Nichts, vor dem man sich fürchten muss, das früher oder später über sie hereinfallen wird.
Die Grundendorfer sehen nur die Distanz zu Wien. Sie beklagen, dass man dort offensichtlich auf sie vergessen hat. Dass die Straßen nicht erneuert werden, die schon so lange versprochene neue Autobahn zwischen Wien und Bratislava, die jede Menge Arbeitsplätze bringen würde, nie gebaut wird, dass die Zugverbindung zwischen den beiden Hauptstädten immer noch eingleisig und nicht elektrifiziert ist und dass die meisten Züge nicht in Grundendorf halten, sondern mit Höchstgeschwindigkeit durchbrausen.
Man könnte meinen, dass sich in dieser Abgeschiedenheit und Einsamkeit eine besonders starke Dorfgemeinschaft herausgebildet hätte. Doch so etwas hatte es in Grundendorf nie gegeben. Die einzigen beiden Vereine des Ortes, die Freiwillige Feuerwehr und der Fußballklub, bekriegen einander seit jeher und kämpfen gegen schrumpfende Mitgliederzahlen – wofür sie den jeweils anderen verantwortlich machen. Wer ein Fest der Feuerwehr besucht, würde niemals zu einem des Fussballvereins gehen und umgekehrt. So ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Grundendorf war kein homogenes Ganzes, sondern vielmehr eine Zweckgemeinschaft, in der sich jeder selbst der Nächste war und so manch einer gar glaubte, dass Solidarität bloß der deutsche Name für dieses Kartenspiel auf ihrem Computer war. Bei der kleinsten Erschütterung drohte dieses fragile Gebilde zu brechen.
Neid und Misstrauen waren also die Masken, hinter denen sich der Hass in Grundendorf eingeschlichen hatte. Dass er seine Verkleidung im Laufe der Zeit zu wandeln verstanden hatte, war uns spätestens vor etwa dreieinhalb Jahren bewusst geworden. Denn da hatte der Schrecken seinen Lauf genommen …
Alles hatte in einer eisigen Februarnacht begonnen, mit dem Verschwinden der beiden 17-Jährigen, Linda und Markus. Angeblich hatte Linda das alljährliche Faschingsfest im Ort besuchen wollen, doch dort kam sie niemals an. Markus, ihr Mitschüler, war mental beeinträchtigt, etwas langsam im Kopf oder »plemplem«, wie es viele Grundendorfer ausgedrückt hatten. Auch von ihm fehlte seit dieser Nacht jede Spur.
Nach dem Verschwinden der beiden kamen schnell Gerüchte auf, wonach Markus Linda nachgestellt haben, ja gar ein Perverser gewesen sein soll. Hatte er sie etwa entführt oder noch Schlimmeres? Immer wildere Spekulationen kursierten im Dorf und allmählich begannen die gegenseitigen Verdächtigungen. Kaum jemand, der nicht einmal in den Fokus der Anschuldigungen geraten wäre. Immerhin konnte Markus es ja wohl kaum alleine geschafft haben, Linda zu entführen. Oder etwa doch?