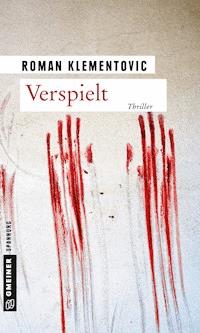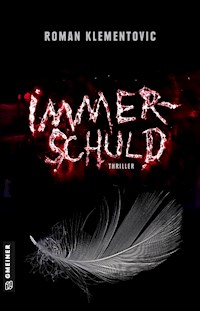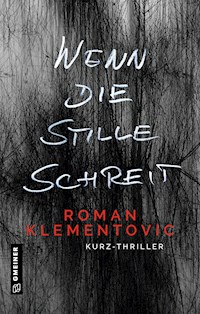Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: GMEINERHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller von Roman Klementovic
- Sprache: Deutsch
Jana hat schon lange keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, dem der Mord an ihrer Mutter nie nachgewiesen werden konnte. Doch als sie die Nachricht erreicht, dass es schlimm um ihn steht, kehrt sie in ihre Heimat zurück und betritt zum ersten Mal seit Jahren wieder ihr Elternhaus. Dabei verschlägt es ihr den Atem. Es stinkt bestialisch. Müllberge türmen sich bis unter die Decke. Ihr Vater ist zu einem Messie geworden. Im ersten Schock darüber versucht Jana, zumindest ein wenig Ordnung zu schaffen. Und macht dabei eine verstörende Entdeckung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman Klementovic
Wenn der Nebel schweigt
Thriller
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Song-Zitat auf Seite 7 entnommen aus: Mein schwarzes Herz von Caliban. Text: Benjamin Richter und Andreas Dörner/Caliban. Aus dem Album
Gravity von Caliban © 2016 Century Media Records Ltd.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ervin-Edward / shutterstock
ISBN 978-3-8392-7390-6
Widmung
Für Ana
Zitat
Hast mich geschaffen,
hast mich zerstört.
Gib mir zurück, was mir gehört.
Aus Mein schwarzes Herz
von Benjamin Richter / Andreas Dörner
Caliban
Prolog
Freitag, 23. Oktober 2009, 0.23 Uhr
Ich war 16, als ich aus meinem Schlaf schreckte. Und im Bett hochfuhr.
Was …?
Erst begriff ich nicht, weshalb ich aufgewacht war. Hatte ich geträumt?
Einen kurzen Moment lang, vielleicht zwei, höchstens drei Sekunden, starrte ich ins Dunkel. Und lauschte der Stille.
Plötzlich ein Schrei. Gefolgt von einem heftigen Rumpeln.
Kein Albtraum! Der Lärm kam aus dem Erdgeschoss.
Jetzt war ich hellwach.
»Mama?«, rief ich.
Keine Antwort.
Stattdessen Gekreische. Ein Krachen. Ein Poltern. Und wieder ein Schrei, der eindeutig von meiner Mutter kam.
Mein Puls schoss in die Höhe. Ich schwang die Beine aus dem Bett. Wollte aufspringen und hinunterlaufen. Hielt dann aber doch inne. Und krallte mich stattdessen in die Bettdecke. Weil die Angst mich gepackt hatte.
»Raus hier!«, glaubte ich, meine Mutter zu hören. Und: »Verschwinde!«
Ein Klirren. Etwas ging offenbar zu Bruch.
»Mama?« Deutlich leiser als zuvor.
Ein letzter Schrei. Ein dumpfer Krach.
Stille.
Viel zu lange.
Dann hastige Schritte.
Und wieder Stille. Gespenstische Stille.
Sekunden verstrichen.
Jetzt war es kaum noch mehr als ein Flüstern, das mir über die Lippen kam: »Mama?«
Keine Antwort. Stattdessen dieses unheilgetränkte Nichts.
Vielleicht sollte ich ja …
Halt, da!
Waren das eben wieder Schritte?
Mein Herz pochte wild.
Erst jetzt kam mir mein Vater in den Sinn. Wie spät war es überhaupt? War er schon daheim?
Ich schaffte es endlich, mich aus meiner Schockstarre zu lösen. Biss die Zähne zusammen, als das Bett unter der Gewichtsverlagerung zu knarren begann. Tastete nach meinem Mobiltelefon auf dem Nachtkästchen und aktivierte das Display.
Grelle schrie mir entgegen.
Ich musste die Augen zusammenkneifen, um etwas zu erkennen.
0.24 Uhr.
Gut möglich, dass er schon zurück war.
Ich zögerte. Traute mich nicht.
Dann viel zu leise: »Papa?«
Stille.
Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte mich in meine Unterlippe gebissen, nahm den Schmerz erst jetzt wahr, schmeckte Blut.
Was sollte ich bloß tun?
Es fiel mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Angst lähmte und verwirrte mich zugleich. Aber dann, auf einmal, begriff ich. Ja, natürlich! Ich musste meinen Vater anrufen! Ihm sagen, dass etwas nicht stimmte. Dass ich Angst hatte. Und er so schnell wie möglich nach Hause kommen musste. Weil da jemand in unserem Haus war. Und Mama nicht mehr antwortete.
Mit zitternden Fingern tippte ich auf meinem Telefon und wählte seine Nummer.
Die Zeit schien stehen geblieben.
Nichts passierte.
Dann doch: »Willkommen in der Sprachbox der Nummer …«
Bitte nicht!
Ich wollte es nicht wahrhaben. Legte auf. Versuchte es ein zweites Mal. Wieder sprang nur die Sprachbox an.
Mist!
Und jetzt?
Unbewusst hatte ich zu atmen aufgehört. In meinen Ohren rauschte das Blut wie ein reißender Strom. Und das Klappern meiner Zähne dröhnte durch meinen Schädel.
Ansonsten herrschte weiter Stille.
Ich legte das Telefon beiseite. Atmete tief durch, dann noch einmal. Zog die Nase hoch. Fasste Mut. Und erhob mich. Aber als der Holzboden unter meinem Gewicht aufknarzte, erstarrte ich sofort wieder. Und hielt abermals die Luft an.
In diesem Augenblick begriff ich nicht, wie absurd mein Gedanke war, dass das Aufknarzen des Bodens mich verraten haben konnte. Wenn jemand im Haus war, hatte er mich ohnehin schon rufen hören.
Komm schon, sei kein Feigling!
Ich nahm all meinen Mut zusammen. Hob das Bein an, setzte einen ersten kleinen Schritt, zögerlich, fast wie in Zeitlupe. Dann einen zweiten. Und noch einen. Aber die Zimmertür schien auf einmal viel weiter entfernt als sonst, fast schon unerreichbar, und der blöde Holzboden viel zu laut. Jedes Knarren glich einem Donnerschlag. Doch ich durfte nicht stehen bleiben! Tapste weiter, immer weiter.
Als ich die Tür endlich erreicht hatte, presste ich mein Ohr dagegen und horchte. Ich sehnte mich nach einem Anzeichen dafür, dass alles in Ordnung war. Dass Mama und Papa miteinander sprachen und lachten. Und die Welt noch heil war.
Doch da war nichts.
Ich war den Tränen nahe. Griff die Klinke mit beiden schweißnassen Händen. Umklammerte sie mit aller Kraft, wie einen rettenden Anker. Und spürte, wie die Verkrampfung plötzlich von meinen Händen aus auf meinen gesamten Körper ausstrahlte. In meinem Nacken zog es schmerzhaft. Doch mir blieb nichts anderes übrig, als es zu ignorieren. Ich drückte die Klinke ganz sachte nach unten, Millimeter für Millimeter. Und zog die Tür vorsichtig auf.
Ich war auf einen Angriff gefasst. Erwartete, dass jeden Moment eine finstere Gestalt um die Ecke springen, die Tür noch weiter aufdrücken, mich zu Boden werfen und sich auf mich stürzen würde.
Aber nichts passierte.
Erst jetzt fiel mir Chris ein, und ich konnte nicht glauben, dass ich bisher nicht an ihn gedacht hatte. Mein Gott, ich war so blöd!
Ich blickte zurück zu meinem Bett, versuchte, mein Telefon dort oder auf dem Nachtkästchen auszumachen. Aber es war so finster, dass ich es nicht entdecken konnte.
Sollte ich zurückschleichen und ihn anrufen?
Ich zögerte, wusste nicht weiter. Und fürchtete, dass ich dadurch wertvolle Zeit verlor.
Später konnte ich nicht mehr sagen, was mich davon abgehalten hatte, Chris um Hilfe zu bitten. Jedenfalls entschied ich mich dagegen. Ich holte tief Luft. Ließ die Klinke los, um die ich mich immer noch verkrampft hatte. Streckte den Kopf durch den schmalen Spalt hinaus in den Flur.
Und lauschte.
Nichts zu hören.
»Mama?«, flüsterte ich, und von all der Stille umgeben, hörte es sich an, als brüllte ich regelrecht.
Keine Reaktion.
»Papa?«
Nichts.
Ich spürte, wie mir eine Träne über die Wange lief, und wischte sie mit dem Handrücken weg. Aus Reflex zog ich wieder die Nase hoch. Und erschrak darüber, wie laut es sich angehört hatte.
Ich horchte weiter starr, um Anzeichen dafür auszumachen, dass mich jemand gehört hatte. Oder die Treppe hochkam und sich mir näherte. Dabei löste sich eine weitere Träne aus einem meiner Lider, und noch eine. Und auch die Nase hörte nicht mehr auf zu laufen. Mehrmals wischte ich sie mir mit dem Unterarm trocken.
Mir war klar, dass ich etwas unternehmen musste, ich konnte ja nicht ewig im Türrahmen stehen bleiben. Also zog ich die Tür noch ein kleines Stück weiter auf. Und bemerkte dabei, dass es ungewöhnlich kühl im Flur war.
Ich machte einen behutsamen Schritt hinaus. Und verharrte auch dort einen Augenblick. Bis ich mich überwinden konnte und in Richtung Treppe schlich.
Der Teppich im Flur ließ mich nahezu geräuschlos vorwärtskommen. Aber trotz meiner Anspannung wusste ich: Die Stufen würden ein Problem werden, die knarrten bei jedem Schritt. Mama hatte sich oft darüber beschwert und Papa gefragt, ob es denn wirklich nichts gäbe, was man dagegen tun könnte. Es würde unmöglich sein, unbemerkt nach unten zu kommen.
Am Absatz wartete ich deshalb.
Und blickte hinunter.
Wie in einen bedrohlichen Schlund.
Ein Lichtschimmer fiel in den Eingangsbereich, vermutlich aus der Küche. Oder dem Wohnzimmer. Der Boden glitzerte nass, Schmutz klebte auf den weißen Fliesen. Und die Eingangstür stand sperrangelweit offen.
Die Kälte zog zu mir hoch, packte mich und ließ mich frösteln.
Ich hatte keine Ahnung, was hier los war. Aber mit jeder Sekunde, die verstrich, breitete sich die Angst davor, dass es etwas ganz, ganz Schlimmes war, weiter in mir aus. Mein Herz klopfte jetzt so heftig gegen meinen Brustkorb, dass es schon fast wehtat. Immer mehr Tränen liefen mir über die Wangen, sammelten sich am Kinn und tropften zu Boden. Ich zitterte am ganzen Körper, fühlte mich wackelig auf den Beinen. Konnte nicht einschätzen, ob sie mich bis ganz nach unten tragen würden. Und auch meine Zähne klapperten immer heftiger.
»Mama?«
Ich rief mehr, um mich abzulenken. Hatte die Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, längst aufgegeben. Doch plötzlich glaubte ich ein Wimmern zu hören.
Konnte das sein?
Ich horchte konzentriert. Versuchte, das rauschende Trommeln in meinen Ohren auszublenden. Aber ich war mir nicht sicher.
Etwas lauter: »Mama?«
Vergeblich.
»Bist du hier?«
Nichts.
»Papa?«
Sollte ich vielleicht doch lieber Chris anrufen?
Auf einmal wieder dieses Wimmern. Ja, eindeutig!
»Mama?«
Ich hielt mich am Geländer zu meiner Rechten fest. Nahm die erste Stufe, ohne dass ich dies so richtig wahrgenommen hatte. Das Knarren zerschnitt die Stille. Aber es war mir gleich. Ich musste runter. Musste wissen, was da los war. Und ob Mama vielleicht meine Hilfe brauchte.
»Bist du da?«
Die nächste Stufe.
»Papa?«
Endlich eine Antwort, wie ein heftiger Stromschlag: »Komm nicht weiter, Jana!«
Die Stimme meines Vaters schien aus dem Wohnzimmer gekommen zu sein. Und löste so viel und gleichzeitig zutiefst Widersprüchliches in mir aus. Da war auf einmal diese unglaubliche Erleichterung. Darüber, dass er schon zu Hause war. Dass er mich beschützen konnte – vor wem oder was auch immer. Dass alles nur ein Missverständnis war. Beinahe wäre mir ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn da nicht der Klang seiner Stimme gewesen wäre, der ganz einfach nichts Gutes verheißen konnte. Da war plötzlich auch die Frage danach, warum er bisher geschwiegen hatte. Danach, wieso er jetzt nichts mehr sagte. Oder mir entgegenkam. Mich anlächelte. Mir erklärte, warum Mama geschrien hatte. Woher der Krach gekommen war. Mir versicherte, dass alles gut war. Und er mich gemeinsam mit Mama zurück ins Bett brachte.
All diese Gedanken und Fragen waren mir binnen Sekundenbruchteilen durch den Kopf geschossen. Mir wurde schwindelig. Ich begriff immer noch nicht, was passiert war. Oder was da immer noch im Gange war. Wie sollte ich auch?
Doch jetzt, mit einem Mal, schlug mein schlechtes Gefühl in eiskalte Panik um.
Am liebsten hätte ich auf der Stelle kehrtgemacht. Wäre zurück in mein Zimmer gelaufen. Hätte mich dort eingesperrt, alle Lichter angemacht und mich dennoch unter der Decke verkrochen. Hätte dort gewartet, bis meine Mutter an die Tür klopfte und mir versicherte, dass alles gut war. Dass sie mich liebte. Und für immer bei mir bleiben würde.
Ich schämte mich so sehr. Nie wieder würde ich meinen Frust an meiner Mutter auslassen, nie mehr wollte ich mich mit ihr wegen Kleinigkeiten zanken. Gott, da war plötzlich so vieles, was mir leidtat. So vieles, was ich ihr sagen wollte.
Aber insgeheim ahnte ich längst, dass ich niemals wieder die Chance dazu haben würde.
Auch wenn mein Vater hier war, vielleicht sollte ich ja besser doch durch die offen stehende Eingangstür hinauslaufen? Ins Dorf? Runter zum See? Oder in den Wald? Bis zur Lichtung? Egal wohin, Hauptsache ganz weit weg?
Doch ich lief weder zurück in mein Zimmer noch aus dem Haus. Stattdessen nahm ich die nächste Stufe.
»Bleib oben, Schatz!«, rief mein Vater ohne jede Kraft in seiner Stimme.
»Was … was ist denn los?«
Wieder wischte ich mir übers Gesicht, der Ärmel meines Pyjamas war schon ganz nass.
»Geh zurück in dein Zimmer!«
Aber ich tat genau das Gegenteil. Stieg eine weitere Stufe hinab. Und noch eine.
»Jana, du sollst wieder hochgehen!«
Ich machte noch einen Schritt nach unten. Der Boden und die Wände schienen immer heftiger ins Schwanken zu geraten. Meine Beine kaum noch Kraft zu haben.
»Hörst du nicht!«
Noch zwei Stufen.
Mein Herz klopfte zum Zerspringen.
»Jana!«
Nur noch eine Stufe.
»Sofort!«
Ich war jetzt im Eingangsbereich. Zu meiner Rechten lag die offen stehende Eingangstür, durch die immer mehr Kälte hereinströmte. Draußen war nichts als nebelverhangenes Dunkelgrau zu sehen. Zu meiner Linken lagen die Küche und das Wohnzimmer, beide hell erleuchtet, aber von meinem Standpunkt aus kaum einsehbar.
»Jana, bitte …«
Keine Frage, die Stimme meines Vaters war aus dem Wohnzimmer gekommen. Nicht mehr so bestimmt wie eben noch, eher weinerlich.
»Bitte, geh in dein Zimmer, Schatz. Bitte.«
LAUF! NICHTS WIE WEG VON HIER!, schrie alles in mir.
Und dennoch bewegte ich mich auf das Wohnzimmer zu.
WAS ZUM TEUFEL TUST DU NUR?
Je näher ich kam, desto deutlicher war das Wimmern meines Vaters zu hören. Und desto größer wurde die einsehbare Fläche. Aber mein Vater war immer noch nicht zu entdecken. Dafür ein Stuhl des Esstischs, der umgekippt auf dem Boden lag.
RENN WEG! LOS, VERDAMMT!
Die Tischdecke lag zerknüllt daneben. Eine zerbrochene Vase. Ein Bilderrahmen. Bücher, die aus dem Regal gefallen waren.
LAUF!
Mit jedem zögerlichen Schritt sah ich mehr von der Verwüstung. Und mit jedem Stück reifte die Gewissheit in mir, dass die Welt aus den Fugen geraten war.
»Bitte, geh in dein Zimmer«, wimmerte und schluchzte mein Vater. »Bitte … bitte …«
Ein letzter kleiner Schritt. Dann hatte ich die Schwelle erreicht. Und blickte vom Türrahmen aus nach links.
Da sah ich ihn.
Und meine Welt gab es nicht mehr.
»Ich habe dir doch gesagt, dass du in dein Zimmer sollst!«
Der Augenblick schien aus der Zeit gefallen.
Sich in alle Ewigkeit zu dehnen.
Nie zu enden.
Nie.
Doch plötzlich drang ein greller, schmerzverzerrter Schrei zu mir durch. Wurde immer lauter und schriller. Und ich begriff, dass ich selbst es war, die sich gerade die Seele aus dem Leib brüllte. Während es mir warm die Beine hinablief, begriff ich, dass sich diese Szene für immer und ewig in meinen Verstand gebrannt hatte:
Mein Vater, wie er da stand. Mit bebenden Schultern. Keuchend, weinend. Wie er zu mir aufsah, aus weit aufgerissenen Augen, mit Blut im Gesicht und an der Kleidung. Wie er seinen Blick wieder von mir abwandte, seine blutverschmierten Hände betrachtete – ungläubig, als wären sie kein Teil von ihm. Als hätte er nichts mit all dem zu tun, was diese eben angerichtet hatten. Und wie er dann zwischen ihnen hindurch zu Boden blickte.
Auf meine Mutter.
Die dort in einer roten Lache lag.
Seltsam verrenkt.
Still.
Tot.
Für immer.
13 Jahre später
Ich hatte es hinaus ins Freie geschafft.
Doch jetzt?
Ich atmete schwer. Riss meinen Blick durch die nächtliche Umgebung. War voller Panik. Wollte um Hilfe schreien, brachte aber bloß ein Krächzen heraus. Die Schmerzen in meinem Kehlkopf trieben mir Tränen in die Augen. Der Schlag eben musste etwas Schlimmes angerichtet haben.
»Hi…«
Es hatte keinen Sinn!
Klappern und Scheppern in meinem Rücken. Ein Fluchen.
Ich fuhr herum. Sah seine Silhouette und den hektisch zuckenden Taschenlampenstrahl. Er schob Müll zur Seite, stieg darüber, bahnte sich einen Weg durch den finsteren Hausflur zu mir. Kam schnell näher.
»Wo willst du hin?«, brüllte er und leuchtete mir direkt ins Gesicht.
Scheiße!
Was tun?
»Glaubst du, du kommst hier weg?«
In der Ferne war das Feuer als orangeroter Schimmer zu erahnen. Ansonsten nichts als nebeldurchzogenes Schwarz.
Meine Gedanken überschlugen sich: Das Auto war keine Option. Ich hatte zwar den Schlüssel dabei, doch ich hatte ein gutes Stück weit abseits geparkt. Und selbst, wenn nicht: Das Öffnen, Einsteigen und Starten des Wagens würde zu lange dauern – bis dahin würde er mich leicht eingeholt haben. Also blieben mir nur zwei Möglichkeiten: die Straße hinunter ins Dorf. Oder in den Wald. Die Straße war beleuchtet, trotz des Nebels wäre ich leicht zu finden gewesen. Normalerweise wäre ich ihm wohl davongelaufen. Aber mit meinem verstauchten Knöchel war ich mir da nicht so sicher. Der Wald hingegen war finster und dicht.
Meine Entscheidung fiel binnen Sekundenbruchteilen. Ich musste ein Versteck finden.
Los!
Unter stechenden Schmerzen rannte ich auf den Waldrand zu. Presste die Augen zusammen. Hob die Arme schützend vors Gesicht. Und preschte durch das dichte Gestrüpp.
Unter meinen Schritten knackten Zweige. Äste, die in der Dunkelheit wie aus dem Nichts auftauchten, peitschten mir ins Gesicht. Kratzten an meiner Haut.
Mein Atem rasselte. Aber ich durfte nicht stehen bleiben. Musste weiter, weiter, weiter!
»Bleib stehen, verdammt!«
Ich riskierte einen Blick zurück. Er hatte jetzt ebenfalls den Wald erreicht. Kam immer näher.
Schneller!
Der Lichtkegel seiner Taschenlampe schnitt nur ganz knapp an mir vorbei. Oder hatte er mich bereits erfasst?
Mein Herz raste.
Plötzlich blieb ich mit meinem verletzten Fuß an etwas hängen. Und alles ging ganz schnell. Ich hatte keine Chance, den Sturz abzufangen. Und knallte mit dem Kopf gegen einen Stamm. Schmerz explodierte hinter meiner Stirn. Ich konnte Blut schmecken, weil ich mir auf die Zunge gebissen hatte.
Einen Augenblick lang war ich außer Gefecht gesetzt. Und sah Sterne.
Dann nahm ich trotz der Benommenheit seine Schritte wieder wahr. Das Brechen von Holz. Viel zu nah.
Los, auf! Sofort!
Ich stemmte mich vom Boden ab, zwang mich aufzustehen. Weiterzulaufen. Aber ich war unsicher auf den Beinen. Die Schmerzen waren schlimmer als zuvor. Die Dunkelheit um mich herum drehte sich. Warm lief es mir die Schläfe hinab.
»Du kannst mir nicht entkommen!«
Ich konnte es hören, er war jetzt direkt hinter mir.
»Hi…!« Ich brach ab, es schmerzte zu sehr. Versuchte es dennoch gleich noch einmal: »Hi…!«
Plötzlich wurde ich an den Haaren zurückgerissen. Mit einer solchen Wucht, dass ich glaubte, skalpiert zu werden. Ich verlor alle Körperspannung. Sofort schlang sich ein Arm um meinen Hals, nahm mich in einen festen Würgegriff. Die Schmerzen in meinem Kehlkopf waren überwältigend.
Mir blieb die Luft weg.
Ich zerrte daran, aber ich war zu schwach. Ich schlug um mich, doch auch das half nichts. Ich trat nach hinten aus, mein Bein fuhr ins Leere.
Seine Stimme ganz nah an meinem Ohr: »Mach es nicht schwerer, als es ohnehin schon ist.«
Der Druck in meinem Kopf stieg an. Hitze breitete sich aus. Ein Kribbeln. Schwindel.
Es war zwecklos. Ich wollte gerade die Augen schließen. Mich meinem Schicksal fügen.
Aber ausgerechnet da tat sich eine kleine Lücke in der dichten Wolkendecke auf. Und auch der Nebel schien sich einen Augenblick lang zu lichten. Der Vollmond kam zum Vorschein und strahlte zwischen den Baumwipfeln hindurch auf uns hinab. Wie ein einsamer Scheinwerfer auf eine Kleintheaterbühne.
Es war wie ein Weckruf, der letzte Energiereserven in mir freisetzte.
Nicht aufgeben!
Ein letztes Aufbäumen. Ich nahm all meine Kräfte zusammen. Wand mich, schlug wie eine Verrückte um mich. Trat noch fester nach hinten aus. Landete einen Treffer. Und noch einen. Es gelang mir tatsächlich, den Druck um meinen Hals zu lockern.
Ich rang nach Luft.
Presste meinen Kopf zur Seite. Fühlte auf einmal seinen Unterarm an meinen Lippen.
Und biss zu.
Sein Schrei an meinem Ohr. Die Taschenlampe auf dem Boden. Faustschläge in meinem Nacken.
Aber ich ließ nicht ab, rammte meine Zähne noch tiefer in sein Fleisch. Und da war es fremdes Blut, das ich schmeckte.
Hoffnung keimte in mir auf.
Jedoch nur ganz kurz.
Denn auf einmal presste er mir seine Finger auf die Augen. Ich riss meinen Kopf hin und her und versuchte, mich aus seinem Griff zu befreien. Aber er ließ nicht von mir ab und drückte zu, immer fester. Bis die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren. Und ich von seinem Unterarm ablassen musste.
Jetzt ließ er endlich von meinen Augen ab.
Ich stolperte zur Seite. Schrie vor Schmerz. Krümmte mich. Presste die Augen zusammen. Drückte mir die Handflächen aufs Gesicht. Und war so abgelenkt, dass ich nicht mitbekam, was hinter mir passierte.
Plötzlich eine Schmerzexplosion an meinem Hinterkopf.
Erst verstand ich nicht. Ich duckte mich aus Reflex. Wollte mich in Deckung bringen. Taumelte. Hatte völlig die Orientierung verloren. Versuchte, etwas zu greifen zu bekommen. Mich auf den Beinen zu halten. Aber ich fuhr ins Leere.
»Hilfe!« Bloß ein gekrächztes Flüstern.
Da traf mich der zweite Schlag. Holz splitterte.
Und mir war klar, dass es vorbei war.
Ich bekam noch mit, dass ich auf die Knie sank. Vornüber kippte. Und ungebremst mit dem Gesicht auf dem nassen Waldboden aufschlug. Dass sich hoch über dem Nebel die massive Wolkendecke wieder vor den Mond schob.
Dann wurde es schwarz.
Zwei Abende zuvor
1
In dem Moment, in dem ich das Unglück kommen sah, war es schon zu spät. Mir blieben nur Sekundenbruchteile. Zu wenig Zeit, als dass ich hätte reagieren können.
Ich hatte den Mann nicht bemerkt. War abgelenkt gewesen. Von dem Adrenalin, das durch meinen Körper schoss. Dem Schweiß, der mir über die Stirn und in die Augen lief, und den ich immer wieder mit meinen nassen Unterarmen wegwischen musste. Von meiner Atmung, die ich unter Kontrolle zu halten versuchte. Und von Bad Religion, die mit ihren verzerrten Gitarren aus meinen Kopfhörern dröhnten und sich gerade ausmalten, wie es wohl wäre, wenn Los Angeles in Flammen stünde.
Außerdem ärgerte ich mich immer noch über Felix, den Sohn des Verlagsinhabers und nur deshalb neuerdings auch Ressortleiter und somit mein neuer Vorgesetzter. Von Anfang an hatte er immer wieder seine Unfähigkeit und Gleichgültigkeit bewiesen und die meiste Zeit damit verbracht, sein Büro mithilfe einer blutjungen, High Heels tragenden Einrichtungsdesignerin, der er bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit auf den Hintern starrte, neu auszustatten. Vergangene Woche erst hatte er drei überdimensionale Gemälde mit einigen Farbklecksern darauf geliefert bekommen. Aus einem Kindergarten, hatten wir von der Belegschaft scherzend angenommen. Aber dann hatte mir Marie beim gemeinsamen Morgenkaffee zugeflüstert, wie viel jede einzelne dieser Kritzeleien gekostet hatte, und ich war einfach nur fassungslos gewesen. Mein Jahresgehalt war nichts dagegen. Die Gehaltserhöhung, um die ich ein paar Wochen zuvor gebeten hatte, war aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Verlags jedoch leider nicht drin gewesen.
»Es tut mir ehrlich leid, Jana.«
Elender Heuchler. Aber egal, sollte so sein. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht mehr über Felix und seinen Vater, diesen widerlichen Sexisten der sogenannten »alten Schule«, zu ärgern. Seine ekeligen, oft nicht einmal mehr zweideutigen Kommentare zu ertragen. Seine Blicke auf mein Dekolleté oder meinen Hintern zu dulden. Immer wieder bekam ich Angebote von der Konkurrenz. Das nächste würde ich annehmen.
Dieses Mal hatte Felix es endgültig zu weit getrieben! Und damit all meine Vorsätze zunichtegemacht.
Ich hatte eigentlich nur noch ein schnelles Update für einen Online-Beitrag rausjagen wollen, als Marie an meinem Schreibtisch aufgetaucht war und mir die druckfrische Ausgabe unter die Nase gehalten hatte.
»Sag mal, dreht der jetzt total durch?«, wollte sie wissen.
Ich sah sie fragend an.
»Das ist doch dein Artikel, oder?«
Ich begriff immer noch nicht, worauf sie hinauswollte.
»Hast du das gewusst?«
»Ich … wieso, was …?«
»Da!« Marie zeigte auf die Headline.
SCHMUTZIGE GESCHÄFTE MIT NEUER MÜLLDEPONIE
Ich fand sie viel zu plump, wollte mir unbedingt noch etwas Besseres einfallen lassen. Aber ja, das war eindeutig …
»Und hier!« Jetzt tippte sie auf Felix’ Namen.
Plötzlich wurden meine Augen ganz groß. Mir stand der Mund offen, aber ich brachte kein Wort heraus. Die Zahnräder meines Verstands hatten endlich ineinandergegriffen.
Felix hatte doch tatsächlich die Unverfrorenheit besessen, meinen über viele Wochen hinweg hartnäckig recherchierten Artikel über die illegalen Machenschaften im Zusammenhang mit der neuen Mülldeponie ohne mein Wissen zu veröffentlichen und einfach seinen Namen darunterzusetzen.
»Dachte ich es mir doch, dass du nichts davon gewusst hast«, sagte Marie.
Erst jetzt hatte ich mich gefangen. Ich sprang hoch, riss Marie die Zeitung aus der Hand und stürmte damit in sein Büro.
»Was soll das?«
Ein Ausdruck des Ertapptwerdens huschte über sein Gesicht. Allerdings nur einen ganz kurzen Moment lang. Dann klappte er sein Notebook zu, sprang von seinem Stuhl hoch, bedachte mich mit einem gleichgültigen Lächeln, wie es nur ein Berufssohn zustande bringt, und drängte sich an mir vorbei aus dem Raum.
»Sorry, Jana, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich.«
Aber so einfach wollte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich hielt mit ihm Schritt und streckte ihm die Zeitung direkt vors Gesicht. Er schob sie beiseite, aber ich ließ nicht locker.
»Wie konntest du das machen?«
»Jana, ich muss wirklich los.«
»Ich will eine Antwort!«
»Es geht jetzt wirklich nicht. Ich bin in einer halben Stunde zum Tennis verabredet und ohnehin schon viel zu spät dran.«
Er legte einen Zahn zu, rannte regelrecht durch den Flur. Doch ich ließ ihn nicht entkommen und folgte ihm bis zum Fahrstuhl. Ich registrierte, dass Marie uns über ihren Bildschirm hinweg beobachtete. Am Fahrstuhl angekommen, fühlte Felix sich, während er voller Ungeduld immer wieder den Knopf drückte, schließlich doch bemüßigt, einen Kommentar zu der Angelegenheit abzugeben.
»Das war ein Versehen.«
»Ein Versehen?«
»Ich bitte dich, das ist doch keine Tragödie.«
»Das ist absolut letztklassig.«
»Mach es nicht schlimmer, als …«
»Du hast mir meinen Artikel gestohlen!«
Jetzt hämmerte er schon regelrecht auf den Knopf ein.
»Jana, wir sind doch ein Team.«
»Und in einem Team bestiehlt man sich?«
Pling.
Die Türen öffneten sich.
Felix verschwand darin, vermied jeden weiteren Augenkontakt und drückte nun unaufhörlich auf die K1-Taste. Bis sich die Türen endlich wieder geschlossen hatten. Und der Aufzug mit ihm unterwegs in Richtung Tiefgarage war, wo der Porsche, den sein Vater ihm unlängst zum 30. Geburtstag gekauft hatte, auf ihn wartete und er damit zum Tennis verschwand.
Jetzt, drei Stunden später, zitterte ich immer noch vor Wut.
Am liebsten hätte ich all meinen Frust lauthals hinausgeschrien. Felix an den Kopf geworfen, dass seine Texte – wenn er sich denn mal dazu bemüßigt fühlte, einen zu verfassen – nur so vor Fehlern strotzten. Dass er Beistriche nicht länger würfeln, sondern endlich die Regeln dafür lernen sollte. Dass er in keinem anderen Verlag als dem seines Vaters einen Job bekommen würde. Und ausnahmslos alle im Team dieser Meinung waren.
Vielleicht würde ich das am nächsten Morgen ja sogar tun.
Der Job war mir egal!
Aber jetzt brauchte ich erst mal ein anderes Ventil. Und deshalb erhöhte ich die Geschwindigkeit des Laufbands weiter. Trotz des Brennens in meinen Oberschenkeln. Und der Tatsache, dass ich ohnehin schon ziemlich außer Atem war.
Noch eine Viertelstunde lang auspowern, dann würde ich es für heute geschafft haben. Dann nur noch duschen und ab auf die Couch. Mit einer kuscheligen Decke. Und ganz viel Schokolade. Ja! Das hatte ich mir heute wirklich verdient. Vielleicht würde ich ja sogar über meinen Schatten springen und …
Plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen.
In meinem Augenwinkel tauchte etwas auf. Eine Hand von rechts. Ich riss den Kopf herum. Bemerkte jetzt endlich den Mann auf dem Laufband neben mir. Sah seine weit aufgerissenen Augen, sein wildes Gestikulieren.
Er zeigte zu meinen Füßen.
Ich blickte an mir hinab.
Da passierte es.
Eine Konzentrationsschwäche. Ein unglücklicher Schritt. Ein offenes Schuhband, auf das ich ausgerechnet jetzt trat. Und ein Laufband, das sich um all das nicht kümmerte und sich energisch weiterdrehte.
Ich wollte den linken Fuß anheben. Doch stattdessen kippte ich vorne über, und es zog mir die Beine nach hinten weg. Ich verlor das Gleichgewicht. War dennoch geistesgegenwärtig. Wollte die Arme hochreißen. Den roten STOPP-Knopf drücken. Aber alles ging viel zu schnell. Ich hatte keine Chance. Meine Hände fuhren ins Leere. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig, den Kopf ein Stück zur Seite zu drehen und mein Gesicht zu schützen. Doch das hemmte nicht die Wucht des Aufpralls. Ich knallte mit der Schläfe gegen die Armatur, und eine Schmerzgranate explodierte in meinem Schädel. Das Laufband drehte sich unbeirrt weiter, zog mich weiter runter. Und noch bevor ich ein weiteres Mal ungebremst mit dem Kopf aufschlug, dieses Mal auf dem Laufband selbst, hatte ich bereits das Bewusstsein verloren.
Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich auf dem Rücken. Das grelle Licht der Halogen-Deckenleuchten trieb mir einen Schwall Tränen in die Augen. Ich blinzelte, hielt mir die Hand vor, aber es half alles nichts. In meinem Kopf wummerte es gewaltig.
Vermutlich waren bloß ein paar Sekunden seit meinem Knock-out vergangen. Doch die Zeit hatte offenbar ausgereicht, dass das ganze Fitnessstudio von meinem Missgeschick erfahren hatte. Unzählige verschwitzte Körper rankten und drehten sich um mich herum. Es schienen immer mehr zu werden. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Viele dumpfe Stimmen schwirrten und hallten durcheinander, und wurden erst allmählich klarer.
»… Gottes willen, … du dir wehgetan?«
»… in Ordnung …?«
»… denn das bloß passiert?«
»Ihr Schuhband …«
»Wahnsinn, … du das gesehen?«
»Voll der Absturz!«
»Bam!«
»So geil!«
»Sagt mal, habt ihr sie noch alle?«
»Hey, was denn?«
»Los, verschwindet!«
»Aber …«
»Sonst fliegt ihr aus dem Studio!«
Ausgerechnet die sensationsgeilen Kommentare der beiden Teenagerkerle waren die ersten, die ich trotz meiner Benommenheit klar und deutlich verstanden hatte. Und auch deren breites Grinsen war mir nicht entgangen.
Am liebsten wäre ich auf der Stelle im Erdboden versunken. Oder weggelaufen. Egal, wohin – einfach nur ganz weit fort.
Doch nun, da ich immer klarer im Kopf wurde, setzten die Schmerzen ein. Wie eine gewaltige Welle, die sich immer weiter auftürmte und jetzt mit voller Wucht gegen die Innenseite meiner Schläfe schwappte.
Fuck!
Ich stöhnte auf.
Die platinblonde Rezeptionistin mit der niedlichen kleinen Stupsnase in ihrem solariumgebräunten Gesicht tauchte in meinem Blickfeld auf. Mit besorgter Miene war sie neben mir in die Knie gegangen und kam ganz nah an mich heran.
»Alles in Ordnung?«, wollte sie wissen und schaute mir dabei prüfend in die Augen.
Ihr Atem roch nach irgendeiner exotischen Frucht. Ananas vielleicht. Oder Mango. Ich war noch zu benebelt, um das beurteilen zu können. Und zu sehr darauf konzentriert, ihr Gesicht zum Stillstand zu bringen.
»Mein Kollege ruft gerade die Rettung.«
»Die brauche ich nicht!«, entfuhr es mir wie von der Tarantel gestochen. Noch mehr Aufregung war das Letzte, was ich gerade wollte.
Ich versuchte, mich aufzurichten. Aber schon bei der ersten kleinen Bewegung brauste eine weitere Schmerzwelle durch meinen Schädel und ließ mich erneut aufstöhnen. Zudem drehte sich das Studio plötzlich wieder richtig heftig.
»Bitte bleib liegen!«
Die Platinblonde schob mir ein Handtuch unter den Kopf.
Ich ließ mich wieder zurücksinken. Spürte etwas Hartes unter meinem Rücken. Zog es hervor und sah, dass es einer meiner Bluetooth-Kopfhörer war. Ich tastete nach dem zweiten, aber der war nicht zu finden.
Irgendjemand lachte.
Mein Schock legte sich nur langsam. Aber je klarer ich im Kopf wurde, desto peinlicher wurde mir die Situation. Ich würde mich hier nie wieder blicken lassen können.
Ich schloss die Augen. Versuchte, die Stimmen um mich herum, das Lachen und die Hitze, die mir in den Kopf stieg, zu ignorieren. Die Benommenheit weiter zurückzudrängen.
»Hier, dein Handy«, hörte ich eine Stimme.
Ich öffnete die Augen und erblickte, erneut von den grellen Halogenlichtern geblendet, einen glatzköpfigen Typen in einem knallpinkfarbenen Kraftshirt, der mir mein Telefon entgegenstreckte.
»Das hat es gut zehn Meter nach hinten gefetzt«, sagte er.
»Danke.«
Trotz der Benommenheit fielen mir die dicken Adern auf seinen Armen auf. Wie fette Würmer, dachte ich.
»Es hat übrigens gerade geläutet«, fügte er noch hinzu.
Kaum etwas konnte mir gerade gleichgültiger sein. Doch ausgerechnet in dem Moment, in dem ich es entgegennahm, begann es erneut zu läuten und zu vibrieren. Ich hatte natürlich vor, es zu ignorieren. Das Letzte, was ich jetzt wollte, war, zu telefonieren. Für mich zählte gerade nur, wie ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine, hier raus und nach Hause kommen konnte.
Aber als mein Blick auf das Display fiel, hatte ich schlagartig ein ganz mieses Gefühl. Jegliche Benommenheit war wie weggeblasen, mein Verstand plötzlich glasklar. Und all die Menschen um mich herum hatten keine Bedeutung mehr.
›Kurt‹ stand dort.
Und mir war klar, dass dies ganz einfach nichts Gutes bedeuten konnte. Denn warum sonst, außer um mir schlechte Nachrichten zu überbringen, sollte der einzig verbliebene Freund meines Vaters, den ich seit Jahren weder gesehen noch gehört hatte, mich anrufen?
»Kleines?«, fragte er, weil ich kein Wort herausbrachte, nachdem ich abgenommen hatte.
Der Klang seiner Stimme ließ meine Lippen beben und die Augen noch feuchter werden. Mit einem Mal war die Erinnerung zurück. Und schwoll zu einem bösartigen Knoten im Hals an.
»Jana?«
»Hey«, würgte ich gerade so heraus.
»Alles okay bei dir?«
»Ja«, log ich.
In meinem Schädel donnerte es. Dennoch war mir der seltsame Klang seiner Stimme sofort aufgefallen.
»Ist …?« Ich brach den Satz ab. Schnappte nach Luft. »Ist etwas mit Papa?«
Kurt zögerte.
»Ist er etwa …?«
»Nein, keine Sorge. Das nicht … aber …«
Ich erwischte mich bei der Überlegung, ob ich mir tatsächlich Sorgen gemacht hatte. Und fühlte mich trotzig und schäbig zugleich.
»Ich denke, du solltest trotzdem besser nach Hause kommen.«
»Wieso, was ist los?«
»Das weiß ich leider auch nicht so genau. Dein Vater spricht nicht darüber. Er sagt, er kann sich nicht erinnern. Aber irgendwie glaube ich das nicht und habe ein ganz schlechtes Gefühl.«
»Was ist passiert? Worüber spricht er nicht?«
»Ich habe ihn letzte Nacht sturzbetrunken aufgelesen. Er war nicht ansprechbar und hat nicht einmal mehr stehen können. Und er … nun ja, also …«
»Was?«
»Es fällt mir wirklich nicht leicht, dich damit zu belasten, Kleines, das musst du mir glauben. Aber … nun ja, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll.«
»Jetzt sag schon!«
»Er war voll Blut.«
»Blut?«, entkam es mir, und um mich herum kam Getuschel auf.
»Ja, seine Kleidung, die Hände und sogar sein Gesicht. Alles war blutverschmiert.«
»Mein Gott!«
»Ja, es … es war wirklich viel Blut, Jana. Sehr viel Blut. Und …«
Er seufzte. Suchte offenbar nach den richtigen Worten.
»Was, und?«
»Er hatte keine Verletzungen.«
Wumms! Diese Nachricht schlug ein wie eine Abrissbirne.
Und als hätte das nicht schon gereicht, fügte Kurt noch hinzu: »Er hatte nicht den kleinsten Kratzer, absolut nichts. Wessen Blut auch immer es war – es war nicht seines.«
2
Den Rest des Abends stand ich neben mir. Trotz zweier Schmerztabletten wummerte es in meinem Schädel, und immer wieder stieg eine leichte Übelkeit in mir hoch. Natürlich wusste ich, dass es besser gewesen wäre, mich im Krankenhaus gründlich durchchecken zu lassen – die Platinblonde und der Muskelprotz mit den Würmern unter der Haut hatten mich eindringlich dazu zu überreden versucht. Aber seit Kurts Anruf war ich wie paralysiert. Weil die schmerzvolle Erinnerung mich wieder fest im Griff hatte. Und er angedeutet hatte, dass es da noch ein weiteres Problem mit meinem Vater gab, er mir aber ums Verrecken nicht hatte verraten wollen, worum zur Hölle es ging. Wohl, weil er wusste, dass ich sonst nur nach Ausreden gesucht und eine Heimreise zu vermeiden versucht hätte. Er kannte mich eben wie kaum jemand sonst – trotz der jahrelangen Funkstille zwischen uns.
»Hör mal, Kurt, ich kann mir nicht einfach so mir nichts dir nichts freinehmen. Ich habe einen Job, in dem ich voll eingespannt bin, und ich muss Abgabetermine einhalten. Außerdem …«
»Jana, ich würde dich nicht darum bitten heimzukommen, wenn es nicht wichtig wäre.«
»Kannst du bitte aufhören, in Rätseln zu sprechen!«
»Ich kann dir das nicht beschreiben.«
»Was?«
»Du musst es mit eigenen Augen sehen.«
»Herrgott, kannst du mir nicht einfach sagen, was …?«
»Nein, das kann ich leider nicht.«
»Aber …«
»Vertraust du mir?«
»Sicher, aber …«
»Dann setz dich in den nächsten Flieger und komm heim!«
Ich hakte natürlich weiter nach, drängte auf Antworten, doch Kurt ließ sich nichts mehr entlocken.
Um eine Rückkehr zu vermeiden, versuchte ich nach langem Hin und Her sogar, meinen Vater zu erreichen. Beim ersten Versuch kam ich jedoch nicht einmal dazu, das Telefon in die Hand zu nehmen. Schon dessen Anblick reichte aus, um mich vor Angst zu lähmen. Erst nach einem Gläschen Bourbon, dem ersten seit über einem Jahr, schaffte ich es immerhin, seine Nummer zu wählen. Aber bereits nach dem ersten Klingeln hatte mich der Mut verlassen und ich legte auf. Zwei Gläser später wagte ich schließlich einen letzten Versuch. Das Herz schlug mir dabei bis zum Hals, und als ich das dritte Klingeln erreicht hatte, zitterte ich am ganzen Körper. Doch mein Vater ging weder ran noch rief er zurück.
Und auch Kurt nahm nicht mehr ab. Genauso wenig wie Tante Gabi oder meine Großeltern.
Sonst fiel mir niemand mehr ein, den ich im Vertrauen hätte anrufen können. Simon, Kurts Sohn, vielleicht noch. Er war zwei Jahre älter als ich, und aufgrund der engen Freundschaft unserer Eltern waren wir viele Jahre fast so etwas wie Geschwister gewesen. Erst im Teenageralter hatte sich das allmählich geändert. Es hatte nie einen wirklichen Bruch gegeben. Vielmehr war es so gewesen, dass ich zunehmend das Gefühl gehabt hatte, dass er mehr als bloß eine Schwester oder eine Freundin in mir gesehen hatte. Aber das konnte ich mir auch eingebildet haben. Wie bei jedem Teenager, hatten auch meine Gefühle damals verrückt gespielt. Jedenfalls hatten wir im Jahr vor dem Tod meiner Mutter kaum noch etwas miteinander zu tun gehabt, und ich war voll und ganz auf Chris aus Simons Klasse fixiert und Hals über Kopf in ihn verschossen gewesen. Die beiden hatten sich nicht besonders gut verstanden – gut möglich, dass das an mir gelegen hatte. Jedenfalls verwarf ich jetzt den Gedanken, Simon anzurufen, wieder. Es wäre ohnehin schon daran gescheitert, dass ich nicht einmal seine Nummer hatte und an diese nur über Kurt gekommen wäre.
Es war zum Verrücktwerden!
Erst dachte ich, dass es im Vorjahr gewesen war. Aber nach kurzem Überlegen wurde mir klar, dass es bereits gut drei Jahre her war, dass ich meinen Vater zuletzt gehört hatte. Ein Höflichkeitsanruf zu dessen Geburtstag war es gewesen, für den ich mir ebenfalls hatte Mut antrinken müssen. Die ganze Zeit über hatte ich ihm anhören können, dass ihm das Telefonat genauso unangenehm gewesen war wie mir. Es hatte keine Minute gedauert und war von Schweigen geprägt gewesen.
Jetzt, beim Gedanken daran, meinen Vater bald wiederzusehen, spürte ich, wie trotz des Alkohols die Panik immer weiter in mir hochstieg – wie eine giftige Brühe, die allmählich überzukochen drohte. Alle Versuche, die Angst zurückzudrängen, waren zwecklos – sie verschafften ihr nur noch mehr Aufmerksamkeit.
Ich würde ins Tal zurückkehren. An den Ort meiner schlimmsten Albträume. Und das wegen Kurts beängstigender Nachricht.
Ich war verrückt!
Immer wieder blitzte vor meinem geistigen Auge das Bild meines Vaters auf. Wie er mich aus weit aufgerissenen Augen anstarrte, mit Blut an den Händen und im Gesicht. Dem Blut meiner Mutter.
Mir brach der Schweiß aus.
Was, zum Teufel, war vorgefallen? Hatte sich die Vergangenheit tatsächlich wiederholt? Wessen Blut hatte an seinem Körper geklebt, als Kurt ihn aufgelesen hatte?
Wie banal mir der Frust darüber, dass Felix mein Vertrauen missbraucht und mir die Story geklaut hatte, jetzt vorkam. Ich empfand auch keinen Ärger, als er sich am Telefon, nachdem ich ihn wegen eines familiären Notfalls um einen spontanen Urlaub gebeten hatte, als der große Gönner aufgespielt hatte. Der Arme würde doch tatsächlich ausnahmsweise ein Auge zudrücken, obwohl er doch stets alle Hände voll damit zu tun hatte, mein hitziges Temperament im Zaum zu halten. Unter normalen Umständen wäre ich wohl am liebsten durch die Leitung gekrochen, um ihm an die Gurgel gehen zu können. Aber an diesem Abend war mir Felix schlichtweg egal. Und so kam mir sogar ein leeres »Danke« über die Lippen, bevor ich auflegte.
Einen Freund hatte ich nicht. Im Grunde hatte ich, von Chris, meiner großen Jugendliebe, einmal abgesehen, noch nie eine richtige Beziehung gehabt. Das lag nicht etwa daran, dass ich niemanden kennengelernt hätte. Ich wurde öfter von Kerlen angequatscht, für meinen Geschmack sogar ein wenig zu oft – manchmal schien es mir, als liefe ich mit einem nur für die Männerwelt sichtbaren Schild über meinem Kopf herum, mit der Aufschrift ›Suche einen Beschützer, bitte sprich mich an!‹. Ich hatte auch nicht gerade wenige Dates und immer wieder kurze Affären – auch ich hatte Bedürfnisse. Und gute Absichten. Ehrlich. Aber jedes Mal, wenn sich auch nur annähernd so etwas wie eine Beziehung an meinem Liebeshorizont abzuzeichnen begann, ergriff mich Panik. Dann zog ich die Reißleine, floh und verkroch mich in meiner Höhle.
Jaja, ich weiß. Es bedarf wohl keiner besonders tiefen psychologischen Kenntnisse, um zu begreifen, dass meine Beziehungsängste und meine Unfähigkeit, anderen zu vertrauen, mit meinen Verlustängsten aufgrund der Ermordung meiner Mutter zu tun hatten. Und der Tatsache, dass mein Vater bis heute im Verdacht stand, sie auf dem Gewissen zu haben. Ich kannte mich mit solchen Dingen aus und war mir derer bewusst – immerhin hatte ich über ein Jahrzehnt Psychotherapie hinter mir. Und dennoch konnte ich einfach nichts dagegen tun.
In besonders dunklen Momenten trauerte ich Chris immer noch nach. Stellte mir vor, wie unsere Beziehung wohl ohne den Mord verlaufen wäre. Und idealisierte ihn immer noch zu diesem zwei Jahre älteren Beschützer hoch.
Auch an diesem Abend war die leise Hoffnung in mir aufgeflammt, ihm in den nächsten Tagen über den Weg zu laufen. Und bei der Vorstellung erfasste mich ein warmes Kribbeln. Andererseits war mir klar, dass er wohl kein so gestörtes Liebesleben wie ich hatte. Dass er ziemlich sicher längst verheiratet war, Kinder hatte und ein glückliches Leben führte. Und dass er sich deswegen wohl kaum noch für mich interessieren würde. Immerhin war ich es gewesen, die Schluss gemacht hatte. Die weggegangen war. Und die seine vielen Anrufe und Nachrichten in den Wochen und Monaten danach mit Tränen in den Augen ignoriert hatte.
Ich versuchte, die Wehmut darüber, dass ich es versaut hatte, abzuschütteln und meine Einsamkeit positiv zu sehen: So musste ich zumindest niemandem erklären, weshalb ich Hals über Kopf aufbrach und nach Hause zurückkehrte, obwohl ich doch ahnte, dass ich mich damit direkt ins Verderben stürzen würde.
Ich musste lediglich eine Lösung für Charles finden. Doch es war bald 22 Uhr, viele Möglichkeiten hatte ich also nicht mehr – eine bloß, um genau zu sein. Meine Nachbarin, Frau Jakob, eine höchst aktive 75-Jährige, die das gesamte Wohnhaus regelmäßig mit nächtlichen Geigenkonzerten oder Operngesang beglückte, war erst wenig erfreut, als ich vor ihrer Wohnung aufschlug. Mit aufgesetztem Bedauern schüttelte sie den Kopf, nachdem ich sie um ihre Hilfe gebeten hatte, und wollte schon die Tür schließen.
»Tut mir leid.«
Die Tür war fast zu.
Ich brauchte eine Idee. Schnell. Aber ich war vom Alkohol und den Schmerzmitteln benebelt. Sollte ich ihr Geld anbieten? Würde sie das überzeugen? Nein, etwas anderes. Komm schon! Da musste ich an ihre neidvollen, halb hinter dem Vorhang versteckten Blicke denken.
»Sie könnten in den nächsten Tagen, wenn Sie Charles Futter geben, natürlich auch gerne meinen Balkon benutzen.«
Ich bereute das Angebot, noch während ich es ausgesprochen hatte. Aber zumindest zeigte es Wirkung, und ich wusste, dass ich die Blicke nicht missinterpretiert hatte. Frau Jakob hielt in der Bewegung inne. Zögerte. Und zog die Tür wieder auf. Zumindest dieses Problem war gelöst.
Zurück in meiner Wohnung, überkam mich ein Schwindelanfall, und ich hatte keine andere Wahl, als mich ein paar Minuten hinzulegen. Als ich mich wieder gefangen hatte und vor meinem Notebook saß, musste ich feststellen, dass es in den nächsten Tagen nur noch absurd teure Flüge gab. Mir blieb nichts anderes übrig, als ein kleines Vermögen dafür hinzublättern. Auch einen Mietwagen hatte ich selbst in London schon mal deutlich billiger bekommen. Ich entschied mich für einen völlig überteuerten VW Polo mit Automatikschaltung und hoffte, dass mir diese nicht allzu viele Probleme machen würde.
Nachdem ich den Koffer gepackt und endlich meinen Reisepass und zur Sicherheit auch die Schlüssel meines Elternhauses gefunden hatte, ließ ich mich erschöpft aufs Bett fallen. Beim Blick auf die Uhr wurde mir klar, dass ich bereits viel zu viel intus hatte. Ein ganzes Jahr lang hatte ich es geschafft, die Finger von dem Mist zu lassen und sogar mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hatte stattdessen angefangen, Sport zu treiben, meine Kondition verbessert und sogar ein paar Muskeln aufgebaut. Heute Abend hatte ich wie selbstverständlich ein Glas nach dem anderen gekippt. Ohne schlechtes Gewissen darüber, was ich mir damit gerade versaute. Oder einen Gedanken daran, wie übel es mir am nächsten Morgen gehen würde. Es war, als hätte ich das ganze letzte Jahr bloß auf einen triftigen Grund gewartet, um mit dem Scheiß wieder anfangen zu können. Tja, tadaaa – hier war er nun also!
Jetzt schwankten die Zeiger, als wollten sie mich verhöhnen. Ich musste die Augen zusammenkneifen und mich konzentrieren. Kurz nach 22 Uhr. Nein, Unsinn! Es war bereits kurz nach 23 Uhr.
Mist!
In weniger als acht Stunden würde mein Flieger gehen.
Ein tiefer Seufzer. Mir graute bei der Vorstellung.
Wie viele Jahre war ich schon nicht mehr daheim gewesen? Sieben? Oder acht?
Mindestens genauso lange versuchte meine Therapeutin mir nun schon weiszumachen, dass ich meine Vergangenheit nicht länger verdrängen dürfe, sondern mich ihr stellen müsse. All das Unausgesprochene dürfe mich nicht länger von innen heraus auffressen. Es müsse endlich alles raus. Vor allem die Frage, die mich seit 13 Jahren schier um den Verstand brachte. Die immer da war – egal ob ich lachte, weinte, hoffte, liebte, trauerte oder stinkwütend war, wie auf Felix zuvor. Die Frage, bei der mir der Schweiß ausbrach, wenn ich nur daran dachte:
War mein Vater der Mörder meiner Mutter?
Einige Wochen lang hatte er damals als Hauptverdächtiger gegolten. Während er in Untersuchungshaft geschmort hatte, war ich immer und immer wieder aufs Neue von Psychologen, Polizeibeamten und auch von Viktor, Kurts Bruder und Polizeichef meiner Heimat, befragt worden. Zigmal hatte ich erzählen müssen, was genau passiert war. Niemand schien mir glauben zu wollen, dass da ganz einfach nicht mehr war, was ich hätte berichten können. Selbst in Kurts Augen hatte ich Zweifel zu entdecken geglaubt.
Jana, wie genau hat das Geräusch geklungen, von dem du aufgewacht bist? Was für eine Art von Rumpeln? Wie spät war es da? Warum weißt du so genau, dass es 0.24 Uhr war? Steht der Radiowecker immer auf deinem Nachtkästchen? Hat noch jemand außer deiner Mutter geschrien? Bist du dir sicher, dass du dich nicht erinnern kannst? Was ist dann passiert? Wie laut hast du nach deiner Mutter gerufen? Kannst du bitte versuchen, es nachzumachen? Sicher nicht lauter? Kannst du dich an deine genauen Worte erinnern? Bestimmt nicht? Bitte denk nach! Und du hast sicher keine Antwort bekommen? Wo war dein Vater, als du den Streit hörtest? Glaubst du, dass er schon von der Arbeit zu Hause war? Wann kommt er üblicherweise von der Nachtschicht heim? Du hast auch nach ihm gerufen, richtig? Was denkst du, warum hat er erst mit dir gesprochen, als du bereits auf der Treppe auf dem Weg nach unten warst? Kannst du dich an seine genauen Worte erinnern? Haben sich deine Eltern öfter mal gestritten? Glaubst du, dass dein Vater deine Mutter getötet hat?
Diese letzte, entscheidende Frage hatte ich immer mit »nein« beantwortet. Dabei hatte ich jedes einzelne Mal das Gefühl, dass man mir die Lüge angesehen hatte.
Ob es an meinen Aussagen gelegen hatte, konnte ich nicht einschätzen. Offiziell war der Mordverdacht gegen meinen Vater aus Mangel an Beweisen fallen gelassen worden. Viktor hatte jedoch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er weiter von der Schuld meines Vaters überzeugt war und nur auf den kleinsten Fehler von ihm wartete, um ihn endlich hinter Gitter bringen zu können.
»Er ist ein toller Mensch und ein noch besserer Bruder. Aber leider nicht der beste Polizist«, hatte Kurt mich einmal zu trösten versucht. »Er ist auf der falschen Spur und will das einfach nicht wahrhaben. Aber sie werden den Mörder finden, glaube mir!«
Doch für viele im Tal kamen die Worte des Polizeichefs einem Schuldspruch gleich.