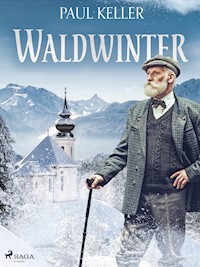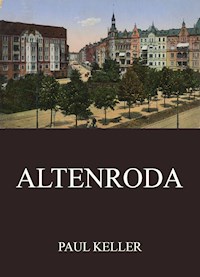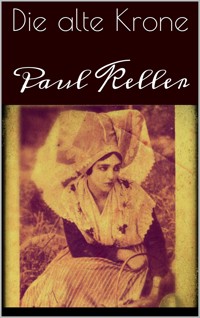Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Du hast mich gerufen ... nun bin ich bei dir! Als du das Buch aufschlugst, kam ich zu dir. Ich bin in deiner Kammer. Denn jetzt willst du lesen. Und ein Lesender ist immer in einer schlichten Kammer, in der nichts da ist als ein Paar Augen, eine Seele und ein Buch." Der Band enthält eine Auswahl von sechzehn teils heiteren, teils besinnlichen bis traurigen Geschichten des Erfolgsautors Paul Keller, unter anderem: "Das alte Heim", "Die Eisenbahn", "Seeschwalben", "Tiergeschichten", "Das Köstlichste", "Begegnung", "Die Weide", "Der Starkasten", "Ansichtspostkarten", "Nebeltag", "In absentia" und "Juninacht". "Das alte Heim" etwa berichtet von der Rückkehr in die nach Jahren wieder zur Vermietung freigegebene alte Wohnung, wo Herr Berthold einst mit seiner ersten Frau so glücklich war, bevor sie in ebenjener Wohnung verstarb. Dergestalt mit der heilen Vergangenheit und der Lüge seines jetzigen Lebens konfrontiert, fasst Berthold einen entschlossenen Plan, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu versöhnen ... "In absentia" dagegen schildert höchst vergnüglich eine eigenartige Verlöbnisfeier: Da Kantor Ehrenfried Becker sich weigert, zur Verlobung seines Sohnes zu reisen, da er an Weihnachten in der Kirche Orgel spielen muss, schickt ihm der Sohn bedauernd eine Flasche Champagner, damit der Vater wenigstens "in absentia" ein wenig zu feiern vermag. Aus der ein wenig an "Dinner for One" erinnernden Solo-Feier des Kantors mit fünf gefüllten Gläsern entwickelt sich, sobald als reale Person auch noch der Steinhuber Karl vorbeischaut, ein ordentliches Gelage; prompt wird auch noch die Tochter Liesel "in absentia" verlobt, und ob Ehrenfried Becker nach alledem noch Orgel zu spielen vermag, steht in den Sternen ... Auch die vierzehn weiteren Erzählungen bieten ähnlich prickelnden Lesegenuss!Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Schriftsteller wie der alte Wilhelm Raabe oder Peter Rosegger schätzten den Autor sehr. Gerade die früheren Werke wie "Waldwinter", "Ferien vom Ich" oder "Der Sohn der Hagar" zeichnen sich durch künstlerische Kraft und Meisterschaft aus. Seinen Roman "Die Heimat" (1903) nannte Felix Dahn "echte Heimatkunst". Seine bekanntesten Werke wurden zum Teil auch verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
In deiner Kammer
Geschichten
Saga
In deiner Kammer
© 1903 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517352
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com
Einleitung.
In deiner Kammer.
Du hast mich gerufen ... nun bin ich bei dir! Als du das Buch aufschlugst, kam ich zu dir. Ich bin in deiner Kammer.
In deiner Kammer? Ja!
Vielleicht schaust du auf seidene Decken, auf hohe Spiegel und kostbare Bilder und siehst mich fragend an.
Ja, es ist doch eine Kammer!
Deine Kammer!
Jetzt — gerade in diesem Moment — fragst du nichts nach Sammetpolstern und goldenen Borden; jetzt — gerade in diesem Moment — willst du an all die tausend Personen und Dinge nicht denken, denen du sonst so nahestehst; jetzt — gerade in diesem Moment — willst du dich auch nicht allein mit dir selbst beschäftigen.
Denn jetzt willst du lesen.
Und ein Lesender ist immer in einer schlichten Kammer, in der nichts da ist als ein Paar Augen, eine Seele und ein Buch.
Wer ich bin? O, das ist gleich! Auch, woher ich komme. Aber ehe ich zu dir kam, war ich auf einer weiten Reise. Da habe ich viel Menschen gesehen. Lachende und weinende, sehr viel gute Leute. Böse Menschen kenne ich fast gar nicht. Es begegnete mir manchmal einer, vor dem ich erschrak und meinte, er sei böse; aber wenn ich ihn genau betrachtete, war er nur ein Unglücklicher. Mit viel Schlechtem werde ich dich nicht erschrecken; du sollst dich in deiner Kammer nicht fürchten.
Ich bin noch jung, deshalb erschüttert mich das Leiden der Menschen heftig. Aber ich kann auch über kleine Dinge glücklich lachen. Und ich habe mich bemüht, mir die Augen blank zu halten, dass ich gut zusehen kann.
Was ich bei dir will? Eines nicht: ich will dich nicht belehren, ich will dir auch nicht raten. Wer weiss, ob du nicht klüger bist als ich, und dann wäre ich schlimm daran. Nein, ich will dir nur erzählen, was ich gehört und gesehen habe. Und wenn es wert für dich ist, wird deine Seele von selbst fortspinnen, wird zustimmen oder widersprechen, wird denken, wird ähnliche oder andere Bilder zeichnen mit deinen Menschen, deinen Fluren, deinem Himmel.
Ob du mir etwas schuldig bist? O ja! Geld freilich nicht. Das, was du etwa bezahlt hast, war für das Papier. Und deine Freundschaft darf ich nicht verlangen. Das wäre zuviel für den kleinen Dienst. Wenn du mir schon einen Gefallen tun willst, so bitte ich dich: mich nicht zu lange bei dir zu behalten. Lass dir nicht alles auf einmal erzählen! Das strengt an, und dann — wenn ich fort bin — weisst du nicht, was ich dir eigentlich gesagt habe. Nein, wenn ich dir bei jedem Besuche eine Geschichte erzähle, das ist genug. Ich komme wieder, sobald du willst.
Das bin ich. Und wer bist du? Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich es nicht gern wissen möchte. Aber ich kann es nicht wissen; ich erzähle dir ja mit geschlossenen Augen. Ich weiss nicht, wie es in deiner Kammer aussieht, weiss nicht, ob die Sonne hineinscheint oder eine goldene Ampel brennt oder ein kleines Talglicht neben dir auf die Diele tropft. Ich weiss nicht, ob du mit funkelnder Brille und kritisch gefurchter Stirn mir zuhörst oder ein schöner Schalk bist, der mir mit lachenden Augen gegenübersitzt. Aber sie ist ganz schön, diese Heimlichkeit. Und eines weiss ich doch von dir:
Du bist ein Mensch, der Stunden hat, in denen er einsam sein will, ein Mensch, der ein Interesse hat, das über seinen Kreis und seine Umgebung hinüberreicht ins grosse Gebiet der Allgemeinheit, einer, der teilnehmen mag an fremden Schicksalen, einer, der eine stille Kammer hat, wo er für sich ist.
Reich mir die Hand, wir wollen uns vertragen!
Das alte Heim.
O Gott, ... lag denn diese Strasse wirklich in derselben Stadt, in der er wohnte? Fast schien es ihm unbegreiflich.
Er wusste wohl: vor Jahren hatte er in diesem Stadtteil gewohnt, war er täglich diese selbe Strasse entlang gegangen, viele Male. Es war ihm heute, als ob er in eine alte Heimat zurückkäme, aber es war ihm auch, als sei er unterdes in weiter Fremde gewesen, in einem Lande, fern überm Meer ... viele Jahre.
Und doch hatte er immer in derselben Stadt gewohnt, die ganze Zeit. Nur in ein anderes Viertel war er gezogen, am anderen Ende der Grossstadt. Von seiner jetzigen Wohnung aus war dieser Stadtteil mit der elektrischen Strassenbahn in einer halben Stunde zu erreichen, und er war in ihm seit zehn Jahren nicht gewesen.
Ja, er hatte ihn absichtlich gemieden. Manchmal war’s nahezu ein Kunststück gewesen; aber er hatte es doch fertig gebracht ...
Was wollte er nur heute hier? Er wusste es nicht. Absichtslos, nur mit einem ganz leisen Schauern hatte er beim Spaziergang den Schritt über die Strombrücke gelenkt, die hierher führte.
Nun ging er willenlos wie ein Träumender den wohlbekannten Weg entlang, immer seiner früheren Wohnung zu, ... ging nach Hause.
Es hatte sich ja mancherlei hier geändert. Die elektrische Bahn durchsauste die Strasse, ein paar alte Häuser waren weggerissen, neue, aber durchaus nicht schönere Gebäude standen an ihrer Stelle, viele Firmenschilder waren geändert, und wo früher die kleine Buchhandlung war, handelte jetzt ein dickes Weib mit Filzschuhen und wollenen Strümpfen.
Aber der Fleischer war noch da. Er stand hinter seiner Ladentafel, rund, rosig und sauber wie einst. Der einsame Mann trat in den Laden und verlangte für 25 Pfennig gewöhnliche Wurst. Der Fleischer bediente den Herrn in dem vornehmen Pelze mit seiner besten Höflichkeit und schaute ihn immer an und war wohl sehr verwundert. Aber er kannte ihn nicht und hatte doch vor Jahren täglich mit ihm geplaudert.
Draussen schenkte der Herr die Wurst einem armseligen Gassenbüblein. Das wollte sie anfangs gar nicht nehmen, und als der Bursche schon das Papier in der Hand hielt, prüfte er erst den Inhalt mit vorsichtiger Miene. Aber dann roch er ein wenig daran und ass das Geschenk des unheimlich freigebigen Herrn auf, ob es vergiftet war oder nicht.
Der Fremde ging weiter. Gewohnheitsmässig kehrte er beim Kaufmann ein und verlangte ein halbes Dutzend Zigarren, das Stück zu 6 Pfennigen. Während der Kaufmann den Beutel füllte, fiel dem Käufer ein, das Rauchen sei eigentlich ein teurer Luxus. Er konnte sich’s nun einmal nicht abgewöhnen. Er bezahlte 40 Pfennige und bekam 4 Pfennige zurück. Die würde er natürlich der alten Henselten schenken, die ja um dieselbe Zeit schon immer vor dem Zigarrenladen auf ihn lauerte. Nun, wer sich selbst einen kostspieligen Genuss gestattet, kann für andere auch etwas tun.
Der Fremde lächelte. Wie weit verlor er sich doch! Gott wusste, wie lange die alte Henselten schon keinen Pfennig mehr brauchte.
Aber als er aus dem Laden trat, ... war sie da. Er erschrak vor ihr, wie vor einem Gespenste. Sie aber hob den vermummten Kopf zu ihm empor, blinzelte ihn mit ihren trüben Äuglein an und sagte, indes ein unendlich glückliches Lächeln über ihr verrunzeltes Gesicht ging:
„Herr Berthold ... hab’ ich doch recht gesehen ... hab’ ich doch recht gesehen ... Nein, so was ... und ich hab’ Sie so lange nicht ...“
Ein Hustenanfall erstickte ihre Stimme. Das hinderte sie aber nicht, ihm ihre braune, magere Hand hinzuhalten. In die liess er mechanisch die 4 Pfennige gleiten, die er noch zwischen den Fingern hielt. Die Alte erholte sich, besah das Geld beim Laternenlicht und nickte ihm zu: die Rechnung sei richtig. Da fasste er sich endlich.
„Nu, Henselten, leben Sie denn immer noch?“
„Immer noch!“ sagte sie weinerlich.
„Und haben Sie mich richtig wiedererkannt?“
Da machte sie ein geschäfts-kluges Gesicht.
„Nu, ich wer’ doch! Sie sein ja immer mei bester Kunde gewesen.“
Er lachte.
„Haben Sie denn eine feste Kundschaft?“
„O je, man muss wissen, wo man was herkriegt. Ich hol’ mir’s so auf der Strasse zusammen seit 15 Jahren. Sie sein wohl ganz von hier fortgemacht gewesen?“
„Ja, Henselten, ja, das heisst, warten Sie mal ... es freut mich riesig, dass Sie mich wiedererkannt haben ... da, nehmen Sie nur ..., ich bin’s Ihnen lange genug schuldig geblieben.“
Die Alte starrte auf das grosse Geldstück, das er ihr hinhielt.
„Nehmen Sie’s nur, ... ich werd’ mich jetzt schon besser um Sie kümmern. Wo wohnen Sie denn?“
Sie stammelte ihre Wohnung. In diesem Augenblicke nahte ein Schutzmann. Da griff sie scheu nach dem Geldstücke und humpelte mit langen Schritten davon.
„Mein Herr, sind Sie von der Alten angebettelt worden?“
„Angebettelt? Ich? Keine Idee! Wir sind alte Bekannte! Ich hab’ mich gefreut, sie wiederzusehen.“
„Pardon! Wir haben nämlich die Frau neuerdings im Verdachte, dass sie bettelt.“
Herr Berthold liess den findigen Polizeimann stehen und ging.
Die Strasse endete, ein kleiner Platz kam. Den Einsamen befiel ein leises Zittern. Hier hatte er gewohnt. Ob er’s wagte, einmal bis an das Haus hinüberzugehen, in dem er so glücklich und so zum Tode verzweifelt gewesen war? Es waren kaum zweihundert Schritte.
Er ging. Aber mitten auf dem Platze blieb er stehen. Dort drüben lag das Haus! Nummer 28... eine richtige Mietskaserne. Und doch sah’s jetzt nicht unschön aus. Fast aus jedem Fenster fiel Lichtschein. Das war ein Zeichen, dass lauter kleine Leute dort wohnten.
Nur die Fenster, hinter denen er gewohnt hatte, waren dunkel. Minutenlang schloss er die Augen. Es störte ihn niemand; der Platz war nicht reich an Verkehr.
Vor vierzehn Jahren war er dort drüben eingezogen, ein armer Kerl, aber doch ein glücklicher Mann. Sein Kleinod war die Margarete gewesen, sein junges, hübsches Weib. Jetzt wohnte er in einem viel schöneren Hause, jetzt hatte er ein anderes Weib ...
O Gott! ...
Ja, es ging doch nicht, dass er so erregt dastand, es würde auffallen. Langsam ging er vollends hinüber. Nummer 28! Ein Schild hing an der Haustür.
„Freundliche Wohnung im zweiten Stock, drei Zimmer mit Zubehör, 480 Mark, bald zu vermieten.“
Das musste „seine“ Wohnung sein. Er trat zurück. Richtig, die Fenster waren ohne Gardinen. Die Wohnung war frei.
Mit raschem Entschluss trat er in das Haus. Ein Klingelzug war da, daneben stand: „Zur Hausmeisterin!“
Er schellte.
Lange musste er warten. Da endlich kam ein schlürfender Schritt die Kellertreppe herauf. Es war wirklich noch die alte, langsame Hausmeisterin. Er erkannte sie genau, doch sie kannte ihn nicht.
„Bitte, wollen Sie mich in die freie Wohnung im zweiten Stock führen.“
„Die Wohnung wird nur bei Tage gezeigt.“
Er suchte in der Tasche und gab ihr ein Markstück.
„Machen Sie eine Ausnahme, ich hatte nicht eher Zeit!“
Da war sie willfährig und holte ein Licht.
Sie stiegen die erste Stiege hinauf. Sie kam ihm sehr schmal und steil vor. Früher war ihm das nicht ausgefallen; jetzt war er verwöhnt. Im ersten Stock las er die Türschilder.
„Ah, wohnen die Wendrichs immer noch hier?“
„Ja! Der Herr kennt wohl die Madame Wendrich? Die Tochter ist jetzt verlobt.“
„Die Luise?“
„Ja, die Luise.“
Na also! Vor 12 Jahren schon war das Mädel heiratsfähig und die Mutter hielt eifrige Ausschau für sie. Und jetzt ist sie schon verlobt. Nur Geduld muss man haben.
Die zweite Stiege!
„Warten Sie mal! Langsamer, — langsamer — ich — ich hab’ etwas kurzen Atem.“
„Wir sind gleich da. Hier — rechts ist die Wohnung!“
Er bleibt auf den letzten Treppenstufen stehen und hält sich an das Geländer. Die Kräfte drohen ihm zu schwinden — eine Angst packt ihn — eine furchtbare Scheu, da hineinzugehen.
„Sie! Ich glaube doch, es ist besser, wenn ich bei Tage wiederkomme.“
„Nu da! Jetzt, wo der Herr oben ist! Nee, nee, — ich hab’ hier ’n Stückchen Licht — bitte, kommen Sie nur! — Also das hier ist das Entree — es ist sehr geräumig —“
„Jawohl,“ sagt er, indes er in der offenen Tür lehnt, — „4 Meter 20 lang und 1 Meter 80 breit.“
„Na, sowas, — so ein Augenmass, — gestern erst ist’s ausgemessen worden! Das stimmt ja aufs Haar! Das is ja rein die Unmöglichkeit.“ —
„Zeigen Sie mir rasch die andere Wohnung, — ich — ich muss dann wieder fort — jawohl, ich hab’ nicht viel Zeit —“
„Gleich, lieber Herr! — Nanu, was ist ’n das für’n Geschrei dort unten? Jeses, das is der Julius, mein Enkelsohn, lieber Herr, — der is gewiss wieder gefallen, — das Kind, das Kind — ’n Augenblick bloss, lieber Herr, muss ich mal runter, — ich bin gleich wieder da — der Julius — entschuldigen Sie nur — der Junge —“
Sie drückt ihm das brennende Stearinlicht in die Hand und lässt ihn allein.
Regungslos steht der Fremde. Es ist totenstill um ihn her. Nur die Flamme knistert leise, und ein wenig Stearin tropft auf die Diele. Da wendet er scheu den Kopf und zuckt kurz zusammen vor seinem eigenen Schatten, der sich dunkel von der Wand abhebt.
Endlich geht er auf die eine Tür zu und legt die Hand auf die Klinke. Aber er bleibt zögernd stehen, als ob er in ein Mysterium eindringen sollte.
Wenn er öffnete, und der Tisch wäre gedeckt da drin wie einst, und sie stünde in der Stube und säh’ ihn an mit ihren freundlichen Augen! Die Hand zittert ihm heftig, und da geht die Tür auf.
Ein leerer, dunkler Raum. Nur das Stearinlicht wirft einen unsicheren Schimmer über das Gemach hin.
Das war ehemals seine Wohnstube! Dort stand das Sofa, dort der Tisch, dort sein kleiner Schreibtisch, dort ihr Nähtisch. Er weiss noch alles, er weiss, wo jedes Bild gehangen hat an der Wand. Und jetzt ist alles fort; das Sofa, der Tisch, die Bilder und — sie!
Der Mann legt die Hand über die Augen. Dann rafft er sich auf und sieht sich genauer in der Stube um. Es ist eine andere Tapete, aber es stecken noch ein paar Nägel in der Wand von seiner Zeit her. Auch der Ofen hat noch die zwei zersprungenen Kacheln, die er kennt.
Die Scheu vermindert sich, ein Heimatgefühl überkommt ihn. Da tritt er in das zweite Zimmer. Es war ehemals seine „gute Stube“. Er wollte ja eigentlich gar keine gute Stube, aber Margarete bestand darauf nach Frauenart. Es war eine ihrer wenigen kleinen Eitelkeiten. Er muss ein wenig lächeln. Wie klein und niedrig dieses Zimmer war! Seine jetzige Küche ist doppelt so gross als diese „gute Stube“. Und doch war es eine gute Stube, so sehr gut, dass er sich jetzt keiner einzigen bösen Stunde erinnert, die er hier verlebte.
Er tritt ans Fenster. Dort drüben liegt ein grosses dunkles Haus. Eine Volksschule ist’s, und er hat vor Jahren dort amtiert. Jetzt ist er längst nicht mehr Lehrer, jetzt ist er Grosskaufmann, Fabrikbesitzer, Stadtverordneter, Gott weiss, was er jetzt alles ist. Ja, ja, er ist gewaltig in die Höhe gekommen, sein Vermögen hat sich vermehrt, sein Ansehen ist gewachsen, seine Lebensweise hat sich verfeinert, nur sein Glück ist verloren gegangen. Nur sein Glück, sonst nichts! Alles andere ist in tadelloser Ordnung.
Er schaut immer hinüber nach den hohen, dunklen Fenstern, und da packt ihn — wie schon so oft — das Heimweh nach dem alten, lieben Berufe, dem doch sein ganzes Herz gehört hatte, und der auch gewiss seine Bestimmung war.
Seufzend wendet er sich endlich ab und geht nach der Wohnstube zurück. Ob er das letzte wagte und auch einmal da hinein in die Schlafstube ging? Dort drin war sie gestorben.
Er zögert lange. Aber dann öffnet er langsam die Tür. Jäh schliesst er die Augen. Steht nicht dort — dort im Winkel, im Scheine eines ungewissen Nachtlichtes, ihr Bett? Liegt sie nicht dort in ihren Qualen, und schaut sie ihn nicht traurig an mit ihren guten Augen? Und wimmert nicht das Kindlein wieder?
„Ich möchte so gerne bei euch bleiben, bei euch beiden! Weine nicht so sehr, guter Franz, — weine nicht gar so sehr?“
„Du hattest mich so lieb, — du bist so gut, — ich danke dir, Franz, ich danke dir für alles! Es war so schön bei dir!“
„Margarete!“
Das Licht fällt verlöschend zur Erde, der Einsame eilt in den leeren Winkel. Er presst die heisse Stirn gegen die kühle Wand und weint bitterlich.
Nach Minuten lehnt er sich ans Fenster. Draussen über dem stillen Hofe leuchten zwei Sterne.
Wie er so in den dunklen Hof hinausschaut, wird sein Gesicht finster. Warum hatte es ihn so furchtbar hart betroffen, warum musste sie sterben? Sie war sein guter Engel gewesen und hatte, als sie schied, die Liebe und das Glück mit sich genommen. Wenn sich sonst eine Ehe löst durch den Tod, findet der zurückbleibende Teil trotz seines Wehes doch einen Trost, einen Halt, einen Frieden, vielleicht gar ein neues Glück. Er nicht! Er hat sich hundertmal selbst belogen.
Hier, hier in diesen Räumen allein hat sein Glück gewohnt. Hier hat er’s zurückgelassen, und er findet es nicht wieder, und wenn er suchend wandert über die ganze Erde. Am allerwenigsten wird er es bei ihr finden — bei der Zweiten.
Kann es denn nach einer Ersten eine Zweite geben? Für ihn nicht! Es war ein furchtbarer Irrtum, als er sich an jene andere band. Sie ist auch nicht sein Weib geworden, — nur seine Gemahlin. Sein Weib war diese hier!
Wie kommt es aber, dass gerade heute nach so langer Zeit seine alte Liebe und Sehnsucht wieder lebendig wird? Weil er geflohen ist vor jener anderen, geflohen aus seinem kalten, frostigen Hause, geflohen wie ein Gemarterter. Und jetzt weiss er auch, warum der Fuss heute über die Strombrücke lenkte, warum er hierher kam.
Er musste einmal wieder zu Hause sein!
Ja, er hat viel verloren: sein Weib, seinen Beruf, seine Heimat. Er hat sich nie wieder heimisch gefühlt. Damals, als ihm kurz nach Margaretens Tode unerwartet die hohe Erbschaft zufiel, als er unglückseligerweise seinen Beruf aufgab, damals ist er ruhelos umhergezogen durch die ganze Welt. Er suchte Vergessen und Frieden. Der Tor! über die höchsten Alpenkuppen vermag ein winziger Grabhügel uns nachzuschauen.
Irgendwo traf er seine jetzige Frau. Sie war ihm so gleichgültig wie alle anderen, aber ihr Vater gefiel ihm. Die Ruhe des älteren Mannes tat seiner aufgeregten jungen Seele wohl.
Und eines Tages war er mit der Tochter verlobt. Als er damals nach dem Feste nach Hause in sein Zimmer kam und vor das Bild seiner Frau treten sollte, war es ihm, als habe er einen Ehebruch begangen. Und doch waren die Augen des Bildes, das vor ihm auf dem Tische stand, gütig und mild. Es war stille Nacht, und er sprach mit ihr in seinem Herzen. Da war es ihm, als ob sie ihm Antwort gäbe, als ob eine leise, zarte Stimme zu ihm spräche: „Armer Freund, ich zürne dir ja nicht! Finde eine neue Heimat, du lieber, ruheloser Mann!“
Und diese Heimat hat er nicht gefunden. Er ist in das Geschäft seines Schwiegervaters eingetreten, er hat ein kostbares Haus bezogen und einen grossen Haushalt eingerichtet, aber eine Heimat war das nicht. Er lebte immer wie ein halbfremder Gast bei seiner Gemahlin und ihren vielen Bedienten.
Ist sie gar so zu verurteilen? O nein! Sie ist schön, reich und geistvoll. Sie hat nur kein Herz. Und er — er hat sie ja auch nie geliebt. Die Heirat mit ihr war nichts als ein neuer, letzter Versuch, zur Ruhe zu kommen. Dass er so ganz und gar misslang, war kaum ihre Schuld.
Es fehlt ihr die Herzensgenialität Margaretens, ihre liebe Stimme, ihr sanftes stilles Wesen, ihre fürsorglichen, weichen Hände. Und das kann durch nichts, durch keinen oberflächlichen Glanz aufgewogen werden.
Müde lehnt sich der Einsame gegen das Fenster. Die zwei Sternlein vom Himmel schauen auf ihn freundlich hernieder. Ganz still steht er und lauscht und schaut mit den feinsten Sinnen seiner Seele. Da fällt der Groll von ihm ab, und sein Herz wird weich. Er schaut nicht nach rückwärts, aber es ist ihm, als schritte unhörbar sein geliebtes Weib durchs Zimmer, wie sie sonst tat, wenn er traurig war. Und jetzt fühlt er’s ... sie legt den blonden Kopf auf seine Schulter und schlingt den Arm weich um seinen Hals, und sie fragt nach seinem Kummer und tröstet ihn, es würde bald wieder besser sein.
Da wendet er sich jäh um. O, er ist allein! Eine Frage, eine einzige Frage nur wollte er an sie stellen: Wie es besser werden könnte.
Und da fällt ihm urplötzlich sein Kind ein, sein Kind und ihr Kind — die kleine Margarete. Die lebte noch. Damals, als die Frau starb, hatte er das Kind zu seiner Mutter und seiner Schwester gegeben, die in einer kleinen Stadt lebten; er selbst konnte es ja nicht erziehen. Und dann, als er sich wieder verheiratet hatte, hatte er sich gescheut, das Kind zu sich zu nehmen. Das Mädchen hing an der Grossmutter und an der Tante; aber die Hauptsache war, er mochte es seiner zweiten Frau nicht zur Erziehung übergeben. Die liebte ihn nicht, um viel weniger würde sie sein Kind lieben. Und die Liebe ist doch das einzige Werkzeug der Erziehung. Nein, sie konnte keine Frau sein, viel weniger eine Mutter. Es war ein Glück, dass sie selbst keine Kinder besass. So blieb die kleine Margarete bei der Grossmutter. Er bezahlte reichlich für die Erziehung und fuhr manchmal hin. Nicht oft! Er fürchtete sich, an seine alte Wunde zu rühren, wie er sich ja gefürchtet hatte, hierherzukommen. Er konnte auch jetzt das Kind nicht in sein Haus nehmen. Das war ganz unmöglich.
Also würde er sein glück- und liebeleeres Leben fortsetzen müssen. Die ganze Bitterkeit seiner Vereinsamung überfällt ihn aufs neue. Wenn jetzt die alte Frau kam und er aus diesen Räumen hinaus musste, wanderte er wieder in die Fremde.
Ein schwerer Seufzer der Angst vor seiner Zukunft ringt sich von seiner Brust; in seiner Qual faltet er die Hände. Und in schwerer Erregung spricht er; die Worte sind kaum hörbar. Manches bleibt nur Gedanke, manches löst sich in ein Seufzen auf. So, wie wenn einer in stiller Kirche mit ganz schwerem Herzen betet:
„Margarete, du Verklärte, kannst du mich hören? Weisst du, dass ich hier bin? Weisst du, dass ich nach Hause gekommen bin? Margarete, ich bin ja so unglücklich! Ich weiss mir keinen Rat, die Verzweiflung überkommt mich; hilf mir, Margarete, hilf mir noch ein einziges Mal! Siehst du, ich bin hier, hier in unserem Zimmer, hier, wo du mein Weib warst, hier, wo du Mutter wurdest, hier, wo du starbst, hier in dem Tempel deiner reinen Weiblichkeit, und ich flehe dich an, tröste mich nur dieses eine Mal!“
Erschöpft von der grossen Erregung, lehnt sich der Unglückliche gegen die Mauer. Er schliesst die Augen und scheint schwer nachzudenken. Es bleibt alles tot und stille. Die, zu der er sprach, ist zu weit. Aber, er lauscht doch ... lauscht ... lauscht ... wie wenn Antwort käme aus hoher Weite. Und plötzlich richtet er sich hastig auf, seine Augen sind weit geöffnet und strahlen vor Freude, seine Hände graben sich in die Haare.
„Das, Margarete, das soll ich tun? Das?! Die Mutter, die Schwester, das Kind hierherholen? Unser altes Heim wieder einrichten? Sie hier wohnen lassen? Hier, Margarete, hier in unserer Wohnung? Und wieder ein Heim haben? Und wieder ein Heim haben?“
Der Mann steht weinend mitten in der Stube.
„Margarete, gute Margarete, siehst du, das wusstest nur du! Das konntest nur du mir raten. Das fiel sonst niemand ein. Du weisst immer, was mir fehlt, du weisst immer einen guten Rat für mich. Ja, ja, ich will unsere alten Möbel von der Mutter kommen lassen, ich werde alles so einrichten lassen, wie’s war, und ich hole alle die Lieben hierher. Ich kann sie dann besuchen, so oft ich will, ich kann heimgehen, wenn es mir nicht gut geht. Ich werde wieder eine Margarete haben, ich werde wieder unsere Wohnung haben, ich werde das Kind selbst unterrichten, und so werd’ ich auch wieder Lehrer sein können. Ich danke dir, Margarete, denn das wusstest nur du!“ — — —
Die alte Hausmeisterin kommt. Sie erhebt ein grosses Lamento über ihren Enkel, der sich sehr verletzt habe, und bittet um Entschuldigung wegen ihres langen Ausbleibens.
„Schon gut, Frau Völker, es ist schon gut! Ich miete die Wohnung! Hier haben Sie eine Anzahlung, und hier ist meine Adresse. Ich komme bald wieder, da regeln wir alles. Gute Nacht, Frau Völker!“
„Gute Nacht, mein Herr!“
Verwundert geht die Frau auf den Flur an eine Gasflamme.
„Woher er bloss meinen Namen weiss!“
Sie liest: „Franz Berthold.“
„Herr Berthold, — Jeses, — Herr Berthold! Herr Berthold!“
Der hört sie nicht mehr. Er geht unten bereits wieder über den Platz.
Die Eisenbahn.
Der Schluss einer Geschichte.
Er sieht wieder nach der nahen Berglehne, über die der Weg nach der Stadt führt. Der Wind geht heute; da ist die Luft klar, und er wird vielleicht die Eisenbahn sehen können. Zwei Stunden sind’s ganz gut bis dahin, aber er hat schon einmal am Damme gestanden und die Bahn ganz nahe gesehen.
Auf der Berglehne steht eine Windmühle, die ist der Stolz des ganzen Dörfchens, denn sie hat fünf Flügel. Der Joachim hat einmal den Müller gefragt: ob es ihm denn nicht auch so vorkäme, als zeige die Windmühle beim Drehen mit ihren fünf Fingern immer hinüber nach der Stadt. Doch der Müller hat gelacht und gesagt, die Windmühle hätte ja gar keine Finger.
„Und sie hat doch Finger!“
Der Joachim lehnt sich am Feldrain zurück und versinkt ins Träumen. Zwei- oder dreimal meldet ihm der Schäferhund, dass nicht alles in Ordnung sei. Er beachtet’s nicht. Er ist dem Hunde gram und den Schafen noch mehr.
Dass er wandern wird, steht fest; aber nicht nach Berlin, wie er bisher wollte, sondern lieber nach Hamburg, wo das Meer ist. — Oder nach Breslau! — —
Eine schwere Röte zieht über das Gesicht des Burschen, und er schaut sich um: ob auch kein Mensch in der Nähe sei. Er ist ganz allein. Da wird er mutig und spinnt seinen Gedanken fort. Nach Breslau!
Ja, das ist sicher: sie hat zu ihrem Vater gesagt, er hätte ein interessantes Gesicht und kleine, schöne Hände. Die Martha hat’s aufgeschnappt und ihm wiedererzählt. Seit der Zeit spricht er öfter mit der Martha als sonst. Aber sie erzählt nichts Neues mehr.
Warum sie nur vorgestern so heulte, die Martha, das dumme Ding? Sie hat’s doch gut, sie ist so viel um das Fräulein und darf ihr die meisten Dienste tun. — —
Wie das Fräulein doch so klug, so reich und so engelsschön sein kann! Weit in der Ferne, in der grossen Stadt, gibt es vielleicht noch mehr solche Mädchen. Doch es soll ja nicht mehr geben, nur diese eine, nur diese!
Nach einer Weile fängt der junge Schäfer an zu rechnen und wälzt sich dann schwer im Grase. Es sind wirklich fünf Wochen, dass sie da ist, und ist nur noch eine Woche Zeit.
Joachim seufzt schwer. Der Winter ist so lang und der Sommer so kurz, und nur im Sommer ist er glücklich.
Die Sommergäste hat er immer verehrt — alle, sogar die dicke Kaufmannsfrau aus Posen. Die Sommergäste sind alle reich, sie brauchen nicht zu arbeiten, sie sind nicht grob zueinander und tragen nie schmutzige Kleider.
Joachim schaut an sich hinunter. Er hat die Sonntagsstiefel an und würde sogar den Sonntagsanzug zum Schafehüten anziehen, wenn er nur nicht gar zu sehr ausgelacht würde. Er möchte sich immer halbtot schämen vor ihr ... so in diesen Lumpen.
Ob sie heute aufs Feld kommen wird, oder ob sie im Walde liest? Gestern hat sie ihm im Vorbeigehen nur zugenickt, aber vor vier Tagen ist sie mit ihrem Vater bei ihm stehen geblieben. Ob denn die Schafe nicht auch manchmal krank würden, hat sie gefragt. Da ist er glücklich gewesen, ihr alle Schafkrankheiten aufzählen zu können, die er kannte, und hat auch die Mittel angegeben, sogar die geheimen.
Jetzt taucht ihm auch der Wunsch auf sie möchte einmal krank werden, er würde dann Tee für sie suchen. Aber er kann nichts für sie tun — gar nichts. —
Der Joachim ist ein wenig müde, darum lässt er von der Zukunft ab und denkt ans Vergangene — an alle Begegnungen mit ihr. Diese Gedanken sind ganz mühelos, weil sie ihm so geläufig sind.
Am liebsten stellt er sie sich vor, wie er sie zuerst gesehen hat; damals, als er mit der Herde heimtrieb und sie in der Haustüre stand. Er hat jetzt herausgefunden, dass das runde Fenster in der Tür, das im Abendlichte glänzte, ausgesehen habe wie eine Krone über ihrem Haupte oder wie ein goldener Heiligenkranz. Manchmal, wenn er sehr lebhaft daran denkt, kommen ihm Tränen in die Augen.
Aber wenn er an die andere Geschichte denkt, wie sie ihn fragte, ob es wahr sei, dass er Gedichte machen könne, wird er wild — wild über sich selbst.
„Es ist ja erst gar nicht wahr.“ Das sagt man doch zu keinem solchen Fräulein. Und dann überhaupt, was war er für ein Esel, dass er sich so schämte! Er hätte sein Glück machen können. Er hätte einfach „ja“ sagen und das blaue Heft zeigen sollen, dann hätte sie doch gesehen, dass er kein so erbärmlicher, dummer Kerl ist.
Nun weiss sie von allem nichts.
Wenn sie ihn noch einmal fragte, nur noch ein einziges Mal fragte! Aber er weiss schon, damit ist’s nichts mehr, sie hat’s übel genommen.
Er müsste selbst anfangen!
Joachim gerät in grosse Erregung, steht auf und macht einen Gang um die Herde. Dann setzt er sich wieder auf den früheren Platz.
Sein alter Plan ist wieder vor ihm aufgetaucht; der Traum von der grossen Stadt, von Ruhm und Reichtum. Den Zeitungsfetzen, auf dem von dem Dichter Peter Rosegger gedruckt steht, der jetzt berühmt und reich sei und doch ehemals bloss ein ungebildeter Schneidergeselle war, trägt er noch immer bei sich. Er liest die Geschichte alle Tage, denn wenn er sie bloss auswendig vor sich hinsagt, glaubt er sie nicht. Dass es so etwas wirklich geben könne, hat ihn ja so glücklich und so faul gemacht. Vor dem Winter wird ihn der Bauer fortjagen. Das macht der Geiz.
Es ist alles egal. Wenn er nur wüsste, wo der Schneider und Dichter Rosegger wohnt; da würde er einmal einen Brief an ihn schreiben, wie man’s anfangen müsse, wenn man ungebildet sei und dichten könne. Aber die Adresse steht nicht in der Zeitung.
Jetzt zieht er das blaue Heft unter der Weste hervor und beginnt in halblautem, singendem Tone Gedichte zu lesen. Plötzlich erstirbt seine Stimme zum Flüstern:
„Es kann nicht sein,
Du bist so fein
Doch du so weit und ich hier allein,
Das — das kann erst recht nicht sein!“
„Adieu, Joachim! Wir reisen heute schon! Adieu! Adieu!“
Der Schäfer schrickt auf. Drüben auf der Strasse sieht er die Droschke seines Bauern vorbeifahren, darin sitzt sie und ihr Vater.
„Adieu, Joachim!“
Der sitzt wie versteinert. Der Wagen fährt weiter. Sie wendet sich um und winkt noch einmal, auch der Vater. Und der Anton sitzt vorn auf dem Bock und knallt mit der Peitsche. Das alles sieht Joachim, aber er vermag kein Glied zu rühren. Er starrt nur dem Wagen nach, der den Berg hinauffährt. Erst wie er ihn jenseits des Hügels verschwinden sieht, öffnen sich seine Lippen. Ein kurzes, lallendes Lachen kommt ihm vom Munde:
„Sie ist fort!“
Dann sitzt er wieder ganz still — eine Viertelstunde lang; nur einen Stengel Sauerampfer kaut er gedankenlos. Schliesslich legt er sich hin, mit dem Gesicht auf die Erde, und bleibt so liegen eine halbe Stunde lang.