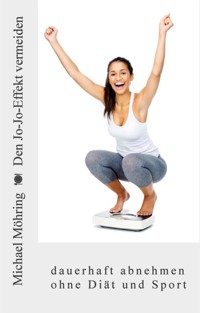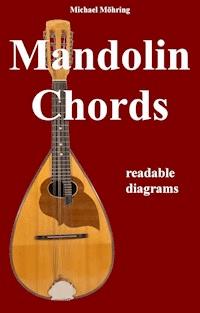4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Dezember 1976 planen zwei Jugendliche, die DDR über die Grenze der ČSSR ungesetzlich zu verlassen. Im letzten Augenblick überlegten sie es sich anders und brachen die Aktion ab. Doch dafür war es bereits zu spät, der Staat hatte sie bereits unter Beobachtung.
Die Angelegenheit fand erst im Februar 1988 endgültig ihr Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
In den Händen der Staatssicherheit
die Jahre 1976 bis 1988
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEine lange Nacht
Klötze ist eine Kleinstadt in der Altmark, die heute zu Sachsen-Anhalt zählt und zu DDR-Zeiten eine Kreisstadt war. In den 70er Jahren war man dort stolz auf das neu gebaute Halbleiterwerk, welches vielen Bürgern einen Arbeitsplatz bot, besaß eine bekannte Weinkellerei und auch heute noch verfügt der Ort über große Anbauflächen für Obst. Während meiner Schulzeit verdiente ich mir dort in den Ferien oft mit Obstpflücken mein Taschengeld. Klötze ist umgeben von Wald, und nur etwa 15 km westlich lag die damalige Staatsgrenze zu Westdeutschland.
Es war das Jahr 1976 und ich hatte gerade die Schule beendet. Meine Eltern bemühten sich redlich, für mich eine Lehrstelle zu finden, denn ich war in der Abschlußprüfung im Fach Literatur durchgefallen, weil ich mich weigerte, die Pflichtbücher so zu rezensieren, wie es von mir verlangt wurde. Als Folge davon erhielt ich nicht den Abschluß der 10. Klasse der »Polytechnischen Oberschule«, sondern nur den der 9. Klasse.
Das war in zweierlei Hinsicht ziemlich ärgerlich. Zum einen hatte ich alle anderen Prüfungen bereits bestanden, zum anderen war ich in unserer Schulklasse mit Abstand derjenige, der zu dieser Zeit die meisten Bücher las. Nicht selten war ich bis tief in die Nacht hinein in ein Buch vertieft und kam morgens oft mit dunklen Augenrändern zum Unterricht.
Dabei gab ich mir redlich Mühe, Kriegsbücher wie »Nackt unter Wölfen« oder »Wie der Stahl gehärtet wurde« zu lesen. Jedoch ertappte ich mich nach ein paar Seiten immer dabei, wie ich mit den Gedanken irgendwo war, nur nicht beim Stoff des Buches. Nach einer halben Stunde gab ich meist auf, denn ich hätte nicht sagen können, was ich gerade gelesen hatte. Meine Abneigung gegenüber Kriegsliteratur war zu groß.
Während des letzten Schuljahres hatte ich die Filme zu beiden Büchern gesehen und war deswegen nicht völlig unvorbereitet zur Prüfung gegangen. Mein Problem war, daß mit dem Stoff des Buches auch die politische Einstellung getestet wurde. So war beispielsweise die Antwort auf die Frage, welche Parteien sich in »Nackt unter Wölfen« gegenüberstanden nicht »Häftlinge und Nazis«, sondern »Menschen und Unmenschen«. Nach einigen ähnlich vermeintlich falschen Antworten ließ man mich durchfallen. Auch bei der Nachprüfung lief es nicht besser.
Nachdem ich also die Abschlußprüfung in Deutsch vergeigt hatte, war es dann nicht mehr so leicht, eine Lehrstelle zu finden. In Greifswald wurden meine Eltern schließlich fündig.
So fuhr ich in der Nacht zum 1. September 1976 von Klötze in das rund 250 km entfernte Greifswald, um im Kernkraftwerk Lubmin eine Lehre als Baufacharbeiter zu beginnen. Am frühen Morgen sollte im dortigen Bahnhofs-Restaurant die Begrüßung aller Schulabgänger stattfinden, die im Kernkraftwerk eine Lehre beginnen wollten. Dieses Kernkraftwerk ging 1974 in Betrieb und galt nun, zwei Jahre später, als Vorzeigewerk der DDR.
Der Bahnhof von Greifswald glich jedem anderen Bahnhof, den ich bisher kennengelernt hatte. Er war grau, laut und dreckig. Wie üblich waren Polizisten zu sehen, um die man besser einen großen Bogen machte, wollte man nicht von ihnen belästigt werden. Derartige Ausweichmanöver kannte ich bereits zur Genüge. In Klötze konnte ich als Mopedfahrer darauf wetten, angehalten und kontrolliert zu werden, wenn ich an umherschlendernde Polizisten vorbeifuhr. Sah ich sie von weitem, nahm ich lieber einen Umweg in Kauf, als gestoppt zu werden und deren wichtigtuerische Fragen nach meinem Ausweis, der Fahrerlaubnis oder wo ich hinwolle zu beantworten. Sie zeigten nur allzugern, welche Macht sie hatten. Da spielte es keine Rolle, in welcher Stadt man sich befand. Die Polizisten waren in der DDR überall gleich.
Als ich das Restaurant betrat, war es bereits gut gefüllt. Die Begrüßung der zukünftigen Lehrlinge erfolgte durch eine Vertretung der Leitung des Kernkraftwerkes und begann pünktlich. Ich stellte mich mit meinem Koffer etwas außerhalb der Menschenmenge und musterte die Lehrlinge. Die meisten waren mit zumindest einem Elternteil gekommen und waren, wie ich später erfuhr, aus der unmittelbaren Umgebung. Lehrlinge, die von so weit angereist waren wie ich, gab es eher selten.
Nach der allgemeinen Eröffnung wurden die Namen aller Neuankömmlinge aufgerufen und einem Lehrausbilder zugewiesen. So bildeten sich nach und nach mittelgroße Gruppen, die jeweils ein eigenes Lehrlingskollektiv bilden sollten. Ausgebildet wurde in zahlreichen Richtungen wie Maler, Schweißer, Schlosser, Elektriker oder eben Baufacharbeiter.
Irgendwann wurde auch mein Name aufgerufen. Ich ging mit meinem Koffern nach vorn zum Redner und wurde dort einem Kollektiv zugeteilt, welches aus zwölf Lehrlingen bestand. Die meisten von ihnen kannten sich gegenseitig und unterhielten sich bereits angeregt, als ich zu ihnen stieß. Mich beachtete man kaum, und obwohl ich mir etwas verloren vorkam, war ich ganz froh darüber.
Nachdem alle Lehrlinge eingeteilt waren, verließen immer mehr Gruppen den Saal.
Unserer Gruppe stand ein Mann mittleren Alters vor, der sich als unser Ausbilder vorstellte und uns erklärte, wie es nun weiterging. Wir und zwei weitere Gruppen sollten noch am selben Tag für eine sechswöchige vormilitärische Ausbildung in ein Lager außerhalb Greifswalds gebracht werden. Es war ein Schock für mich, denn mit allem hatte ich gerechnet, nur nicht, daß statt einer Lehre erst einmal militärischer Drill und politische Schulungen meinen Tagesablauf bestimmen sollten. Zwar wußte ich, daß eine vormilitärische Ausbildung zur Lehrzeit gehörte, jeder Lehrling in der DDR mußte in seiner Lehrzeit zweimal diese sechs Wochen durchlaufen, daß sie jedoch so überraschend kam, übertraf meine schlimmsten Befürchtungen. Insgeheim hatte ich die Hoffnung gehegt, die Lehre abbrechen zu können, denn der Beruf des Maurers war weder interessant für mich, noch hatte ich dazu die körperliche Statur, und auf diese Weise die vormilitärische Ausbildung zu umgehen.
Das war ein Irrtum. Kurze Zeit später brachte uns ein Bus ins Ausbildungslager.
Im Wehrerziehungslager
Das Lager lag zwischen Feld und Wald, war umzäunt, beinhaltete zwei Baracken und ein zweistöckiges Backsteinhaus. Gleich nach der Ankunft ging es auch schon los mit dem militärisch strengen Ton der Ausbilder. Noch mit den Koffern in der Hand hatten sich alle auf dem Appellplatz vor den Baracken aufzustellen, wo nach einer kurzen Ansprache und der Unterweisung, wie wir uns im Lager zu verhalten haben, unsere Namen vorgelesen wurden.
Jeder der aufgerufenen Lehrlinge bekam ein Zimmer in einer der beiden Baracken zugewiesen, auf dem er mit drei weiteren Lehrlingen die nächsten sechs Wochen wohnen sollte. Am Ende des Appells durften wir abtreten und bekamen zwanzig Minuten Zeit, um die Zimmer aufzusuchen und den Inhalt unserer Koffer in die Schränke zu verstauen. Anschließend sollten wir uns wieder in Reih und Glied auf dem Appellplatz einfinden.
In jedem dieser Zimmer standen vier Holzbetten, auf deren Brettern, die als Ersatz für einen Lattenrost dienten, jeweils eine dreiteilige blaue Matratze lag. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit vier Holzhockern und an den Wänden für jeden ein kleiner Schrank für die persönlichen Besitztümer. Alles mußte schnell gehen, und so suchte sich jeder einen Schlafplatz aus und verstaute seinen Kofferinhalt in den Spind. Von diesem Zeitpunkt an bekamen wir keine ruhige Minute mehr, diese Hektik sollte die ganzen sechs Wochen andauern.
Zum ersten Mal kam ich mit meinen neuen Kollegen ins Gespräch. Alle nahmen die kommende Zeit ziemlich gelassen. Es wird durchgezogen und fertig. Mir dagegen war es schon immer ein Greuel, mit fremden Menschen zusammenzuleben. Deshalb schreckte mich auch die kommende Zeit im Internat ab. Im Gegensatz zu meinen drei Mitbewohnern hatte ich auch etwas gegen Befehlston und Marschieren. Alles Militärische lehnte ich ab, wobei noch nicht einmal pazifistische Gründe vorlagen. Ich war nur nicht der Typ dafür und hätte Gründe gefunden, die Lehre gar nicht erst anzutreten oder irgendwie verspätet anzufangen, hätte ich gewußt, was gleich zu Beginn auf mich zukam.
Ich belegte das obere Bett auf der rechten Seite, verstaute meinen Kofferinhalt notdürftig in einem der Schränke und ging, nachdem auf dem Flur ein lauter Pfiff mit einer Trillerpfeife zu vernehmen war, mit den anderen wieder zum Appellplatz. Hier bekamen wir zu hören, was als nächstes geplant war. Zunächst sollte es zur Kleiderkammer gehen, wo wir unsere Uniformen, Decken, Kopfkissen und blauweiß karierte Bettwäsche bekamen. Wieder im Barackenzimmer verschwand nun auch unsere Zivilkleidung in den Schränken und ich steckte das erste Mal in meinem Leben in einer Uniform.
Mehr und mehr spürte ich Müdigkeit, die sich durch Schwindel bemerkbar machte. Die letzte Nacht hatte ich nicht schlafen können und war nun seit über 24 Stunden auf den Beinen. Meine Zimmergenossen kamen allesamt aus der unmittelbaren Umgebung und waren in deutlich besserer Verfassung. Sie waren ausgeschlafen und neugierig auf das, was kommen wird.
Noch vor dem Mittagessen ging es hinaus aufs Feld, und wir mußten dort den ersten Drill über uns ergehen lassen. Zuerst regte sich leichter Widerstand, denn viele wollten nach dem Durcheinander in Greifswald und all den neuen Eindrücken im Lager erst einmal zur Ruhe kommen. Doch unser Ausbilder blieb hart, und so blieb uns nichts anderes übrig, als zu gehorchen und die Tortur über uns ergehen zu lassen. Auf dem Feld wurde marschiert, sich in Reihen aufgestellt, gerobbt, gelaufen, stillgestanden. Der Ausbilder, der uns über das Feld scheuchte, war später auch für unsere Ausbildung auf dem Bau zuständig.
Nach zwei Stunden war der Spuk vorerst vorbei und wir marschierten zurück in die Zimmer, um unsere Sachen zu ordnen und das Bett zu beziehen. Dreißig Minuten später ermahnte uns wieder die Trillerpfeife, in einer Reihe auf dem Flur der Baracke Aufstellung zu nehmen. Es war Mittagszeit. Zu jeder Mahlzeit marschierten wir, ein aus der Schulzeit gelerntes Kampflied aus dem letzten Weltkrieg singend, zum Speisesaal: »Auf, auf zum Kampf, zum Kampf! Zum Kampf sind wir geboren ...«. Am Tisch hinsetzen durften wir uns erst, nachdem der Befehl dazu kam.
In diesem Lager wurden wir in allem ausgebildet, was die Armee auch für normale Soldaten zu bieten hatte. Den einen Tag übten wir marschieren, an einem anderen waren Schießübungen an der Reihe. Wir robbten über Felder und Waldwege, gruben uns im Wald mit einem Feldspaten ein, gehorchten Befehlen, standen bei Appellen still und wurden nachts wegen Probealarm aus den Betten geholt. Zum nächtlichen Wachdienst, der jeweils für zwei Lehrlinge zwei Stunden dauerte, bekamen wir munitionslose Luftgewehre. Unser Einwand, damit bei einer reellen Gefahr nichts ausrichten zu können, begegneten die Ausbilder mit der Bemerkung, allein der Anblick einer Waffe würde den Gegner in die Flucht schlagen.
Mir fielen diese sechs Wochen unsagbar schwer und ich spürte dort einmal mehr, ich war nicht für den Armeedienst geschaffen. Alles war mir zuwider: der Befehlston, das Marschieren, die politischen Schulungen, der Lärm auf dem Zimmer und im Flur. Dazu kam meine Ablehnung gegen alles, was mit Militär zu tun hatte, und ich wollte die DDR weder verteidigen, noch mein Leben für sie einsetzen.
Nachdem unsere Wehrerziehung vorüber war und wir das Lager geräumt hatten, waren andere Lehrlingskollektive an der Reihe. Ich war froh, als der Spuk vorläufig sein Ende fand.
Stahlbrode
Mitte Oktober fing schließlich die eigentliche Lehre an. Sie begann auf einer Baustelle an einer Chaussee zwischen den Ortschaften Stahlbrode und Reinberg, etwa 20 km nördlich von Greifswald.
Das Haus, an welchem wir zusammen mit einer anderen Lehrgruppe das Bauhandwerk erlernen sollten, stand schon mit seinen vier Außenwänden. Unsere Aufgabe sollte es sein, die Innenwände hochzumauern. Auf der gegenüberliegenden Chausseeseite lag unsere Baracke, wo wir nachts alle in einem großen Zimmer in den zehn zweistöckigen Betten schliefen.
Nach der Arbeit war es schwer, die Zeit totzuschlagen. Der kleine Fußballplatz war durch Regen meist überschwemmt und fiel als Freizeitbeschäftigung aus. Und weil dann nur noch der Fernsehraum übrigblieb, liefen wir abends in die gut einen Kilometer entfernte Ortschaft Stahlbrode, wo sich eine Gaststätte befand. Bier trinken wurde zu unserem liebsten Hobby. Besonders deprimierend war es an den Wochenenden. Fast alle Lehrlinge, die in der Nähe wohnten, fuhren nach Hause. Diejenigen, die das nicht konnten oder wollten, ließen sich an einer Hand abzählen.
Meist fuhr ich dann nach Greifswald, weil die Stadt mehr Abwechslung bot und sich dort die Zeit leichter totschlagen ließ. Nach Klötze zu fahren war nicht nur zu aufwendig für mich, sondern auch viel zu teuer. Von dem Lehrgeld konnte ich mir keine großen Sprünge erlauben, zumal ein Großteil des Geldes für Bier draufging.
Eine schicksalhafte Bekanntschaft
Als ich gerade Vorbereitungen traf, den Abend eines dieser langweiligen Wochenenden totzuschlagen, ging die Tür der Baracke auf und herein kam ein Junge, den ich von der Baustelle her kannte, der jedoch nicht direkt mit mir zusammenarbeitete. Er war etwas kleiner als ich, hatte blonde, für diese Zeit etwas zu kurze Haare und blaue Augen. Bisher hatten wir kaum miteinander gesprochen, doch er machte auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck. Viele Lehrlingskollegen waren Angeber, prügelten sich gerne oder prahlten mit ihren Taten, die meist ihrer Phantasie entsprangen. Von dem Typen vor mir wußte ich bereits, daß er nicht so war. Maurer war anscheinend ebenso wenig sein Traumberuf, wie es bei mir der Fall war. Zudem war er zu klein und zu schmächtig, um auf Dauer die schwere Arbeit auf dem Bau bewältigen zu können. »Kommst du mit?«, fragte er.
»Wohin?«
Er grinste: »Sicher nicht auf eins der freien Felder rings umher. In die Kneipe natürlich!«
»Ja. Warum eigentlich nicht? Es ist ja sonst nichts los.«
Von meinen 80,-- Mark Lehrlingsgeld hätte ich mir 200 Gläser Bier kaufen können. Ich nahm mein Portemonnaie und stiefelte mit ihm die Landstraße in Richtung Gaststätte entlang.
»Du kommst auch nicht von hier, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Zerbst.«
»Ich wohne in etwa genauso weit weg. Aber das Kaff wird dir nichts sagen. Irgendwo nördlich von Magdeburg.«
»Und warum hier oben die Lehre?«
»Bei mir in der Umgebung gab es ausbildungsmäßig nichts für mich. Ich bin durch die Abschlußprüfung gefallen, und habe deshalb nur den Abschluß der 9. Klasse. So bin ich halt hier gelandet. Und du?«
»Ich wollte weg von zu Hause.«
»Ärger?«
»Ich wollte einfach nur weg.«
Die Kneipe war wie immer gut besucht. Wir holten an der Theke zwei Bier und setzten uns an einen freien Tisch. Anfangs drehte sich unser Gespräch noch über die Arbeit, doch im Laufe des Abends begann er, mir von seiner Vorstrafe wegen versuchter Flucht nach Westdeutschland zu erzählen. Das erstaunte mich, denn er war gerade erst 17 Jahre alt geworden. Zu dieser Zeit hatte ich zwar hin und wieder an einen Fluchtversuch in Richtung Westdeutschland gedacht, aber bisher blieb es bei dem Gedanken. Diese mißglückte Flucht brachte ihm den Verlust seines Personalausweises ein, und er bekam stattdessen einen sogenannten PM 12, ein zweiseitiger Ausweis, der ihn als vorbestrafte Person brandmarkte. Als er davon sprach, was bei seiner ersten Flucht alles schiefgegangen war, stieg in mir die Hoffnung auf, in ihm einen Menschen gefunden zu haben, der genug Erfahrung für eine erfolgreiche Flucht nach Westdeutschland besaß.
Ein schwerer Fehler, wie ich Wochen später feststellen mußte.
Im Laufe der nächsten Tage trafen wir uns immer öfter nach Feierabend. Unsere Gespräche drehten sich dabei fast ausschließlich um den Westen. Auf der Landstraße konnten wir sicher sein, von niemandem belauscht zu werden.
Der Gedanke, die DDR mittels Flucht in den Westen zu verlassen, setzte sich durch unsere Gespräche immer mehr in meinem Kopf fest. Wenn ich schon am Anfang meines Berufslebens stehe, warum dann nicht ein Leben in Westdeutschland beginnen?
Bei den Gesprächen mit Bernd-Ulrich, so hieß der junge Mann, wurden aus kleinen Andeutungen bald konkrete Vorhaben: Wir planten einen Fluchtversuch. Bei der ersten Verurteilung hatte Bernd-Ulrich eine Bewährungsstrafe bekommen. Würde er erneut erwischt werden, würde es mit Sicherheit härter für ihn ausgehen. Die Flucht durfte also nicht mißglücken.
Ein Weg über die Grenze der DDR erschien uns zu gefährlich und so beschlossen wir, über die ČSSR nach Westdeutschland zu gelangen. Leider wußten wir sehr wenig über dieses Land und noch weniger über die dortigen Grenzanlagen. Alles waren nur Vermutungen, jedoch nahmen wir an, der Weg über die ČSSR sei einfacher als die Flucht über die Grenze der DDR. Wir konnten uns nur schwer vorstellen, daß die Staatsgrenze in anderen Ländern genauso scharf bewacht wurde, wie es in der DDR der Fall war.
»Und du würdest hier niemanden vermissen?«, fragte ich.
Zwar wußte ich mittlerweile, daß Bernd-Ulrich kaum überbrückbare Probleme mit seinen Eltern hatte, trotzdem hätte er jemanden vermissen können. Nach einer Flucht würden selbst Besuche in der DDR nicht mehr möglich sein.
»Nein, niemanden. Du?«
»Meine Mutter und mein Stiefvater sind froh, daß ich aus dem Haus bin. Ob ich nun irgendwo in der DDR wohne oder drüben im Westen, dürfte ihnen egal sein. Und von meinen Freunden bin ich jetzt schon getrennt. Irgendwann schläft das sowieso ein.«
»Und was willst du drüben machen?«
»Irgend etwas mit Musik, denke ich. Wie ist es bei dir?«
»Weiß noch nicht. Da wird sich schon etwas finden.«
»Und du hast keine Angst, noch einmal erwischt zu werden?«
»Doch, ein bißchen schon. Das wäre echt übel.«
»Und wieso?«
»Weil ich dann garantiert in den Bau gehe.«
»Ins Gefängnis? Quatsch doch nicht!«
»Doch, so würde es dann kommen.«
»Die würden dich doch nicht einsperren!«
»Und ob die das machen würden!«
»Jetzt höre auf, mir solchen Stuß zu erzählen! Verbrecher sperrt man ein. Außerdem bist du noch nicht einmal volljährig. Warst du schon mal im Knast? Nein? Wie willst du dann wissen, ob man dich deswegen einsperren würde?«
»Du hättest sehen sollen, wie die sich angestellt hatten, als sie mich das erste Mal geschnappt haben!«
»Und da haben sie dich auch nicht eingesperrt, oder?«
»Nur, weil ich Glück hatte.«
»Und diesmal werden wir beide das Glück haben, gar nicht erst erwischt zu werden. Wenn wir es gut genug planen, dürfte kaum etwas schiefgehen. Das haben schon ganz andere geschafft.«
»Und wann soll es deiner Meinung nach losgehen?«
»Alt will ich hier nicht werden. Ich habe die erste vormilitärische Ausbildung hinter mir. Wenn der zweite Teil losgeht, will ich eigentlich nicht mehr hier sein. Am liebsten wäre es mir, es ginge so bald wie möglich los.«
Wir kamen zwar zu keinem Ergebnis, wann und wo unsere Flucht stattfinden soll, jedoch hatte ich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich sah eine Möglichkeit, irgendwo anders mein Leben aufzubauen. Die letzten Wochen hatten mir bestätigt, daß ich nicht das geringste Interesse für den Bauberuf aufbringen konnte. Und eine Lehre, die besser zu mir paßt, würde ich nicht bekommen. In der DDR galten diesbezüglich strenge Regeln. Sogar um Elektriker zu werden, hätte mein Zeugnis besser sein müssen. Bestenfalls hätte ich noch Maler lernen können, vorausgesetzt, ich hätte eine entsprechende Lehre bekommen.
Die erste Flucht
Ein paar Wochen später trennten sich unsere Wege, denn ich mußte zum praktischen Unterricht ins Internat nach Greifswald. Bernd-Ulrich blieb auf der Baustelle. Sein Unterricht sollte zu einer anderen Zeit beginnen. Da es zu jener Zeit kein Telefon gab, und wir in Stahlbrode auch keine Postadresse hatten, sahen und hörten wir vorerst nichts mehr voneinander.
Die Zeit in Greifswald war weitaus angenehmer. In Stahlbrode fuhren die Ausbilder zum Feierabend nach Hause und die Lehrlinge waren in der Baracke sich selbst überlassen. Dann bestimmten Rangeleien, Diebstähle oder gar Zerstörungswut häufig die Abende. Im Internat Greifswald, wo die Zimmer nur vier Betten hatten und alle Kollektive durcheinandergewürfelt waren, ging es wesentlich gesitteter zu. Dort war es nicht so, daß es in der Nacht gänzlich an Aufsehern fehlte, die für Ruhe und Ordnung sorgen konnten.
Der Unterricht fiel mir schwer, weil mich der Stoff nicht interessierte, deshalb schweifte ich oft mit den Gedanken ab. Trotzdem war es gut, den Tag auf einem Stuhl zu verbringen, statt auf dem Bau bei harter Arbeit. In meiner Freizeit streunte ich gerne durch die Stadt. Oft mit anderen Lehrlingen des Internats. Am Wochenende war ich oft von früh morgens bis spät abends unterwegs. Das Essen, was im Internat geboten wurde, war nicht selten ungenießbar. Dort sah ich zum ersten Mal eine riesige Pfanne, die voller Fettstücke war, was den Lehrlingen als Fleisch angeboten wurde. Irgendwann ging ich gar nicht mehr in den Speisesaal und kaufte mir beim Bäcker lieber ein oder zwei trockene Brötchen.
Obwohl die Abwechslungen und Angebote der Stadt groß waren, reichte mein Lehrgeld bestenfalls für bessere Stadtbesichtigungen. Das trübte aber meine Stimmung nicht. Mir gefiel es, durch die Stadt zu streifen. Allerdings mußte ich spätestens um 22 Uhr wieder im Internat sein, wollte ich es nicht verschlossen vorfinden.
Mitte November war die Zeit der Theorie vorbei und ich kehrte wieder nach Stahlbrode zurück. Das Wetter wurde draußen, und somit auch während der Arbeit, immer ungemütlicher. Hat die Arbeit im Spätsommer schon keinen Spaß gemacht, so war es jetzt noch schlimmer.
Die Gespräche mit Bernd-Ulrich gingen bald weiter, denn nichts sprach dafür, erst die Lehre zu beenden und dann erst eine Flucht zu versuchen. Wir beschlossen, noch im selben Jahr die DDR zu verlassen. Anfang Dezember hielten wir den Termin für gekommen. Am Wochenende zuvor war jeder von uns noch einmal nach Hause gefahren. Bernd-Ulrich wollte noch ein paar Differenzen mit seinen Eltern klären, ich schlug mir mit der Heimreise die Zeit tot.
Am Abend des 6. Dezembers 1976, zwei Tage vor meinem 18. Geburtstag, trafen wir uns auf dem Bahnhof in Greifswald und nahmen den Zug in Richtung Süden. Die einzigen Fluchtvorbereitungen bestanden darin, genügend Geld und Proviant mitzunehmen und eine Zeit auszuwählen, wo wir von den Lehrausbildern nicht sofort vermißt wurden. Unser erstes Ziel war der Bahnhof von Johanngeorgenstadt, nicht weit entfernt von der tschechischen Grenze. Dort wollten wir den Zug verlassen und die Flucht zu Fuß fortsetzen, denn wegen des vorläufigen Personalausweises von Bernd-Ulrich war eine Fahrt bis in die ČSSR nicht möglich.
Am späten Abend bestiegen wir den Zug und versuchten in der Nacht abwechselnd wenigstens ein paar Stunden zu schlafen, was uns jedoch nur mäßig gelang. Immer wieder nahm ich den Atlas hervor und überlegte, wo wir in der ČSSR die Grenze nach Westdeutschland überwinden könnten. Der Atlas gab keinerlei Informationen über das Grenzgebiet der ČSSR her, und so zeichnete ich wahllos dort, wo sich keine größeren Städte in der Nähe der Grenze befanden und wo die Gegend bewaldet zu sein schien, mit Bleistift und Lineal zwei mögliche Fluchtwege ein. Bernd-Ulrich sah, wenn er nicht versuchte zu schlafen, zum Fenster hinaus in die Nacht. So zog sich die Zeit hin, bis wir schließlich den vorletzten Bahnhof erreichten. Der nächste Halt war in Johanngeorgenstadt. Dort mußten wir aussteigen und die Flucht zu Fuß fortsetzen.
Ich stieß Bernd-Ulrich an.
»Was ist los?«, fragte er mich.
»Es ist gerade ein Polizist in den Waggon gekommen.«
Bernd-Ulrich drehte sich um und sah den Mann in Uniform. Er ging langsam durch das Abteil, sah sich die Mitfahrenden an und kam mit jedem Schritt näher auf uns zu, bis er schließlich vor uns stehenblieb.
»Wo fahren Sie hin?«, sprach er uns grußlos an.
Ich sah Bernd-Ulrich an und er mich. Wir hätten uns auf derartige Fragen vorbereiten sollen. Jeder weiß, daß derartige Kontrollen bei Jugendlichen, auch ohne einen besonderen Grund, üblich waren.
»Wir wollen jemanden besuchen …«, kam es von Bernd-Ulrich.
»Wen?«
»Einen Cousin«, antwortete er nach leichtem Zögern.
»Und wo wohnt dieser Cousin?«
Wieder sah mich Bernd-Ulrich an und ich ihn, sagten aber nichts.
»Kann ich mal Ihre Ausweispapiere sehen?«
Wir wühlten in unseren Taschen und gaben sie ihm, ohne ein Wort zu sagen.
Er sah sie sich an und meinte: »Sie müssen doch wissen, wo Ihr Cousin wohnt!«, sagte aber nichts bezüglich des PM 12 von Bernd-Ulrich.
»Ich weiß wo, aber nicht, wie die Straße heißt«, entfuhr es meinem Partner.
Der Zugpolizist sah von einem zum anderen, gab uns wortlos die Ausweise zurück und verließ das Abteil, ohne noch ein Wort zu sagen. Uns war klar, wie auffällig wir uns benommen hatten, und konnten nicht ausschließen, daß wir von nun an unter Beobachtung standen. Wir hielten es deshalb für ratsam, die Flucht abzubrechen und in Johanngeorgenstadt den nächsten Zug zurück nach Greifswald zu nehmen.
Auf dem Bahnhof in Johanngeorgenstadt
Doch zum Abbruch der Flucht war es bereits zu spät. Als der Zug einige Zeit später in den Bahnhof einrollte, sahen wir auf dem Bahnsteig eine kleine Gruppe Männer. Sie waren in Zivil, aber uns war klar, daß sie dort wegen uns standen. Sonst befand sich kaum jemand auf dem Bahnsteig.
Es war verdammt leichtsinnig, bis zur letzten Zughaltestelle vor der Grenze zu fahren. Wären wir nur eine Station früher ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen, dann hätten wir es zumindest bis in die ČSSR geschafft, fluchte ich innerlich. Die Grenze der DDR zur ČSSR war kaum gesichert und es hätte uns keine Mühe bereitet, sie in der Dunkelheit zu überwinden.
Als der Zug hielt und wir ausstiegen, kamen die Männer auf uns zu. Einer von ihnen forderte uns auf, »zur Klärung eines Sachverhaltes« mit auf das Polizeirevier zu kommen. Bernd-Ulrich und ich wurden sofort getrennt.
Auf einer Polizeidienststelle sperrte man uns in zwei kleine, nebeneinanderliegende Zellen im Keller des Gebäudes. Sie hatten keine Fenster und außer einer Holzpritsche, auf der ein Kopfkissen und eine dünne Decke lagen, war die Zelle leer. Wir konnten uns zwar unterhalten, sagten aber nichts. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sich Bernd-Ulrich jetzt fühlte. Wegen seiner Vorstrafe ahnte er sicher, wie schlimm es diesmal für ihn ausgehen könnte. Doch wir waren schlau genug, jetzt kein Wort über unser Vorhaben zu verlieren, denn es war anzunehmen, daß wir belauscht wurden.
In unseren Koffern waren noch eine Mettwurst und ein Kuchen, die uns ein Polizist gab. Wir gingen sehr sparsam damit um, denn wir wußten nicht, wie lange sich die Sache hinziehen würde. Bis zum Abend würde es aber reichen, und dann könnten wir uns auf der Rückfahrt etwas kaufen.
Langsam wurde mir die Zeit lang und ich fragte mich, warum man uns überhaupt so lange warten ließ. Nach ein paar Stunden in der Zelle wurde Bernd-Ulrich abgeholt.
Erkläre denen, daß wir in den nächsten Zug nach Greifswald steigen wollten. Wir hatten nicht vor, lange in Johanngeorgenstadt zu bleiben, dachte ich, als er verschwunden war.
Noch bevor Bernd-Ulrich wiederkam, wurde ich abgeholt.
Endlich tut sich hier etwas.
Ich wurde in einen großen Raum geführt, wo an einem Tisch, der sich in der Mitte des Raumes befand, zwei Polizisten standen. Nur einer davon war in Uniform. Auf dem Tisch war bereits der Inhalt meines Koffers ausgebreitet. Ich sollte mich an den Tisch setzen, einer der Polizisten setzte sich mir gegenüber. An seinen Schulterstücken sah ich, daß es sich um einen hochrangigen Polizisten handelte. Er widmete seine Aufmerksamkeit zwei Seiten aus meinem Atlas, die bereits herausgetrennt waren und meine Einzeichnungen zeigten. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, daß Leugnen nicht viel Sinn hatte. Die Striche gingen von Johanngeorgenstadt über die tschechische Grenze und Prag bis hin zur Grenze im Westen des Landes. Sie waren eindeutig als Route zu erkennen, und wir befanden uns bei der Festnahme auf dieser Route.
Er fragte mich, was diese Striche zu bedeuten hatten. Ich sagte nichts. Es wäre genug Zeit gewesen, die Atlasseiten verschwinden zu lassen, als der Zugpolizist weggegangen war, doch mir fehlte damals vollkommen die Erfahrung. Noch nie war ich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ich wußte nicht viel über Festnahmen, Durchsuchungen oder Verhören.
»Sie wollten in die BRD!«
Noch immer sagte ich nichts, spürte aber, wie mir die Röte hochstieg.
»Wollten Sie das?«
»Wir wollten von Johanngeorgenstadt wieder nach Greifswald zurückfahren. Wir wollten nicht in den Westen.«
Er schob die Atlasseiten zu mir herüber und tippte mit dem Zeigefinger auf die Bleistiftstriche. »Und was bedeutet das? Das ist doch eine Wegstrecke! Oder wollen Sie mir etwas anderes erzählen?«
Ich starrte auf die Atlasseiten.
»Antworten Sie! Sie wollten in die BRD! Das ist doch hier deutlich zu sehen.«
»Wir wollten zurück nach Greifswald.«
»Erzählen Sie mir nichts! Was sollen die Striche sonst bedeuten?«
Ja, was sollten sie bedeuten? Abstreiten hatte keinen Sinn. Man hatte uns erwischt. Da konnte ich dem Mann erzählen, was ich wollte. Aber es war noch nichts passiert. Außerdem hatten wir wirklich vor, zurück nach Greifswald zu fahren. Und so gab ich zu, daß die Flucht der anfängliche Plan war, wir es uns aber anders überlegt hatten.
Als ich wieder in der Zelle war, machte ich mir wegen dieser Einzeichnungen große Vorwürfe und teilte Bernd-Ulrich mit, wie die Sache stand. Es sah nicht gut aus für uns. Auf der einen Seite war der Atlas mit meinen Bleistiftlinien, auf der anderen Seite Bernd-Ulrichs vorläufiger Personalausweis. Zudem konnten wir keinen vernünftigen Grund für die Fahrt nach Johanngeorgenstadt vorweisen. Doch wir hatten noch nichts Verbotenes getan, und so hielten sich meine Befürchtungen in Grenzen. Außerdem könnte ich sagen, ich habe mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Das Schlimmste, was mir die Polizei dann vorwerfen konnte, war die geplante Flucht. Doch hier sprach für mich, daß wir das Gebiet der DDR noch nicht verlassen hatten, ja noch nicht einmal in der Nähe der Grenze waren. Außerdem hatten wir vor, in Johanngeorgenstadt zurück nach Greifswald zu fahren. Der Schreck, den ich durch die Verhaftung bekam, wird die Polizei für einen ausreichenden Denkzettel ansehen. Deshalb war meine größte Sorge, wie meine Eltern oder der Lehrbetrieb reagieren würden, wenn sie erfahren, daß ich festgenommen wurde. Ich ging nicht davon aus, daß ich diesen Vorfall verheimlichen konnte. Ganz sicher wird die Polizei alle informieren.
Nach diesen Gedankengängen fragte ich Bernd-Ulrich, ob er der Meinung ist, diese Flucht könnte ernsthafte Konsequenzen haben. In Greifswald war mir gar nicht in den Sinn gekommen, daß unser Vorhaben mißglücken könnte und sprach deshalb nie mit ihm über mögliche Folgen.
»Es wird zur Gerichtsverhandlung kommen.«
»Du meinst, man stellt dich noch einmal vor Gericht?«
»Nicht nur mich, uns beide.«
»Wieso mich? Weil ich mit dem Zug gefahren bin?«
»Weil du nach dem Westen abhauen wolltest.«
»Wolltest, ja. Aber ich habe es nicht getan, noch nicht einmal versucht. Und du auch nicht. Außerdem wollten wir von Johanngeorgenstadt wieder zurück.«
»Das hat nichts zu sagen.«
»Und wieso nicht, bitte schön? Ich wollte in Johanngeorgenstadt den Zug zurücknehmen. So wie du auch. Was ist daran strafbar? Die paar Bleistiftstriche in einem Atlas? Dafür kommt man vor Gericht? Wegen ein paar Strichen im Atlas? Blödsinn!«
»Es war ein Versuch, und schon der Versuch ist strafbar.«
»Wo haben wir denn etwas versucht? Kannst du mir das mal erklären? Wir waren ja noch nicht einmal in der Nähe irgendeiner Grenze. Also haben wir auch nichts versucht. Wenn ich zur Kaufhalle gehen will, in der Absicht, etwas zu stehlen, gehe dann aber ganz woanders hin, war das dann bereits ein Versuch, etwas zu stehlen? Ganz sicher nicht!«
Bernd-Ulrich blieb bei seiner Meinung und machte mir klar, daß es zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird, ob ich das nun glaube, oder nicht. Und sie wird wahrscheinlich in Greifswald, unserem jetzigen Wohnort stattfinden.
Das wäre mir zwar recht, denn dort kannte mich kaum jemand. Zumindest in meiner Heimatstadt Klötze würde dann niemand von meiner Verhaftung erfahren. Das wäre mir peinlich gewesen. Doch ich glaubte ihm noch immer nicht. Mit einer Gerichtsverhandlung würde die Staatsmacht sich lächerlich machen. »Angeklagter, ich verurteile Sie, weil sie mit dem Zug in Richtung Süden gefahren sind und zu Beginn der Fahrt vorhatten, in den Westen abzuhauen.« – das klang einfach unsinnig.
Bernd-Ulrich jedoch legte nach und sagte, daß ich eine Bewährungsstrafe bekommen würde. Eine Gefängnisstrafe für mich schloß er wegen der geringen Schuld aus.
»Die lassen uns spätestens heute abend, allerspätestens morgen früh wieder laufen. Du wirst sehen.« Damit war die Sache für mich erledigt. Ich wollte nichts mehr hören von Gefängnis und Gericht. Bernd-Ulrich hielt die DDR scheinbar für einen Staat in Mittelamerika. Vieles ist hier nicht in Ordnung, aber daß man so mir nichts dir nichts Leute einsperrt, daß konnte mir keiner erzählen. Für etwas, was man nicht getan hat, wird man auch nicht bestraft. Wäre es so, hätte ich sicher schon davon gehört.
Trotzdem hinterließen Bernd-Ulrichs Worte ein ungutes Gefühl in mir. Er war einfach nicht der Mensch, der sich mit Sprüchen wichtig machen wollte. War er überängstlich und wollte er diese Angst auf mich übertragen? War es das? Redete er sich etwas ein, weil er bereits das zweite Mal in so einer Situation steckte? Woher wollte er denn wissen, wie die Sache ausgeht?
Nein, man wird unsere Ausbilder Bescheid geben, die werden uns gehörig den Kopf waschen und das war es dann. Unsere Idee war einfach dumm. Irgendwie werde ich die Lehre schon schaffen, und dann werde ich weitersehen. Im ungünstigsten Fall werde ich hier einige Tage festgehalten und der Lehrbetrieb und meine Eltern würden benachrichtigt werden.
Es wurde Abend, und es geschah nichts. Das bedeutete für mich, man würde uns erst morgen wieder laufenlassen.
Ich saß auf dem Rand der Pritsche und überlegte, wie ich auf die Fragen reagieren werde, die mir meine Eltern oder der Lehrbetrieb stellen werden. Was sollte ich antworten auf die Frage, warum ich abhauen wollte? Ich konnte nicht sagen, daß ich es in der DDR blöd fand, denn das würde weitere Fragen nach sich ziehen. Am besten wäre, es einfach auf eine fixe Idee zu schieben, mich dafür zu entschuldigen und dann zu hoffen, daß möglichst schnell Gras über die Sache wächst.
Vor dem Haftrichter
Tags darauf wurden wir früh geweckt. Wir hatten beide die Nacht zuvor wenig geschlafen, und waren deshalb abends in unseren Zellen, trotz aller Grübeleien, schnell eingeschlafen.
Kurz nachdem der Wärter weg war, hörte ich die Stimme meines Leidensgenossen: »Michael?«
»Ja?«
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«
Mir wurde schmerzlich bewußt, daß ich heute 18 Jahre alt wurde. Volljährig.
»Danke. Was ich mir wünsche, weißt du sicherlich.«
»Träum‘ weiter, du kommst heute nicht raus!«
Ich hatte keine Lust, die Streitereien vom Vortag weiterzuführen, und so hob ich meine Sachen vom Boden auf, zog mich an und aß ein Stück von unserem Reiseproviant. Es war klug, damit sparsam umzugehen, denn von der Polizei hatten wir noch nichts bekommen.
Am frühen Vormittag wurden wir nacheinander aus der Zelle geholt. Diesmal ging es nicht zum Verhör, sondern in einen kleinen Raum, in dessen Mitte quer ein Tisch stand. Dahinter saß ein älterer, mürrisch dreinblickender Herr, und seitlich links hinter ihm stand eine junge Frau und hielt einen Notizblock in der Hand. Vor dem Tisch des Mannes stand ein Stuhl und ich wurde angewiesen, dort Platz zu nehmen. Kurz darauf machte mir der Mann klar, daß er der Haftrichter sei und darüber entscheiden werde, ob er einen Haftbefehl gegen mich ausstellen wird.
Noch ist also nichts verloren, dachte ich. Ich werde dem Mann jetzt erklären, wie sich die Sache abgespielt hat, und dann wird der Spuk hoffentlich ein Ende haben.
Doch der Mann wollte nur sehr wenig von mir wissen. Er ließ sich meinen Namen, das Geburtsdatum und andere Fakten bestätigen, las die Anschuldigung vor, stellte mir ein paar Fragen zu dem Vorwurf, nach »der BRD« abhauen zu wollen, die ich so beantwortete, wie ich es tags zuvor bei dem Polizisten tat, und unterschrieb den vor ihn liegenden und bereits ausgefüllten Haftbefehl. Als er damit fertig war, schob er ihn zu mir herüber und forderte mich auf, ihn zu unterschreiben.
Ich war wie gelähmt. Man hatte mich tatsächlich verhaftet! Träume ich? Sollte Bernd-Ulrich doch recht haben?, schoß es mir durch den Kopf. Was nun? Es bedeutet nichts anderes, als daß ich hierbleiben muß. Und wer weiß, wie lange sich die Sache hinziehen wird. Nun war es sicher, daß ich die Angelegenheit vor meinen Eltern und Kollegen nicht verheimlichen könnte.
Als ich zurückgeführt wurde und dabei an Bernd-Ulrichs Zelle vorbeikam, bemerkte er meine deprimierte Stimmung, doch er ersparte sich jeden Kommentar. Er wußte, wie ich mich jetzt fühlte.
»Was nun?«, fragte ich ihn, als der Polizist, der mich gebracht hatte, wieder verschwunden war.
»Untersuchungshaft.«
»Wir bleiben nicht hier?«
»Nein.«
»Also geht es in den Knast?«
»Nein, in Untersuchungshaft.«
»Und was ist der Unterschied?«
»Dort sitzt du und wartest auf deine Verhandlung.«
»Und wie lange wird das dauern?«
»Drei, vier Monate. Vielleicht länger.«
Ich wagte es nicht, erneut seine Worte anzuzweifeln. Warum, zum Geier, haben wir das vor der Flucht nicht besprochen?
»Und wie, meinst du, wird es ausgehen?«
»Dich werden sie nach der Verhandlung laufenlassen, du bist ja bei der Flucht noch Jugendlicher gewesen. Mich sperrt man mit Sicherheit eine Weile ein.«
Abermals widersprach ich ihm nicht.
Mir bereitete der Gedanke an die Untersuchungshaft Kopfzerbrechen. Ich hatte keine Vorstellung darüber, wie es in einem Gefängnis der DDR zuging, und kannte auch niemanden, der schon einmal eingesperrt war. Alles, was ich über Gefängnisse wußte, stammte aus historischen Büchern oder alten Filmen, und das hatte in mir keinen guten Eindruck hinterlassen.
Gegen Mittag wurden wir mit der grünen Minna in die 40 Kilometer nordwestlich gelegene Untersuchungshaftanstalt Zwickau gefahren. Unsere restlichen Nahrungsmittel, mit denen wir so sparsam umgegangen waren, wanderten in den Mülleimer. Ich bedauerte, nicht mehr davon gegessen zu haben.
Während der Fahrt konnte ich Bernd-Ulrich ein letztes Mal sprechen. Viel zu sagen gab es nicht. Es war sinnlos, die Angelegenheit irgendwie zu unseren Gunsten verbiegen zu wollen. Wir konnten nur hoffen, daß die Sache trotz allem glimpflich für uns ausgeht.
Ich sollte Bernd-Ulrich erst in der Untersuchungshaftanstalt Stendal und einige Monate später vor Gericht wiedersehen.
Der Staatsanwalt des Kreises Schwarzenberg Bermsgrüner Straße 5 Aktenzeichen: 3 – 103/76 P/K
Herrn Eberhard B a r t h und Frau Ingeburg 358 K l ö t z e Oebisfelder Straße 44 943 Schwarzenberg, 08.12.1976
Betrifft:
Ich teile Ihnen mit, daß Ihr Sohn
M ö h r i n g, Michael, geboren am 08.12.1958
heute auf Beschluß des Kreisgerichts Schwarzenberg in Untersuchungshaft genommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts begangener strafbarer Handlungen eingeleitet. Er befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt
95 Zwickau, Schillerstraße 2
und wird nach Ablauf der Rechtsmittelfrist (1 Woche) in die für seinen Wohnsitz zuständige Untersuchungshaftanstalt verlegt.
Nach § 305 fg. StPO in Verbindung mit § 284 Absatz 2 StPO haben Sie als gesetzliche Vertreter das Recht der Beschwerde gegen den Erlaß des Haftbefehls. Die Beschwerde ist binnen einer Woche bei dem Gericht, von dem der Beschluß erlassen ist, zu Protokoll der Rechtsantragsstelle oder schriftlich durch den Betroffenen oder einen Rechtsanwalt einzulegen.
Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist werden die Haft- und Ermittlungsunterlagen an den für den Wohnsitz zuständigen Staatsanwalt des Kreises übersandt bzw. abgegeben, der das Verfahren weiter bearbeitet.
Bei irgendwelchen Fragen können Sie sich innerhalb der Rechtsmittelfrist an den Staatsanwalt des Kreises Schwarzenberg, 943 Schwarzenberg, Bermsgrüner Straße 5 bzw. nach Ablauf der Rechtsmittelfrist an den für den Wohnsitz zuständigen Staatsanwalt des Kreises mündlich oder schriftlich wenden.
(Unterschrift)(Pache)
Hinter Schloß und Riegel
Die Untersuchungshaftanstalt in Zwickau war groß und laut. Als erstes fielen mir die vielen uniformierten Wärter, die verriegelten Türen und vergitterten Fenster auf. So hatte ich es schon einmal im Fernsehen gesehen, damals empfand ich dafür allerdings kein allzu großes Interesse. Nun war es für mich bittere Wirklichkeit geworden.
Das Gebäude war mehrere Stockwerke hoch. Die Treppen zu den Etagen befanden sich in der Mitte, und zwischen den Etagen war Maschendraht gespannt, so daß kein Gefangener in Suizidabsicht vom oberen Stockwerk herunterspringen konnte.
Nach einer Leibesvisitation wurde ich nackt in eine Stehzelle gesperrt. Sie bestand aus Holz, war nicht viel größer als einen Quadratmeter und an den Innenwänden waren Namen und Paragraphen eingeritzt. Immer wieder stieß ich auf das Wort »R-Flucht« und hielt es für eine Möglichkeit, aus der Untersuchungshaftanstalt zu fliehen. Obwohl ich mir den Kopf darüber zerbrach, wofür das »R« stehen könnte, fiel mir nichts ein.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, ehe ich wieder aus dieser Stehzelle herausgelassen wurde.
In der Zwischenzeit hatten zwei Wärter meine Kleidung und meinen Koffer durchsucht. Ich durfte mich wieder anziehen und wurde zur Effektenkammer geführt, wo alle Gegenstände verwahrt wurden, die ich während der Flucht bei mir hatte. Behalten durfte ich nur meine Waschsachen und was ich an Kleidung am Leib trug. Meine Armbanduhr, meine Halskette, private Bilder, Schreibsachen, es war alles verboten und blieb in der Effektenkammer unter Verschluß.
Ich bekam Bettzeug, zwei Decken und Plastikgeschirr. Den Erhalt mußte ich mit meiner Unterschrift bestätigen. Anschließend brachte mich ein Wärter zu meiner Zelle in den zweiten Stock. Es fiel mir schwer, ihm mit den Sachen in meinen Armen zu folgen, denn man hatte mir auch den Gürtel und die Schnürsenkel weggenommen.
Der Wärter hatte andere Sorgen. Ihm störte meine Schwierigkeit, seinen sächsischen Dialekt zu verstehen und daß ich die Sitten und Regeln des Hauses nicht kannte. Vor der Zelle herrschte er mich an, ich solle mich neben der Tür mit dem Gesicht zur Wand stellen. Das tat ich und rührte mich nicht, bis er die Zelle aufgeschlossen hatte.
Von drinnen hörte ich einen Häftling sagen: »Verwahrraum 263 mit drei Inhaftierten belegt. Keine besonderen Vorkommnisse.«
Nachdem der Wärter die Meldung abgenommen hatte, wandte er sich wieder zu mir und winkte mit dem Kopf ungeduldig in Richtung Zelle: »Gehn’s nei, gehn’s nei«.
Ich tat es und war froh, als sich die Zellentür krachend hinter mir schloß.
Die Zelle war verqualmt und recht dunkel. Das Fenster gegenüber der Zellentür war etwa einen Meter breit und nur wenige Dezimeter hoch. Ringsum war es in Glasbausteinen gefaßt. Hinter der Scheibe war eine Metallblende, die, zusammen mit den Glasbausteinen, Blicke nach draußen unmöglich machen sollten. Alles ließ nur wenig Licht und frische Luft herein.
Die drei Häftlinge, alle älter als ich, musterten mich.
»Das erste Mal eingesperrt, was?«, fragte der Älteste unter ihnen.
Er war freundlich und sah mich eher mitfühlend an. Auch die anderen beiden machten einen netten Eindruck.
Ich nickte verlegen.
»Wegen was bist du denn hier?«
»Ich wollte in den Westen abhauen.«
Nach diesen Worten herrschte allgemeine Heiterkeit, die allerdings keine Unhöflichkeit ausdrückte.
»Da bist du nicht der einzige, deswegen sind viele hier«, sagte ein anderer. Er war vielleicht zehn oder fünfzehn Jahre älter als ich. Der dritte Häftling war in seinem Alter. Der Stubenälteste hatte die 50 wohl schon lange überschritten.
»Deswegen sind viele hier?« Ich kannte keinen, der die gleiche Idee hatte, wie Bernd-Ulrich und ich, und schon gar keinen, der es mal probiert hätte, in den Westen abzuhauen oder davon sprach, es irgendwann einmal tun zu wollen.
Ich faßte schnell Vertrauen zu den drei Mitgefangenen und sie erklärten mir, wie ich mich in der U-Haft verhalten muß, um nicht bei den Wärtern aufzufallen. Meine erste Aufgabe bestand darin, die Dienstgrade der Wärter auswendig zu lernen. Später erfuhr ich von ihnen, daß »R-Flucht« die Kurzform von Republikflucht sei, dem Delikt, weswegen ich eingesperrt war. Die armen Teufel, die in der Stehzelle das Wort R-Flucht eingeritzt hatten, wollten also ebenfalls in den Westen verschwinden, und ihre Flucht endete hier in der Untersuchungshaftanstalt.
Ausfertigung
Klötze, den 14.12.1976
Das Kreisgericht Klötze Aktenzeichen R 95/76
Beschluß
In der Strafsache gegen Michael Möhring, geboren am 08.12.1958
wegen versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts
wird die auf Anordnung des Staatsanwaltes am 13.12.1976 durchgeführte Durchsuchung der Räume der Eltern des Beschuldigten gemäß § 121 StPO richterlich bestätigt, da sie sachlich berechtigt war und die Art und Weise ihrer Durchführung dem Gesetz entsprach.
Gegen diesen Beschluß ist die Beschwerde zulässig. Sie ist innerhalb einer Woche nach Zustellung des Beschlusses beim unterzeichneten Gericht zu Protokoll der Rechtsantragstelle oder schriftlich durch den Betroffenen oder einen Rechtsanwalt einzulegen.
Ausgefertigt: Klötze, den 14.12.1976
(Unterschrift)gezeichnet Hey Kreisgerichtsdirektor(Unterschrift)Sekretär
In den folgenden Tagen mußte ich viele neue Wörter und Redewendungen lernen. So war ich nicht in einer Zelle, sondern in einem Verwahrraum eingesperrt. Die Wärter waren mit dem Dienstgrad anzureden und ich wollte nicht »in den Westen abhauen«, sondern war wegen »versuchten illegalen Grenzübertritts« inhaftiert, und obwohl wir den ganzen Tag eingeschlossen waren, hieß die abendliche Zählung »Einschluß«.
Anfangs fiel es mir schwer, alle neuen Wörter anzuwenden und mir die Dienstgrade zu merken. Der Zellenälteste machte zwar jedesmal eine Meldung, wenn die Tür geöffnet wurde und nannte dabei den Dienstgrad des Wärters, der vor ihm stand, doch nützte mir das nichts, denn nur der Zellenälteste sah den Wärter. Alle anderen Gefangenen mußten wie abgerichtete Hunde von den Hockern aufspringen und sich mit dem Gesicht zum Fenster und dem Rücken zur Tür stellen. Ich empfand das als äußerst erniedrigend. Gespräche mit den Wärtern führte grundsätzlich der Zellenälteste. Umdrehen durften sich die anderen Häftlinge nur, wenn der Wärter sie direkt ansprach, zu den Mahlzeiten oder wenn Medizin verteilt wurde.
Wagte es doch jemand, zu gucken, was sich an der Tür abspielte, kam sofort ein barsches: »Drehen Sie sich um!« vom Wärter.
Der erste Brief an meine Eltern
Es war mir außerordentlich peinlich, auf die Toilette zu gehen, während die drei anderen Gefangenen direkt danebensaßen und dabei zusehen konnten. Intimsphäre gab es in der Zelle nicht einmal ansatzweise. Verrichtete jemand sein Geschäft auf der Toilette, mußte er immer wieder spülen, damit es nicht zu sehr zu üblen Gerüchen kam. Das kleine Fenster stand zwar offen, nur wehte durch die Verblendung kaum frische Luft herein.
Bereits am zweiten Tag wurden mir die Haare kurzgeschoren. Sich dagegen zu wehren war zwecklos. Auf den Haarschnitt selbst wurde dabei kaum geachtet. Wichtig war es der Anstaltsleitung nur, daß die Haare kurz waren. Dementsprechend sahen die Frisuren der Untersuchungshäftlinge auch aus. Es wurde nicht ausrasiert, nicht begradigt und nicht auf den individuellen Haarwuchs geachtet. Es wurde nur geschnitten, und das ziemlich kurz. Um den Job des Friseurs in der Anstalt ausführen zu können, bedurfte es keiner diesbezüglichen Ausbildung. Es reichte, wenn der von den Wärtern zum Friseur ernannte Häftling mit der Schere umgehen konnte. In den 70er Jahren wurden Armeeangehörige oder ehemalige Häftlinge leicht auf der Straße erkannt, denn kurze Haare waren bei jungen Menschen zu dieser Zeit ungewöhnlich.
Nach ein paar Tagen bekam ich Schreiberlaubnis. Mir wurde gestattet, einer Person außerhalb des Gefängnisses zu schreiben. Ich mußte nicht lange überlegen, wem ich schreiben wollte, und entschied mich für meine Eltern. Sie würden mir am besten helfen können. Der erste Brief fiel mir schwer und ich war mir nicht sicher, ob meine Eltern schon über meine Verhaftung informiert wurden.
Erster Dezemberbrief ´76
Liebe Eltern!
Wie Ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich zur Zeit in Zwickau in Untersuchungshaft. Man klagt mich wegen versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts an. Es wird zur Gerichtsverhandlung kommen, die höchstwahrscheinlich im Bezirk Magdeburg, vielleicht aber auch im Kreis Klötze durchgeführt wird.
Ich hoffe, es geht Euch gut und Ihr habt Weihnachten schön verbracht.
Im Januar oder Februar wird meine Verhandlung sein. Hoffentlich kommt Ihr gut ins neue Jahr und macht Euch keine Sorgen um mich! Es wird schon alles gutgehen. Ich werde mich jetzt schweren Herzens auf das neue Jahr vorbereiten. Aber ich bin optimistisch. Es wird wohl nicht so schlimm werden.
Ich wünsche Euch noch einen guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr.
Grüßt alle von mir! Euer Michael
Ein paar Tage später wurde ich in eine andere Zelle verlegt. Auch diese Zellengenossen waren angenehm im Umgang. Dieses Mal waren alle in meinem Alter, was jedoch nicht der Grund für die Verlegung war. Es war üblich, Häftlinge alle paar Tage zu verlegen. Wahrscheinlich sollten damit Freundschaften verhindert werden.
Um fünf Uhr wurden alle Häftlinge geweckt. Ich war morgens immer wie benommen, denn die Sorgen ließen mich abends kaum in den Schlaf kommen. Auch ließ nachts der Krach in der Haftanstalt nie ganz nach. Irgendwo lärmte immer ein Häftling, wurde eine schwere Zellentür zugeschlagen und klirrend verschlossen und verriegelt, laut geredet, oder das Licht in der Zelle zur Kontrolle der Häftlinge angeschaltet. An ein Durchschlafen war überhaupt nicht zu denken.
Kurz nach dem Wecken hatten wir uns zur Zählung aufzustellen. Zu dieser Zeit mußte der Bettenbau fertig, und die Häftlinge gewaschen und angezogen sein. Nach der Zählung trat bis zum Frühstück gegen 7 Uhr wieder Ruhe ein. Diese Zeit nutzten wir, um uns noch einmal aufs Ohr zu legen. Zwar war das verboten, doch erwischt wurden wir dabei nicht. Die Wärter hatten Wachablösung und deshalb etwas anderes zu tun, als uns zu kontrollieren.
Bald lernte ich die Regeln und Tricks im Gefängnis kennen: Kleidungsstücke tauschten gegen Zigaretten oder Tabak den Besitzer, die Kanalisation der Toiletten wurde für die Kommunikation mit anderen Zellen genutzt, Zigaretten wurden aus Tabak und kleinen Tüten aus Zeitungsstreifen gedreht, und Löffelstiele am Gemäuer geschliffen, denn Messer waren verboten.
Tagsüber auf dem Bett liegen war ebenfalls streng verboten. Wurde ein Gefangener dabei ertappt, konnte es im schlimmsten Fall ein paar Tage Arrest geben, was sich dann negativ bei der Beurteilung vor Gericht auswirkte. Mit der Zeit schulte sich unser Gehör dermaßen, daß wir sogar im Schlaf die Schritte der Wärter draußen auf dem Flur hörten. Beim kleinsten Geräusch sprangen wir aus den Betten und noch im Halbschlaf zogen wir die Bettdecke gerade, um keine Spuren zu hinterlassen. Hier erwies es sich als Vorteil, mit dem Gesicht zum Fenster stehen zu müssen, wenn die Tür geöffnet wurde. Die Wärter hätten leicht an unseren Gesichtern erkennen können, daß wir geschlafen hatten.
Manche Wärter nutzten dieses Verbot zu ihrer persönlichen Belustigung. Sie schlichen sich an die Zellentür, sahen durch den Spion, und während sie den Riegel aufrissen erfreuten sie sich daran, wie die Gefangenen erschreckt aus den Betten sprangen. Meist war es den Wärtern damit getan und nur selten machten diese Sorte Wärter wirklich die Tür auf und maßregelte uns.
In Zwickau hörte ich das erste Mal von der Möglichkeit, mittels Ausreiseantrag über das Gefängnis Karl-Marx-Stadt in den Westen zu gelangen, jedoch hielt ich so einen Antrag in meinem Fall nicht für ratsam. Erstens rechnete ich nicht damit, ins Gefängnis zu müssen, zweitens könnte ein solcher Antrag verheerende Folgen vor Gericht haben. Zudem war meine Lust gebremst, weitere Versuche zu unternehmen, um in den Westen zu kommen.
Verlegung in einen anderen Trakt
Nach einer weiteren Woche wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre zu arbeiten. Ich willigte ein, weil die Tage in der Zelle kaum vergingen. Durch etwas Beschäftigung erhoffte ich, der Langeweile wenigstens teilweise entfliehen zu können.
Man verlegte mich noch am selben Tag in einen anderen Anstaltstrakt. Auch meine neue Zelle hatte vier Betten. Ein Doppelstockbett stand unter dem Fenster, das andere an der rechten Zellenwand. Neben zwei gleichaltrigen Zellengenossen, wovon einer ebenfalls wegen Republikflucht eingesperrt war, gab es einen älteren, etwa fünfunddreißigjährigen Mann, der durch seine hochtrabenden Geschichten, die er uns erzählte, schnell eine Führungsrolle in der Zelle einnahm. Er erzählte oft von seiner Arbeit als Artist und beschrieb uns in den schillerndsten Farben seine Erlebnisse. Ganz besonders stolz war er auf seinen Nappaleder-Anzug, den er für die Auftritte in der Manege anzog. Außer einem Blatt Papier, welches er auf der Nase jonglierte, zeigte er uns allerdings nichts, was die Tätigkeit als Artist irgendwie bewies.
Der ältere Mann und ich schliefen in den unteren Betten, er quer unter dem Fenster, ich seitlich an der Wand, die beiden jungen Leute schliefen in den oberen Betten.
Die Arbeitsstelle lag direkt vor der Zelle. Etwa zehn bis fünfzehn Gefangene saßen sich dort vor einer Art Bügelbrett gegenüber und wendeten mit Hilfe dieses Brettes noch ungefärbte Damenstrümpfe von der linken auf die rechte Seite. Lohn gab es für die Arbeit kaum, dafür etwas mehr zu essen.
Schnell merkte ich, daß durch diese stumpfsinnige Arbeit die Zeit auch nicht schneller verging. Zwar hatte ich mehr Gesprächspartner, aber das, was mich interessierte, was meinen Fall betraf, darüber erfuhr ich so gut wie nichts.
Wir arbeiteten nur in einer Schicht, am späten Nachmittag ging es wieder zurück in die Zellen. Hier warteten wir dann auf das Abendbrot und den Einschluß. Ein paar Stunden später schalteten die Wärter das Licht aus, und nur die Hofscheinwerfer, die ab und zu durch die Glasbausteine in die Zelle leuchteten, blieben als einzige Lichtquelle übrig.
Nachts trockneten wir heimlich unsere Sachen auf der Heizung, die wir tagsüber - natürlich verbotenerweise - im Waschbecken mit kaltem Wasser und Seife gewaschen hatten. Die Heizung war sehr klein, weshalb nur immer ein Gefangener seine Sachen trocknen konnte. Ich war froh, nach dieser Verfahrensweise wenigstens halbwegs saubere Sachen anziehen zu können, denn seit meiner Verhaftung hatte ich dieselbe Hose, dasselbe Hemd, dieselben Strümpfe und dieselbe Unterwäsche an. Zwar hatte ich noch Wäsche zum Wechseln in meinem Koffer, doch der war in den Effekten unter Verschluß. Nachfragen, an diese Wäsche heranzukommen, wurden mit der Begründung abgelehnt, ich könnte auch Kleidung von der Haftanstalt bekommen.
Ein nächtlicher Zwischenfall
Eines nachts, nicht lange, nachdem das Licht ausging, spürte ich die Hand des Zellenältesten an meinem Kopf. Es schien, als habe sich sein Arm im Schlaf auf mein Kopfkissen verirrt. Die Kopfenden der Betten lagen aneinander, deshalb achtete ich nicht weiter darauf und legte meinen Kopf etwas zur Seite, damit der Arm mich nicht mehr erreichte. Ich wollte den Zellengenossen nicht wecken, indem ich seinen Arm zurückschob.
Doch schon bald sollte ich merken, daß dieser Mann gar nicht schlief. Seine Hand suchte nun bewußt nach meinem Kopf, um ihn zu streicheln.
Ich schob die Hand weg. Erst sanft, dann unsanft und mit bösem, aber leisem Gemurmel. Es wäre mir peinlich gewesen, würden die beiden jungen Leute in den oberen Betten etwas davon bemerken.
Doch der Mann hörte nicht auf, mit seiner Hand nach mir zu grapschen. Schließlich sprang ich aus dem Bett und zischte ihn flüsternd an, ich werde die Wärter rufen, wenn er mit seiner Anmache nicht sofort aufhört.
Noch immer bewegten sich die beiden jungen Leute in ihren oberen Betten nicht. Still taten sie, als ob sie schliefen und von der ganzen Angelegenheit nichts mitbekamen. Oder schliefen sie wirklich?
Der Mann drehte sich wortlos zur Wand und ich ging wieder in mein Bett.
Keiner sprach je davon.
Auf Transport
Nach zwei langen Wochen in Zwickau ging es mit dem Grotewohl-Expreß zur Untersuchungshaftanstalt Stendal. Mittlerweile hatte ich erfahren, daß die Gerichtsverhandlung wohl nicht wie vermutet in Greifswald, sondern eher in meiner Heimatstadt Klötze stattfinden würde. Post hatte ich noch nicht bekommen, und so hatte ich keine Ahnung, ob meine Eltern schon über mich Bescheid wußten.
Schon am frühen Morgen wurde ich mit etwa vierzig Häftlingen, die ebenfalls auf Transport gehen sollten, nackt in einen großen Duschraum gesperrt. Während wir warteten, filzten draußen auf dem Flur einige Wärter unsere Sachen. Nach mehr als einer Stunde konnten wir uns wieder anziehen und wurden in eine Transportzelle eingeschlossen. Die Zeit, bis es endlich zum Bahnhof ging, war ermüdend lang. Für den Transport gaben uns die Wärter lieblos belegte Brote mit auf dem Weg, die in Butterbrotpapier eingewickelt waren. Die Schnürsenkel hatte ich von den Effekten wiederbekommen, doch statt des Gürtels hielt immer noch ein kleines Band, welches zwei Gürtellaschen zusammenzog, meine Hose dort, wo sie sein sollte. Mein Koffer wurde zusammen mit anderen Gepäckstücken separat transportiert.
Am Nachmittag wurden alle Gefangenen mit einem Gefängnisbus zum Hauptbahnhof gefahren. Jeweils zu zweit an eine Handschelle gefesselt, ging es durch unterirdische Gänge des Bahnhofes direkt zum Zug.
Der Gefängniswaggon war in der Mitte eines normalen Personenzugs angekoppelt. Während wir gefesselt in Reih und Glied vor dem Waggon standen, sahen uns die Bahnhofsgäste entsetzt aber neugierig an. Ich wäre vor Scham am liebsten in den Boden versunken. Vor dem Einsteigen wurden wir noch einmal von den Wärtern gezählt, dann stiegen wir nacheinander in den Zug, wo uns die Handschellen abgenommen wurden.
In der Mitte des Gefängniswaggons befand sich ein enger Gang. Hier stand ein Wärter und wies uns in die links und rechts befindlichen Zellen ein. Diese waren sehr klein und hatten in Fahrtrichtung und entgegengesetzt je zwei Klappsitze aus Sperrholz. Ein fünfter Sitz befand sich unter dem mit Milchglas und Gittern versehenen Fenster und war hochgeklappt.
Platzmäßig wäre die Zelle bestenfalls für zwei Gefangene ausreichend gewesen. Wir wurden zu viert in dieses Abteil verfrachtet, und es war kaum vorstellbar, wie noch eine fünfte Person unter dem Fenster hätte Platz finden können.
Schon nach einer Stunde Fahrt waren unsere Nerven aufgrund des Platzmangels stark angespannt. Dichtgedrängt wie die Heringe in Dosen saßen wir in dem kleinen Abteil und waren froh, daß keiner von uns übergewichtig war. Oft standen wir während der Fahrt auf, denn das brachte uns ein klein wenig mehr Platz. Solange der Zug fuhr, war die Situation einigermaßen erträglich. Schlimmer waren die Zeiten, wo unser Waggon auf irgendeinem Abstellgleis stand und wir nicht wußten, ob oder wann es weiterging.
Nur sehr selten konnten wir durch den kleinen Spalt, der entstand, wenn das Fenster aufgeklappt wurde, an dem Ortsschild des Bahnhofs erkennen, wo wir waren. Allerdings nützte das nur bedingt etwas, denn im Abteil hatte jeder nur eine Vermutung, wo seine Reise enden würde. Von den Wärtern erfuhren wir nichts. Wir konnten froh sein, wenn sie uns erlaubten, auf die Toilette zu gehen.
Das Untersuchungsgefängnis in Magdeburg
Meine Befürchtung, die Nacht auf einem Abstellgleis irgendeines Bahnhofs verbringen zu müssen, bewahrheitete sich Gott sei Dank nicht. Die Fahrt endete irgendwann am späten Abend in Magdeburg. Hier wurde ich mit einigen anderen Gefangenen in einem Gefängnistransporter zum Untersuchungsgefängnis der Stadt gebracht.
Wieder wurden wir gezählt, durchsucht und fotografiert. Es ging zur Kleiderkammer, wo uns Bettzeug und Plastikgeschirr ausgehändigt wurde, was auf einen längeren Aufenthalt hindeutete. Im Anschluß daran brachte mich ein Wärter zu einer Zelle im Erdgeschoß. Als die Zellentür geöffnet wurde, strömte mir ein Geruch von abgestandener Luft, menschlichen Ausdünstungen und Qualm entgegen. Es war eine Großzelle, und kaum ein Gefangener interessierte sich dafür, daß ein Wärter die Tür geöffnet hatte. Auf eine Meldung des Zellenältesten legten die Wärter scheinbar keinen Wert, und es stellte sich auch niemand mit dem Rücken zur Tür.
Diese große Zelle waren einmal vier normalgroße Zellen gewesen. Die Wand von den mittleren beiden Zellen wurde herausgenommen, und zu den links und rechts angrenzenden Zellen Durchgänge geschaffen.
Diese Großzelle sollte für achtundzwanzig Gefangene Platz bieten. Im größten Raum befanden sich vier dreistöckige Betten, die beiden kleinen Räume hatten je zwei vierstöckige Betten. Es gab insgesamt zwei Toiletten und drei Waschbecken.
Ich suchte mir ein Bett in der rechten kleinen Zelle, denn die große Zelle war vollständig belegt. In das Etagenbett konnte ich mich nur hineinrollen, denn der Liegeplatz war mit einer Höhe, der dem Abstand von der Fingerspitze bis zum Ellenbogen ausmachte, klaustrophobisch eng. Die Metallhaken des Gitterrostes über mir waren nach unten gebogen, so daß ich mir jede Nacht, wenn ich mich umdrehte, daran die Arme und den Kopf blutig schlug. Als das oberste Bett frei wurde, zog ich dorthin um. Ab diesem Zeitpunkt waren die Nächte für mich schmerzfreier.
In dieser Großzelle lagen ausschließlich Häftlinge, die sich auf Transport befanden. Einige waren schon verurteilt und fuhren zur nächsten Gerichtsverhandlung oder wurden in ein anderes Gefängnis verlegt. Andere waren gerade erst verurteilt und kamen nun von der Untersuchungshaft in den Strafvollzug.
Während mir als Untersuchungshäftling Gegenstände wie Rasierklingen, Fotos, Nagelscheren oder Gürtel verboten waren, lagen derartige Dinge überall in der Zelle herum, denn für verurteilte Gefangene galten diese Einschränkungen nicht.
Gerade Rasierklingen konnten sich als überaus nützlich erweisen. Einige Häftlinge banden zwei davon dicht nebeneinander zusammen, befestigten zwei Drähte, die sie von wer weiß woher hatten, daran und steckten die anderen Enden in eine Steckdose. Ein kleiner, selbstgebastelter Tauchsieder entstand, mit dem Wasser zum Rasieren oder für den Zahnputzbecher erwärmt wurde. Oft sprang dabei die Sicherung heraus, doch war es angesichts der Vielzahl der Zellen unwahrscheinlich, daß die Wärter herausfanden, welche Zelle den Kurzschluß ausgelöst hatte. Man wartete eine Weile, bis die Wärter die Sicherung gewechselt hatten, und begann von vorn.
In Magdeburg sah ich das erste Mal in meinem Leben, wie sich Gefangene tätowierten. Mit schwarzer Tusche, die irgendwie ins Gefängnis geschmuggelt wurde, und einer Nadel, um der Zwirn gewickelt war, stachen sie sich gegenseitig Bilder oder Wörter in die Haut, oft, bis ihr gesamter Körper mit dunkelblauer Farbe überzogen war. Viele Bilder mißglückten, weil sich fast jeder an der Nadel probierte, ob er nun tätowieren konnte oder nicht.
Die Brutalität in dieser Großzelle war unerträglich. Schon am zweiten Tag erlebte ich, wie vor meinen Augen ein Inhaftierter von anderen Gefangenen derart zusammengeschlagen wurde, daß hinterher nur noch ein blutüberströmtes und wimmerndes Etwas übrigblieb. Dieses Ereignis machte mir unsagbar Angst, denn solche Gewalt hatte ich bisher noch nicht einmal im Fernsehen gesehen. Nun stand ich mittendrin. Den Grund, warum dieser Gefangene geschlagen wurde, habe ich nie erfahren.
Das Untersuchungsgefängnis in Magdeburg war eine Haftanstalt, die mich wirklich schaudern ließ. Da Gewalt an der Tagesordnung war, konnte ich nur dafür sorgen, nicht aufzufallen. Allein dann bestand Hoffnung, die Wut einiger Gefangener würde sich nicht gegen mich richten. Es galt die Macht des Stärkeren, und wer sich nicht fügte, lief Gefahr der nächste zu sein, der zusammengeschlagen wurde. Den Wärtern schien es egal, was sich in den Zellen abspielte. Regelmäßige Kontrollen, wie ich sie in Zwickau kennenlernte, gab es in Magdeburg nicht. Kontrolliert wurde nur morgens und abends mit der Zählung. Tagsüber wurden die Zellen nur zu den Mahlzeiten geöffnet, oder wenn es hinaus zur Freistunde ging.
In dieser Zeit wollte ich nur noch raus aus dieser Situation und hatte keine Ahnung, wie lange sich der Aufenthalt in Magdeburg hinziehen würde. Es konnte Wochen dauern, bis der Grotewohl-Expreß wieder einmal die Strecke Magdeburg - Richtung Klötze fuhr.
Abends in meinem Bett betete ich, ich möge einschlafen und nie wieder aufwachen. Aus purer Angst heraus dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben intensiv über Selbstmord nach. Es wäre leicht gewesen, an Rasierklingen zu kommen. Allein die Furcht es zu tun, hielt mich davon ab. Zu dieser Zeit fing ich an, die DDR abgrundtief zu hassen. Das, was mir die Staatsmacht antat, stand in keinem Verhältnis zu dem, was Bernd-Ulrich und ich getan hatten und war auch mit nichts zu rechtfertigen.
Die Freistunden waren zwar unregelmäßig, dafür ausgedehnter als die in Zwickau. Ich genoß es, die kurze Zeit für mich allein zu sein. Von den achtundzwanzig Betten in unserer Zelle waren zwar nur zweiundzwanzig belegt, doch mich erdrückte diese Enge fast. Der Freistundenhof war sehr viel größer als der von Zwickau. Zu welcher Zeit wir auch hinausgeführt wurden, immer war der Hof voll mit Gefangenen, wovon sich viele, wie ich, auf der Durchreise befanden.
Nach eineinhalb Wochen war der Alptraum in Magdeburg vorbei und ich ging wieder auf Transport. Diesmal zur vorläufig letzten Station, der Untersuchungshaftanstalt in Stendal.
Vor dem Abtransport mußten wir uns auf dem Flur des Gebäudes nackt ausziehen. Ein Sanitäter notierte bei jedem Gefangenen alle Tätowierungen, die seit seiner Ankunft in Magdeburg neu hinzugekommen waren. Auch hier wurden wir in einen Duschraum eingeschlossen, bis unsere Sachen gefilzt waren.
Einige Gefangene vermißten nach dem Filzen Streichholzkuppen oder kleine Tütchen mit Tabak, die sie in den Zug schmuggeln wollten. Niemandem wurde gesagt, wie lange er unterwegs sein wird und nur wenige wußten, wohin ihre Reise ging. Um sich die Zeit wenigstens etwas zu verkürzen, versuchten einige Gefangene Tabak und Streichholzkuppen zu behalten, um unterwegs rauchen zu können. Allerdings gelang es nur sehr wenigen, verbotene Gegenstände durch die Kontrolle zu bekommen. Die Wärter waren im Suchen geübt und kannten die Verstecke in der Kleidung gut.
Eine Stunde vor Zugabfahrt ging es wieder durch unterirdische Gänge des Bahnhofs zum Gefängniswaggon. Es tat mir weh, den Bahnhof von Magdeburg als Gefangener zu sehen. Die seelischen Schmerzen nahmen zu, je mehr der Zug in Richtung Norden fuhr. Immer mehr spürte ich die alte Heimat, wo ich nun nicht mehr dorthin gehen konnte, wohin ich gehen wollte. Die Strecke von Magdeburg nach Klötze war ich schon unzählige Male mit dem Zug gefahren, nun konnte ich noch nicht einmal aus dem Fenster sehen. Nie hätte ich gedacht, meine Heimat als Gefangener wiedersehen zu müssen.
Die Untersuchungshaftanstalt Stendal
Stendal liegt etwa 55 km östlich von meinem damaligen Heimatort Klötze entfernt. Die Vergangenheit hatte mich noch nie bis Stendal geführt. Durch die Milchglasfenster der grünen Minna, die uns ins Untersuchungsgefängnis brachte, konnte ich nichts von der Stadt sehen.
Die Haftanstalt machte auf mich einen ordentlichen Eindruck. Es war kein Vergleich zu Zwickau und schon gar nicht zur U-Haft in Magdeburg. Die Wände waren sauber gestrichen und es war relativ ruhig im Haus, was sicherlich auch daran lag, daß diese Haftanstalt nicht sehr groß war.
Wir waren etwa fünfzehn Gefangene und warteten in Dreierreihe auf dem Flur des Erdgeschosses auf die Einweisung in die Zellen. Zu Beginn bekamen wir Teile der Hausordnung zu hören und anschließend ging es einzeln zu den Effekten, wo unsere persönlichen Sachen verwahrt und den Gefangenen Plastikgeschirr, Bettzeug und, sofern sie diese bei der Verhaftung dabeihatten, Wäsche zum Wechseln ausgehändigt wurde.
Besonders letzteres war mir wichtig, denn noch immer trug ich seit meiner Verhaftung dieselbe Wäsche. Weder in Zwickau noch in Magdeburg kam ich an meinen Koffer, um meine Kleidung wechseln zu können.
War ein Gefangener in der Effektenkammer fertig, führte ihn ein Wärter zu seiner Zelle. Wie in Zwickau hatten sich die Gefangenen neben der Tür mit dem Gesicht zur Wand zu stellen, wenn die Zellentür geöffnet wurde, und mit dem Rücken zur Tür galt für Gefangene in der Zelle.
Der Wärter, der mich zu meiner Zelle führte, war nur wenig älter als ich. Dienstgradmäßig stand er noch am Anfang seiner Laufbahn. Er genoß seine Überlegenheit den Gefangenen gegenüber sichtbar. Vor der Zelle angekommen, steckte er den Schlüssel in das Schloß, drehte ihn lässig und geübt mit dem linken Zeigefinger herum und schob gleichzeitig mit dem rechten Handballen den Riegel zur Seite. Nachdem der Verwahrraumälteste mit seiner Meldung fertig war, forderte er mich mit einer Kopfbewegung auf, in die Zelle zu gehen. Ich nahm mein Bündel mit Bettzeug und Geschirr, und voller Ungewißheit, was mich nun erwarten würde, folgte ich der Anweisung.
Doch der erste Eindruck beruhigte mich.
Die Zelle hatte vier Betten, ein Waschbecken mit einem kleinen, in den Putz eingelassenen Spiegel, einen an der Wand befestigten Tisch, vier Holzhocker, eine Toilette und einen kleinen Wandschrank mit zwei Türen und vier Fächern. Die Meldung hatte ein etwa 45-jähriger Mann aufgesagt. Hinter ihm standen zwei Jugendliche mit dem Rücken zur Tür und den Köpfen nach unten gesenkt. Sie schienen jünger zu sein als ich. Gewalttätig sah keiner von den Dreien aus.
Schnell machten wir uns miteinander bekannt und es dauerte nur ein paar Tage, da wußte jeder über den anderen genauestens Bescheid.
So erfuhr ich, daß der ältere Mann wegen Steuerhinterziehung angeklagt war. Er hatte vor seiner Verhaftung einen kleinen Betrieb in Stendal und behauptete, unschuldig zu sein. Die anderen beiden Häftlinge waren vierzehn und sechzehn Jahre alt, wovon der jüngere ebenfalls wegen Republikflucht angeklagt war. Der ältere Jugendliche war wegen Mopeddiebstahls eingesperrt und sollte wenige Wochen später auf Bewährung entlassen werden.
Die Tage verliefen friedlich, doch es gab auch Tage, wo wir uns wegen Nichtigkeiten stritten. So etwas bleibt nicht aus, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum auf engstem Raum zusammenleben müssen. Streitereien waren trotzdem eher die Ausnahme.
Wegen der bevorstehenden Gerichtsverhandlung kümmerte ich mich so schnell wie möglich um einen Rechtsanwalt und bat meine Eltern im 1. Januarbrief, mir das Geld dafür zu überweisen. Bisher hatte ich immer noch nichts von ihnen gehört, hoffte jedoch, von ihnen Unterstützung zu erhalten.
Erster Januarbrief
Liebe Eltern!
Ich hoffe, Ihr habt Weihnachten und Silvester gut überstanden. Was macht das Haus? Könnt Ihr bald einziehen? Bitte kommt mich mal besuchen. Dazu braucht Ihr eine Sprechgenehmigung vom Staatsanwalt.
Ich habe mich mit dem Rechtsanwalt Helmut Schernikau in Verbindung gesetzt (Tel.: Salzwedel 2376). Bitte zahlt darum von meinem Sparkassenbuch hundertfünfzig Mark auf das Konto 3004-34-52, GH Gardelegen, Zweigstelle Salzwedel, ein. Ihr könnt es auch telegraphisch überweisen, damit es möglichst schnell geht. Der Anwalt setzt sich erst dann für mich ein, wenn die Anzahlung bei ihm eingegangen ist. Ich habe inzwischen von diesem Rechtsanwalt eine Prozeßvollmacht erhalten, die ich heute, am 15.01.1977, unterzeichnet an ihn zurücksende.
Über meine Anschuldigung darf ich Euch nichts schreiben, jedoch wird Herr Schernikau Euch Auskunft erteilen können. Allein sehe ich mich nicht in der Lage, mich in meiner Angelegenheit wirksam zu verteidigen. Deshalb bin ich auf einen Anwalt angewiesen. Ich sende Euch mit dem heutigen Schreiben eine Vollmacht, die Euch ermächtigt, von meinem Sparguthaben einhundertfünfzig Mark abzuheben.