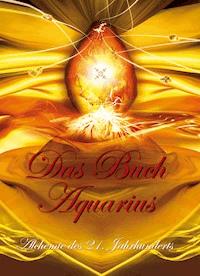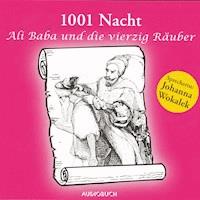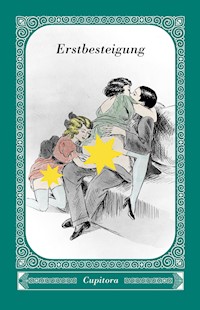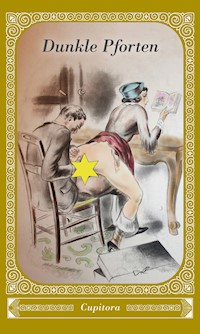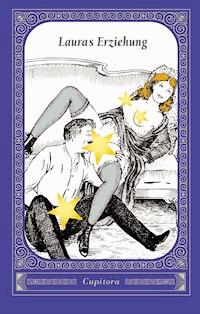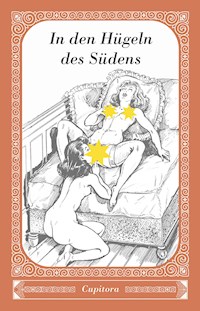
Sechs erotische Geschichten "Ha! Welche Wonne, wie sie meine Eichel beleckte, wie sie bald oben, bald unten von der sammetweichen, warmen Zunge geliebkost wurde. Ich empfand ein Entzücken, wie ich es noch nie empfunden, eine Wonne, die ich nie gefühlt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In den Hügeln des Südens
Sechs erotische Geschichten
eISBN 978-3-95841-764-9
© by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
Der Maler und seine Modelle
I.
Italien, sonniges Land, du Land des ewigen Frühlings, des Veilchenduftes und des Sonnenscheines, Land, in dem das Herz höher schlägt, die Wangen holder Mädchen rosiger glühen und die Augen heller funkeln, o Rom, du ewige Stadt mit deinen Kunstschätzen und den wissbegierigen Schülern voll tollen Jugendübermutes, stets aufgelegt zu Scherz und Spiel, zu kräftigem Trunk und süßen Kuss, wie oft gedenk ich deiner, wie oft wird die Sehnsucht nach dir aufs Neue in mir entfacht, wie oft wünsche ich die schönen Tage, die ich in dir verlebte, noch einmal durchzumachen, im Kreise der frohen Genossen in der Künstlerherberge zu zechen und einer Flasche nach der anderen vom roten Vino d’Asti den langen Hals zu brechen bei Scherz und Rundgesang, oder auf einsamen Wegen mit einem Freunde in zauberischer Frühlingsmondnacht die Wunder der stolzen Stadt zu belauschen oder gar im stillen Atelier eifrig zu streben und zu schaffen und dann in den Pausen mit dir, du reizendes Kind Annita, zu kosen und deinem lieben Geplauder zu lauschen, oder mit dir, du üppige, nie zu befriedigende Gelsemina, die tollsten Streiche zu verüben.
Ach, die Zeiten sind vorüber, die Jahre sind vergangen und alles Schöne, das ich einst genossen, lebt nur noch in der Erinnerung.
Ich war zwanzig Jahre alt, als ich meine Studien auf verschiedenen Akademien beendet hatte und endlich das Ziel meiner sehnlichsten Wünsche, Rom, erreichte. In der Ewigen Stadt, wohin ich gute Empfehlungen mitbrachte, wurde ich von den Mitgliedern der deutschen Kolonie auf das Freundlichste empfangen, und bald fehlte es mir nicht an Freunden und gleich gesinnten Genossen. Mit ihnen schwelgte ich in den tausend Genüssen, welche Rom bietet, und war der Tollsten einer. Der Erste beim Trunk, der Letzte beim Becher, und manche schöne Römerin habe ich heimlich im blühenden Orangengarten aufgesucht und mit ihr glühende Küsse getauscht, manche stille Mädchenkammer öffnete sich mir, manches jungfräuliche Bett wurde von mir von den Erstlingen seiner Besitzerin rot gefärbt, manchem reizenden Schelm gewährte ich Einlass in mein Zimmer, um sie erst beim Morgengrauen, ganz ermattet, wieder zu entlassen. Mein Ruf war nicht der beste, doch tat ich niemand Unrecht, sondern trat stets mutig für Recht ein; mehr als einmal kam ich in die Lage, mit scharfer Klinge oder auch mit der Pistole mich zu verteidigen. So war es ganz natürlich, dass man mich im Kreise der Kollegen den tollen Artur nannte. Ich war damals ein strammer Kerl, mit kräftigem blondem Schnurrbart und offenem Gesicht, was mir unter den Mädchen unserer Bekanntschaft den Beinamen: barba bionda, der Blondbart, eintrug.
Das Fach, für welches ich besonders schwärmte, war die Landschaft; da ich für diese großes Talent hatte, zog ich, sobald der Frühling nahte, hinaus, um überall das Schöne, was sich mir bot, auf dem Papier mit flinkem Stift festzubannen oder ad die Leinwand zu übertragen.
Von den Kollegen hatte ich oftmals ihre Abenteuer erzählen hören, die sie mit ihren Modellen auf ihren Ateliers erlebten; mir war indes naturgemäß noch kein solches Erlebnis begegnet, da ich für meine Landschaften keine lebenden Modelle benutzte. So war ich beim Beginn des Frühlings nach Frascati gegangen, hatte mich, so gut es ging, eingerichtet und malte an einem Bild, wozu ich dort ein prächtiges Motiv gefunden.
Ein zerfallenes Gemäuer, ganz und halb gestürzte Säulen, alles von Rosen überwuchert und von Efeu umsponnen, dazwischen Reste von Statuen, darunter ein prachtvoller Faun, der neben einem noch plätschernden Brunnen stand.
Während ich an dem Bilde malte, kam mir der Gedanke, die Ruhe der Landschaft durch ein menschliches Wesen, und zwar ein nacktes Mädchen, zu dem der Marmor-Faun lüstern hinüberschielte, zu beleben. Woher jedoch in Frascati ein Modell nehmen? In Rom war dies eine Kleinigkeit, da konnte man sie überall für wenige Scudi an den Straßenecken auflesen, hier jedoch schien mir die Sache etwas schwieriger zu sein. Mehrere Tage vergingen mir so, ohne dass mein Suchen nach einem passenden Modell von Erfolg gewesen wäre, und missmutig wollte ich die Vollendung meines Bildes aufschieben, bis ich wieder in Rom sein würde.
Aber noch etwas anderes ärgerte mich. Dass ich kein passendes Mädchen finden konnte, das verursachte die mir aufgenötigte Enthaltsamkeit. Ich war gewohnt, in Rom mindestens zweimal in der Woche mich meines Überschusses an jugendlicher Kraft in einen weiblichen Schoß zu entledigen, hier aber lebte ich nun schon über einen Monat im Zölibat, denn ich konnte mich nicht überwinden, bei einem der alten Weiber Hilfe zu suchen, dagegen sträubte sich mein Schönheitsgefühl; und einer der jungen Frauen mit Liebkosungen zu nahen, war sehr gefährlich, denn den dortigen Ehemännern steckte damals das Messer sehr locker im Gürtel und ich wusste, dass schon mehr als ein Fremder einen Versuch, sich nächtlicherweile einer Schönen zu nähern, mit dem Leben bezahlt hatte. So saß ich eines Tages schlecht gelaunt an meiner Staffelei. Vergebens hatte ich versucht, aus dem Gedächtnis eine für meine Zwecke passende nackte Mädchenfigur zu zeichnen; so wie ich sie zu haben wünschte, brachte ich sie nicht zustande; doch die Folge meiner Bemühungen, das Zeichnen und Betrachten dieser nackten Gestalten, machte sich alsbald bei mir bemerkbar: mein Glied steifte sich so und fing zu rebellieren an, dass ich fast versucht war, den Ungestümen aus der Hose zu holen und mir durch Onanieren endlich Ruhe zu verschaffen. Da klopfte es plötzlich leise und zaghaft an meiner Tür.
»Entrez!«
Die Tür öffnete sich, ich höre das Rauschen eines Frauenkleides und drehe mich schnell auf meinem Stuhle um.
Ein junges Mädchen von etwa fünfzehn Jahren war eingetreten. Schüchtern blieb sie an der Tür stehen. Ich betrachtete mir die Gestalt vorn Kopf bis zur Sohle.
Ein Strohhut aus weißem Geflecht, mit einem gelben Band verziert, bedeckte das schwarze Haar, welches in einem einfachen Knoten am Hinterkopf aufgesteckt war, ein rundes, frisches Gesicht mit roten, etwas sinnlich aufgeworfenen Lippen, denen der Anflug eines zarten dunklen Flaumes etwas ganz besonders Anziehendes verlieh. Ein paar schelmische Augen mit schön geschwungenen schwarzen Brauen, ein niedliches Näschen vervollständigten das anmutige Bild.
Die nicht sehr große Figur schien, soweit man ihre Formen, die durch ein graues Kleid und eine dunkle einfache Taille verhüllt waren, erkennen konnte, von schönstem Ebenmaß zu sein.
Im Nu hatte ich die ganze kleine Person gemustert, und sogleich kam mir der Gedanke das wäre ein Modell für mich.
Als die Kleine noch immer zaghaft an der Tür stehen blieb, bat ich sie freundlich, näherzutreten und fragte sie, was sie wünsche und womit ich ihr dienen könnte.
Sie trat zögernd näher zu mir und sagte dann schüchtern:
»Oh, Signore, verzeihe, man sagt mir, du seiest ein Tedesco, ein Artist, ein Maler, und mir scheint, dass dem so ist.«
Dabei ließ sie ihre Blicke im Atelier umherschweifen und betrachtete neugierig die ringsherum hängenden und stehenden, fertigen und halb fertigen Bilder.
»Ganz recht, liebes Kind«, antwortete ich – »man hat dir berichtet, ich bin allerdings ein Maler, möchtest du meine Bilder gern einmal sehen?«
»Ach nein, Herr, aber – aber ich möchte fragen, ob – du nicht ein Modell gebrauchst, aber ich sehe, du malst nur Häuser und Bäume.«
»Möchtest du mir Modell stehen?«
»Sì, Signore.«
»Es scheint mir nicht, als ob du daran gewöhnt wärest, mia carissima, hast du es bereits früher getan?«
»Nein, Herr, aber man sagte mir, dass – dass man dafür Geld bekäme, und die Mutter ist schon so lange krank, der Vater ist schon den ganzen Winter fort; er arbeitet irgendwo in einem fremden Lande an einer Eisenbahn und schickt kein Geld, da muss ich den jüngeren Bruder und die Mutter ernähren, und das wird mir – ach, oftmals so schwer, dass ich nicht weiß, woher ich das Geld nehmen soll um Brot zu kaufen, und wenn du mich nun als Modell gebrauchen könntest und mich malen würdest, dass ich doch etwas verdienen könnte.«
Hier brach sie ab, und Tränen erstickten ihre Stimme.
»Wie heißt du, poveretta?«
»Annita.«
»Höre, Annita, vielleicht kann ich ein Modell gebrauchen; was verlangst du, wenn du täglich einige Stunden zu mir kommst?«
Ihr betrübtes Gesicht verklärt sich sofort, und freudestrahlend antwortete sie:
»Oh, Herr, was ich verlange? Gib mir, was du willst, ich bin mit allem zufrieden.«
Ich bot ihr den üblichen Preis, und jubelnd klatschte sie in die Hände über die frohe Aussicht, so viel, so sehr viel Geld verdienen zu können.
»Freue dich nicht zu früh, liebe Annita«, sagte ich nun, »ich biete dir das Geld in dem Fall, wenn ich dich als Modell gebrauchen kann.«
»Und warum solltest du mich nicht gebrauchen können, Herr?«
»Dein Gesicht ist hübsch, liebes Kind, es fragt sich nur, ob auch dein Körper so schön ist, dass ich ihn malen kann.«
Ich weidete mich an ihrer Verlegenheit und suchte diese reizende Szene möglichst in die Länge zu ziehen, auch ein wenig den Beichtvater zu spielen und die intimsten Geheimnisse aus ihr herauszulocken.
»Herr«, sagte sie endlich nach einer kleinen Pause des Nachdenkens, »ich glaube, ich bin ebenso hübsch wie jedes andere Mädchen, aber warum fragst du mich darum?«
»Nun, weil ich nicht nur dein Gesicht, sondern auch deinen ganzen Körper malen würde, ohne Kleid, ja sogar ohne Hemd.«
Sie errötete tief, dann antwortete sie leise, aber mit einem gewissen Stolz: »Ich bin so schlank und gerade gewachsen, wie nur ein Mädchen sein kann und habe, soviel ich weiß, außer einem kleinen Muttermal auf der rechten Hüfte kein Fleckchen an mir.«
»Und wie ist dein Busen beschaffen, hängt er herunter oder steht er gerade ab?«
»Nein, er steht ganz fest nach beiden Seiten.«
»Sind deine Brüste dick und groß oder noch klein?«
»Nein, Herr, sehr groß sind sie nicht, ich kann jede mit einer Hand bedecken.«
»Und die Wärzchen darauf, sind sie rot oder braun?«
»Rot wie Rosen, Herr.«
Allmählich verlor die Kleine ihre Befangenheit, und ihre Antworten kamen nicht mehr zögernd, sondern dreister, als ob sie sich ärgere, dass ich glauben könne, sie sei nicht am ganzen Körper schön.
»Doch deine Arme, Annita, sind etwas mager, nicht wahr?«
»O nein, nicht doch, sie sind ganz voll und rund.«
»Dein Bauch scheint wohl gerundet und die Hüften voll, wie ist es mit den Beinen, sind dieselben nicht an den Knien nach innen gebogen oder nach außen?«
»Nein, nein, meine Beine sind so gerade als sie nur sein können.«
»Sind die Waden nicht etwas schwach?«
»Wie du fragst, Herr, nein, sie sind rund und fest.«
»Wie sieht denn dein Hinterer aus, liebe Annita?«
Jetzt lachte sie laut auf: »Wie soll ich das wissen, ich habe ihn doch noch nicht gesehen.«
»Du hast recht, Mädchen, du kannst ihn nicht .selbst sehen, aber sage mir, bist du noch Jungfrau?«
»Ja, gewiss.«
»Hast du keinen Schatz?«
»Nein, Herr, ich bin zu arm dazu.«
»Gewiss aber hat ein Bursche schon mit der Hand oder gar mit einem anderen Dinge an deiner kleinen Scham gespielt?«
»Nein, außer meinem Bruder noch niemand.«
»Wie alt ist dieser Bruder?«
»Zehn Jahre.«
»Und ihr spielt euch manchmal gegenseitig daran herum?«
»Ach ja, wir schlafen ja nachts zusammen, und das ist so allerliebst.«
»Spielst du dir auch selbst daran?«
»O ja, bisweilen, es ist aber nicht so hübsch, als wenn es mein Bruder tut.«
»Steckt er dir auch den Finger hinein?«
»Ach, Herr, wie du fragst, ich sollte meinen, das hätte doch mit dem Malen nichts zu tun.«
»Du hast recht, Kind, ich weiß genug – aber, weißt du, um zu beurteilen, ob ich dich gebrauchen kann, müsste ich selbst sehen – komm einmal her.«