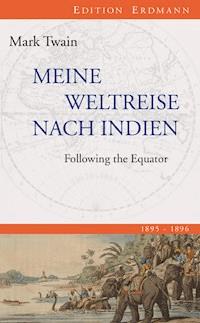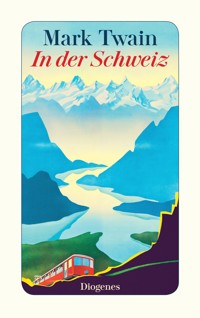
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mark Twain bummelt 1878/79 durch Europa, insbesondere durch die Schweiz. Seine Ziele sind Luzern, Rigi, Interlaken, Kandersteg, Monte Rosa, Zermatt, Matterhorn und, nach einem kleinen Abstecher zum Mont Blanc, Genf. Humorvoll und mit viel Ironie beschreibt Twain dieses kleine Land mit seinen merkwürdigen Einwohnern sowie deren Sitten und Gebräuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mark Twain
In der Schweiz
Aus dem Amerikanischen von Ana Maria Brock
Diogenes
Erstes Kapitel
Luzern · Schönheit des Sees · Die wilde Gemse · Ein großer Irrtum enthüllt · Methoden, die Gemse zu jagen · Schönheit Luzerns · Der Alpenstock · Alpenstöcke markieren · Nationalitäten raten · Eine amerikanische Gesellschaft · Eine unvermutete Bekanntschaft · Ich komme ins Schwimmen · Ich folge blinden Fährten · Eine frohe halbe Stunde · Niederlage und Rache
Am nächsten Morgen fuhren wir mit der Eisenbahn nach der Schweiz und erreichten Luzern gegen zehn Uhr abends. Meine erste Entdeckung war, daß man die Schönheit des Vierwaldstätter Sees nicht übertrieben hatte. Nach einem oder zwei Tagen machte ich eine weitere Entdeckung. Und zwar, daß die vielgepriesene Gemse keine wilde Ziege ist; daß sie kein gehörntes Tier ist; daß sie nicht scheu ist; daß sie die menschliche Nähe nicht meidet; und daß es nicht gefährlich ist, sie zu jagen. Die Gemse ist ein schwarzes oder braunes Tier, nicht größer als ein Senfkorn; man braucht sie nicht aufzusuchen, sie sucht einen auf; sie kommt in riesigen Herden und hüpft und springt einem unter der Kleidung über den ganzen Leib; also ist sie nicht scheu, sondern äußerst gesellig; sie fürchtet sich nicht vor dem Menschen, im Gegenteil, sie greift ihn an; ihr Biß ist nicht gefährlich, aber auch nicht angenehm; ihre Lebhaftigkeit ist nicht übertrieben worden – wenn man versucht, den Finger auf sie zu legen, hüpft sie in einem Sprung über das Tausendfache ihrer Länge, und kein Auge ist scharf genug, um zu sehen, wo sie landet. Man hat über die Schweizer Gemse und die Gefahren der Gemsenjagd eine Menge romantischen Unsinns geschrieben; wahr ist vielmehr, daß sogar Frauen und Kinder sie jagen, und zwar ganz ohne Furcht; tatsächlich jagt sie jedermann; die Jagd ist dauernd im Gange, Tag und Nacht, im Bett und außer Bett. Es ist eine schwärmerische Torheit, sie mit dem Gewehr zu jagen; das tun sehr wenige Leute; unter einer Million Menschen gibt es keinen, der sie mit einem Gewehr treffen könnte. Sie zu fangen ist viel leichter, als sie zu schießen, und beides kann nur der erfahrene Gemsenjäger schaffen. Noch eine verbreitete Übertreibung betrifft die »Seltenheit« der Gemse. Sie ist das Gegenteil von selten. Herden von hundert Millionen Gemsen sind in den schweizerischen Hotels nicht ungewöhnlich. Sie sind tatsächlich so zahlreich, daß sie eine große Plage darstellen. Die Romanschreiber kleiden den Gemsenjäger immer in eine phantasievolle, malerische Tracht, während die beste Methode, dieses Wild zu jagen, die ist, es überhaupt ohne jede Tracht zu tun. Der Handelsartikel namens »Chamoisleder« ist ein weiterer Betrug; niemand könnte eine Gemse häuten, sie ist viel zu klein. Das Geschöpf ist in jeder Beziehung ein Humbug, und alles, was darüber geschrieben worden ist, ist gefühlvolle Übertreibung. Es hat mir keine Freude gemacht, die Gemse zu entlarven, denn sie war eine meiner Lieblingsillusionen; mein ganzes Leben lang hatte ich davon geträumt, sie eines Tages in ihrer Wildnis zu sehen und mich in den abenteuerlichen Sport stürzen zu können, sie von Klippe zu Klippe zu hetzen. Es macht mir keine Freude, sie jetzt bloßzustellen und des Lesers Entzücken über sie und seine Achtung vor ihr zu zerstören; aber es muß doch sein, denn wenn ein ehrlicher Schriftsteller eine Betrügerei entdeckt, ist es einfach seine Pflicht, sie aufzudecken und von ihrem Ehrenplatz herabzustürzen, gleichgültig, wer darunter leidet. Durch jedes andere Vorgehen würde er sich des öffentlichen Vertrauens unwürdig erweisen.
Luzern ist eine bezaubernde Stadt. Sie beginnt am Ufer des Sees mit einem Saum von Hotels, klettert empor und breitet sich dichtgedrängt, in ungeordnetem, malerischem Stil über zwei oder drei steile Berge aus, wobei es dem Blick einen aufgetürmten Wirrwarr aus roten Dächern, wunderlichen Giebeln, Dachfenstern, zahnstocherähnlichen Kirchtürmen darbietet, wobei hier und da ein Stück alter, zinnengekrönter Stadtmauer wurmartig über die Bergkuppen kriecht und da und dort ein alter, viereckiger Turm aus festem Mauerwerk steht. Und auch hier und da eine Turmuhr mit nur einem Zeiger – einem Zeiger, der quer über das Zifferblatt reicht und kein Gelenk besitzt; eine solche Uhr hebt die Gesamtwirkung, aber die Tageszeit kann man von ihr nicht ablesen. Zwischen der geschwungenen Reihe der Hotels und dem See liegt eine breite Allee mit Lampen und einer doppelten Reihe niedriger, schattenspendender Bäume. Das Seeufer ist wie ein Pier mit Mauerwerk eingefaßt und besitzt ein Geländer, damit die Leute nicht über Bord gehen. Den ganzen Tag lang rasen Fahrzeuge die Allee entlang, und Kindermädchen, Kinder und Touristen sitzen im Schatten der Bäume oder lehnen sich über das Geländer und sehen zu, wie die Schwärme von Fischen im klaren Wasser umherflitzen, oder blicken über den See hinaus auf den prachtvollen Saum schneebedeckter Bergspitzen. Immerzu kommen und gehen kleine Vergnügungsdampfer, schwarz von Menschen, und überall sieht man junge Mädchen und junge Männer in wunderlichen Ruderbooten umherpaddeln oder, wenn Wind weht, mit Hilfe von Segeln dahintreiben. Die Vorderzimmer der Hotels haben einen kleinen vergitterten Balkon, wo man in ruhigem, kühlem Behagen für sich allein speisen und auf dieses geschäftige und hübsche Bild hinunterblicken und es genießen kann, ohne eine der damit verbundenen Arbeiten leisten zu müssen.
Die meisten Leute, Männer und auch Frauen, gehen in Wanderkleidung und tragen Alpenstöcke. Offensichtlich hält man es nicht für sicher, in der Schweiz – selbst in der Stadt – ohne Alpenstock umherzulaufen. Wenn der Tourist nicht daran denkt und ohne Alpenstock zum Frühstück herunterkommt, geht er zurück, holt ihn und stellt ihn in die Ecke. Wenn seine Reisen durch die Schweiz zu Ende sind, wirft er diesen Besenstiel nicht fort, sondern schleppt ihn mit nach Hause in die fernsten Winkel der Erde, obwohl ihm das mehr Mühe und Ärger macht, als ein Säugling oder ein Reiseführer verursachen könnten. Man muß wissen, der Alpenstock ist seine Trophäe; der Name des Besitzers ist darauf eingebrannt; und wenn er damit einen Hügel erstiegen, einen Bach übersprungen oder eine Ziegelei überquert hat, läßt er die Namen dieser Orte auch darauf einbrennen. Daher ist der Alpenstock sozusagen seine Regimentsfahne und trägt das Register seiner Heldentaten. Wenn der Reisende ihn kauft, ist er drei Franken wert, aber um eine Goldgrube könnte man ihn nicht kaufen, nachdem seine großen Taten darauf eingeritzt sind. In der ganzen Schweiz gibt es Handwerker, deren Gewerbe es ist, das in die Alpenstöcke der Touristen einzubrennen. Und man beachte, daß in der Schweiz ein Mann nach seinem Alpenstock bewertet wird. Ich stellte fest, daß ich dort keine Aufmerksamkeit auf mich lenken konnte, solange ich einen Stock ohne Brandmale trug. Aber das Brennenlassen ist nicht teuer, deshalb half ich dem bald nach. Die Wirkung auf die nächste Touristenabteilung war sehr bemerkenswert. Ich fühlte mich für meine Mühe belohnt.
Die Hälfte der Meute, die im Sommer die Schweiz bevölkert, besteht aus Engländern; die andere Hälfte setzt sich aus vielen Nationalitäten zusammen, wobei die Deutschen vorangehen und die Amerikaner als nächste folgen. Die Amerikaner waren nicht so zahlreich, wie ich erwartet hatte.
Die Table d’hôte um halb acht im großen Schweizerhof brachte ein gewaltiges Aufgebot der mannigfaltigsten Nationalitäten hervor, aber sie bot bessere Gelegenheit, Trachten zu studieren als Leute, denn die Menschenmenge saß an unendlich langen Tischen, und deshalb waren die Gesichter hauptsächlich in der Perspektive zu sehen; das Frühstück wurde an kleinen runden Tischen aufgetragen, und wenn man dann das Glück besaß, einen Tisch in der Mitte der Versammlung zu bekommen, hatte man so viele Gesichter zu betrachten, wie man es sich nur wünschen konnte. Wir versuchten immer, die Nationalitäten zu erraten, und im allgemeinen gelang uns das ziemlich gut. Manchmal versuchten wir auch, die Namen der Leute zu erraten, aber das schlug fehl; das ist etwas, das wahrscheinlich eine Menge Übung erfordert. Wir ließen es bald fallen und widmeten unsere Anstrengungen weniger schwierigen Einzelheiten. Eines Morgens sagte ich:
»Dort sitzt eine Gruppe Amerikaner.«
Harris sagte: »Ja, aber nenne den Staat.«
Ich nannte einen Staat, Harris nannte einen anderen. Wir waren uns jedoch über eines einig, und zwar, daß das junge Mädchen in dieser Gruppe sehr schön sei, und sehr geschmackvoll angezogen. Aber wir waren uns nicht über ihr Alter einig. Ich sagte, sie sei achtzehn, Harris sagte, sie sei zwanzig. Der Disput zwischen uns erhitzte sich, und schließlich sagte ich mit gespieltem Ernst:
»Na, es gibt einen Weg, die Sache zu klären – ich werde hingehen und sie fragen.«
Harris sagte sarkastisch: »Sicher, das ist das Richtige. Du brauchst nur die hier übliche Formel zu gebrauchen; geh nur hin und sage: ›Ich bin Amerikaner!‹ Natürlich wird sie sich freuen, dich kennenzulernen.«
Dann deutete er an, daß meine Absicht, sie anzusprechen, nicht sehr gefährlich sei.
Ich sagte: »Ich habe nur so hingeredet – ich hatte nicht vorgehabt, an sie heranzutreten, aber ich merke schon, daß du gar nicht weißt, was für ein waghalsiger Mensch ich bin. Ich fürchte mich vor keiner lebenden Frau. Ich werde hingehen und dieses junge Mädchen ansprechen.«
Was ich vorhatte, war nicht schwierig. Ich wollte sie in höchst respektvoller Weise ansprechen und sie um Verzeihung bitten, falls ihre starke Ähnlichkeit mit einer früheren Bekannten mich getäuscht hätte; und wenn sie antworten sollte, daß der von mir erwähnte Name nicht der ihre wäre, wollte ich wieder höchst respektvoll um Verzeihung bitten und mich zurückziehen. Nichts Schlimmes wäre geschehen.
Ich ging also zu ihrem Tisch, verneigte mich vor dem Herrn, wandte mich dann ihr zu und wollte gerade meine kleine Rede beginnen, als sie ausrief: »Ich wußte doch, daß ich mich nicht irre – ich habe John gesagt, Sie sind es! John sagte, Sie sind es wahrscheinlich nicht, aber ich wußte, daß ich recht hatte. Ich sagte, Sie würden mich bald erkennen und herüberkommen; und ich bin froh, daß Sie es getan haben, denn ich hätte mich nicht sehr geschmeichelt gefühlt, wenn Sie diesen Raum verlassen hätten, ohne mich zu erkennen. Setzen Sie sich, setzen Sie sich – wie merkwürdig ist das doch; Sie jemals wiederzusehen hätte ich zu allerletzt erwartet.«
Das war eine sinnbetäubende Überraschung. Für einen Augenblick raubte sie mir völlig den Verstand. Doch wir schüttelten uns herzlich ringsherum die Hände, und ich setzte mich. Aber es war wirklich die größte Klemme, in der ich jemals gesessen hatte. Jetzt schien es mir, als erinnerte ich mich dunkel an das Gesicht des Mädchens, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich es vorher gesehen hatte oder welcher Name dazugehörte. Ich versuchte sofort, die Unterhaltung auf die schweizerische Landschaft abzulenken, um sie daran zu hindern, Themen anzuschneiden, die verraten könnten, daß ich sie nicht kannte, aber es war zwecklos, sie wandte sich sogleich Sachen zu, die sie mehr interessierten.
»Oje, war das eine Nacht, als die See die vorderen Boote fortspülte – wissen Sie noch?«
»Na und ob!« sagte ich – aber ich wußte nichts. Ich wünschte, die See hätte das Steuerruder, den Schornstein und den Kapitän fortgespült – dann hätte ich diese Fragestellerin identifizieren können.
»Und wissen Sie noch, wie erschrocken die arme Mary war und wie sie weinte?«
»Freilich«, sagte ich, »lieber Himmel, wie mir das alles wieder einfällt!«
Ich wünschte glühend, es wollte mir einfallen – aber mein Gedächtnis war leer. Das klügste wäre gewesen, das aufrichtig zu gestehen; aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, nachdem das junge Mädchen mich so sehr dafür gelobt hatte, daß ich es erkannt hatte; also tappte ich weiter, immer tiefer in den Sumpf hinein, und hoffte auf einen zufälligen Anhaltspunkt, bekam aber nie einen. Die Unerkennbare fuhr lebhaft fort:
»Wissen Sie, daß George Mary doch noch geheiratet hat?«
»Aber nein! Ist das wahr?«
»Allerdings. Er sagte, er glaube, sie hätte nicht halb so viel Schuld wie ihr Vater, und mir schien, daß er recht hatte. Meinen Sie nicht auch?«
»Natürlich hatte er recht. Es war ein völlig klarer Fall. Ich habe das immer gesagt.«
»Aber nein, das haben Sie nicht gesagt! – wenigstens nicht in jenem Sommer.«
»O nein, nicht in jenem Sommer. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Im darauffolgenden Winter habe ich es gesagt.«
»Nun, wie sich herausgestellt hat, war Mary keineswegs zu tadeln – an allem war ihr Vater schuld, zumindest er und der alte Darley.«
Es mußte etwas gesagt werden – also sagte ich: »Darley kam mir immer wie ein lästiger alter Kerl vor.«
»Das war er auch, aber sie hatten ihn halt immer sehr gern, obwohl er so voller Schrullen steckte. Sie erinnern sich doch, wenn es nur ein bißchen kalt war, versuchte er immer schon, ins Haus zu kommen.«
Ich hatte ziemliche Angst, fortzufahren. Offensichtlich war Darley kein Mensch – er mußte einer anderen Tiergattung angehören –, möglicherweise ein Hund, vielleicht ein Elefant. Immerhin haben alle Tiere Schwänze gemeinsam, also riskierte ich es, zu sagen:
»Und was für einen Schwanz er hatte!«
»Einen! Tausend hatte er!«
Das war sehr verwirrend. Ich wußte nicht genau, was ich sagen sollte, daher sagte ich nur: »Ja, er war wirklich ziemlich gut versorgt, was Schwänze anbetraf.«
»Für einen Neger und noch dazu für einen Verrückten kann man das wohl sagen«, sagte sie.
Es wurde allmählich ziemlich schwül für mich. Ich sagte mir: ›Hört sie etwa an dieser Stelle auf und wartet, daß ich spreche? Wenn ja, ist die Unterhaltung abgeschnitten. Ein Neger mit tausend Schwänzen, das ist ein Thema, über das ein Mensch nicht ohne einige Vorbereitung flüssig und lehrreich sprechen kann. Sich unbesonnen in ein so gewaltiges Thema zu stürzen …‹
Aber hier unterbrach sie zu meiner Freude meine Gedanken, indem sie sagte: »Ja, wenn es auf Schilderungen seiner verrückten Beschwerden hinauslief, gingen sie einfach ins Unendliche, wenn nur jemand zuhören wollte. Seine eigene Behausung war ganz behaglich, aber wenn es kalt war, konnte die Familie sicher auf seine Gesellschaft rechnen – nichts konnte ihn dem Hause fernhalten. Aber sie ertrugen es immer freundlich, weil er vor Jahren Tom das Leben gerettet hatte. Erinnern Sie sich an Tom?«
»Oh, ganz genau. War ein feiner Kerl.«
»Ja, das war er. Und was sein Kind für ein reizendes kleines Ding war!«
»Das kann man wohl sagen. Ich habe noch nie so ein hübsches Kind gesehen.«
»Ich habe es immer so gern gehätschelt und gewiegt und mit ihm gespielt.«
»Ich auch.«
»Sie haben ihm den Namen gegeben. Wie war doch der Name? Er fällt mir nicht ein.«
Mir schien, als würde hier das Eis ziemlich dünn. Ich hätte etwas darum gegeben, zu wissen, welchem Geschlecht das Kind angehörte. Aber zum Glück fiel mir ein Name ein, der auf beide Geschlechter paßte, also rückte ich damit heraus: »Ich habe es Frances genannt.«
»Vermutlich nach einem Verwandten? Aber Sie haben auch dem Kinde, das gestorben ist, den Namen gegeben – dem Kinde, das ich nie gesehen habe. Wie haben Sie es genannt?«
Ich hatte keinen neutralen Namen mehr auf Lager, aber da das Kind tot war und sie es nie gesehen hatte, glaubte ich, einen Namen riskieren und dem Glück vertrauen zu können. Also sagte ich: »Ich nannte es Thomas Henry.«
Sie sagte nachdenklich: »Das ist sonderbar – sehr sonderbar.«
Ich saß still da und ließ den kalten Schweiß fließen. Ich war in ziemlichen Nöten, glaubte aber, mich durchquälen zu können, wenn sie mich nicht aufforderte, weitere Kinder zu benamsen. Ich fragte mich, wo der Blitz das nächste Mal einschlagen würde. Noch immer sann sie über den Namen dieses letzten Kindes nach, aber plötzlich sagte sie: »Ich habe immer bedauert, daß Sie damals nicht da waren – ich hätte Sie gern gebeten, meinem Kinde einen Namen zu geben.«
»Ihrem Kinde! Sind Sie verheiratet?«
»Ich bin seit dreizehn Jahren verheiratet.«
»Getauft, meinen Sie wohl.«
»Nein, verheiratet. Der Junge hier ist mein Sohn.«
»Es scheint unglaublich – ja, unmöglich. Ich meine es nicht böse, aber würden Sie mir bitte sagen, ob Sie überhaupt älter als achtzehn sind? – das heißt, wollen Sie mir bitte sagen, wie alt Sie sind?«
»An dem Tage, als der Sturm war, von dem wir eben sprachen, wurde ich gerade neunzehn. Das war mein Geburtstag.«
Das half nicht viel, da ich das Datum des Sturmes nicht kannte. Ich versuchte, mir etwas Unverbindliches auszudenken, was ich sagen könnte, um von meiner Seite aus das Gespräch aufrechtzuerhalten und meine Armut an Erinnerungen so unauffällig wie nur möglich zu machen, aber anscheinend hatte ich keine unverbindlichen Sachen mehr auf Lager. Ich wollte gerade sagen: ›Sie haben sich seither kein bißchen verändert‹, aber das war gewagt. Ich wollte sagen: ›Sie haben sich seither gewaltig herausgemacht‹, aber das wäre natürlich auch nicht gegangen. Ich war gerade im Begriff, einen rettenden Versuch mit dem Wetter zu unternehmen, als das Mädchen mir zuvorkam und sagte:
»Wie ich dieses Gespräch über die alten, glücklichen Zeiten genossen habe – Sie nicht auch?«
»In meinem ganzen Leben habe ich noch keine solche halbe Stunde erlebt!« sagte ich mit Gefühl; und ich hätte hinzusetzen können und wäre damit der Wahrheit sehr nahe gekommen: ›Und ich möchte mich eher skalpieren lassen, als noch so eine zu erleben.‹
Ich war innig dankbar, diese Prüfung durchgestanden zu haben, und wollte mich gerade verabschieden und verziehen, als das Mädchen sagte: »Aber eines ist mir doch sehr rätselhaft.«
»Nanu, was denn?«
»Der Name jenes toten Kindes. Wie sagten Sie doch, lautete er?«
Das war wieder eine wohltuende Situation: ich hatte den Namen des Kindes vergessen; ich hatte nicht geahnt, daß ich ihn wieder brauchen würde. Aber jedenfalls mußte ich vorgeben, ihn zu wissen, also sagte ich:
»Joseph William.«
Der Junge neben mir berichtigte mich und sagte: »Nein – Thomas Henry.«
Ich dankte ihm – in Worten – und sagte bebend: »O ja – ich dachte gerade an ein anderes Kind, dem ich den Namen gab – ich habe sehr vielen den Namen gegeben und bringe sie durcheinander – dieses bekam tatsächlich den Namen Henry Thompson …«
»Thomas Henry«, warf der Junge gelassen ein.
Ich dankte ihm wieder – nur in Worten – und stammelte: »Thomas Henry – ja Thomas Henry hieß das arme Kind. Ich nannte ihn nach Thomas – hm – Thomas Carlyle, dem großen Schriftsteller, wissen Sie – und Henry – hm – hm – Heinrich VIII. Die Eltern waren sehr erfreut, ein Kind namens Thomas Henry zu haben.«
»Dadurch wird es noch viel sonderbarer«, murmelte meine schöne Freundin.
»Ja? Warum?«
»Weil die Eltern, wenn sie jetzt von diesem Kinde sprechen, es immer Susan Amelia nennen.«
Das grub mir endgültig das Wasser ab. Ich konnte nichts mehr sagen. Meine rednerischen Winkelzüge waren endgültig zu Ende; weiterzugehen hätte zu lügen bedeutet, und das wollte ich nicht. Also verhielt ich mich einfach still und litt – saß stumm und ergeben da und brutzelte – denn ich briet langsam in den Flammen meines eigenen Errötens zu Tode.
Plötzlich lachte der Feind fröhlich heraus und sagte: »Dieses Gespräch über alte Zeiten hat mir wirklich Spaß gemacht, aber Ihnen nicht. Ich habe sehr bald bemerkt, daß Sie nur vorgaben, mich zu kennen, und da ich anfangs ein Kompliment an Sie verschwendet hatte, beschloß ich, Sie zu bestrafen. Und es ist mir ziemlich gut gelungen. Ich habe mich gefreut, festzustellen, daß Sie George und Tom und Darley kannten, denn ich hatte vorher noch nie von ihnen gehört und konnte deswegen nicht genau wissen, ob das auch für Sie zuträfe; und ich habe mich auch gefreut, die Namen dieser imaginären Kinder zu erfahren. Wenn man es geschickt anstellt, kann man einen ganzen Schatz von Auskünften aus Ihnen herausholen. Mary, der Sturm und das Fortspülen der vorderen Boote, das waren Tatsachen – der ganze Rest war Dichtung. Mary war meine Schwester, ihr voller Name war Mary –. Erinnern Sie sich jetzt an mich?«
»Ja«, sagte ich. »Jetzt erinnere ich mich an Sie; und Sie sind noch genau so hartherzig wie vor dreizehn Jahren auf dem Schiff, sonst hätten Sie mich nicht so gestraft. Ihr Wesen und Ihr Aussehen haben sich überhaupt nicht verändert; Sie sehen genau so jung aus wie damals, Sie sind genau so schön wie damals, und Sie haben einen Teil Ihrer Anmut auf diesen hübschen Jungen übertragen. Bitte sehr – wenn diese Rede Sie im geringsten rührt, dann lassen Sie uns die Flagge des Waffenstillstands hissen, wobei ich selbstverständlich zugebe, daß ich besiegt bin.«
Auf der Stelle wurde das alles gebilligt und erledigt. Als ich zu Harris zurückkehrte, sagte ich:
»Jetzt siehst du, was ein begabter und gewandter Mensch erreichen kann.«
»Entschuldige, ich sehe nur, was ein kolossal unwissender und einfältiger Mensch erreichen kann. Man stelle sich bloß vor, du gehst einfach hin, drängst dich auf diese Art einer Gruppe von Fremden auf und unterhältst dich eine halbe Stunde lang; na, ich habe noch nie gehört, daß ein Mann im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte so etwas getan hätte. Was hast du zu ihnen gesagt?«
»Ich habe nichts Böses gesagt. Ich habe bloß das Mädchen gefragt, wie sie heißt.«
»Das bezweifle ich nicht. Wirklich nicht. Ich glaube, du wärest dazu fähig. Es war blöd von mir, dich dort hinübergehen und dich selbst so bloßstellen zu lassen. Aber weißt du, ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, daß du etwas so Unentschuldbares tun würdest. Was werden diese Leute bloß von uns denken! Aber wie hast du es gesagt? – ich meine die Form. Ich hoffe, du bist nicht brüsk gewesen.«
»Nein, darauf habe ich geachtet. Ich habe gesagt: ›Mein Freund und ich würden gern wissen, wie Sie heißen, wenn Sie gestatten.‹«
»Nein, das war nicht brüsk. Es zeigt eine Gewandtheit, die dir unendliche Ehre macht. Und ich freue mich, daß du mich mit hineingezogen hast; das war eine zarte Aufmerksamkeit, die ich sehr hoch schätze. Was hat sie gemacht?«
»Sie hat nichts weiter gemacht. Sie hat mir gesagt, wie sie heißt.«
»Hat dir einfach gesagt, wie sie heißt. Willst du damit sagen, daß sie gar keine Überraschung gezeigt hat?«
»Na, wenn ich es mir so überlege, sie hat etwas gezeigt; vielleicht war es Überraschung; daran habe ich nicht gedacht – ich hatte den Eindruck, sie fühlte sich geschmeichelt.«
»Oh, du hast zweifellos recht gehabt; sie muß sich geschmeichelt gefühlt haben; es kann nur schmeichelhaft sein, von einem Fremden mit einer solchen Frage überfallen zu werden. Was hast du dann gemacht?«
»Ich habe die Hand ausgestreckt, und die Leute haben sie geschüttelt.«
»Ich habe es gesehen! Ich traute in dem Moment meinen Augen nicht. Hat der Herr etwas davon gesagt, daß er dir die Kehle durchschneiden wolle?«
»Nein, sie schienen sich alle darüber zu freuen, mich kennenzulernen, soweit ich das beurteilen kann.«
»Weißt du, ich glaube sogar, das stimmt. Sie werden sich gesagt haben: ›Sicher ist dieser seltene Vogel seinem Wärter entsprungen – wir wollen uns einen Spaß mit ihm machen.‹ Es gibt keine andere Erklärung für ihre leichte Fügsamkeit. Du hast dich also hingesetzt. Haben sie dich aufgefordert, dich zu setzen?«
»Nein, aufgefordert haben sie mich nicht, aber ich nahm an, sie hätten nicht daran gedacht.«
»Du hast einen unfehlbaren Instinkt. Was hast du noch gemacht? Worüber hast du gesprochen?«
»Na, ich habe das Mädchen gefragt, wie alt sie ist.«
»Zweifellos. Dein Zartgefühl ist über alles Lob erhaben. Weiter, weiter, kümmere dich nicht um meinen scheinbaren Jammer – ich sehe immer so aus, wenn ich in tiefe, andächtige Freude versunken bin. Weiter, hat sie dir erzählt, wie alt sie ist?«
»Ja, sie hat mir erzählt, wie alt sie ist, und alles über ihre Mutter, ihre Großmutter und ihre anderen Verwandten und alles über sich selbst.«
»Hat sie diese Personalien von sich aus mitgeteilt?«
»Nein, nicht direkt. Ich habe Fragen gestellt und sie hat sie beantwortet.«
»Das ist göttlich. Weiter – hast du etwa vergessen, dich nach ihren politischen Ansichten zu erkundigen?«
»Nein, ich habe daran gedacht. Sie ist Demokratin, ihr Mann ist Republikaner, und alle beide sind sie Baptisten.«
»Ihr Mann? Ist dieses Kind verheiratet?«
»Sie ist kein Kind. Sie ist verheiratet, und der dort bei ihr sitzt, ist ihr Mann.«
»Hat sie Kinder?«
»Ja, sieben und ein halbes.«
»Das ist unmöglich.«
»Nein, sie hat sie wirklich. Sie hat es mir selbst gesagt.«
»Na ja, aber sieben und ein halbes. Wie erklärst du dir das halbe? Wie kommt das halbe zustande?«
»Das ist ein Kind, das sie von einem anderen Ehemann hatte – nicht von diesem, sondern von einem anderen –, deswegen ist es ein Stiefkind, und sie zählen es nicht voll.«
»Einem anderen Ehemann? Hat sie denn noch einen anderen Mann gehabt?«
»Ja, vier. Dieser ist Nummer vier.«
»Ich glaube kein Wort davon. Es ist ganz unmöglich. Ist der Junge dort ihr Bruder?«
»Nein, das ist ihr Sohn. Es ist ihr Jüngster. Er ist nicht so alt, wie er aussieht. Er ist erst elfeinhalb.«
»Das ist offensichtlich alles unmöglich. Es ist eine vermaledeite Geschichte. Ein ganz klarer Fall ist das: Sie haben dich einfach taxiert und daraufhin beschlossen, dich auf den Arm zu nehmen. Es scheint ihnen gelungen zu sein. Ich bin froh, daß ich nicht mit in der Tinte stecke; vielleicht sind sie wenigstens so barmherzig, anzunehmen, daß wir nicht beide vom selben Kaliber sind. Bleiben sie lange?«
»Nein, sie fahren noch vor Mittag ab.«
»Einen Menschen gibt es, der tief dankbar dafür ist. Wie hast du das erfahren? Ich nehme an, du hast gefragt?«
»Nein, ziemlich zu Anfang habe ich mich ganz allgemein nach ihren Plänen erkundigt, und sie sagten, sie wollten eine Woche lang hierbleiben und Touren in die Umgebung machen; aber gegen Ende der Unterhaltung, als ich sagte, daß du und ich uns mit Vergnügen an ihren Ausflügen beteiligen würden, und anbot, dich herüberzuholen und vorzustellen, zögerten sie ein bißchen und fragten, ob du aus demselben Hause stammst wie ich. Ich sagte ja, da meinten sie, sie hätten es sich anders überlegt und hielten es für erforderlich, sofort aufzubrechen und eine kranke Verwandte in Sibirien zu besuchen.«
»O Gott, das ist der Gipfel! Du hast den höchsten Gipfel der Dummheit erreicht, den menschliche Bemühungen jemals erklommen haben. Wenn du vor mir stirbst, sollst du ein Grabmal aus Eselsköpfen bekommen, so hoch wie das Straßburger Münster. Sie wollten wissen, ob ich aus demselben ›Hause‹ stamme wie du, wie? Was haben sie wohl mit ›Haus‹ gemeint?«
»Ich weiß nicht; es ist mir gar nicht eingefallen, danach zu fragen.«
»Na, ich weiß es. Sie meinten eine Anstalt – eine Irrenanstalt, verstehst du? Also denken sie doch, wir wären vom selben Kaliber. Sag mal, was hältst du nun eigentlich von dir?«
»Na, ich weiß nicht. Ich habe nicht gedacht, daß ich etwas Schlimmes anrichte; ich habe nichts Böses gewollt. Es waren sehr nette Leute, und sie sahen mich anscheinend gern.«
Harris ließ einige grobe Bemerkungen fallen und ging in sein Schlafzimmer – um ein paar Möbel zu zerschlagen, sagte er. Er war ungewöhnlich reizbar; jede Kleinigkeit verdarb ihm die Laune.
Die junge Frau hatte mich gründlich schmoren lassen, aber egal, ich habe es an Harris ausgelassen. Man sollte stets irgendwie quitt werden, sonst schmerzt die wunde Stelle immer weiter.
Zweites Kapitel
Wirtschaftsleben Luzerns · Vorteile des Martyriums · Ein bißchen Geschichte · Die Heimat der Kuckucksuhren · Eine befriedigende Rache · Der Mann, der bei Gadsby abstieg · Eine vergessene Geschichte · Wollte Postmeister werden · Ein Mann aus Tennessee in Washington · Er beschloß, eine Weile zu bleiben · Moral der Geschichte
Die Hofkirche ist wegen ihrer Orgelkonzerte berühmt. Den ganzen Sommer lang strömen die Touristen gegen sechs Uhr abends in diese Kirche, bezahlen ihren Franken und lauschen dem Lärm. Sie bleiben nicht, um alles zu hören, sondern stehen auf und trampeln über den hallenden Steinfußboden hinaus, wobei sie Zuspätkommenden begegnen, die geräuschvoll hereinpoltern. Dieses Hin- und Hergetrampel dauert fast die ganze Zeit über an und wird durch das ständige Türenschlagen und das Husten, Bellen und Niesen der Menge noch unterstrichen. Unterdessen tost und kracht und donnert die große Orgel dahin und tut, was sie nur kann, um zu beweisen, daß sie die größte und lauteste Orgel Europas ist, und daß eine kleine enge Kiste von Kirche der günstigste Ort ist, um ihre Gewalt abschätzen und würdigen zu können. Es ist wahr, daß gelegentlich leise und barmherzige Stellen vorkamen, aber das Trapptrapp der Touristen gestattete nur dann und wann gewissermaßen einen flüchtigen Blick davon zu erhaschen. Dann ließ der Organist gleich wieder eine neue Lawine los.
Das Wirtschaftsleben Luzerns besteht hauptsächlich aus dem Andenkentrödelmarkt; die Läden sind vollgestopft mit Bergkristallen, Landschaftsphotographien und Holz- und Elfenbeinschnitzereien. Ich möchte die Tatsache nicht verhehlen, daß es dort kleine Reproduktionen des Löwen von Luzern zu kaufen gibt. Millionen davon. Aber jede einzelne stellt einen Hohn auf ihn dar. Das majestätische Pathos des Originals besitzt ein gewisses Etwas, das der Kopist nicht herausbekommt. Sogar der Sonne gelingt das nicht; sowohl der Photograph als auch der Bildschnitzer liefern einen sterbenden Löwen und weiter nichts. Die Form stimmt, die Haltung stimmt, die Proportionen stimmen, aber jenes unbeschreibliche Etwas fehlt, das aus dem Löwen von Luzern das trauervollste und ergreifendste Stück Stein der Welt macht.
Der Löwe liegt auf seinem Lager in der senkrechten Stirnwand eines niedrigen Felsens – denn er ist aus dem gewachsenen Felsen der Steilwand gemeißelt. Er hat kolossale Größe, eine edle Haltung. Sein Haupt ist gesenkt, der abgebrochene Speer steckt ihm in der Schulter, seine schützende Pranke ruht auf den bourbonischen Lilien. Ranken hängen an dem Felsen herab und wehen im Winde, von oben tröpfelt ein klarer Wasserlauf in einen Teich am Fuße der Klippe, und in der glatten Fläche des Teiches spiegelt sich der Löwe zwischen den Seerosen wider.
Grüne Bäume und Gras rings umher. Es ist ein geschützter, stiller Waldwinkel, fern allem Lärm, Betrieb und Wirrwarr – und das stimmt alles, denn Löwen sterben wirklich an solchen Stellen und nicht auf Granitsockeln öffentlicher Plätze, eingeschlossen zwischen bizarren Eisengeländern. Der Löwe von Luzern würde überall Eindruck machen, aber nirgends so viel wie dort, wo er ist.
Das günstigste Geschick, das manche Leute treffen kann, ist das Martyrium. Ludwig XVI. ist nicht im Bett gestorben, deshalb geht die Geschichte sehr glimpflich mit ihm um; sie ist seinen Schwächen gegenüber nachsichtig und findet hohe Tugenden an ihm, die man gewöhnlich nicht als Tugenden ansieht, wenn sie in Königen stecken. Sie stellt ihn als Menschen mit sanftmütigem, bescheidenem Sinn, mit dem Herzen eines Heiligen und mit verdrehtem Kopf dar. Keine dieser Eigenschaften, außer der letzteren, ist königlich. Zusammengenommen ergeben sie einen Charakter, dem es unter den Händen der Geschichte schlecht ergangen wäre, wenn sein Eigentümer das Pech gehabt hätte, dem Martyrium zu entgehen. Mit der besten Absicht, das Richtige zu tun, erreichte er stets das Falsche. Außerdem konnte ihm nichts das Heilige austreiben. Er wußte ganz gut, daß er bei einem nationalen Notstand nicht überlegen durfte, wie er als Mensch handeln sollte, sondern nur, wie er als König zu handeln hätte, und so versuchte er ehrlich, den Menschen zu unterdrücken und König zu sein – aber das ging daneben; es gelang ihm nur, der Heilige zu sein. Er handelte nicht zur rechten Zeit, sondern zur Unzeit. Er war nicht zu überzeugen, etwas zu tun, solange es nützen konnte – da war er eisern, war er steinhart in seiner Dickköpfigkeit –, aber sobald die Angelegenheit einen Punkt erreicht hatte, wo es unbedingt schädlich sein mußte, das zu tun, gerade dann tat er es, und nichts konnte ihn aufhalten. Er tat es nicht, weil es schädlich sein würde, sondern weil er hoffte, es wäre noch nicht zu spät, das Gute zu erreichen, das es bewirkt hätte, wenn es früher geschehen wäre. Sein Begriffsvermögen hinkte immer um einen oder zwei Züge hinterher. Wenn ein nationaler Zeh amputiert werden mußte, konnte er nicht einsehen, daß er mehr als ein Zugpflaster brauchte; wenn andere sahen, daß der kalte Brand das Knie erreicht hatte, entdeckte er zum erstenmal, daß man den Zeh abschneiden müßte – also schnitt er ihn ab; und er sägte das Bein am Knie ab, wenn andere sahen, daß das Leiden die Hüfte erreicht hatte. Er war gut und aufrichtig und hatte bei der Jagd auf nationale Krankheiten die besten Absichten, aber nie konnte er eine überholen. Als Privatmann wäre er liebenswert gewesen; aber betrachtet man ihn als König, war er unbedingt zu verachten.
Seine Laufbahn war höchst unköniglich, aber das erbärmlichste Schauspiel bot der sentimentale Verrat gegenüber seiner Schweizergarde an jenem denkwürdigen 10. August, als er zuließ, daß diese Helden für seine Sache niedergemetzelt wurden, und ihnen verbot, das »heilige französische Blut« zu vergießen, das angeblich in den Adern des rotbemützten Haufens von Lumpen floß, die in dem Palast wüteten. Er meinte, königlich zu handeln, aber er war nur wieder einmal der Heilige. Einige seiner Biographen glauben, daß bei diesem Anlaß der Geist des heiligen Ludwig auf ihn herabgekommen sei. Er muß ein ziemlich enges Logis vorgefunden haben. Hätte Napoleon I. an jenem Tage in den Schuhen Ludwigs XVI. gestanden, statt nur ein zufälliger und unbekannter Zuschauer zu sein, gäbe es jetzt keinen Löwen von Luzern, sondern in Paris einen wohlgefüllten Kommunardenfriedhof, der genau so geeignet wäre, an den 10. August zu erinnern.
Vor dreihundert Jahren machte das Martyrium aus Maria Stuart eine Heilige, und sie hat kaum ihren ganzen Heiligenschein verloren. Das Martyrium machte aus der unbedeutenden und törichten Marie-Antoinette eine Heilige, und ihre Biographen haben ihr bis zum heutigen Tage den Geruch der Heiligkeit bewahrt; dabei beweisen sie unbewußt auf fast jeder Seite, die sie schreiben, daß sie den einzigen unglückseligen Instinkt besaß, der ihrem Manne abging – den Instinkt, ehrliche, fähige und treue Beamte auszuroden und abzuschieben, wo immer sie welche fand. Die scheußliche, aber wohltätige Französische Revolution wäre aufgeschoben oder nicht vollendet worden oder hätte womöglich überhaupt nicht stattgefunden, wenn Marie-Antoinette nicht den unklugen Fehler begangen hätte, geboren zu werden. Die Welt verdankt der Französischen Revolution eine ganze Menge und folglich auch ihren bedeutendsten Förderern, Ludwig dem Armen im Geiste und seiner Königin.
Wir haben keine hölzernen Nachbildungen des Löwen gekauft, auch keine aus Elfenbein, Ebenholz, Marmor, Kreide, Zucker oder Schokolade, nicht einmal photographische Verleumdungen des Löwen. Tatsächlich waren diese Kopien in den Läden und überall so allgemein verbreitet, daß sie dem ermüdeten Auge bald so unerträglich wurden wie gewöhnlich der neueste Schlager dem gemarterten Ohr. In Luzern begannen uns auch bald Holzschnitzereien anderer Art zu ermüden, die so nett ausgesehen hatten, wenn man sie gelegentlich zu Hause zu Gesicht bekam. Wir hatten es bald reichlich satt, Wachteln und Hühner aus Holz um Zifferblätter herumpicken und -stolzieren zu sehen, und noch viel satter bekamen wir hölzerne Darstellungen der angeblichen Gemse, wie sie auf hölzernen Felsen herumhüpft, in Familiengruppen auf ihnen liegt oder wachsam hinter ihnen hervorlugt. Am ersten Tag hätte ich hundertfünfzig solcher Uhren gekauft, wenn ich das Geld gehabt hätte – und drei habe ich gekauft –, aber am dritten Tag war die Krankheit überstanden, ich war genesen und erneut auf dem Markt – und versuchte zu verkaufen. Aber ich hatte kein Glück; das war auch nicht schlimm, denn zweifellos werden die Sachen, wenn ich sie nach Hause bringe, wieder ganz nett wirken.
Jahrelang hatte meine eifrigste Abscheu der Kuckucksuhr gegolten; nun befand ich mich hier zu guter Letzt mitten in der Heimat dieses Geschöpfes; und so lag mir immer, wohin ich mich auch wandte, dieses zermürbende »Huhu! Huhu! Huhu!« in den Ohren. Ein schöner Zustand für einen nervösen Menschen. Manche Töne sind abstoßender als andere, aber kein Ton ist so unsinnig, albern und unangenehm wie das »Huhu« der Kuckucksuhr, meine ich. Ich habe eine gekauft und nehme sie für eine gewisse Person mit nach Hause; denn ich habe immer gesagt, daß ich diesem Manne eins auswischen würde, wenn sich je die Gelegenheit dazu ergeben sollte. Ich hatte zwar gemeint, daß ich ihm ein Bein brechen würde, oder etwas in dieser Art; aber in Luzern erkannte ich sofort, daß ich seinen Geist zerrütten könnte. Das wäre dauerhafter und in jeder Beziehung befriedigender. Also kaufte ich die Kuckucksuhr; und wenn ich jemals damit nach Hause komme, ist er »geliefert«, wie man in den Silbergruben sagt. Ich dachte an einen weiteren Kandidaten – einen Literaturkritiker, den ich nennen könnte, wenn ich wollte –, aber nachdem ich es mir überlegt hatte, kaufte ich ihm doch keine Uhr. Seinem Geiste könnte ich keinen Schaden mehr zufügen.
Wir sahen uns die beiden langen, überdachten Holzbrücken an, welche die grüne, glitzernde Reuß kurz unterhalb der Stelle überspannen, wo sie tollend und jauchzend dem See entströmt. Diese schrägverlaufenden, schwankenden Tunnel mit ihren überdachten Ausblicken auf das liebliche, gemütserfrischende Wasser sind ganz reizend. Sie enthalten zwei- oder dreihundert wunderliche alte Bilder von alten schweizerischen Meistern, die vor dem Niedergang der Malerei wirkten.
Der See wimmelt von Fischen, die für das Auge deutlich sichtbar sind, denn das Wasser ist sehr klar. Die Geländer vor den Hotels säumten gewöhnlich Angler aller Altersstufen. Eines Tages wollte ich stehenbleiben und zusehen, wie ein Fisch anbeißt. Das Ergebnis erinnerte mich sehr an einen Vorfall, an den ich seit zwölf Jahren nicht mehr gedacht hatte, und zwar an folgenden:
Als mein sonderbarer Freund Riley und ich im Winter 1867 Pressekorrespondenten in Washington waren, gingen wir eines Abends gegen Mitternacht im jagenden Schneesturm die Pennsylvania Avenue hinunter, als der Lichtstrahl einer Straßenlaterne auf einen Mann fiel, der hastig in entgegengesetzter Richtung dahineilte. Dieser Mann hielt sogleich an und rief:
»Habe ich ein Glück! Sie sind Mr. Riley, nicht wahr?«
Riley war der beherrschteste und bedächtigste Mann der Republik. Er hielt an, besichtigte seinen Mann von Kopf bis Fuß und sagte endlich: »Ich bin Mr. Riley. Haben Sie zufällig nach mir gesucht?«
»Genau das«, rief der Mann freudig, »und es ist der glücklichste Zufall der Welt, daß ich Sie gefunden habe. Mein Name ist Lykins. Ich bin Lehrer an der Oberschule von San Francisco. Sobald ich hörte, daß die Stelle des Postmeisters in San Francisco vakant sei, habe ich mich entschlossen, sie zu bekommen – und hier bin ich.«
»Ja«, sagte Riley langsam, »wie Sie soeben bemerkten … Mr. Lykins … hier sind Sie. Und haben Sie sie bekommen?«
»Na, nicht direkt bekommen, aber ich bin drauf und dran. Ich habe ein Gesuch mitgebracht, vom Volksbildungsinspektor und von allen Lehrern und mehr als zweihundert anderen Leuten unterschrieben. Ich möchte Sie nun bitten, so freundlich zu sein und mit mir zu der Abgeordnetengruppe der Pazifikstaaten hinüberzugehen; denn ich möchte diese Sache rasch durchschleusen und wieder nach Hause kommen.«
»Wenn die Sache so dringend ist, werden Sie wohl wünschen, daß wir die Pazifikabgeordneten heute abend noch aufsuchen«, sagte Riley mit einer Stimme, die keinen Spott enthielt – für ein nicht daran gewöhntes Ohr.
»Oh, heute abend, gewiß doch! Ich habe keine Zeit, herumzutrödeln. Ich möchte ihre Zusage haben, bevor ich schlafen gehe – ich bin kein Mann von Worten, sondern von Taten!«
»Ja … dazu sind Sie an die richtige Stelle gekommen. Wann sind Sie eingetroffen?«
»Genau vor einer Stunde.«
»Wann wollen Sie abfahren?«
»Nach New York morgen abend – nach San Francisco am nächsten Morgen.«
»Aha … Was wollen Sie morgen tun?«
»Tun! Na, ich muß mit dem Gesuch und der Abordnung zum Präsidenten gehen und mich ernennen lassen, nicht?«
»Ja … sehr richtig … das stimmt. Und dann?«
»Beschlußfassung des Senats um zwei Uhr nachmittags – ich muß die Ernennung bestätigt bekommen – das ist doch richtig, nehme ich an?«
»Ja … ja«, sagte Riley nachdenklich. »Sie haben wieder recht. Dann nehmen Sie abends den Zug nach New York und am nächsten Morgen den Dampfer nach San Francisco?«
»Genau – so stelle ich es mir vor.«
Riley überlegte eine Weile, dann sagte er: »Sie können wohl nicht einen Tag … na, sagen wir … zwei Tage länger bleiben?«
»Herrje, nein! Das ist nicht meine Art. Ich bin nicht der Mann dazu, herumzutrödeln – ich sagte doch, ich bin ein Mann von Taten.«
Der Sturm tobte, der dichte Schnee trieb in Schwaden daher, Riley stand schweigend, offenbar tief in Nachsinnen versunken, eine Minute oder länger da, dann blickte er auf und sagte: »Haben Sie jemals von dem Manne gehört, der einmal bei Gadsby abgestiegen ist? Aber ich sehe schon, Sie haben nichts davon gehört.«
Er drängte Mr. Lykins mit dem Rücken gegen ein Eisengitter, ergriff ihn am Knopfloch, hielt ihn wie der »Alte Seefahrer« mit dem Blick fest und ging daran, so heiter und gelassen seine Geschichte zu erzählen, als lägen wir alle gemütlich auf einer blühenden Sommerwiese ausgestreckt, statt von einem nächtlichen Schneesturm bedrängt zu werden:
»Ich werde Ihnen von diesem Manne erzählen. Es war zu Jacksons Zeit. Gadsbys Hotel war damals das beste. Na, dieser Mann kam eines Morgens gegen neun Uhr aus Tennessee an, mit einem schwarzen Kutscher, einem prächtigen, vierspännigen Wagen und einem eleganten Hund, den er offensichtlich gern hatte und auf den er stolz war; er fuhr bei Gadsby vor, und der Empfangschef, der Wirt und jedermann kamen herausgestürzt, um sich seiner anzunehmen; aber er sagte: ›Laßt nur‹, sprang heraus und befahl dem Kutscher, zu warten – sagte, er habe keine Zeit, irgendwas zu essen, er habe nur eine kleine Forderung von der Regierung einzutreiben, wolle über die Straße zum Schatzamt laufen und das Geld holen, und dann sofort nach Tennessee zurückfahren, denn er habe es mächtig eilig.
Na, gegen elf Uhr abends kam er zurück und bestellte ein Bett und ließ die Pferde ausspannen – sagte, er wolle die Forderung am Morgen eintreiben. Das war im Januar, wissen Sie, Januar 1834, am 3. Januar, Mittwoch.
Na, am 5. Februar verkaufte er die vornehme Kutsche und kaufte eine billige aus zweiter Hand – sagte, diese tauge genau so gut dazu, das Geld nach Hause zu fahren, und auf Eleganz käme es ihm nicht an.
Am 11. August verkaufte er ein Paar der schönen Pferde – sagte, er habe oft gedacht, ein Paar sei besser als vier, um über die rauhen Bergstraßen zu kommen, wo man vorsichtig fahren müsse, und so viel habe er nicht zu fordern, daß er das Geld nicht ganz leicht mit einem Zweigespann nach Hause ziehen könnte.
Am 13. Dezember verkaufte er noch ein Pferd – sagte, zwei seien nicht nötig, um dieses alte, leichte Gefährt zu ziehen, tatsächlich bringe es eines schneller vom Fleck, als unbedingt nötig sei, wo jetzt gutes, solides Winterwetter herrsche und sich die Straßen in großartigem Zustand befänden.
Am 17. Februar 1835 verkaufte er die alte Kutsche und kaufte einen billigen, leichten Einspänner aus zweiter Hand – sagte, der Einspänner sei genau das Richtige, um auf schlammigen, matschigen Vorfrühlingsstraßen dahinzufliegen, und er habe sowieso schon immer gewünscht, auf diesen Bergstraßen einen Einspänner auszuprobieren.
Am 1. August verkaufte er den Einspänner und kaufte die Überreste eines alten Sulkys – sagte, er wolle nur mal diese grünen Tennesseeleute starren und glotzen sehen, wenn sie ihn auf einem Sulky angesaust kommen sähen – er glaube nicht, daß sie in ihrem ganzen Leben schon von einem Sulky gehört hätten.
Na, am 29. August verkaufte er seinen farbigen Kutscher – sagte, er brauche für einen Sulky keinen Kutscher – wäre sowieso nicht genug Platz für zwei darin –, und außerdem sende einem das Schicksal nicht jeden Tag einen Trottel, der neunhundert Dollar für so einen drittklassigen Neger zu zahlen bereit wäre – habe schon seit Jahren die Kreatur los sein wollen, wollte ihn aber auch nicht verschleudern.
Achtzehn Monate später – das heißt, am 15. Februar 1837