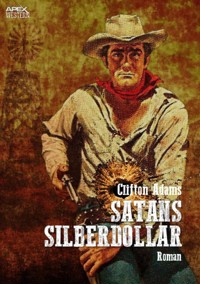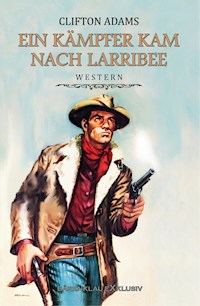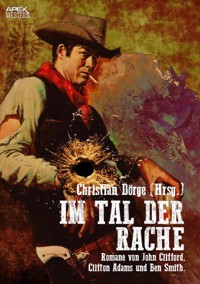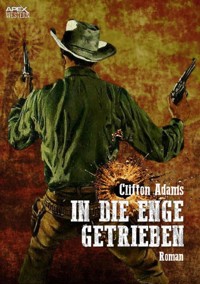
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sie John Salem vom Galgenbaum schnitten, fanden sie einen Brief in seiner Tasche. Keiner von ihnen würde die Unterschrift je vergessen: »Dein Bruder, Jute McCoy.« Denn sie alle hatten schon von McCoy gehört, einem der schnellsten Revolverhelden im Westen, so gefährlich und so tückisch wie eine Klapperschlange. Und er würde kommen, um den Tod seiner Bruders zu rächen.
Angst packte die Stadt und ihre Einwohner, denn jeder Fremde konnte McCoy sein. Jeden Tag konnte er nach Menloe kommen und die Schuldigen erbarmungslos zur Rechenschaft ziehen.
Und schließlich kam der Fremde. Er nannte sich Tom Kelso. War es sein richtiger Name, oder handelte es sich bei ihm um McCoy, der seinen Bruder rächen wollte?
Clifton Adams (01. Dezember 1919 – 07. Oktober 1971) war ein US-amerikanischer Western-Autor. Der Roman In die Enge getrieben erschien erstmals im Jahre 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1966.
In die Enge getrieben erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX WESTERN.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CLIFTON ADAMS
In die Enge getrieben
Roman
Apex Western, Band 46
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
IN DIE ENGE GETRIEBEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Das Buch
Als sie John Salem vom Galgenbaum schnitten, fanden sie einen Brief in seiner Tasche. Keiner von ihnen würde die Unterschrift je vergessen: »Dein Bruder, Jute McCoy.« Denn sie alle hatten schon von McCoy gehört, einem der schnellsten Revolverhelden im Westen, so gefährlich und so tückisch wie eine Klapperschlange. Und er würde kommen, um den Tod seiner Bruders zu rächen.
Angst packte die Stadt und ihre Einwohner, denn jeder Fremde konnte McCoy sein. Jeden Tag konnte er nach Menloe kommen und die Schuldigen erbarmungslos zur Rechenschaft ziehen.
Und schließlich kam der Fremde. Er nannte sich Tom Kelso. War es sein richtiger Name, oder handelte es sich bei ihm um McCoy, der seinen Bruder rächen wollte?
Clifton Adams (01. Dezember 1919 – 07. Oktober 1971) war ein US-amerikanischer Western-Autor. Der Roman In die Enge getrieben erschien erstmals im Jahre 1960; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1966.
In die Enge getrieben erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe APEX WESTERN.
IN DIE ENGE GETRIEBEN
Erstes Kapitel
Als Sheriff Ben McDermit am Nachmittag nach Menloe zurückkam, brodelte es in der Stadt. Zwei Stunden zuvor hatte das Aufgebot die Stadt verlassen. Seit zwei Stunden machte es Jagd auf John Salem. Die Schießerei hatte in der Frontier Bar stattgefunden. Herb Brawley, der Barbesitzer, stand vor der Tür, als McDermit aus dem Sattel glitt.
»Schätze, du hast es schon gehört«, begrüßte er den Sheriff.
Ben nickte kurz. »Habe einen Reiter von der K-Bar auf dem Weg zu Mayhews Ranch getroffen«, erklärte er. »Wie lange ist das Aufgebot schon fort?«
Der Saloonbesitzer schaute auf die Uhr. »Zwei Stunden. Vielleicht ein bisschen länger.« Er räusperte sich. »Willst du dir Ed Ferguson anschauen?«
Ben zögerte. Dann nickte er. Er folgte Brawley in den rückwärtigen Teil des Saloons. Mehrere Sekunden schaute er auf Ferguson herab. Der Tote war bereits steif. Mitte Vierzig, überlegte der Sheriff, gesund, stark. Schmied war Ed Ferguson gewesen, laut und rau, aber beliebt. Er hatte viele Freunde in Menloe gehabt. Immer erwischte es die, die allgemein beliebt waren, dachte der Sheriff bitter.
»Mord«, hörte er Brawley sagen. »Glatter Mord. Ich habe diesem Burschen nie getraut. Von dem Tag an, an dem er in Menloe auf tauchte.«
Was geschehen war, schien sonnenklar. Der Junge, der sich John Salem nannte, hatte Ed Ferguson vor zwanzig Zeugen erschossen. Und dann war er auf Jake Wilsons Lieblingspferd geflüchtet. Eines stand außer Zweifel: John Salem war schuldig.
Aber darum ging es gar nicht.
McDermit sagte sich, dass es die Schwierigkeiten nicht
hätte geben müssen. Wenigstens zum Teil nicht. Wenn er nur in der Stadt gewesen wäre. Oder wenn Salem ein anderes Pferd gestohlen hätte. Und nicht ausgerechnet das von Jake Wilson. Aber es hatte wieder einmal so kommen müssen. So und nicht anders. Er hatte wegen ein paar Kälbern unterwegs sein müssen. Ein paar Kälbern, die angeblich auf der Mayhew-Ranch gestohlen worden waren. Und das Pferd hatte genau dort stehen müssen, wo der Junge es nicht übersehen konnte. Kleinigkeiten. Aber manchmal bestimmten sie das Schicksal.
Ben sah auf. »Welche Richtung hat das Aufgebot eingeschlagen?«
Brawley zuckte die Achseln. »Die Männer sind nach Norden geritten. In dieser Richtung machte sich Salem aus dem Staub.«
»Ist mein Deputy dabei?«
Der Saloonbesitzer nickte.
Nun, dachte Ben, das könnte helfen. Aber er glaubte nicht daran. Er wusste zu gut, was ein Lynchmob tat, wenn er wütend war.
»Mord«, hörte er Brawley nochmals sagen.
Ben trat aus dem Saloon. Sein Fuchs war schweißbedeckt. Er ritt ihn zum Corral des Mietstalls, sattelte ihn ab und warf den Sattel einem Hellbraunen über. Als er den Gurt festzog, kam o-beinig Pop Finney, der alte, vertrocknete Mietstallbesitzer, hinzu.
»Haben Sie vor, sich an dem Spaß zu beteiligen, Sheriff?«
Bens Augen richteten sich auf den Alten. Sie waren glasklar und steinhart. »Was für einem Spaß?«, erkundigte er sich.
»Na, dem Lynchen«, krächzte der Alte. »Schätze, sie werden den Burschen inzwischen schon aufgehängt haben.«
Der Mietstallbesitzer redete noch weiter. Ben McDermit hörte es nicht. Sein Kinn unter zusammengebissenen Zähnen war eckig geworden. Die Muskeln seiner Schultern spannten sich und traten deutlich hervor. Er schwang sich in den Sattel und gab dem Hellbraunen die Sporen. Im Galopp fegte er davon.
Er versuchte, klar zu denken. Das Wichtigste, so sagte er sich immer wieder, war es, der Fährte des Aufgebots zu folgen und so schnell wie möglich voranzukommen. Gedanken an den Jungen, an den Mord musste er von sich schieben. Ärger, Zorn durften ihm den klaren Blick nicht nehmen. Denn er hatte eine Aufgabe, die wichtiger war als alles andere. Er musste die vor Wut halb verrückten Bürger von Menloe einholen, bevor sie das Gesetz in die eigenen Hände nahmen. Bevor sie etwas taten, was nie wieder ungeschehen gemacht werden konnte.
Die Fährte der zwanzig Pferde war nicht schwer zu halten.
Für Sheriff McDermit war es eine Kleinigkeit. Und seine Gedanken wanderten. Sie wanderten zurück zu dem Tag, an dem er John Salem zum ersten Mal gesehen hatte.
Etwas länger als einen Monat war das her. Mit einem herumziehenden Händler war der Junge in die Stadt gekommen. Er hatte hinten auf dem Planwagen gesessen. Und er war geblieben. Warum, das wusste keiner.
John Salem mochte zwanzig oder einundzwanzig sein. Er war groß und stark. Seine Augen waren wasserblau und wirkten starr. Denn wenn Salem einen ansah, dann blinzelte er nicht ein einziges Mal. Sein Haar war blond und zottig. Es hing ihm bis über den schmutzigen Hemdkragen. Er trug einen Overall und Stiefel, wie die Neusiedler sie trugen. Schwer und mit Sohlen, die dicker waren als ein Daumen. Um die Hüften aber hatte er einen alten Tucker-Sherrod Colt geschnallt. Und das wirkte bei ihm eher komisch als gefährlich.
McDermit konnte sich nicht erinnern, mehr als ein Dutzend Worte aus dem Mund des Jungen gehört zu haben. Salem lungerte gern im Frontier Saloon herum, sah den anderen beim Kartenspielen zu, lauschte auf die Gespräche, aber sagte selbst kein Wort. Sein Geld verdiente er sich mit Gelegenheitsarbeiten. Meistens machte er den Stallburschen im Mietstall. Und es dauerte nicht lange, da waren alle in Menloe überzeugt, dass John Salem ein wenig beschränkt sei. Viele hielten ihn kurzerhand für einen Idioten.
Und dabei fiel McDermit auch ein, wer den Jungen als erster dummer John gerufen hatte. Ed Ferguson, der Schmied. Ed Ferguson, der jetzt hinten in Herb Brawleys Saloon lag. Tot.
Zweites Kapitel
Das Aufgebot verfolgte die Spur des Jungen bis zum Little Creek. Dort führte sie ins Wasser. Salem hatte das Bachbett genutzt, war entweder stromauf oder stromab geritten. Zwanzig Augenpaare starrten wütend auf den Bachgrund. Er war kiesig und verriet ihnen nichts.
Deputy Sheriff Jess Webb schob den Hut ins Genick. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Schätze, wir können ruhig zum anderen Ufer hinüberreiten«, meinte er. »Früher oder später reitet er bestimmt einen Bogen und wendet sich nach Süden.«
Jake Wilson warf dem Deputy ärgerlich einen Blick zu. »Und wie, bitte, kommen Sie auf die Idee, dass er nach Süden reiten wird?«
Webb, ein ehemaliger Cowboy, wettergegerbt und hager, zuckte die Achseln. »Ich an seiner Stelle tät's. Ich würde versuchen, ins Niemandsland zu kommen.«
»Ja, aber Sie sind nicht der dumme John«, fuhr ihn Wilson an. »Was so ein Narr tut, kann keiner vorausahnen.«
Jake Wilson war Mitte Vierzig und wirkte vierschrötig. Im Sattel saß er wie ein Mehlsack. Sein Gesicht aber verriet seine Wut. Er dachte an seinen Morgan, ein wertvolles Zuchttier, das der Junge gestohlen hatte. Und er schwor bei sich, wenn dem Pferd etwas passierte, dann wollte er den Burschen umbringen. Mit bloßen Händen!
Woody Pollard und sein Bruder Vern ritten an die Seite des Deputys. »Jake hat recht«, sagte Woody. »Man kann nie wissen, was so ein Idiot wie der dumme John tut. Schätze, wir sollten Gruppen bilden. Vier, fünf Gruppen. Und die Bachufer in beiden Richtungen hin absuchen. Sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir die Stelle nicht finden, wo er wieder aus dem Wasser herausgekommen ist.«
Webb zuckte die Achseln. Er wünschte sich nur eins. Nämlich, dass Ben McDermit da wäre und ihm sagte, was er tun sollte. Die Pollards waren Hitzköpfe, das wusste jeder. Auf die war kein Verlass. Und Jake Wilson? Der dachte doch an nichts anderes als an seinen Morgan, den John gestohlen hatte. Die ganze Geschichte mit dem Aufgebot gefiel Webb immer weniger. Von Minute zu Minute.
Der Deputy richtete sich in den Steigbügeln auf. Er besah sich die Gesichter. Eins nach dem anderen. War denn keiner unter den Männern, auf den er sich verlassen könnte, wenn's hart auf hart ging? Plötzlich atmete er erleichtert auf. Frank Maynard kam auf ihn zugeritten. Frank war Bankier. Er genoss allgemein Achtung. Die Männer in Menloe fragten ihn um Rat, wenn es Wichtiges zu entscheiden gab. Entscheidender noch! Sie taten, was er ihnen riet.
»Frank, was halten Sie davon?«, wandte sich Webb an ihn.
Maynard wiegte den Kopf und rieb sich nachdenklich das Kinn. Er war grauhaarig, trug einen dunklen Anzug aus teurem Tuch und ein weißes Hemd. Fest sah er die Männer an. Und Webb hatte das Gefühl, sie würden auch diesmal tun, wozu Frank Maynard riet.
»Nun, Jess«, sagte der Bankier nach einer Pause, »vielleicht hat Woody recht. Es könnte ja sein, dass Salem gar nicht auf die andere Seite des Baches geritten ist. Dass er einen Haken geschlagen hat und hofft, wir würden seine Spur verlieren.«
Jake Wilson lachte rau. »Sie trauen dem dummen John aber mächtig viel Verstand zu!«
Frank Maynard ignorierte die Unterbrechung. »Ich will nicht behaupten, dass ich etwas vom Fährtenlesen verstehe. Aber ich halte es für eine gute Idee, wenn wir vier Gruppen bilden, fünf Mann je Gruppe, und die Ufer in beiden Richtungen absuchen.«
Webb nickte. »Klingt vernünftig.«
»Klingt blödsinnig!«, grollte Wilson. »Ein Idiot wie John Salem läuft in gerader Richtung, bis er nicht mehr laufen kann.«
Der Deputy drehte sich im Sattel um. Er sah Jake Wilson an. Hart und unbeugsam. »Wir machen es, wie Frank vorgeschlagen hat. Wir bilden vier Gruppen. Jake, Sie und Frank und die beiden Pollards durchqueren den Bach und reiten stromauf. Ich folge euch, sobald ich die anderen eingeteilt habe.«
Jetzt, nachdem einer ihm gesagt hatte, was er tun sollte, handelte Webb schnell und zielstrebig. Er teilte die anderen in drei Gruppen und schickte sie los. Dann durchquerte er den Bach und ritt Maynard, Wilson und den Pollards nach.
»Ich halte das immer noch für Blödsinn«, empfing ihn Wilson.
Der Deputy zügelte sein Pferd. »Jake, hier hält Sie niemand, falls Sie lieber in die Stadt zurückreiten wollen«, sagte er kalt.
Jakes Nacken wurde brandrot. Aber er lächelte nur dünn. »Darauf können Sie lange warten, Jess! Wie diese Geschichte zu Ende gebracht wird, das will ich miterleben.«
»Zum Teufel mit der Rederei!«, mischte sich Vern Pollard ein. »Während wir hier sitzen und quatschen, reitet der dumme John in aller Gemütsruhe bis zum Cimarron.«
Insgeheim verfluchte Webb den Schmied. Warum hatte Ed Ferguson den dummen John so lange ärgern müssen, bis dieser ihn umbrachte? Und warum war ausgerechnet an diesem Nachmittag Ben McDermit aus der Stadt geritten? Oberhaupt, der Sheriff hätte diesen verdammten dummen John aus Menloe jagen sollen. Gleich damals, bevor etwas passierte!
Jess seufzte und spuckte aus. Er wusste genau, was für ein Ende diese Jagd nehmen würde. Zwanzig Mann, wütend, mit Lassos an den Sattelhörnern! John Salem konnte ihnen nicht entkommen!
Langsam ritten sie den Bach hinauf. Sie beugten sich weit aus den Sätteln, studierten den Boden. Woody Pollard, breit, vierschrötig und Anfang der Dreißig, warf seinem jüngeren Bruder einen Blick zu. Er grinste.
»Ich hab' so ein Gefühl, Junge!«
Vern, einen Zoll größer, aber nicht so schwer wie Woody, nickte. Seine Mundwinkel zogen sich noch weiter herab. »Ich auch!«
Woody Pollard schlug ans Lasso. Dann lachte er laut.
»Komm nur nicht auf falsche Gedanken!«, sagte Frank. Er sprach ruhig und kühl, als ob er einen Kunden in seiner Bank vor sich hätte. »Wir haben ein Gericht in Menloe. Und die Geschworenen werden entscheiden, was mit John Salem zu geschehen hat!«
»Klar«, grinste Vern. »Klar! Machen Sie sich nur ja keine Sorgen, Frank!«
»Haltet lieber die Augen offen«, brummte Jake Wilson. »Wenn wir ihn erst einmal haben, werden wir schon sehen, was mit ihm geschieht.«
Eine Weile ritten sie schweigend. Kein Blatt, kein trockener Ast, der auf dem Boden lag, entging ihnen. Hatte ein Pferdehuf ihn aus seiner ursprünglichen Lage gebracht? War der Bruch dort frisch, die Blätter von einem Steigbügel abgerissen?
Auch Frank Maynard suchte den Boden ab. Doch er verstand nichts vom Fährtenlesen. Er sah nichts. Dafür verstand er etwas von der Psyche der Männer. Er wusste nur zu gut, was sie dachten. Und das bereitete ihm Sorgen. Denn Frank Maynard war für Gerechtigkeit. Er hatte etwas gegen Lynchjustiz. Er wusste, sie mussten John Salem fangen. Sie mussten ihn vor Gericht stellen. Und die Geschworenen würden ihn wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Gut, dann würde er eben gehängt. Dann würde er sterben, weil das Gesetz es so wollte, und alles war in Ordnung. Die Worte Gesetz und Ordnung wurden in Frank Maynards Lebensphilosophie großgeschrieben. Er hatte Weidekriege miterlebt. In Kansas. Er hatte mit angesehen, was geschah, wenn die Männer das Gesetz in die Hand nahmen. Er hatte Städte sterben sehen. Und Banken mit ihnen.
Ich bin alt, dachte Frank Maynard. Sechsundfünfzig – das war alt in diesem Land. Zu alt, um noch einmal von vorne anzufangen. Er warf Jess Webb einen Blick zu, las die Sorge und Hilflosigkeit aus dessen Gesicht und schüttelte den Kopf. Das Gesetz bedeutete nicht viel in diesem Südostwinkel von Colorado. Die öffentliche Ordnung hing von ein paar Männern ab. Starken Männern mit Mut und Entschlossenheit. Und, weiß Gott, Jess Webb gehörte nicht zu ihnen!
Da bemerkte er, dass Jake Wilson ihn beobachtete. Aus Augen, die zu Schlitzen zusammengekniffen waren. »Was ist los, Frank? Passt Ihnen etwas nicht?«
»Ach, nichts«, murmelte Frank.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Wilson. »Der Bursche kriegt, was ihm zusteht!«
Maynard zuckte die Achseln, aber er sagte nichts. Auf seine Art war Jake Wilson gefährlicher als die beiden Pollards zusammengenommen. Die Pollards zählten nicht. Jake Wilson aber genoss Respekt und Ansehen. Sein Wort galt in Menloe. Und wegen seines Pferdes war Jake Wilson bereit, das Gesetz zu brechen! So also standen die Dinge! So und nicht anders!
Der Bankier spürte einen Eisklumpen im Magen. Insgeheim wünschte er, John Salem möge entkommen.
»Halt!«, rief Vern Pollard.
Die anderen zügelten ihre Pferde. Sie starrten auf den blitzenden Gegenstand, den Vern entdeckt hatte. Zwischen Steinen und Unkraut halb verborgen lag ein Hufeisen. Vern sprang aus dem Sattel, hob es auf und untersuchte es.
»Blitzblank! Das liegt noch nicht lange hier, soviel ist sicher!« Er hielt Wilson das Eisen hin. »Stammt es von dem Morgan?«
Wilson besah es sich genau. Dann steckte er es wortlos in die Satteltasche.
»Was ist?«, erkundigte sich Webb ungeduldig. »Stammt es von dem Morgan oder nicht?«
»Vielleicht.«
»Was soll das heißen? Wissen Sie es nicht?«
Jake Wilson zuckte die Achseln. »Nicht mit Sicherheit.«
Sie ritten am Ufer entlang und fanden die Stelle, wo ein Pferd aus dem Wasser gekommen war.
»Da haben wir, was wir suchen!«, rief Webb. »Ich jage einen Schuss in die Luft, damit die anderen wissen, dass wir die Fährte gefunden haben.«
»Warten Sie noch!«, sagte Wilson. »Das Eisen kann von dem Morgan stammen. Aber es ist auch möglich, dass ein anderes Pferd es verloren hat.«
Frank Maynard sah Wilson an. Nachdenklich, durchbohrend. »Komisch, dass einer das Hufeisen seines eigenen Pferdes nicht erkennt.«
Jake Wilsons Gesicht wurde dunkelrot. »Was wollen Sie damit sagen, Frank?«
»Gerade bei dem Morgan sorgen Sie doch immer persönlich dafür, dass er richtig beschlagen wird, nicht wahr? Da sollten Sie sich eigentlich erinnern!«
Wilson wendete sein Pferd, so dass er dem Bankier ins Gesicht schauen konnte. »Frank, wenn Sie mir damit etwas unterstellen wollen, dann sagen Sie es gerade heraus!«
Maynard setzte zum Sprechen an. Das Blut schoss ihm ins Gesicht. Aber plötzlich senkte er den Kopf.
»Verflucht«, ließ Webb sich vernehmen. »Haben wir nicht schon genug Schwierigkeiten? Müsst ihr noch anfangen, untereinander zu streiten? Wir werden die Spur ein Stück weiter verfolgen. Vielleicht bekommen wir dann heraus, ob sie von dem Morgan stammt oder nicht.«
Der Fährte zu folgen, war nicht schwer. Vom Bach weg führte sie nach Osten, bog dann nach Süden. Auf die Felsberge lief sie zu, auf das Niemandsland. Langsam begriff Webb. Jake Wilson hatte von Anfang an gewusst, dass das Eisen von seinem Morgan stammte. Wilson kannte sich mit Pferden aus. Und der Morgan war sein Liebling.
Die Fährte führte in ein Tai zwischen zwei Felsrücken. Sie fanden Losung, die noch warm und frisch war.
Maynard sah Webb an. In seinem Blick lag eine Bitte, die Webb nicht erfüllen konnte. Denn jetzt war es zu spät, den Rest des Aufgebotes herbeizurufen. Brachen sie die Jagd ab, um die anderen zu holen, dann entkam ihnen der Bursche. Nein, jetzt war es ihre Sache, John Salem einzuholen und zu fangen. Ihre Sache allein. Und das hatte Jake Wilson gewollt. Von Anfang an.
Verdammt, dachte Jess Webb, schließlich bin immer noch ich Deputy! Und kann entscheiden, was ich will!
Damit ritten sie das Tal hinauf immer weiter nach Süden. Sie kamen an ein Rinnsal, einen Nebenbach des Little Creek, und kreuzten ihn. Plötzlich änderte sich das Fährtenbild. Die Hufabdrücke wurden ungleich, stärker auf der einen, schwächer auf der anderen Seite.
Woody Pollard grinste. »Na, jetzt dauert’s nicht mehr lange. Der Morgan lahmt.«
Jake Wilsons Lippen wurden schmal. Seine Augen leuchteten gefährlich. Aber er sagte kein Wort. Vorsichtig ritten die Männer weiter. Ihre Augen suchten die Berghänge ab. Sie wussten, hinter jedem Felsen konnte der Bursche auf sie warten.
Als sie um einen Felsvorsprung bogen, hatten sie plötzlich den Morgan vor sich. Sie zügelten ihre Tiere, starrten dem goldfarbenen Pferd entgegen. Langsam kam es auf sie zugehinkt.
»Da ist er!«, schrie Vern Pollard. Er zeigte den Hang hinauf.
Die beiden Pollards sprangen aus den Sätteln. Sie rissen die Gewehre aus den Scabbards und eröffneten das Feuer. John Salem machte verzweifelt den Versuch, auf ein Felsband zu kommen. Steinsplitter flogen ihm um die Ohren. Da ließ er sich fallen, rollte hinter einen Felsen. »Nicht schießen!«, schrie er.
Woody Pollard lachte. »Hör dir das an! Der dumme John kann reden!«
Jess Webb legte die Hände an den Mund. »Werfen Sie Ihren Revolver weg, Salem!«, rief er.
»Ich habe keinen, hab ihn verloren«, rief der Junge zurück.
»Glauben Sie dem Burschen nicht«, knurrte Wilson.
Vern Pollard hob erneut das Gewehr. Da beugte sich Frank Maynard aus dem Sattel und schlug ihm den Lauf zur Seite. »Nun mal langsam! Vielleicht hat er wirklich seinen Revolver verloren. Außerdem hilft ihm das Schießeisen sowieso nicht. Wir sind außer Schussweite.«
Der Deputy nickte. »Stimmt«, sagte er. Dann legte er die Hände an den Mund und rief: »Kommen Sie herunter, Salem! Aber mit den Händen schön hoch in der Luft.«
Stille. Mehrere Sekunden vergingen. Dann stand John Salem auf. Ganz langsam kam er hinter einem Felsen hervor, die Hände erhoben.
»Nicht schießen!«
»Aber warum sollten wir denn!«, lachte Woody Pollard. »Wo wir doch etwas viel Besseres vorhaben!«
Salem stolperte den Hang herab, die Hände hinter dem Kopf. Alle paar Schritte rief er: »Nicht schießen!«, und jedes Mal lachten die Pollards. Jake Wilson schwieg. Nur seine Augen blitzten zornig. Er ging zu dem Morgan und untersuchte den verletzten Huf. Er nahm dem Tier den Sattel ab, löste das Lasso und kam zu den anderen zurück.
»Tun Sie das Seil weg«, mahnte Frank Maynard. »Das hier ist eine Sache für die Geschworenen.«
»Die Geschworenen machen Ed Ferguson nicht wieder lebendig.«
»Trotzdem, Frank hat recht, Jake«, sagte Webb. »Legen Sie das Lasso weg.«
»Mein Morgan ist erledigt«, sagte Jake rau. »Der Huf ist tief gespalten. Ich muss das Tier erschießen!«
»Der Bursche wird büßen, was er verbrochen hat«, erklärte Maynard. »Aber die Strafe bestimmt das Gesetz.«
Wilson sah den Bankier kalt an. Die Pollards grinsten.
Dann drehten sich alle wie auf ein Kommando um und sahen John Salem entgegen.
Die Augen des jungen Mannes leuchteten wild. Sein Haar wirkte noch zottiger, noch schmutziger als sonst. Er hatte Angst. Sein Mund zuckte. Es dauerte eine Weile, bis er herausbekam, was er sagen wollte.
»Wirklich, bei Gott, ich wollte Mister Ferguson nicht umbringen! Aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen, hat mich immer wieder gereizt.«
»Wie der mit einem Mal reden kann!«, wunderte sich Woody Pollard.
»Hol mal einer einen Strick und binde ihm die Hände auf den Rücken«, befahl Jess Webb.
Jake Wilson machte einen Schritt auf John Salem zu. In der Hand hatte er das Lasso. Einen Augenblick lang sah er den Jungen an. Dann schlug er ihm mitten ins Gesicht. Eiskalt, mit der ganzen Kraft seiner breiten Schultern. Salem taumelte zurück, fiel, blieb liegen.
»Steh auf, du Hundesohn!«, stieß Wilson hervor.
Maynard fuhr herum. »Jess, Sie sind Deputy Sheriff. Sie führen hier das Kommando! Lassen Sie so etwas zu?«
Jake Wilson funkelte den Bankier an. »Halten Sie sich heraus, Frank!«
»Dazu ist es zu spät! Ich bin genauso beteiligt wie Sie. Aber weder Sie noch ich sind hier Vertreter des Gesetzes. Wir haben Jess geholfen, John Salem festzunehmen. Jetzt müssen wir ihn nach Menloe schaffen und vor Gericht stellen. Alles andere ist nicht unsere Sache. Mehr noch – es ist gegen das Gesetz!«
»Wollen Sie sich vielleicht für diesen Mörder starkmachen?«, fragte Jake. »Wenn das die Leute in Menloe hören, da werden Sie sich aber wundern!«
»Oh, verflucht, lasst es gut sein, ja? Ich mache es schon selbst«, fuhr Webb dazwischen. Er ging zu seinem Pferd, holte ein Stück Seil aus der Satteltasche und trat zu dem Gefangenen. »Steh auf!«, befahl er.
Salem wischte sich das Blut vom Mund. »Was haben Sie mit mir vor?«
»Schätze, das werden die Geschworenen entscheiden.«
»Auf Ehre, ich wollte Mister Ferguson nicht töten!«
»Ich will davon nichts hören. Steh auf!«
Zögernd stand John Salem auf. Angstvoll sah er zu Jake Wilson hinüber.
»Dreh dich um!«, befahl Webb rau. Der Junge gehorchte, und Webb band ihm die Hände auf den Rücken. Er half ihm auf das Pferd, schwang sich selbst hinter den Sattel. Auch die anderen stiegen auf. Alle außer Jake Wilson. Jake zog seinen .45er, spannte den Hahn und ging zu seinem lahmen Morgan. Er strich dem Tier über den seidigen Hals. Dann hob er den Revolver, setzte ihn dem Pferd hinters Ohr. Die anderen schauten weg. Der Schuss krachte.
Schweigend ritten sie zurück. Jess Webb spürte, dass die anderen vor Wut kochten. Sogar Maynard war die Zornesröte ins Gesicht geschossen, als er den Morgan zusammenbrechen hörte. Der Tod des Pferdes hatte die Erbitterung über den Mord an Ferguson erneut in den Männern angefacht. Alle starrten John Salem an. Aber keiner sagte ein Wort.
Sie näherten sich dem Rinnsal. Jess Webb sah die hohen Cottonwood Bäume, die am Ufer wuchsen. Und plötzlich fing er an zu schwitzen.
»Machen wir mal eine Minute Rast«, sagte Jake Wilson, als sie das Ufer erreicht hatten.
Jess Webb musterte die Gesichter der anderen. Besonders die Gesichter von Jake Wilson und den Pollards. Wilson zügelte sein Pferd unter einem dicken Cottonwood. Er schaute ins Astwerk hinauf. »Es tut einem Pferd nicht gut, wenn es doppelt tragen muss«, sagte er leise. »Wie war’s, Jess?«
»Nun mal langsam, Jake!«, sagte Maynard. »Schätze, wir alle fühlen genauso wie Sie. Was mit John Salem auch passiert, er hat es verdient. Aber wir dürfen das Gesetz nicht einfach in die Hand nehmen. Das steht uns nicht zu!«
Vern Pollard grinste. Mit dem Kinn wies er auf Jess Webb. »Und was ist mit Jess? Er vertritt doch schließlich das Gesetz!«
»Ihr wisst genau, was ich meine!« Maynard sah sich hilfesuchend nach Webb um, aber der Deputy starrte auf den Boden. »Jedermann hat ein Anrecht darauf, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden!«
»Gericht!«, sagte Wilson verächtlich. »Wir brauchen keine Geschworenen, um zu erfahren, wer Ed Ferguson umgebracht hat!«
»Richtig!«, stimmte Pollard zu. »Salem hat ihn mitten ins Gesicht geschossen. Ich hab’s selber gesehen.«
Jake Wilson löste das Lasso, band eine Schlinge. John Salem schaute von einem zum anderen. Seine Augen blitzten wild und irr. Er hatte begriffen, worum es ging. Er drehte sich im Sattel um, starrte den Deputy an.
»Sheriff, Sie dürfen nicht zulassen, dass sie mich hängen!«