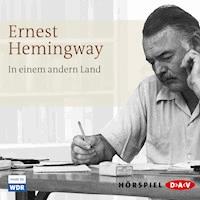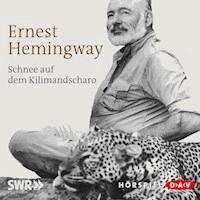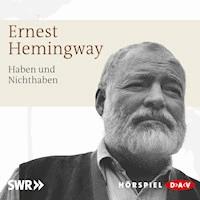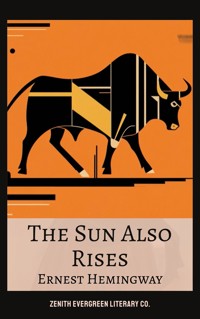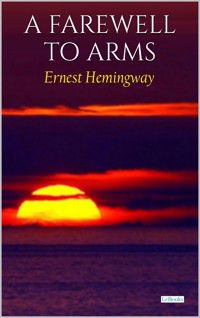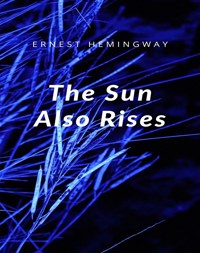9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser wohl berühmteste Roman Hemingways erschien 1929 und basiert auf seinen Erlebnissen als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Als er ihn schrieb, war er dreißig Jahre alt, und der Roman wurde als das beste Buch über diesen Krieg gefeiert. Es begründete seinen Weltruhm. "In einem anderen Land" erzählt die Geschichte des amerikanischen Ambulanzfahrers Frederic Henry an der Isonzo-Front und seiner Leidenschaft für die schöne, aber empfindsame englische Krankenschwester Catherine Barkley – eine Liebe, die angesichts der Umstände, unter denen sie gedeiht, nur in einer Katastrophe enden kann. Den Roman zeichnet die meisterhafte erzählerische Leistung aus, dass er die Brutalität des Krieges und das zarte Spiel einer beginnenden Liebe auf erschreckend zwingende Weise miteinander verbindet. Daraus entsteht ein Drama von beinahe übermenschlicher Tragik und, da frei von jeglicher Sentimentalität, ein "wunderschönes, bewegendes und zutiefst menschliches Buch" (Vita Sackville-West).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ernest Hemingway
In einem anderen Land
Roman
Über dieses Buch
Dieser wohl berühmteste Roman Hemingways erschien 1929 und basiert auf seinen Erlebnissen als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Als er ihn schrieb, war er dreißig Jahre alt, und der Roman wurde als das beste Buch über diesen Krieg gefeiert. Es begründete seinen Weltruhm.
«In einem anderen Land» erzählt die Geschichte des amerikanischen Ambulanzfahrers Frederic Harvey an der Isonzo-Front und seiner Leidenschaft für die schöne, aber empfindsame englische Krankenschwester Catherine Barkley – eine Liebe, die angesichts der Umstände, unter denen sie gedeiht, nur in einer Katastrophe enden kann.
Den Roman zeichnet die meisterhafte erzählerische Leistung aus, dass er die Brutalität des Krieges und das zarte Spiel einer beginnenden Liebe auf erschreckend zwingende Weise miteinander verbindet. Daraus entsteht ein Drama von beinahe übermenschlicher Tragik und, da frei von jeglicher Sentimentalität, ein «wunderschönes, bewegendes und zutiefst menschliches Buch» (Vita Sackville-West).
Vita
Ernest Hemingway, geboren 1899 in Oak Park, Illinois, gilt als einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In den zwanziger Jahren lebte er als Reporter in Paris, später in Florida und auf Kuba; er nahm auf Seiten der Republikaner am Spanischen Bürgerkrieg teil, war Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg. 1953 erhielt er den Pulitzer-Preis, 1954 den Nobelpreis für Literatur. Hemingway schied nach schwerer Krankheit 1961 freiwillig aus dem Leben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 1930 by Ernst Rowohlt Verlag, Berlin // 1946, 1959, 1977, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg // Copyright 1929 by Charles Scribner's Sons // Copyright renewed © 1957 by Ernest Hemingway, Hemingway Library Edition // Copyright © 2012 by The Hemingway Copyright Owners
Covergestaltung Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Umschlagillustration: Marion Blomeyer
ISBN 978-3-644-00256-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für G.A. Pfeiffer
Buch eins
Kapitel 1
Im Spätsommer dieses Jahres waren wir in einem Haus in einem Dorf mit Blick über den Fluss und die Ebene zu den Bergen. Im Flussbett lagen Kiesel und Felsen, trocken und weiß in der Sonne, und das Wasser war klar und strömte schnell und blau in den Rinnen. Soldaten gingen am Haus vorbei die Straße hinunter, und der Staub, den sie aufwirbelten, senkte sich auf das Laub der Bäume. Auch die Stämme der Bäume waren staubig, und das Laub fiel früh in diesem Jahr, und wir sahen die Soldaten die Straße entlangmarschieren und den Staub aufsteigen und die vom Wind bewegten Blätter fallen und die Soldaten marschieren und hinterher die Straße kahl und weiß bis auf die Blätter.
Auf der Ebene wogten die Felder; es gab viele Obstbäume, und die Berge dahinter waren braun und kahl. In den Bergen fanden Gefechte statt, und nachts sahen wir die Artillerie aufblitzen. Im Dunkeln wirkte es wie ein Sommergewitter, aber die Nächte waren kühl und ließen nicht an ein aufziehendes Gewitter denken.
Manchmal hörten wir im Dunkeln die Soldaten unter dem Fenster marschieren und von Traktoren geschleppte Geschütze vorbeiziehen. Nachts war starker Verkehr, viele Maultiere mit Munitionskisten in Packsätteln auf beiden Seiten und graue Lastwagen voller Männer und andere Lastwagen mit von Planen abgedeckter Ladung, die sich langsamer über die Straßen bewegten. Auch tagsüber zogen Traktoren große Geschütze vorbei, die langen Kanonenrohre mit grünen Zweigen und die Traktoren mit grün belaubten Zweigen und Weinranken bedeckt. Nach Norden sahen wir über ein Tal und einen Kastanienwald und dahinter auf einen anderen Berg diesseits des Flusses. Auch um diesen Berg wurde gekämpft, aber ohne Erfolg, und als im Herbst der Regen kam, fielen alle Blätter von den Kastanien, und die Äste waren kahl und die Stämme schwarz vom Regen. Auch die Weingärten waren gelichtet und kahl und das ganze herbstliche Land nass und braun und tot. Nebelschwaden hingen über dem Fluss und Wolken über den Bergen, und die Lastwagen spritzten Schlamm auf die Straße, und die Soldaten waren voller Schlamm und nass in ihren Umhängen; ihre Gewehre waren nass, und die zwei ledernen Patronentaschen vorne an den Gürteln, graue Ledertaschen mit dünnen, langen 6,5-Millimeter-Patronen in gebündelten Ladestreifen, wölbten sich unter ihren Umhängen, sodass die auf der Straße vorbeimarschierenden Soldaten aussahen, als wären sie im sechsten Monat schwanger.
Es gab auch kleine graue Autos, die sehr schnell vorbeifuhren, meist mit einem Offizier auf dem Sitz neben dem Fahrer und weiteren Offizieren auf der Rückbank. Die verspritzten noch mehr Schlamm als die Lastwagen, und wenn einer der hinten sitzenden Offiziere sehr klein war und zwischen zwei Generälen saß, er selbst so klein, dass man nicht sein Gesicht, sondern nur seine Kappe und seinen schmalen Rücken sehen konnte, und wenn das Auto besonders schnell fuhr, dann war es wahrscheinlich der König. Er lebte in Udine und fuhr fast jeden Tag so hinaus, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen, und die Lage war sehr schlecht.
Mit dem Winter kam der Dauerregen, und mit dem Regen kam die Cholera. Aber die wurde in Schach gehalten, und am Ende starben daran nur siebentausend Soldaten.
Kapitel 2
Im nächsten Jahr gab es viele Siege. Der Berg jenseits des Tals und der Hang mit dem Kastanienwald wurden eingenommen, und es gab Siege auf dem Plateau im Süden jenseits der Ebene, und im August gingen wir über den Fluss und bezogen ein Haus in Gorizia, das einen Brunnen und einen ummauerten Garten mit vielen dichten Schattenbäumen hatte, und eine Seite des Hauses war ganz mit violetten Glyzinien überhangen. Jetzt fanden die Gefechte in den nächsten Bergen dahinter statt, keine Meile entfernt. Die Stadt war sehr nett, und unser Haus war sehr schön. Hinter uns war der Fluss, und die Stadt war sehr sauber erobert worden, aber die Berge jenseits davon waren nicht einzunehmen, und ich war sehr froh, dass die Österreicher irgendwann einmal, falls der Krieg jemals ein Ende nehmen würde, in die Stadt zurückkommen zu wollen schienen, weil sie sie nicht bombardierten, um sie zu zerstören, sondern nur ein wenig zu militärischen Zwecken. Die Bewohner blieben, und es gab Lazarette und Cafés und Artillerie in Nebenstraßen und zwei Bordelle, eins für Soldaten und eins für Offiziere, und zum Ende des Sommers hin die kühlen Nächte, die Kämpfe in den Bergen jenseits der Stadt, das von Granaten gezeichnete Eisen der Eisenbahnbrücke, den zerstörten Tunnel am Fluss, wo die Schlacht stattgefunden hatte, die Bäume um den Marktplatz und die lange Allee, die zum Marktplatz führte; all dies, und dazu die Mädchen in der Stadt, der König, der in seinem Auto vorbeifuhr, sichtbar sein kleiner Körper mit dem langen Hals und zuweilen sein Gesicht mit dem grauen Bart wie der am Kinn einer Ziege; all dies, und dazu das plötzliche Innere von Häusern, die beim Beschuss eine Mauer verloren hatten, Putz und Trümmer in den Gärten und manchmal auf der Straße, und auch, dass im Carso alles ruhig war, das alles unterschied den Herbst sehr von unserem Herbst im Jahr zuvor in diesem Land. Auch der Krieg hatte sich verändert.
Der Eichenwald auf dem Berg jenseits der Stadt war weg. Als wir im Sommer in die Stadt gekommen waren, war der Wald grün gewesen, jetzt aber gab es nur Stümpfe und zerfetzte Stämme und aufgewühlten Boden, und als ich einmal gegen Herbstende dorthin ging, wo der Eichenwald gewesen war, sah ich eine Wolke über den Berg kommen. Sie kam sehr schnell, und die Sonne wurde mattgelb, und dann war alles grau, und der Himmel war zu, und die Wolke senkte sich auf den Berg, und plötzlich waren wir darin, und es schneite. Der Wind trieb den Schnee, der nackte Boden wurde zugedeckt, die Baumstümpfe ragten empor, Schnee lag auf den Geschützen, und im Schnee führten Pfade zu den Latrinen hinter den Gräben.
Später, unten in der Stadt, beobachtete ich das Schneien durchs Fenster des Bordells, das für die Offiziere bestimmt war, wo ich mit einem Freund und zwei Gläsern saß und wir eine Flasche Asti tranken, und als wir den Schnee so dicht und langsam fallen sahen, wussten wir, für dieses Jahr war alles vorbei. Die Berge flussauf waren nicht eingenommen; kein Berg jenseits des Flusses war eingenommen. Das musste bis nächstes Jahr warten. Mein Freund sah den Priester unserer Einheit auf der Straße vorbeigehen, vorsichtig durch den Matsch waten, und klopfte ans Fenster, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Der Priester blickte auf. Er sah uns und lächelte. Mein Freund winkte ihm hineinzukommen. Der Priester schüttelte den Kopf und ging weiter. Am Abend im Speiseraum, nach den Spaghetti, die jeder sehr schnell und mit großem Ernst verzehrte, entweder, indem man die Spaghetti mit der Gabel hochhob, bis sie lose herabhingen, und sodann in den Mund senkte, oder, indem man sie sich pausenlos in den Mund schaufelte und einsaugte, und während wir uns Wein aus der in Stroh gehüllten Vierliterflasche einschenkten, die in einem Metallkorb lag und mit dem Zeigefinger am Hals nach unten gedrückt wurde, sodass der Wein, klar und rot und herb und herrlich in das mit derselben Hand gehaltene Glas lief, machte der Hauptmann sich über den Priester her.
Der Priester war jung und errötete schnell und trug wie wir alle Uniform, jedoch mit einem Kreuz aus dunkelrotem Samt über der Brusttasche seines grauen Rocks. Der Hauptmann sprach zu meinem zweifelhaften Nutzen Pidgin-Italienisch, damit ich nur ja alles mitbekam und nichts verlorenging.
«Priester heute bei Frauen», sagte der Hauptmann und sah den Priester und mich an. Der Priester lächelte und errötete und schüttelte den Kopf. Dieser Hauptmann hänselte ihn oft.
«Stimmt nicht?», fragte der Hauptmann. «Ich Priester heute sehen bei Frauen.»
«Nein», sagte der Priester. Die anderen Offiziere amüsierten sich über die Fopperei.
«Priester nicht bei Frauen», fuhr der Hauptmann fort. «Priester nie bei Frauen», erklärte er mir. Er nahm mein Glas und füllte es, wobei er mir in die Augen sah, ohne den Priester aus dem Blick zu verlieren.
«Priester jede Nacht fünf gegen einen.» Alle am Tisch lachten. «Du verstehen? Priester jede Nacht fünf gegen einen.» Er machte eine Geste und lachte laut. Der Priester nahm das als Scherz hin.
«Der Papst will, dass die Österreicher den Krieg gewinnen», sagte der Major. «Er liebt Franz Joseph. Da kommt das Geld her. Ich bin Atheist.»
«Hast du mal das ‹Schwarze Schwein› gelesen?», fragte der Leutnant. «Ich kann dir das Buch besorgen. Es hat meinen Glauben erschüttert.»
«Ein schmutziges, niederträchtiges Buch», sagte der Priester. «Das kann dir nicht gefallen.»
«Ein sehr wertvolles Buch», sagte der Leutnant. «Man lernt daraus über diese Priester. Es wird dir gefallen», sagte er zu mir. Ich lächelte dem Priester zu, und er lächelte über die brennenden Kerzen hin zurück. «Lies es bloß nicht», sagte er.
«Ich werde es dir geben», sagte der Leutnant.
«Alle denkenden Menschen sind Atheisten», sagte der Major. «An die Freimaurer glaube ich aber auch nicht.»
«Ich glaube an die Freimaurer», sagte der Leutnant. «Eine edle Organisation.» Die Tür ging auf, als jemand hineinkam, und ich sah es schneien.
«Jetzt, wo es zu schneien angefangen hat, wird es keine Offensive mehr geben», sagte ich.
«Allerdings», sagte der Major. «Du solltest Urlaub machen. Geh nach Rom, Neapel, Sizilien –»
«Er sollte nach Amalfi gehen», sagte der Leutnant. «Ich schreibe dir Karten an meine Familie in Amalfi. Die werden dich aufnehmen wie einen Sohn.»
«Er sollte nach Palermo gehen.»
«Er sollte nach Capri gehen.»
«Ich würde mich freuen, wenn du in die Abruzzen gehen und meine Familie in Capracotta besuchen würdest», sagte der Priester.
«Hört euch den an: die Abruzzen. Da liegt noch mehr Schnee als hier. Was soll er bei den Bauern. Er sollte die Zentren von Kultur und Zivilisation besuchen.»
«Und schöne Frauen. Ich gebe dir die Adressen von Häusern in Neapel. Schöne junge Frauen – in Begleitung ihrer Mütter. Ha! Ha! Ha!» Der Hauptmann spreizte die Hand, Daumen nach oben und die Finger gestreckt, wie wenn man Schattenbilder macht. Der Schatten seiner Hand fiel auf die Wand. Er sprach jetzt wieder Pidgin-Italienisch. «So du weggehen», er zeigte auf den Daumen, «und so du kommen zurück», er berührte den kleinen Finger. Alle lachten.
«Schau», sagte der Hauptmann. Wieder spreizte er die Hand. Wieder warf das Kerzenlicht ihre Schatten an die Wand. Er begann mit dem aufgerichteten Daumen und benannte die Finger vom Daumen bis zum kleinen: «sotto-tenente (der Daumen), tenente (Zeigefinger), capitano (Mittelfinger), maggiore (Ringfinger) und tenente-colonello (der kleine Finger). Du gehen als sotto-tenente! Du kommen zurück als tenente-colonello!» Wieder lachten alle.
«Du musst sofort Urlaub machen», sagte der Major.
«Ich würde dich gern begleiten und dir alles zeigen», sagte der Leutnant.
«Bring ein Grammophon mit, wenn du zurückkommst.»
«Und gute Opernplatten.»
«Caruso.»
«Bloß nicht Caruso. Der brüllt.»
«Möchtest du nicht brüllen können wie er?»
«Er brüllt. Ich sage, er brüllt.»
«Ich würde mich freuen, wenn du in die Abruzzen gehen würdest», sagte der Priester. Die anderen schrien. «Die Jagd dort ist gut. Und die Menschen werden dir gefallen; es ist zwar kalt, aber klar und trocken. Du könntest bei meiner Familie wohnen. Mein Vater ist ein berühmter Jäger.»
«Schluss damit», sagte der Hauptmann. «Gehen wir ins Freudenhaus, bevor es zumacht.»
«Gute Nacht», sagte ich zu dem Priester.
«Gute Nacht», sagte er.
Kapitel 3
Als ich an die Front zurückkam, waren wir immer noch in dieser Stadt. Es war Frühling geworden, und es gab mehr Geschütze in der Umgebung. Die Felder waren grün, an den Weinstöcken saßen kleine grüne Triebe, die Bäume an der Straße hatten kleine Blätter, und der Wind kam vom Meer. Ich sah die Stadt mit dem Hügel und oben in einer Senke die alte Festung mit den Bergen dahinter, braune Berge mit ein wenig Grün an den Hängen. Auch in der Stadt waren mehr Geschütze, es gab ein paar neue Lazarette, auf der Straße begegnete man britischen Männern und manchmal auch Frauen, und einige weitere Häuser waren von Granaten getroffen worden. Es war warm, wie es im Frühling warm ist, und ich ging die Gasse mit den Bäumen hinunter, erwärmt von der Sonne an der Mauer, und stellte fest, dass wir noch im selben Haus waren und alles so aussah, wie ich es verlassen hatte. Die Tür stand offen, draußen saß ein Soldat auf einer Bank in der Sonne, ein Sanitätswagen wartete vor der Nebentür, und als ich hineinging, roch es drinnen nach Marmorböden und Lazarett. Alles war so, wie ich es verlassen hatte, außer dass jetzt Frühling war. Ich warf einen Blick in das große Zimmer und sah den Major an seinem Schreibtisch sitzen, und durch das offene Fenster schien die Sonne ins Zimmer. Er sah mich nicht, und ich wusste nicht, ob ich hineingehen und mich melden oder erst nach oben gehen und mich zurechtmachen sollte. Ich entschied mich, nach oben zu gehen.
Das Zimmer, das ich mit Leutnant Rinaldi teilte, sah auf den Hof hinaus. Das Fenster stand offen, mein Bett war mit Decken bezogen, und meine Sachen hingen an der Wand, die Gasmaske in einem länglichen Blechbehälter, der Stahlhelm am selben Haken. Am Fußende des Betts stand mein flacher Koffer, und auf dem Koffer standen meine glänzend eingefetteten Winterstiefel. Mein österreichisches Scharfschützengewehr mit dem gebläuten achteckigen Lauf und dem schönen dunklen, an die Wange angepassten Schaft aus Walnussholz hing über den zwei Betten. Das zugehörige Zielfernrohr war, erinnerte ich mich, im Schrank eingeschlossen. Der Leutnant, Rinaldi, lag schlafend auf dem anderen Bett. Er erwachte, als er mich im Zimmer hörte, und setzte sich auf.
«Ciao!», sagte er. «Wie ist es dir ergangen?»
«Großartig.»
Wir gaben uns die Hand, und er legte mir einen Arm um den Nacken und küsste mich.
«Uff», sagte ich.
«Du bist schmutzig», sagte er. «Du solltest dich waschen. Wo warst du, und was hast du getrieben? Erzähl mir alles, sofort.»
«Ich war überall. Mailand, Florenz, Rom, Neapel, Villa San Giovanni, Messina, Taormina –»
«Hört sich an wie ein Fahrplan. Hast du auch was Schönes erlebt?»
«Ja.»
«Wo?»
«Mailand, Florenz, Rom, Neapel –»
«Das reicht. Erzähl mir, was das Beste war.»
«Mailand.»
«Weil es das Erste war. Wo hast du sie kennengelernt? Im Cova? Wo bist du hingegangen? Wie war das für dich? Erzähl mir alles. Bist du die ganze Nacht geblieben?»
«Ja.»
«Nichts Besonderes. Wir haben hier jetzt wunderschöne Mädchen. Neue Mädchen, die vorher noch nie an der Front waren.»
«Großartig.»
«Du glaubst mir nicht? Wir gehen heute Nachmittag hin, dann wirst du’s sehen. Und wir haben schöne Engländerinnen in der Stadt. Ich bin jetzt in Miss Barkley verliebt. Ich werde sie dir vorstellen. Wahrscheinlich werde ich Miss Barkley heiraten.»
«Erst muss ich mich waschen und zurückmelden. Arbeitet hier jetzt keiner?»
«Seit du weg warst, hatten wir nur Erfrierungen, Frostbeulen, Gelbsucht, Durchfall, Selbstverstümmelungen, Lungenentzündung und weichen und harten Schanker. Jede Woche wird jemand durch Felstrümmer verletzt. Ein paar richtig Verwundete haben wir auch. Nächste Woche geht der Krieg wieder los. Vielleicht geht er wieder los. Sagt man. Meinst du, ich sollte Miss Barkley heiraten – nach dem Krieg natürlich?»
«Auf jeden Fall», sagte ich und goss Wasser in die Schüssel.
«Heute Abend wirst du mir alles erzählen», sagte Rinaldi. «Jetzt muss ich wieder schlafen, damit ich nachher schön frisch für Miss Barkley bin.»
Ich zog Jacke und Hemd aus und wusch mich mit dem kalten Wasser in der Schüssel. Während ich mich mit einem Handtuch abtrocknete, sah ich im Zimmer umher und aus dem Fenster und zu Rinaldi, der mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag. Er sah gut aus, war in meinem Alter und kam aus Amalfi. Er arbeitete gern als Chirurg, und wir waren gute Freunde. Während ich ihn betrachtete, machte er die Augen auf.
«Hast du Geld?»
«Ja.»
«Leih mir fünfzig Lire.»
Ich trocknete meine Hände und holte meine Brieftasche aus der Jacke, die ich an die Wand gehängt hatte. Rinaldi nahm den Schein, faltete ihn und schob ihn, ohne vom Bett aufzustehen, in eine Tasche seiner Kniehose. Er lächelte. «Ich muss auf Miss Barkley den Eindruck eines hinreichend vermögenden Mannes machen. Du bist mein guter Freund und Wohltäter.»
«Red keinen Quatsch», sagte ich.
Abends im Speiseraum saß ich neben dem Priester, und er war enttäuscht und gekränkt, dass ich nicht in den Abruzzen gewesen war. Er hatte seinem Vater von meinem Besuch geschrieben, und sie hatten dort Vorbereitungen getroffen. Ich fühlte mich genauso schlecht wie er und konnte nicht begreifen, warum ich nicht dort hingefahren war. Ich hatte es wirklich vorgehabt und versuchte zu erklären, wie eins zum andern geführt hatte, und schließlich verstand er und glaubte mir, dass ich es wirklich vorgehabt hatte, und beruhigte sich einigermaßen. Ich hatte viel Wein und dann Kaffee und Strega getrunken und erklärte mit weinschwerer Zunge, wir täten nicht immer das, was wir wollten; wir täten es nie.
Wir zwei unterhielten uns, während die anderen sich stritten. Ich hatte wirklich in die Abruzzen fahren wollen. Ich war nirgendwo hingefahren, wo die Straßen gefroren und hart wie Eisen waren, wo es klar und kalt und trocken war und der Schnee trocken und pulvrig und wo es Hasenspuren im Schnee gab und die Bauern den Hut zogen und einen mit Herr anredeten und es gute Gelegenheit zur Jagd gab. Solche Orte hatte ich nicht aufgesucht, nur den Qualm von Cafés und Nächte, in denen der Raum um einen kreiste und man die Wand anstarren musste, damit es aufhörte, Nächte, betrunken im Bett, wo man wusste, das war alles, mehr gab es nicht, und die seltsame Erregung beim Aufwachen, wenn man nicht wusste, wer da neben einem lag, die Welt ganz unwirklich im Dunkeln und so aufregend, dass man wieder mit dem nächtlichen Nichtwissen und der Sorglosigkeit anfangen musste, überzeugt davon, dass dies alles und alles und alles war, und weiter sorglos. Plötzlich sehr besorgt sein und einschlafen und manchmal morgens damit aufwachen, und alles verschwunden, was da gewesen war, alles scharf und hart und klar, und manchmal Streit um den Preis. Manchmal noch angenehm und liebevoll und freundlich und Frühstück und Mittagessen. Manchmal alle Nettigkeit verschwunden und froh, auf die Straße hinauszukommen, aber immer ein neuer Tag und dann eine neue Nacht. Ich versuchte, von der Nacht zu erzählen, vom Unterschied zwischen Nacht und Tag, und dass die Nacht besser war, es sei denn, der Tag war sehr rein und kalt, und ich konnte es nicht erklären; so wie ich es jetzt nicht erklären kann. Aber wenn man es erlebt hat, weiß man es. Er hatte es nicht erlebt, verstand aber, dass ich wirklich in die Abruzzen hatte fahren wollen, es aber nicht getan hatte, und wir waren immer noch Freunde mit vielen ähnlichen Vorlieben, nur mit dem einen Unterschied. Er hatte immer gewusst, was ich nicht wusste und was ich, als ich es erfuhr, immer vergessen konnte. Aber damals wusste ich es nicht, ich erfuhr es erst später. Unterdessen waren wir alle im Speiseraum, die Mahlzeit war beendet, und der Streit ging weiter. Wir zwei brachen unsere Unterhaltung ab, und der Hauptmann rief: «Priester nicht glücklich. Priester nicht glücklich ohne Frauen.»
«Ich bin glücklich», sagte der Priester.
«Priester nicht glücklich. Priester möchte, dass Österreich den Krieg gewinnt», sagte der Hauptmann. Die anderen hörten zu. Der Priester schüttelte den Kopf.
«Nein», sagte er.
«Priester will nie, dass wir angreifen. Stimmt doch, du willst nie, dass wir angreifen.»
«Nein. Wenn Krieg ist, müssen wir wohl angreifen.»
«Müssen angreifen. Werden angreifen!»
Der Priester nickte.
«Lass ihn in Ruhe», sagte der Major. «Der ist in Ordnung.»
«Er kann sowieso nichts daran ändern», sagte der Hauptmann. Wir standen alle auf und verließen den Tisch.
Kapitel 4
Am Morgen weckte mich die Batterie im Nachbargarten, und ich sah die Sonne im Fenster und stieg aus dem Bett. Ich ging zum Fenster und sah hinaus. Die Kieswege waren feucht und das Gras nass vom Tau. Die Batterie feuerte zweimal, und jedes Mal kam die Luft wie ein Schlag und ließ das Fenster zittern und die Vorderseite meines Schlafanzugs flattern. Ich konnte die Geschütze nicht sehen, aber sie feuerten offenkundig direkt über uns hinweg. Es war lästig, dass sie da waren, aber ein Trost, dass sie nicht größer waren. Während ich in den Garten hinaussah, hörte ich einen Lastwagen auf der Straße losfahren. Ich zog mich an, ging nach unten, trank Kaffee in der Küche und ging zur Garage hinaus.
Zehn Wagen standen nebeneinander in dem offenen Schuppen. Kopflastige Krankenwagen mit stumpfer Nase, grau gestrichen und gebaut wie Umzugswagen. An einem arbeiteten draußen auf dem Hof die Mechaniker. Drei weitere waren bei Verbandsplätzen oben in den Bergen.
«Gerät die Batterie auch mal unter Beschuss?», fragte ich einen der Mechaniker.
«Nein, Signor Tenente. Der kleine Hügel gibt ihr Deckung.»
«Und wie läuft’s?»
«Nicht schlecht. Der Motor hier ist kaputt, aber die anderen sind in Ordnung.» Er unterbrach seine Arbeit und lächelte. «Waren Sie auf Urlaub?»
«Ja.»
Er wischte sich die Hände an seinem Pullover ab und grinste. «Gut amüsiert?» Die anderen grinsten auch.
«Prächtig», sagte ich. «Was ist denn mit diesem Motor?»
«Kaputt. Immer wieder was anderes.»
«Und jetzt gerade?»
«Neue Ringe.»
Der Wagen sah geschändet aus, entblößt, der Motor freigelegt und einzelne Teile auf der Werkbank; ich ließ sie weitermachen, ging in den Schuppen und sah mir die anderen Wagen an. Sie waren einigermaßen sauber, ein paar frisch gewaschen, die anderen staubig. Ich prüfte die Reifen sorgfältig auf Schnitte oder Quetschungen. Alles schien in gutem Zustand. Offenbar machte es keinen Unterschied, ob ich da war und mich darum kümmerte oder nicht. Ich hatte mir eingebildet, der Zustand der Wagen, ob Ersatzteile verfügbar seien oder nicht, das reibungslose Funktionieren des Abtransports Verwundeter oder Kranker von den Verbandsplätzen und ihrer Überführung aus den Bergen zum Feldlazarett und dann ihrer Verteilung auf die in ihren Papieren genannten Krankenhäuser hingen wesentlich von mir ab. Offenbar spielte es keine Rolle, ob ich da war oder nicht.
«Gab es Probleme mit Ersatzteilen?», fragte ich den Chefmechaniker.
«Nein, Signor Tenente.»
«Wo ist der Tankplatz jetzt?»
«Noch an derselben Stelle.»
«Gut», sagte ich, ging ins Haus zurück und trank noch einen Kaffee am Esstisch. Der Kaffee war blassgrau, gesüßt mit Kondensmilch. Draußen vor dem Fenster war ein schöner Frühlingsmorgen. In der Nase begann sich ein Gefühl von Trockenheit auszubreiten, was bedeutete, dass es im Verlauf des Tages warm werden würde. An diesem Tag inspizierte ich die Stellungen in den Bergen und kam spätnachmittags in die Stadt zurück.
In meiner Abwesenheit schien das Ganze besser zu laufen. Die Offensive würde bald wieder losgehen, hörte ich. Die Division, für die wir arbeiteten, sollte an einer Stelle flussaufwärts angreifen, und der Major erklärte mir, ich hätte mich während des Angriffs um die Stellungen zu kümmern. Der Angriff sollte oberhalb der engen Schlucht über den Fluss gehen und dann in breiter Front den Hang hinaufgeführt werden. Die Stellungen für die Wagen sollten so nah am Fluss wie möglich und gut getarnt sein. Sie würden natürlich von der Infanterie ausgewählt, aber wir hätten für die Ausführung zu sorgen. Das war eins dieser Dinge, die einem das Soldatendasein verleideten.
Ich war voller Staub und Schmutz und ging nach oben in mein Zimmer, um mich zu waschen. Rinaldi saß auf dem Bett und las in Hugos englischer Grammatik. Er war angezogen, auch seine schwarzen Stiefel hatte er an, und sein Haar glänzte.
«Sehr gut», sagte er, als er mich sah. «Du begleitest mich zu Miss Barkley.»
«Nein.»
«Doch. Komm bitte mit und sorg dafür, dass ich einen guten Eindruck auf sie mache.»
«Na schön. Warte, bis ich mich zurechtgemacht habe.»
«Wasch dich, mehr ist nicht nötig.»
Ich wusch mich, bürstete mir die Haare, und wir zogen los.
«Warte noch», sagte Rinaldi. «Vielleicht sollten wir vorher was trinken.» Er machte seinen Koffer auf und nahm eine Flasche heraus.
«Keinen Strega», sagte ich.
«Nein. Grappa.»
«Na schön.»
Er schenkte zwei Gläser ein, und wir stießen an, die Zeigefinger ausgestreckt. Der Grappa war sehr stark.
«Noch einen?»
«Na schön», sagte ich. Wir tranken den zweiten Grappa, Rinaldi verstaute die Flasche, und wir gingen die Treppe hinunter. Es war heiß in der Stadt, aber die Sonne ging schon unter, und das tat sehr gut. Das britische Lazarett befand sich in einer großen Villa, die vor dem Krieg von Deutschen gebaut worden war. Miss Barkley war im Garten. Bei ihr noch eine andere Krankenschwester. Wir sahen ihre weißen Kittel durch die Bäume und gingen auf sie zu. Rinaldi salutierte. Auch ich salutierte, aber zurückhaltender.
«Guten Tag», sagte Miss Barkley. «Sie sind kein Italiener, oder?»
«O nein.»
Rinaldi sprach mit der anderen Krankenschwester. Sie lachten. «Wie ungewöhnlich – in der italienischen Armee zu sein.»
«Nicht direkt in der Armee. Nur bei den Sanitätern.»
«Trotzdem sehr ungewöhnlich. Warum tun Sie das?»
«Ich weiß nicht», sagte ich. «Es gibt nicht immer für alles eine Erklärung.»
«Ach, wirklich? Mir hat man das Gegenteil beigebracht.»
«Schön für Sie.»
«Müssen wir weiter so reden?»
«Nein», sagte ich.
«Das freut mich, Sie auch?»
«Wozu ist dieser Stock?», fragte ich. Miss Barkley war ziemlich groß. Sie trug eine Art Schwesterntracht, hatte blondes Haar, leicht gebräunte Haut und graue Augen. Ich fand sie sehr schön. Sie hielt einen dünnen, mit Leder bezogenen Rohrstock, der aussah wie eine Reitgerte für Kinder.
«Der gehörte einem Jungen, der voriges Jahr getötet wurde.»
«Das tut mir sehr leid.»
«Ein sehr netter Junge. Er wollte mich heiraten und ist an der Somme gefallen.»
«Das war eine furchtbare Schlacht.»
«Waren Sie dabei?»
«Nein.»
«Ich habe davon gehört», sagte sie. «Hier bei uns gibt es diese Art von Krieg nicht. Man hat mir das Stöckchen geschickt. Seine Mutter hat es mir geschickt. Zusammen mit seinen anderen Sachen.»
«Waren Sie lange verlobt?»
«Acht Jahre. Wir sind zusammen aufgewachsen.»
«Und warum haben Sie nicht geheiratet?»
«Ich weiß nicht», sagte sie. «Es war einfach dumm von mir. Wenigstens das hätte ich ihm geben können. Aber ich dachte, es würde ihm schaden.»
«Verstehe.»
«Waren Sie schon mal verliebt?»
«Nein», sagte ich.
Wir setzten uns auf eine Bank, und ich sah sie an.
«Sie haben schönes Haar», sagte ich.
«Gefällt es Ihnen?»
«Sehr.»
«Ich wollte es mir ganz abschneiden, als er starb.»
«Nein.»
«Ich wollte etwas für ihn tun. Das andere war mir nicht wichtig, er hätte alles haben können. Er hätte alles haben können, was er wollte, wenn ich’s gewusst hätte. Ich hätte ihn geheiratet und alles. Jetzt kenne ich mich aus. Aber damals, als er in den Krieg zog, wusste ich gar nichts.»
Ich sagte nichts.
«Damals hatte ich von nichts eine Ahnung. Ich dachte, für ihn wäre es schlimmer. Ich dachte, vielleicht hält er es nicht aus, und dann musste er sterben, und das war’s.»
«Hm.»
«O doch», sagte sie. «Das war’s.»
Wir sahen Rinaldi mit der anderen Krankenschwester reden.
«Wie heißt sie?»
«Ferguson. Helen Ferguson. Ihr Freund ist Arzt, oder?»
«Ja. Ein sehr guter.»
«Großartig. Gute hat man so nah an der Front nur selten. Wir sind hier doch nah an der Front?»
«Ziemlich.»
«Eine blöde Front», sagte sie. «Aber schön ist es hier. Gibt es bald eine Offensive?»
«Ja.»
«Dann bekommen wir Arbeit. Jetzt haben wir nichts zu tun.»
«Machen Sie das schon lange?»
«Seit Ende fünfzehn. Seit er in den Krieg gezogen ist. Irgendwie hatte ich die alberne Phantasievorstellung, er könnte in das Lazarett kommen, wo ich arbeite. Vielleicht mit einer Säbelwunde und einem Verband um den Kopf. Oder mit einer Kugel in der Schulter. Was Malerisches.»
«Die Front hier ist malerisch», sagte ich.
«Ja», sagte sie. «Kein Mensch kann sich vorstellen, wie es in Frankreich ist. Wenn doch, könnte das alles nicht weitergehen. Er hatte keine Säbelwunde. Er wurde in die Luft gesprengt.»
Ich sagte nichts.
«Meinen Sie, es wird immer weitergehen?»
«Nein.»
«Wie soll es denn aufhören?»
«Irgendwo wird der Faden reißen.»
«Uns wird es zerreißen. In Frankreich. Man kann nicht weiter so etwas wie an der Somme tun und nicht zerrissen werden.»
«Dazu wird es hier nicht kommen», sagte ich.
«Meinen Sie?»
«Ja. Vorigen Sommer haben sie sich hier sehr gut geschlagen.»
«Es könnte uns zerreißen», sagte sie. «Jeden kann es zerreißen.»
«Die Deutschen auch.»
«Nein», sagte sie. «Das glaube ich nicht.»
Wir gingen zu Rinaldi und Miss Ferguson.
«Gefällt Ihnen Italien?», fragte Rinaldi Miss Ferguson auf Englisch.
«Recht gut.»
«Nicht verstehen.» Rinaldi schüttelte den Kopf.
«Abbastanza bene», übersetzte ich. Er schüttelte den Kopf.
«Also nicht gut. Und England?»
«Nicht besonders. Ich bin aus Schottland.»
Rinaldi sah mich verständnislos an.
«Sie ist Schottin, also liebt sie Schottland mehr als England», sagte ich auf Italienisch.
«Aber Schottland ist doch England.»
Ich übersetzte das für Miss Ferguson.
«Pas encore», sagte Miss Ferguson.
«Noch nicht?»
«Niemals. Wir mögen die Engländer nicht.»
«Nicht mögen die Engländer? Nicht mögen Miss Barkley?»
«Oh, das ist was andres. Sie dürfen nicht alles so wörtlich nehmen.»
Nach einer Weile verabschiedeten wir uns und gingen. Unterwegs sagte Rinaldi: «Miss Barkley hat dich lieber als mich. Das ist ganz deutlich. Aber die kleine Schottin ist sehr hübsch.»
«Sehr», sagte ich. Ich hatte nicht auf sie geachtet. «Magst du sie?»
«Nein», sagte Rinaldi.
Kapitel 5
Am nächsten Nachmittag ging ich Miss Barkley wieder besuchen. Da sie nicht im Garten war, ging ich zum Nebeneingang der Villa, wo die Krankenwagen vorfuhren. Drinnen erfuhr ich von der Oberschwester, dass Miss Barkley Dienst hatte – «wir haben Krieg, falls Sie’s noch nicht wissen.»
Ich sagte, das wisse ich.
«Sind Sie der Amerikaner in der italienischen Armee?», fragte sie.
«Ja, Ma’am.»
«Wieso tun Sie das? Warum sind Sie nicht zu uns gekommen?»
«Ich weiß nicht», sagte ich. «Ginge das jetzt noch?»
«Leider nein. Warum haben Sie sich den Italienern angeschlossen?»
«Ich war in Italien», sagte ich, «und kann Italienisch.»
«Oh», sagte sie. «Ich lerne noch. Eine schöne Sprache.»
«Jemand hat behauptet, dass man es in zwei Wochen lernen kann.»
«Oh, ich werde es nicht in zwei Wochen lernen. Ich versuche es schon seit Monaten. Wenn Sie sie besuchen wollen, kommen Sie nach sieben. Dann hat sie frei. Aber bringen Sie nicht so viele Italiener mit.»
«Nicht mal wegen der schönen Sprache?»
«Nein. Und auch nicht wegen der schönen Uniformen.»
«Guten Abend», sagte ich.
«Arrivederci, Tenente.»
«Arrivederla.» Ich salutierte und ging. Es war mir sehr peinlich, vor Ausländern auf italienische Art zu salutieren. Der italienische Salut schien nicht für den Export gemacht.
Es war ein heißer Tag gewesen. Ich hatte mir den Brückenkopf flussaufwärts bei Plava angesehen. Dort sollte die Offensive beginnen. Im Jahr zuvor hatte man nicht auf die andere Seite vorrücken können, weil nur eine einzige Straße vom Pass hinunter zu der Pontonbrücke führte, und die hatte auf einer Strecke von fast einer Meile unter Maschinengewehr- und Granatfeuer gestanden. Außerdem war sie nicht breit genug zum Transport des Nachschubs für eine Offensive, sodass die Österreicher alles in Schutt und Asche hätten legen können. Aber die Italiener hatten den Fluss überquert und sich auf der österreichischen Seite etwa anderthalb Meilen weit ausgebreitet. Ein gefährliches Gelände, eigentlich hätten die Österreicher sie nicht so weit vorrücken lassen dürfen. Vielleicht tolerierte man sich gegenseitig, weil die Österreicher immer noch einen Brückenkopf weiter flussabwärts hielten. Die österreichischen Gräben befanden sich oben am Hang, nur wenige Meter von den italienischen Linien entfernt. Dort hatte es ein Dorf gegeben, das dem Erdboden gleichgemacht worden war. Der Bahnhof lag in Trümmern, ebenso eine feste Brücke, die sich nicht wiederherstellen ließ, weil sie ohne Deckung war.
Ich fuhr die schmale Straße zum Fluss hinunter, ließ den Wagen am Verbandsplatz am Fuß des Hügels stehen, überquerte die von einem Vorsprung des Bergs geschützte Pontonbrücke und ging durch die Gräben in dem zerstörten Dorf und dann unten an der Böschung entlang. Alle waren in den Unterständen. In Gestellen standen Signalraketen bereit, mit denen, falls die Telefonleitungen zerschnitten wurden, die Artillerie zur Unterstützung gerufen werden konnte. Es war still, heiß und schmutzig. Ich spähte über den Drahtverhau nach den österreichischen Linien. Dort war niemand zu sehen. Ich trank in einem Unterstand etwas mit einem Hauptmann, den ich kannte, und ging über die Brücke zurück.
An dem Berghang wurde eine neue breite Straße angelegt, die in Serpentinen zur Brücke führte. Wenn sie fertig wäre, würde die Offensive beginnen. Sie wand sich in scharfen Kurven durch den Wald. Der Plan war, über die neue Straße alles nach unten zu bringen und die leeren Lastwagen und Karren und die beladenen Krankenwagen und den anderen zurückgehenden Verkehr über die alte schmale Straße zu leiten. Der Verbandsplatz lag am Fuß des Hügels auf der österreichischen Seite des Flusses, und die Sanitäter brachten die Verwundeten über die Pontonbrücke in Sicherheit. So sollte es auch während der Offensive sein. Soweit ich das erkennen konnte, würden die Österreicher die letzte Meile der neuen Straße, dort, wo sie in flacheres Gelände kam, leicht unter Beschuss nehmen können. Das sah mir ganz und gar nicht gut aus. Aber ich fand eine Stelle, wo die Wagen nach diesem letzten, übel aussehenden Stück in Deckung gehen und warten konnten, dass die Verwundeten über die Pontonbrücke gebracht wurden. Ich hätte die neue Straße gern einmal abgefahren, aber sie war noch nicht fertig. Sie schien breit und fest gebaut, das Gefälle unproblematisch, die Kurven sehr beeindruckend, wo man sie an freien Stellen auf dem bewaldeten Berghang sehen konnte. Die Krankenwagen mit ihren starken Metallbremsen würden dort gut zurechtkommen und wären ohnehin auf der Fahrt nach unten nicht beladen. Ich fuhr auf der schmalen Straße wieder nach oben.
Zwei Carabinieri hielten mich an. Eine Granate war eingeschlagen, und während wir warteten, schlugen oben auf der Straße drei weitere ein. Es waren Siebenundsiebziger, die zischend angeflogen kamen, ein hartes Krachen, ein Blitz und dann grauer Rauch, der über die Straße wehte. Die Carabinieri winkten uns weiter. Wo die Granaten eingeschlagen waren, umkurvte ich die kleinen beschädigten Stellen, es roch nach Sprengstoff und nach aufgeworfenem Lehmboden und frisch zertrümmertem Feuerstein. Ich fuhr zu unserer Villa nach Gorizia zurück und ging, wie gesagt, Miss Barkley besuchen, die aber noch Dienst hatte.
Nach einem hastigen Abendessen ging ich wieder zu der Villa, in der die Briten ihr Lazarett hatten. Ein sehr großes und schönes Haus mit prächtigen Bäumen auf dem Gelände. Miss Barkley saß auf einer Bank im Garten. Miss Ferguson war bei ihr. Sie schienen froh, mich zu sehen, und nach einer Weile entschuldigte sich Miss Ferguson und ging weg.
«Ich lass euch zwei allein», sagte sie. «Ihr kommt auch ohne mich sehr gut miteinander aus.»
«Geh nicht, Helen», sagte Miss Barkley.
«Doch. Ich muss ein paar Briefe schreiben.»
«Gute Nacht», sagte ich.
«Gute Nacht, Mr. Henry.»
«Schreiben Sie nichts, woran sich der Zensor stören könnte.»
«Keine Sorge. Ich schreibe nur, wie schön es hier ist und wie tapfer die Italiener sind.»
«Dafür werden Sie einen Orden bekommen.»
«Das würde mich freuen. Gute Nacht, Catherine.»
«Ich komme bald nach», sagte Miss Barkley. Miss Ferguson verschwand in der Dunkelheit.
«Sie ist nett», sagte ich.
«O ja, sehr nett. Sie ist Krankenschwester.»
«Sind Sie das nicht auch?»
«O nein. Ich bin beim V.A.D. Wir arbeiten sehr hart, aber niemand traut uns.»
«Warum?»
«Man traut uns nicht, wenn nichts los ist. Wenn richtig was zu tun ist, traut man uns.»
«Wie kommt das?»
«Eine Krankenschwester ist so was wie ein Arzt. Man braucht eine lange Ausbildung. Eine vom V.A.D. hat die Abkürzung genommen.»
«Verstehe.»
«Die Italiener wollten keine Frauen so nah an der Front. Deshalb sind wir hier sehr eingeschränkt. Wir dürfen nicht ausgehen.»
«Aber ich kann herkommen.»
«O ja. Wir sind hier nicht im Kloster.»
«Lassen wir den Krieg.»
«Wie soll das gehen? Wo kann man ihn lassen?»
«Lassen wir ihn trotzdem.»
«Na gut.»
Wir sahen uns in der Dunkelheit an. Ich fand sie sehr schön und nahm ihre Hand. Sie ließ sie mir, und ich hielt sie und nahm sie in den Arm.
«Nein», sagte sie. Ich ließ meinen Arm, wo er war.
«Warum nicht?»
«Nein.»
«Doch», sagte ich. «Bitte.» Als ich mich im Dunkeln vorbeugte und sie küssen wollte, sah ich einen scharfen, stechenden Blitz. Sie hatte mir hart ins Gesicht geschlagen. Ihre Hand hatte mich auf Nase und Augen getroffen, und unwillkürlich traten mir Tränen in die Augen.
«Tut mir leid», sagte sie. Ich glaubte, jetzt sozusagen im Vorteil zu sein.
«Du hast ja recht.»
«Tut mir furchtbar leid», sagte sie. «Ich will bloß nicht als eine dastehen, die so etwas für ein Feierabendvergnügen hält. Ich wollte dir nicht weh tun. Aber ich hab dir weh getan, oder?»
Sie sah mich in der Dunkelheit an. Ich war wütend, mir aber meiner Sache sicher; ich sah schon alles vor mir wie die Züge in einer Schachpartie.
«Du hast vollkommen recht», sagte ich. «Lass es gut sein.»
«Armer Mann.»
«Du musst verstehen, was für ein merkwürdiges Leben ich führe. Nie kann ich mal englisch sprechen. Und dann bist du so schön.» Ich sah sie an.
«Du brauchst dich nicht rauszureden. Ich sage doch, es tut mir leid. Wir vertragen uns.»
«Ja», sagte ich. «Und wir haben nicht mehr vom Krieg gesprochen.»
Sie lachte. Es war das erste Mal, dass ich sie lachen hörte. Ich beobachtete sie.
«Du bist nett», sagte sie.
«Nein, bin ich nicht.»
«Doch, du bist lieb. Ich würde dich gerne küssen, wenn du nichts dagegen hast.»
Ich sah ihr in die Augen, nahm sie wieder in den Arm und küsste sie. Ich küsste sie stürmisch und drückte sie an mich und versuchte, ihre Lippen zu öffnen; sie blieben fest geschlossen. Ich war immer noch wütend, und plötzlich begann sie in meinen Armen zu zittern. Ich drückte sie an mich und fühlte ihr Herz schlagen, und ihre Lippen öffneten sich, und ihr Kopf sank in meine Hand, und dann weinte sie an meiner Schulter.
«Oh, Darling», sagte sie. «Du wirst gut zu mir sein, ja?»
Was soll’s, dachte ich. Ich strich ihr übers Haar und tätschelte ihre Schulter. Sie weinte.
«Sag ja, bitte.» Sie sah zu mir auf. «Weil wir ein nicht alltägliches Leben führen werden.»
Nach einer Weile begleitete ich sie zum Eingang der Villa, sie ging hinein, und ich lief nach Hause. Zurück in der Villa, ging ich nach oben aufs Zimmer. Rinaldi lag auf seinem Bett. Er sah mich an.
«Du kommst bei Miss Barkley voran?»
«Wir sind Freunde.»
«Du wirkst so sympathisch wie ein läufiger Hund.»
Ich verstand den italienischen Ausdruck nicht.
«Wie ein was?»
Er erklärte es mir.
«Du hingegen», sagte ich, «wirkst so sympathisch wie ein Hund, der –»
«Hör auf», sagte er. «Sonst werfen wir uns noch Beleidigungen an den Kopf.» Er lachte.
«Gute Nacht», sagte ich.
«Gute Nacht, kleiner Welpe.»
Ich warf seine Kerze mit dem Kopfkissen um und legte mich im Dunkeln ins Bett.
Rinaldi hob die Kerze auf, zündete sie an und las weiter.
Kapitel 6
Zwei Tage lang war ich draußen bei den Stellungen. Als ich zurückkam, war es zu spät, sodass ich Miss Barkley erst am nächsten Abend wiedersah. Sie war nicht im Garten, und ich musste im Büro des Lazaretts warten, bis sie nach unten kam. Dort standen viele Marmorbüsten auf lackierten Holzsäulen an den Wänden des Zimmers, das als Büro genutzt wurde. Auch im Flur vor dem Büro standen welche. Wie bei Marmor üblich, sahen sie alle gleich aus. Ich hatte mit Bildhauerei nie etwas anfangen können – obwohl Bronzen schon nach etwas aussahen. Aber bei Marmorbüsten musste ich immer an Friedhof denken. Allerdings gab es einen sehr schönen Friedhof – den in Pisa. Während man in Genua nur ganz schlechte Marmorbüsten sah. Die Villa hatte einem schwerreichen Deutschen gehört, und die Büsten mussten ihn einiges gekostet haben. Ich fragte mich, wer sie gemacht und wie viel er dafür bekommen hatte. Ich versuchte zu erkennen, ob sie Familienähnlichkeiten aufwiesen, aber sie waren unterschiedslos klassisch. Man konnte nichts über sie sagen.
Ich saß auf einem Stuhl und hielt meine Mütze in der Hand. Eigentlich sollten wir auch in Gorizia Stahlhelme tragen, aber die waren unbequem und wirkten unangebracht theatralisch in einer Stadt, die nicht von der Zivilbevölkerung geräumt worden war. Ich trug meinen nur, wenn wir zu den Stellungen fuhren, und da hatte ich auch eine englische Gasmaske dabei. Wir hatten gerade die ersten geliefert bekommen. Richtige Gasmasken. Wir mussten auch eine Selbstladepistole tragen – sogar die Ärzte und Sanitätsoffiziere. Ich spürte sie an der Stuhllehne. Wer sie nicht sichtbar bei sich trug, wurde mit Arrest bestraft. Rinaldi hatte sein Halfter mit Toilettenpapier ausgestopft. Ich selbst trug eine und hielt mich für einen guten Schützen, bis ich die ersten Schießübungen damit machte. Es war eine Astra Kaliber 7,65 mit kurzem Lauf und einem so heftigen Rückstoß, dass an Treffen gar nicht zu denken war. Ich übte damit, indem ich auf eine Stelle unterhalb der Scheibe zielte und den Schlag des lächerlich kurzen Laufs auszugleichen versuchte, bis ich aus zwanzig Schritt Entfernung nur noch höchstens einen Meter danebenschoss, und dann ging mir auf, wie lächerlich es war, überhaupt eine Pistole zu tragen, und bald vergaß ich sie und trug sie locker im Kreuz, ohne überhaupt etwas zu empfinden außer einem vagen Schamgefühl, wenn ich englischsprechenden Leuten begegnete. Jetzt saß ich auf dem Stuhl, und irgendein Sanitäter sah mich hinter einem Schreibpult missbilligend an, während ich den Marmorboden, die Säulen mit den Marmorbüsten und die Fresken an der Wand betrachtete und auf Miss Barkley wartete. Die Fresken waren nicht schlecht. Alle Fresken waren gut, wenn sie anfingen, sich von der Wand abzuschälen.
Ich sah Catherine Barkley durch den Flur herankommen und stand auf. Sie schien nicht groß, als sie auf mich zukam, sah aber ganz reizend aus.
«Guten Abend, Mr. Henry», sagte sie.
«Guten Abend», sagte ich. Der Sanitäter lauschte hinter dem Tisch.
«Wollen wir uns hier setzen oder in den Garten gehen?»
«Gehen wir nach draußen. Da ist es kühler.»
Ich folgte ihr in den Garten, der Sanitäter sah uns nach. Als wir auf der Kieseinfahrt standen, sagte sie: «Wo bist du gewesen?»
«Auf Posten.»
«Hättest du mir keine Nachricht schicken können?»
«Nein», sagte ich. «Das ging nicht. Außerdem dachte ich, ich käme bald zurück.»
«Du hättest mir Bescheid sagen sollen, Darling.»
Wir verließen die Einfahrt und gingen zwischen den Bäumen umher. Ich nahm ihre Hände, blieb stehen und küsste sie.
«Können wir uns nicht irgendwohin verziehen?»
«Nein», sagte sie. «Wir bleiben hier. Du warst lange fort.»
«Drei Tage. Aber jetzt bin ich zurück.»
Sie sah mich an. «Und liebst du mich?»
«Ja.»
«Du hast doch gesagt, dass du mich liebst?»
«Ja», log ich. «Ich liebe dich.» Bis dahin hatte ich es noch nicht gesagt.
«Und du sagst Catherine zu mir?»
«Catherine.» Wir gingen weiter und blieben unter einem Baum stehen.
«Sag: ‹Ich bin abends zu Catherine zurückgekommen.›»
«Ich bin abends zu Catherine zurückgekommen.»
«Oh, Darling, du bist doch zurückgekommen?»
«Ja.»
«Ich liebe dich so sehr, es war schrecklich. Du verlässt mich nicht?»
«Nein. Ich werde immer zurückkommen.»
«Oh, ich liebe dich so sehr. Bitte leg deine Hand wieder dorthin.»
«Die war gar nicht fort.» Ich drehte sie so, dass ich ihr Gesicht sehen konnte, als ich sie küsste, und sah, dass sie die Augen geschlossen hatte. Ich küsste sie auf die geschlossenen Lider. Ich hielt sie für ein bisschen verrückt. Und wennschon, dachte ich. Es kümmerte mich nicht, worauf ich mich da einließ. Immer noch besser, als jeden Abend in das Haus für Offiziere zu gehen, wo die Mädchen sich an einen heranschmissen und einem zum Zeichen ihrer Zuneigung, wenn sie mit Offizierskameraden nach oben gingen, die Mütze abnahmen und verkehrt herum aufsetzten. Ich wusste, ich liebte Catherine Barkley nicht, und hatte auch nicht vor, sie zu lieben. Es war ein Spiel, wie Bridge, nur dass man irgendetwas sagte, statt Karten auf den Tisch zu werfen. Wie beim Bridge musste man so tun, als spiele man um Geld oder sonst einen Einsatz. Um welchen Einsatz es ging, hatte niemand erwähnt. Mir sollte es recht sein.
«Wenn wir uns bloß irgendwohin verziehen könnten», sagte ich. Ich hatte wie alle Männer Probleme damit, längere Zeit im Stehen Zärtlichkeiten auszutauschen.
«Wir können nirgends hin», sagte sie, zurück von dort, wo immer sie gewesen war.
«Wir könnten uns ein Weilchen setzen.»
Wir ließen uns auf der flachen Steinbank nieder, und ich hielt Catherine Barkleys Hand.
«Bist du sehr müde?», fragte sie.
«Nein.»
Sie sah ins Gras hinunter.
«Ist das nicht ein blödes Spiel, das wir hier treiben?»
«Was für ein Spiel?»
«Stell dich nicht dumm.»
«Tu ich nicht, nicht mit Absicht.»
«Du bist nett», sagte sie. «Und du spielst es, so gut du kannst. Aber es ist ein blödes Spiel.»
«Weißt du immer, was die Leute denken?»
«Nicht immer. Aber bei dir weiß ich es. Du brauchst nicht so zu tun, als ob du mich liebst. Für heute reicht’s. Möchtest du mit mir von was anderem reden?»
«Aber ich liebe dich wirklich.»
«Bitt, lass uns nicht lügen, wenn es nicht nötig ist. Ich habe das eben sehr genossen, und jetzt bin ich zufrieden. Verstehst du, ich bin nicht verrückt, und wütend bin ich auch nicht. Nur manchmal ein bisschen.»
Ich drückte ihre Hand. «Catherine, meine Liebe.»
«Wie komisch sich das jetzt anhört – Catherine. Du sprichst es ganz anders aus. Aber du bist sehr nett. Ein sehr netter Junge.»
«Das hat der Priester auch gesagt.»
«Ja, du bist sehr gut. Kommst du mich weiter besuchen?»
«Aber ja.»
«Und du brauchst nicht zu sagen, dass du mich liebst. Es reicht für eine Weile.» Sie stand auf und reichte mir die Hand. «Gute Nacht.»
Ich wollte sie küssen.
«Nein», sagte sie. «Ich bin furchtbar müde.»
«Küss mich trotzdem», sagte ich.
«Ich bin furchtbar müde, Darling.»
«Küss mich.»
«Willst du es so sehr?»
«Ja.»
Wir küssten uns, dann stieß sie sich plötzlich ab. «Nein. Gute Nacht, bitte, Darling.» Wir gingen zur Tür, und ich sah sie hineingehen und im Flur verschwinden. Ich mochte es, wie sie sich bewegte. Sie ging den Flur hinunter. Ich ging nach Hause. Es war ein warmer Abend, und oben in den Bergen war einiges los. Über San Gabriele blitzten die Geschütze.
Ich blieb vor der Villa Rossa stehen. Die Rollläden waren hochgezogen, aber drinnen war noch Betrieb. Jemand sang. Ich ging weiter nach Hause. Als ich mich auszog, kam Rinaldi herein.
«Aha!», sagte er. «Es läuft nicht gut. Der Kleine ist durcheinander.»
«Wo warst du?»
«In der Villa Rossa. Sehr erbaulich, Kleiner. Wir haben alle gesungen. Und wo warst du?»
«Zu Besuch bei den Briten.»
«Gott sei Dank, dass ich mit den Briten nichts zu tun habe.»
Kapitel 7
Als ich am nächsten Tag von unserem ersten Gebirgsposten zurückkam, parkte ich vor dem Smistamento, wo die Verwundeten und Kranken anhand ihrer Papiere sortiert und die Papiere für die verschiedenen Lazarette ausgestellt wurden. Ich hatte den Wagen gefahren und blieb sitzen, während der Fahrer die Papiere hineinbrachte. Es war ein heißer Tag, und der Himmel war sehr hell und blau und die Straße weiß und staubig. Ich saß auf dem hohen Sitz des Fiat und dachte an nichts. Ein Regiment marschierte auf der Straße vorbei, und ich sah mir die Männer an. Sie waren erhitzt und schwitzten. Einige trugen ihren Stahlhelm, aber die meisten hatten ihn an ihren Rucksack gehängt. Die meisten Helme waren zu groß und gingen denen, die sie trugen, fast über die Ohren. Die Offiziere trugen alle ihren Helm; denen passten sie besser. Es war die halbe Brigata Basilicata. Ich erkannte sie an den rot und weiß gestreiften Kragenspiegeln. Einige Nachzügler folgten dem Regiment in weitem Abstand – Männer, die mit den anderen nicht mehr Schritt halten konnten. Sie waren verschwitzt und staubbedeckt und erschöpft. Manche sahen ziemlich schlecht aus. Nach den letzten Nachzüglern kam noch ein einzelner Soldat. Er zog ein Bein nach. Er blieb stehen und setzte sich an den Straßenrand. Ich stieg aus und ging zu ihm rüber.
«Was ist?»
Er sah mich an und stand auf.
«Ich gehe weiter.»
«Was ist denn?»
«– der Krieg.»
«Was ist mit deinem Bein?»
«Gar nichts. Ich habe einen Leistenbruch.»
«Warum lässt du dich nicht fahren?», fragte ich. «Warum gehst du nicht ins Lazarett?»
«Die lassen mich nicht. Der Leutnant sagt, ich hätte das Bruchband absichtlich verbummelt.»
«Lass mich mal fühlen.»
«Müsste deutlich zu fühlen sein.»
«Welche Seite?»
«Hier.»
«Husten», sagte ich.
«Davon könnte es noch schlimmer werden. Es ist jetzt schon doppelt so dick wie heute früh.»
«Setz dich. Wenn ich die Papiere für diese Verwundeten habe, fahre ich dich zu deinem Sanitätsoffizier.»
«Der wird sagen, ich hätt’s mit Absicht getan.»
«Die können nichts machen», sagte ich. «Das ist keine Verletzung. Du hattest das doch schon vorher, oder?»
«Aber ich hab das Bruchband verloren.»