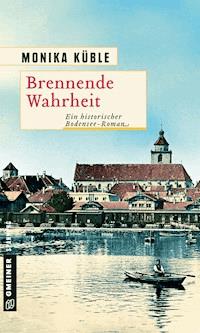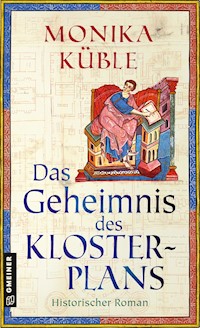Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Oktober 1414. Kaum ist der junge Bäcker Cunrat Wolgemut in Konstanz eingetroffen, um während des Konzils sein Glück zu finden, gerät er auch schon in Schwierigkeiten: Er wird in eine Schlägerei verwickelt, seine heiratswütige Base stellt ihm nach und sein Freund wird tot aufgefunden. Bald gibt es weitere Tote und Cunrat wird klar, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Gemeinsam mit dem Bäcker Giovanni Rossi und dem Humanisten Poggio Bracciolini macht er sich auf, das Geheimnis um die Toten zu lüften …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1119
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M. Küble / H. Gerlach
In Nomine Diaboli
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Wolgemut Oktober 1414. Tausende Menschen strömen zum Konzil nach Konstanz: König und Papst, Kardinäle, Bischöfe, Handwerker, Gaukler und Dirnen. Doch mit ihnen hält auch der Tod Einzug in die Stadt. Eine unheimliche Serie von Mordfällen überschattet die ersten Monate der großen Kirchenversammlung: Ein Mann wird erhängt aufgefunden, ein anderer kommt durch Gift ums Leben, eine Frau stürzt von der Stadtmauer. Der Stadtvogt steht vor einem Rätsel, und die Bürger glauben, der Teufel sei am Werk, denn auf den ersten Blick scheint die Toten nichts zu verbinden. Doch der schwäbische Bäckergeselle Cunrat Wolgemut, dessen Freund ermordet wurde, beginnt gemeinsam mit seinem venezianischen Kollegen Giovanni Rossi und dem Humanisten Poggio Bracciolini Nachforschungen anzustellen. Dabei werden die drei in einen Strudel von Ereignissen gezogen, der die Grundfesten des Konzils zu erschüttern droht, und als sie erkennen, welch perfider Mörder hier am Werk ist, ist es schon fast zu spät.
Monika Küble stammt aus Oberschwaben und hat Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Perugia und Konstanz studiert. Neben Publikationen zu oberschwäbischer Literatur und italienischer Architektur hat sie unter dem Pseudonym Helene Wiedergrün drei Oberschwabenkrimis geschrieben: »Der Tote in der Grube«, »Der arme schwarze Kater« (beide als E-Book bei Gmeiner) und »Blutmadonna« (Gmeiner 2013). Sie arbeitet außerdem als Italienischlehrerin und Dolmetscherin.
Henry Gerlach kam schon als Student aus Hamburg an den Bodensee, wo er Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert hat. Er ist Experte für das Konzil von Konstanz und hat gemeinsam mit Monika Küble den Konzilsroman »In Nomine Diaboli« veröffentlicht, der 2013 beim Gmeiner-Verlag erschien.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag von Monika Küble:
Brennende Wahrheit (2017)
Das Geheimnis der Ordensfrau (mit Henry Gerlach, 2016)
Der arme schwarze Kater (als Helene Wiedergrün, E-Book Only 2015)
Der Tote in der Grube (als Helene Wiedergrün, E-Book Only 2015)
In Nomine Diaboli (2013)
Blutmadonna (als Helene Wiedergrün,2013)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
9. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Cappella tornabuoni, Annuncio dell’angelo a San Zaccaria« von Domenico Ghirlandaio;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domenico_ghirlandaio,_cappella_Tornabuoni,_annuncio_dell%27angelo_a_zaccaria,_detail.jpg
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-4242-1
Venedig, September 1414
Nebel liegt über der Stadt und der Lagune, wälzt sich wie kalter Rauch die Kanäle entlang, dringt mit Geisterfingern in die schmalen, hohen Gassen ein, verhüllt mit feinem Gespinst die Kuppeln und den Campanile von San Marco.
Langsam pendelt im Morgennebel ein Leichnam hin und her, dreht sich dann und wann gemächlich um sich selbst. An einem Fuß aufgehängt, wie ein geschlachtetes Schwein, baumelt er von einem Gerüst zwischen den beiden Prunksäulen auf der Piazzetta, der kleinen Schwester der Piazza San Marco. Am Hals des Toten dunkle Male, offenbar wurde er erwürgt. Vorher aber hat man ihn gefoltert, sein geschundener Körper ist übersät mit Wunden, die ihm zugefügt wurden beim Versuch, ihn zum Reden zu bringen.
Nach und nach belebt sich der Platz, Menschen kommen vorbei, ein paar Fischer zunächst, dann eilige Händler auf dem Weg zu den Kontoren, Frauen, die schon früh zum Markt wollen. Beim Anblick des Toten verlangsamen sie ihren Schritt, verharren einen Moment und bekreuzigen sich, doch dann senken sie die Augen und gehen rasch weiter. Niemand weiß, wer da am Gerüst hängt, und niemand wird es je erfahren. Der Rat der Zehn hat wieder zu Gericht gesessen.
Andrea Dandolo eilt die Stufen des Dogenpalastes hinauf. Den Toten hat er durch den Nebel schemenhaft von Weitem hängen sehen und einen Augenblick gelächelt. Wieder ein Verräter bestraft. Das wird die anderen hoffentlich abschrecken. Im ersten Stock hastet er an den ›Löwenmäulern‹ vorbei, den Briefschlitzen mit der Aufschrift Denontie secrete, anonyme Anzeigen, dann läuft er weiter bis ins dritte Obergeschoss. Dort reißt er eine Tür neben dem Senatssaal auf und tritt ein. Zwei Männer erwarten ihn bereits. Sie sind ebenso prächtig gekleidet wie er, mit seidenem Wams, eleganten roten und schwarzen Beinlingen und kostbaren Samtmänteln, deren Ärmel mit Arabesken aus Goldfäden bestickt sind. Venedig ist das Zentrum der Welt, der Handelswelt zumindest, und hier gibt es alles zu kaufen, was ein wertvolles Gewand ausmacht. Einer der beiden Männer trägt über dem kurzen schwarzen Haar ein grünes Barett, das zur Farbe seines Mantels passt. Die Haare des zweiten sind länger und rötlich-weiß. Das Alter und die Strenge haben tiefe Furchen um seinen Mund gegraben.
»Ihr seid spät, Dandolo!«, eröffnet der Rote missmutig das Gespräch.
Dandolo lächelt maliziös.
»Im Gegensatz zu Euch, Venier, habe ich hin und wieder Pflichten zu erfüllen, die mich etwas länger ans Bett fesseln. Aber nun bin ich ja hier.«
Der Schwarzhaarige wird ungeduldig.
»Ihr wisst, worum es geht. Der Senat muss unserem Vorschlag zustimmen, sonst stehe Gott uns bei!«
»Lasst Gott aus dem Spiel!«, winkt der Alte ab. »Das hier ist unsere Sache.«
»Habt Ihr mit ihm gesprochen, Prioli?«, will Dandolo wissen.
Der Schwarze nickt.
»Wie viel will er haben?«
»35.000. Die Hälfte als Anzahlung, den Rest danach.«
Dandolo pfeift durch die Zähne. Mit 35.000 Gulden kann man drei prächtige Paläste am Canal Grande bauen. Oder eine ausgedehnte Grafschaft auf der Terraferma erwerben. Oder zehn Galeeren ausrüsten. Nicht viele Kaufleute in Venedig besitzen so viel Geld. Sie werden dem Senat gute Argumente liefern müssen. Aber dafür sind sie da, die drei Capi, die Köpfe des Rats der Zehn.
»Und er braucht Zeit«, fährt Prioli fort.
»Was heißt das, er braucht Zeit? Er soll seinen Auftrag so schnell wie möglich ausführen! So war es vereinbart!«, faucht der Alte den Schwarzen an.
»Venier, beruhigt Euch, er braucht Zeit, um alles so gründlich vorzubereiten, dass ihm selbst nichts geschieht. Aber er wird den Auftrag erledigen.«
»Wegen mir kann er danach zum Teufel gehen!«
»Ihr wisst, er hat gute Referenzen. Es gibt keinen Besseren.«
»Es gibt keinen anderen!«, pflichtet Dandolo dem Schwarzen bei.
Venier murrt noch eine Weile, dann sind sie sich einig.
Als Dandolo am späten Nachmittag den Dogenpalast nach der Senatssitzung verlässt, ist er zufrieden. Es ist ihnen gelungen, die Regierenden Venedigs zu überzeugen, dass 35.000 Gulden nicht zu viel sind für die Sicherheit der Serenissima. Fast einstimmig haben die Senatoren die Ausgabe gebilligt. Dandolos Blick fällt erneut auf die Leiche des bestraften Verräters, was seine Genugtuung noch erhöht. Da hängt der tote Beweis für die Effizienz der venezianischen Geheimpolizei und ihrer Führer, des Rates der Zehn. Sie sind es, die die Republik vor allen Feinden schützen, äußeren wie inneren. Alle sollen vor ihnen erzittern, alle ohne Ausnahme!
Leichten Herzens geht er über die Piazza San Marco, durch das enge Gassengewirr bis zum Canal Grande, wo der Palast steht, der schon seit den Zeiten des großen Enrico Dandolo, des blinden Dogen und Eroberers von Konstantinopel, seiner Familie gehört. Dort wartet Violetta auf ihn. Es wird wieder eine lange Nacht werden.
Weinmond
Als Cunrat Wolgemut zum ersten Mal die Augen aufschlug, war er gestorben. Gottes Thron stand vor ihm, und der himmlische Vater hielt ihm das Kreuz vor Augen, mit seinem daran genagelten Sohn, über allem schwebte der Heilige Geist, und um den Thron flogen Engel mit Schriftbändern, die sangen »Siehe, dies ist mein eingeborener Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.«
Dann trat eine Heilige zu Cunrat, mit lieblichem Antlitz und sanftem Blick, und ihre milde Stimme fragte ihn, ob ihn dürste. Cunrat nickte, und sie reichte ihm einen himmlischen Trunk, der allerdings recht sauer schmeckte, und er wunderte sich, dass es selbst im Paradies Knechtewein gab. Doch er war’s zufrieden, denn er hatte nicht damit gerechnet, überhaupt ins Paradies zu kommen, nach all den Predigten, denen er bei den Barfüßern und den Dominikanern gelauscht hatte, über die Bestrafung der Sünder in der Hölle, und nach allem, was er getan hatte. Gottvater sah weiterhin huldvoll auf ihn herab, die Heilige lächelte ihn an, und da lächelte er auch und war glücklich.
Als Cunrat das zweite Mal die Augen öffnete, war Gottvater mitsamt seiner Engelsschar verschwunden. Ein weißes Gewölbe erstreckte sich über ihm, und um ihn herum tönte lautes Stöhnen. Er versuchte sich aufzurichten, doch in diesem Augenblick kam der Schmerz über ihn. Und mit dem Schmerz die Erinnerung.
*
Die Ledi glitt über den Bodensee. Ihr einziges Segel war hart gespannt vom Wind und trieb das Schiff von Meersburg in Richtung Costentz, sodass die Ruderer kaum etwas zu tun hatten. Der Lastkahn war schwer beladen, Fässer mit Wein und Getreide stapelten sich auf dem Deck, und Cunrat saß mit zwei weiteren Passagieren auf einem Brett am Heck, direkt vor dem Steuermann.
Es war ein sonniger Herbsttag mit kräftigem Wind, der die Wasseroberfläche kräuselte und die Männer frösteln ließ. Cunrat zog seinen Wollmantel enger um sich und die Gugel tiefer ins Gesicht, und er war nicht böse, dass er in der Mitte saß, sodass die beiden anderen ihm etwas von ihrer Wärme abgaben. Allerdings war der Mann rechts neben ihm so dick, dass Cunrat sich fragte, ob es für die Sicherheit des Bootes und seiner Ladung nicht besser gewesen wäre, ihn in die Mitte zu setzen. Doch der Steuermann, der ihnen die Plätze zugewiesen hatte, würde schon wissen, was er tat.
Der Dicke war Weinhändler aus Costentz und prahlte damit, was für ein Geschäft er mit den Gästen des Konzils machte, dass er den Knechtewein um das Doppelte verkaufte als zu gewöhnlichen Zeiten und den Rheinwein um das Dreifache. Normalerweise fuhr er auch nicht selbst mit, wenn Wein geholt wurde auf der anderen Seeseite in Meersburg, Überlingen oder Hagnau, aber heute hatte er zwei Winzer besucht, um mit ihnen über größere Lieferungen zu verhandeln.
»Die Pfaffen saufen, was das Zeug hält. Ich kann gar nicht so viel heranschaffen, wie sie hinabschütten!«
Er lachte dröhnend, dann zog er einen Weinschlauch unter seinem Mantel hervor und nahm einen kräftigen Schluck. Offenbar war er sich selbst ein guter Kunde.
»Trink mit mir, langer Lulatsch, das ist ein feiner Tropfen aus dem Elsass, nicht so ein saurer Dreimännerwein wie in den Fässern hier!«, sagte er zu Cunrat und klopfte ihm dabei so freundschaftlich auf den Rücken, dass der junge Mann zu husten anfing. Cunrat war an allerlei Spottnamen gewöhnt, denn die Natur hatte ihn nicht gerade mit Wohlgestalt gesegnet. Alles an ihm schien zu groß geraten, die Zähne, die Nase, die Ohren, ja der ganze Kerl überragte seine Mitmenschen um Haupteslänge. Man konnte ihn nur schwerlich beleidigen, und einen Schluck Elsässer war’s allemal wert. Also ließ er sich nicht zweimal bitten. Süß und stark rann der Wein durch seine Kehle, und er fühlte sich etwas wärmer.
»Da, Geselle«, wandte sich der Weinhändler nun an den Dritten, einen mürrisch dreinblickenden Mann mit langem, grauem Haar, dichtem Bart und einer Narbe über dem rechten Auge, der ein großes Bündel bei sich trug. Aber der winkte ab, ohne ein Wort zu sagen.
»Gewiss ein Ausländer!«, raunte der Dicke Cunrat ins Ohr. »Versteht wahrscheinlich unsere Sprache nicht. Komm, trink du noch einen Schluck!«
Und Cunrat trank, während der Weinhändler – »Johann Tettinger ist mein Name!« – ihm vom Concilium erzählte und wie die vielen Ausländer die Stadt unsicher machten, aber die Frauen – und hier begannen seine Augen zu leuchten – , die gemeinen Frauen, hohoho, da waren die welschen allen anderen vorzuziehen, und er verdrehte die Augen bei der Erinnerung an unerhörte Vergnügungen, die er Cunrat ins Ohr flüsterte. Dessen Ohren und Gesicht färbten sich langsam rot, ob vom Gehörten oder vom Wein, wusste er selber nicht recht, jedenfalls war ihm nun mehr heiß als kalt.
»Und? Was sagst du zu meinem Elsässer?«, fragte Tettinger. Cunrat sagte nie viel, er vermied es zu sprechen, wo immer möglich, denn zu seinem unschönen Äußeren hatte ihm Gott auch noch einen Sprachfehler aufgebürdet. Bisher hatte Tettinger das noch nicht bemerkt, denn er hatte selber ununterbrochen erzählt. Aber jetzt wartete er auf Antwort. Cunrat räusperte sich, dann sagte er knapp: »G… gut!«, und nickte fachmännisch.
»G… gut!«, äffte ihn der andere nach und lachte lauthals. Cunrat wurde noch röter als zuvor. Doch da klopfte ihm der Weinhändler gutmütig auf die Schulter und drängte ihm einen weiteren Schluck Wein auf. »Der ist nicht g… gut, sondern seeehr gut! Bei Meister Tettinger bekommst du nur reinsten Wein, nicht so gepanschtes Zeug wie in den anderen Weinstuben!«
Cunrat trank und fasste Mut.
»Herr, w… was ist ein D… dreimännerwein?«
Wieder lachte Tettinger und schüttelte den Kopf über so viel Unwissenheit. Dann zeigte er auf die Fässer.
»Das da ist Dreimännerwein aus Überlingen, so sauer, da braucht’s drei Männer, um ihn zu trinken, denn wenn ein Mann den trinken soll, müssen ihn zwei festhalten, und der Dritte muss ihm das Gesöff reinleeren!«
Der Weinhändler schüttete sich aus vor Lachen über seinen Witz, und Cunrat lachte verschämt mit.
»Ach so!«
»Der ist für die Knechte, mein Freund«, flüsterte Tettinger und deutete mit dem Kopf auf die Seeleute. »Aber wir, wir trinken den Elsässer! Vivat Concilium!« Und noch einmal hielt er dem Jungen seinen Schlauch hin: »Möge der heilige Otmar dafür sorgen, dass er immer gefüllt bleibe!«
Der Wind flaute langsam ab, und die Ruderer am Bug mussten sich nun kräftig ins Zeug legen, um den schweren Kahn voranzubringen. Schlag für Schlag umrundete die Lädine das waldig grüne Horn vor Costentz, man sah das Frauenkloster von Münsterlingen auf der südlichen Seeseite liegen, und dahinter, als ob er kaum eine halbe Tagesreise entfernt wäre, türmte sich der Säntis auf mit seiner Doppelspitze. Sie war bereits in Schnee gehüllt, denn Mitte Oktober war es plötzlich kalt geworden.
Und dann sahen sie Costentz.
Wie das himmlische Jerusalem lag die Stadt vor ihnen in der Morgensonne, umschlossen von hohen Mauern und zahlreichen Türmen, die zinnenbekrönt waren oder spitz bedacht, und darüber erhoben sich die mächtig aufragenden Zwillingstürme der Bischofskirche, gegen die alle anderen klein schienen, der Säntis unter den Türmen. An der Ostfassade des Münsters blinkten vier runde Kupferscheiben im Sonnenlicht wie goldene Münzen, als ob sie weithin rufen wollten: Komm Freund, hier ist gut Geld verdienen!
Darum war auch Cunrat unterwegs nach Costentz. Er war Bäckergeselle, aus dem Dorf des Prämonstratenser Klosters Weißenau, und als nun das große Concilium bevorstand, war eine Nachricht seines Onkels aus Costentz gekommen, dass er Hilfe brauche und Cunrat bei ihm einen schönen Batzen Geld verdienen könne. Der strenge Zunftzwang in der Stadt sei für die Zeit des Conciliums aufgehoben, nun könne jeder Handwerker nach Costentz kommen und seine Dienste anbieten, und so solle auch Cunrat nur schnell herüberkommen, er werde ihm die Fahrt bezahlen. Der Onkel war der Vetter seiner Mutter und besaß schon seit vielen Jahren eine Bäckerei in Costentz.
Cunrat, der noch nie am Bodensee gewesen war, hatte sich nicht lang bitten lassen. Er war 21 Jahre alt und lebte allein mit seiner Mutter. Sein Vater war lange tot, und der einzige Bruder war Schuhmacher geworden und nach Ravensburg gezogen, um dort eine Schuhmachermeisterstochter zu heiraten.
Die Mutter hatte bei Cunrats Abschied sehr geweint, aber er hatte ihr versprochen, sobald wie möglich wieder heimzukommen und ihr einen ordentlichen Beutel Geld mitzubringen, der die Not ihrer alten Tage lindern würde. So saß er nun mit seinem Bündel auf dem Schiff und schaute fasziniert auf die Stadt, die für die kommende Zeit sein Zuhause werden sollte.
Der Weinhändler bemerkte seine Begeisterung.
»Nun, was meinst du zu unserer schönen Stadt?«, fragte er mit einem Stolz in der Stimme, als ob er selbst sie eigenhändig bis zum höchsten Turme erbaut hätte, und sein Blick ging von Cunrat zu dem Fremden, der daneben saß und auf die Stadt starrte, aber immer noch den Eindruck erweckte, als ob er nichts verstünde.
»W… wunderbar!«, war alles, was Cunrat herausbrachte.
»W… wunderbar!«, kam das Echo von Tettinger. Dann erzählte er selber weiter. Dass der spitze Turm links vom Münster zu Sankt Stephan gehörte und der rechts davon zu Sankt Johann, und dass der Stadtturm ganz außen links der Raueneggturm war, wo die bösen Buben einsaßen, und der ganz rechts der Rheintorturm, und davor lag das Inselkloster der Dominikaner und hinter diesem die Niederburg, und da gab es die meisten Frauenhäuser. Und er begann mit so detaillierten Beschreibungen, dass Cunrat aus dem Rotwerden gar nicht mehr herauskam. Der Mann neben ihm schaute verächtlich zur Seite. Vielleicht verstand er ja doch Deutsch.
»Siehst du, und gleich da vorn, das große Haus in der Mauer, das ist das Kaufhaus. Da legen wir jetzt an und laden die Fässer aus. Und dann gehen wir einen trinken!«
Das Kaufhaus schob sich wie ein mächtiger Riegel vor die Stadt, mit drei Stockwerken, auf denen ein riesiges Dach noch einmal drei Fensterreihen zeigte. Cunrat hatte außer dem Kornhaus in Ravensburg noch nie ein so großes Gebäude gesehen.
»Gewaltig, nicht wahr?«, dröhnte die mächtige Stimme von Tettinger. »Das haben sich die Costentzer einiges kosten lassen. Steht auf 1000 Eichenpfählen! Da haben so viele Waren Platz, das kannst du dir gar nicht vorstellen.«
Sie fuhren durch die enge Lücke im Palisadenzaun, der die gesamte Seeseite der Stadt vor räuberischen Wellen und feindlichen Angreifern schützte, dann legten sie neben dem Kaufhaus am Landesteg an, der vom Konradstor ins Wasser hineinragte, der sogenannten Fischbrücke. Dort hatten bereits andere Schiffe festgemacht, und Cunrat sah beeindruckt, wie viele Waren ausgeladen wurden: Tuchballen und Pelze, Fässer mit Wein, Getreide, Salz oder Heringen, ganze Stöße von Rebstangen und allerlei mehr. Träger und Karrenschieber eilten auf dem schmalen Steg hin und her, schrien und fluchten und transportierten alles Gut durch das Stadttor und dann über eine steinerne Brücke, die das Tor mit dem Kaufhaus verband, um es in den weitläufigen Lagerräumen und Dachböden zu lagern, bis es weiter zu den Lagerstätten und Kellern in der Stadt gebracht würde.
Nachdem ihr Schiff angelegt hatte, kamen sofort einige Männer herbeigelaufen, um die neue Ware in Empfang zu nehmen. Ächzend stieg der Weinhändler zwischen zwei Fässern aus, was ohne die Hilfe der Träger beschwerlich gewesen wäre, und auch Cunrat balancierte mühsam vom Rand der Lädine auf den Steg und blieb dann erst einmal stehen, denn ihn schwindelte, ob von der ungewohnten Fahrt übers Wasser oder vom Wein, war ihm selbst nicht ganz klar. Der dritte Mann packte seinen Reisesack, machte einen Satz auf den Steg und ging ohne Gruß davon.
»Ich muss da hinauf!«, sagte Tettinger und wies auf den Fachwerkaufbau des Tores. »Steueramt!«, fügte er zur Erklärung hinzu und machte dabei ein Gesicht, als ob er in einen sauren Apfel gebissen hätte. Cunrat verstand. Hier musste der Weinhändler seine Ware verzollen, bevor er sie in den heimischen Keller bringen durfte.
Cunrat marschierte mit ihm durch das Tor. Auf der Stadtseite ging der See noch weiter, das Wasser drängte unter der steinernen Brücke ein Stück zwischen die Häuser hinein bis zu einem kleinen Platz. Dort standen einige hölzerne Marktbuden.
»Der Fischmarkt!«, erklärte Tettinger und wandte sich zur Treppe, die auf der Rückseite des Tores in den Turm hochführte.
Da bemerkte Cunrat in der Mitte des Platzes einen seltsamen mannshohen Käfig, wie für Vögel, nur viel größer.
»H… herr, w… was ist das?«, rief er Tettinger zu, »g… gibt es hier w… wilde Tiere?«
Er hatte auf einem Markt in Ravensburg einmal einen Bären gesehen, der Kunststücke vorführte.
Der Weinhändler lachte. Er schien sich sehr über den jungen Burschen zu amüsieren.
»Ja, die gibt es hier haufenweise! Aber solche mit zwei Beinen. Und wenn sie erst einmal drei Maß von meinem Wein getrunken haben, dann werden sie zu Bestien. Dann sperrt man sie hier ein. Und du kannst hingehen und sie ein wenig anspucken. Oder den Käfig drehen. Das gefällt ihnen besonders! Da spucken sie dann zurück, soviel sie getrunken haben! Hahaha! Pass nur auf, dass du nie in die Trülle kommst!«
Dabei hielt er Cunrat noch einmal seinen Weinschlauch hin, der unerschöpflich schien.
»Noch einen Schluck zum Abschied!«
Der junge Bäcker hatte aber schon genug getrunken, dafür, dass erst Mittag war, und die Trülle machte ihm Eindruck. So dankte er dem Weinhändler und ließ sich von ihm noch den Weg zur Bäckerei von Meister Katz erklären. Nach all den Schilderungen hatte er schon einen regelrechten Stadtplan im Kopf, allerdings einen, der Cunrats Mutter wohl nicht gefallen hätte, denn sie war eine fromme Frau und hatte ihren jüngsten Sohn in der Furcht des Herrn erzogen.
So schüttelten sich Cunrat und Tettinger zum Abschied die Hand, und der Dicke lud ihn ein, möglichst bald in seiner Weinstube Zur Haue vorbeizuschauen.
»Du bist ein rechter Kerl, mit dir ist gut reden!«, sagte er herzlich. »Wirst dein Glück machen hier in Costentz!« Dann wandte er sich zum Gehen.
Cunrat lachte: »G… gewiss, mein Herr!«, und schaute freudig auf die leuchtende Stadt, die ihn erwartete.
Zur selben Zeit hielt der Tod Einzug in Costentz. Kaum einer nahm Notiz von ihm, und diejenigen, die ihn sahen, erkannten ihn nicht.
Cunrat stapfte indes über eine weitere Brücke zum Fischmarkt hinüber. Auch hier waren viele Menschen unterwegs, und während er noch um sich schaute, rief ihn einer der Karrenschieber, die mit ihren zweirädrigen Wagen Fässer transportieren, laut an, er solle Platz machen. Cunrat wich zur Seite und stieß dabei an den Verkaufsstand einer Fischhändlerin. Diese keifte hinter ihrem Tisch hervor, er solle gefälligst aufpassen, wo er hintrete, er bringe ja ihre Ware durcheinander. Neugierig begutachtete der Bäcker, was für Fische sie zum Verkauf anbot: Kretzer und Felchen, Hechte und Aale, alles Fische vom Bodensee, doch dem Oberschwaben unbekannt. Daneben lagen, oder besser gesagt: saßen in zwei Reihen eine ganze Anzahl grüner Frösche, die so lebendig aussahen, als ob sie gleich davonhüpfen würden. Und ganz am Rand des Tisches räkelten sich in einer Schale unter- und übereinander Dutzende von Schnecken. Cunrat wurde flau im Magen. Solche Dinge hatte er im Kloster Weißenau nie gegessen, dort hatte es nur Forellen aus dem Mühlbach gegeben, und diese waren den Mönchen vorbehalten gewesen. In einer hölzernen Tonne neben dem Tisch lagen silbern glänzende Heringe, von grobem Salz bedeckt. Der an sich nicht unangenehme Geruch der Fische wurde überdeckt vom Gestank der Fischabfälle, die von den Händlern achtlos auf den Boden geworfen wurden und vor sich hin zu stinken begannen, während sie darauf warteten, dass die Stadtknechte den Marktplatz am Abend sauber fegten. Ein paar Katzen balgten sich darum.
Cunrat hielt sich die Nase zu und ging rasch zwischen den Ständen hindurch, in die Gasse zu seiner Linken, die hinter dem großen Kaufhaus vorbeiführte, dann stieg ihm endlich ein angenehmer und vertrauter Duft in die Nase: Er kam zur Marktstätte, dem großen Marktplatz, an dessen unterem, seezugewandtem Teil die Verkaufsstände der Bäcker aufgereiht waren, alle von gleicher Art, mit einer Tür und einem Fenster mit einem hölzernen Laden, den man zum Verkauf wie ein Vordach hochklappte. Cunrat spürte gleichzeitig den Hunger und den Wein. Die Wegzehrung, die seine Mutter ihm in das Bündel gepackt hatte, war längst aufgegessen. Seiner schlaksigen Gestalt sah man den Appetit nicht an, der ihn ständig plagte. Hier würde er bestimmt auch den Marktstand von Meister Katz finden, und der Onkel würde ihm ein Stück Brot nicht verweigern.
Am ersten Stand wies man ihn weiter, und schließlich fand er den Laden von Bäcker Katz, in dem zu Cunrats Überraschung eine Frau hinter dem Tisch stand. Sie war nicht mehr ganz jung, hatte die blonden Haare zu einem Zopfkranz geflochten und darunter ein rundes Gesicht mit kleinen Schweinsäuglein. Als sie ihn anlächelte und fragte, was er wünsche, sah er, dass ihr oben ein Zahn fehlte und unten zwei schwarze Stümpfe ihr Lächeln verunstalteten. Cunrat musste an seine Mutter denken, die, obwohl sie schon eine alte Frau von fast 50 Jahren war, noch alle Zähne besaß. Sie hatte ihm beigebracht, für die Gesundheit seiner Zähne nach jedem Essen den Mund auszuspülen und am Abend Kräuter zu kauen, Petersilie, Minze oder Liebstöckel. Er fragte sich, ob man diese Regeln hier nicht kannte. Stotternd erklärte er, wer er war, worauf das Lächeln noch breiter wurde und eine weitere Zahnlücke entblößte.
»Cunrat! Willkommen in Costentz! Ich bin Barbara, die Tochter von Hans Katz, deine Base. Mein Vater ist über Mittag nach Haus gegangen, zum Imbiss und um sich ein wenig auszuruhen. Wir haben so viel Arbeit! Gott sei Dank bist du da!«
Der junge Bäcker dankte für den Willkommensgruß und fragte dann vorsichtig, ob er vielleicht ein Stück Brot haben könne, er sei so hungrig. Barbara sah sich kurz im Laden um, wo in Holzregalen verschiedene Brote gestapelt waren, Pfundbrote und Kränze, weißes und dunkles Brot. Schließlich griff sie nach einem kleinen, spitzen Brotstück.
»Aber natürlich, nimm den hier«, sie reichte ihm den Pfennigwecken, »aber dann geh gleich nach Haus, dort wollen sie jetzt essen, da kannst du richtig mitessen, Fleisch und Suppe und Wein, aber nein, warte, ich mache den Laden zu und komm mit dir, du weißt ja den Weg nicht …«
Sie klappte den Holzladen herunter, verriegelte den Stand und ging Cunrat voraus durch die Stadt, wobei sie in einem fort redete. Die Costentzer scheinen gern zu schwätzen, dachte sich Cunrat, ob Weinhändler oder Bäckerstochter, mir soll’s recht sein, da muss ich selber nicht so viel von mir geben.
Barbara – »sag Bärbeli!« – führte ihn die Marktstätte hoch, wo rechter Hand das Spital zum Heiligen Geist und links der mächtige Kornspeicher lagen. Beide trugen denselben Treppengiebel und dasselbe Glockentürmchen und waren mit dem Costentzer Wappen – einem schwarzen Kreuz auf weißem Grund – geschmückt, sodass Cunrat gleich begriff, dass beide der Stadt gehörten. Am Kornspeicher konnte er die eingeritzten Vorlagen für die verschiedenen Costentzer Brote erkennen, an deren Ausmaße die Bäcker sich zu halten hatten.
Vor ihnen erhob sich mitten auf dem Platz die Große Metzig, und die beiden gingen links daran vorbei weiter die Marktstätte hinauf, auf der sich eine Krämerbude an die nächste reihte. Überall waren Menschen unterwegs, reiche Bürgersfrauen mit langen, farbigen Mänteln und hohen Hauben, Mägde in einfachen Gürtelkleidern und wollenen Übermänteln, Kaufleute mit pelzbesetzter Cotte und schweren Geldbörsen am Gürtel, Kleriker in schwarzem, weißem oder braunem Habit, und dazwischen Träger und Karrenfahrer, Wahrsagerinnen, Gaukler und Bettler.
Entlang der Metzig waren die Fleischstände aufgebaut. Auf den Holzbänken lagen Vögel jeder Art, Amseln, Drosseln, Enten und Gänse, daneben Fleisch vom Rind, Lamm oder Schwein. Über jeder Fleischbank war eine Querstange befestigt, an der die Waage hing, daneben baumelten Schenkel von Geißen und Schafen. Ein Metzger zerlegte mit einem mächtigen Beil gerade einen großen Hirsch, und – noch viel aufregender – am Stand daneben wurde Fleisch von einem Bären feilgeboten, Tatzen, die noch bluteten, und auf dem Tisch lag sein Kopf mit aufgerissenem Rachen.
Cunrat stand immer wieder still und staunte, ihm lief das Wasser im Munde zusammen, doch Bärbeli zog ihn rasch am Arm weiter. Schließlich bog sie links in die Mordergasse ein, die von stattlichen Bürgerhäusern gesäumt war. Da trat aus einem Hauseingang ein Mann mit einer seltsamen Kopfbedeckung: Wie ein umgekehrter Trichter saß sein Hut auf dem Kopf. Dazu trug er einen feinen, knielangen Mantel, und sein schwarzer Bart hing über die Brust herab. Cunrat starrte ihn überrascht an, doch den Mann schien das nicht zu stören. Er grüßte freundlich und ging an ihnen vorbei. Als Cunrat ebenfalls zum Gruß nickte, stieß Bärbeli ihn an und bekreuzigte sich.
»W… wer war das?«, wollte er wissen.
»Das war ein Jud!«, antwortete sie mit Abscheu in der Stimme.
»Ach?« Cunrat hatte von den Juden reden gehört, meist nichts Gutes, aber er hatte noch nie einen gesehen.
»Ja«, sprach Bärbeli wichtig weiter, während sie sich der Kirche des Augustinerklosters näherten, »in dem Haus wohnt der Gutman, da kam er wahrscheinlich her. Man sagt, hier war früher auch die Judenschule, aber die ist jetzt in der Sammlungsgasse. Die nehmen Wucherzinsen, mein Vater kann dir ein Lied davon singen! Als er einen neuen Ofen gebaut hat und Geld brauchte, da hat er ihnen ein großes Stück Land verschreiben müssen. Und außerdem haben sie unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen!«
Es kam Cunrat seltsam vor, dass der freundliche Mann mit dem Trichterhut den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben sollte, aber was wusste er schon von den Juden!
Gegenüber der Fassade der Augustinerkirche lag ein prächtiges Haus, gemauert und verputzt im unteren Teil, mit Fachwerk versehen im Obergeschoss. Auf der Traufseite, die der Straße zugewandt war, war dem Dach ein kleiner Giebel vorgebaut, durch dessen Fenster man Waren in die Lagerräume im Dachgeschoss hochziehen konnte. Sie standen vor dem Haus des Bäckermeisters Katz.
Bärbeli ging voraus durch das breite Portal und die Treppe hoch in den ersten Stock, wo die Stube lag. Im ganzen Haus duftete es nach Mehl und Brot, und Cunrats Magen knurrte heftig. Der Pfennigwecken hatte nicht viel ausgerichtet. Als er in die Stube trat, die von einem Kachelofen beheizt wurde, und die reich gedeckte Tafel vor sich sah, lief ihm erneut das Wasser im Munde zusammen. Doch zunächst stellte Bärbeli ihn triumphierend allen vor, die am Tisch saßen.
Der Bäcker Hans Katz war ein kahlköpfiger, kleiner Mann, der Cunrat fest die Hand drückte und ihm sagte, wie froh er sei, dass er endlich gekommen war. Auch ihm fehlten einige Zähne. Von Mutter Katz hatte Bärbeli ihre Rundungen geerbt, sie lachte genauso breit und freundlich, und vermutlich hätte sie Cunrat mütterlich an ihre Brust gedrückt, wäre er nicht viel zu groß dafür gewesen. Die Eheleute Katz hatten außer Barbara keine weiteren Kinder. Wie Cunrat von seiner Mutter wusste, waren ihnen sechs gestorben, zwei schon im Kindbett, drei im Kindesalter. Der einzige Sohn, der das Gesellenalter erreicht hatte, hatte Anfälle bekommen vom Mehlstaub, wie es hieß, er bekam dann keine Luft mehr, und selbst eine Wallfahrt nach Einsiedeln hatte keine Hilfe gebracht. Vor vier Jahren war er bei einem solchen Anfall erstickt.
So saßen am Tisch nur noch zwei weitere Gesellen und ein Lehrbub von etwa 14 Jahren, der müde aussah und Cunrat mit einem Kopfnicken begrüßte. Die Gesellen schienen nicht sonderlich begeistert zu sein über seine Ankunft. Mürrisch nannten sie ihre Namen, Uli Riser und Joß Vogler.
Aber Cunrat interessierte sich sowieso viel mehr für das, was auf dem Tisch stand als für die, die drumherum saßen. Die Tafel war weiß gedeckt mit einem Leinentuch, durch das sich eine blaue Borte zog. In der Mitte stand ein Weinkrug, auf zwei Platten lag gesottenes Fleisch, »Hammel oder Rind, ganz wie du willst, Cunrat!«, daneben ein großer Laib dunkles Brot. So reichlich zu essen hatte es bei seinem Bäckermeister in Weißenau nie gegeben, jedenfalls nicht für die Gesellen.
Joß und Uli rückten nun auf der Bank zusammen, und Bärbeli holte schnell irdene Becher für sich und den neuen Tischgenossen. Der Meister schnitt zwei große Brotscheiben ab, die er den beiden reichte als Unterlage für das Fleisch.
»Greif zu, Cunrat!«
Der ließ sich nicht zweimal bitten. Er zog sein Messer aus dem Gürtel, spießte sich ein ordentliches Stück Rindfleisch auf das Brot, das sich vollsog mit dem Fleischsaft, und begann unter lautem Schmatzen zu essen. Das war das Zeichen für die anderen, ebenfalls die unterbrochene Mahlzeit wieder aufzunehmen, und erst, als Platten und Krüge restlos geleert und die safttriefenden Finger abgeschleckt waren, wurde die Tafel aufgehoben. Der junge Mathis musste mit der Meisterin das Geschirr in die Küche tragen und säubern.
Barbara hatte Cunrat während des ganzen Essens immer wieder stolz angeschaut wie eine Trophäe, die sie von der Jagd mit nach Hause gebracht hatte, und dabei hatte sie fast ununterbrochen geredet, sodass Cunrat sich sehr wunderte, wie das möglich war, gleichzeitig zu sprechen und zu essen; er hätte das nie gekonnt, tat er sich doch bei leerem Mund schon schwer mit der Aussprache. Sie hatte von der Bäckerei erzählt, wie gut sie lief, dass ein Mann hier wohl sein Auskommen haben konnte, und vom Konzil, das jeden Tag neue Prälaten nach Costentz führte, mit vielen Pferden und Knechten, sodass die Stadt all die Menschen kaum fassen konnte, und dass in wenigen Tagen der Papst erwartet wurde und der König, ja, ein richtiger König würde nach Costentz kommen, mit seiner Königin, die auch Barbara hieß, so wie sie! Königin Bärbeli! Sie kicherte.
Schließlich wurde sie von ihrem Vater mit rüden Worten ermahnt, endlich still zu sein, damit Cunrat erzählen konnte, wie seine Fahrt hierher gewesen war und wie es seiner Mutter ging. Der junge Bäcker mühte sich redlich ab, ohne Stocken zu berichten, aber je mehr er sich anstrengte, umso mehr fing er an zu stammeln. Die Gesellen lachten heimlich und stießen sich unter dem Tisch an, wofür sie böse Blicke von Bärbeli ernteten.
Diese wurde schließlich wieder zur Brotlaube geschickt, während Meister Katz den älteren Gesellen, Joß, anwies, Cunrat sein Bett zu zeigen, damit sie anschließend an die Arbeit gehen konnten. Er selbst legte sich zum Schlafen hin.
Die Schlafkammer für die Gesellen lag in einem Anbau an der Rückseite des Hauses. Sie mussten durch die ebenerdig gelegene Backstube in den Hinterhof gehen, wo einige dunkelborstige Schweine herumliefen, und von dort eine Holztreppe hoch zu einer Galerie. Linker Hand, zum Ehgraben hin, befand sich der Abtritt, rechter Hand die aus grobem Holz gezimmerte Gesellenkammer. Hier gab es keine Butzenglasfenster wie in der Stube, sondern nur mit geöltem Pergament bespannte Lichtöffnungen. Natürlich war die Kammer nicht beheizt, und da es kalt war, hatten die Gesellen die Holzläden an der Innenseite der Fenster gar nicht erst aufgemacht. Das einzige Licht fiel von der Tür ein, aber was Cunrat auch ohne Licht sofort bemerkte: Es stank hier nach Schweiß und dreckigen Füßen. Und von draußen kam der Geruch des Abtritts und der Schweine und ihres Misthaufens dazu. Nun war es nicht so, dass Cunrat nicht an Gestank gewöhnt gewesen wäre, auch da, wo er herkam, gehörte übler Geruch zum Alltag. Doch hatte er zu Hause in der Küche geschlafen, nur seine Mutter hatte eine eigene Kammer gehabt. Und dort in der Nähe des Herdfeuers roch es nach Rauch und nach Essen. Den Geruch von anderen Menschen in einem so kleinen Raum war er nicht gewöhnt. Er hielt sich die Nase zu, was der Geselle, der ihn hergebracht hatte, mit einem Grunzen quittierte; er schien genauso maulfaul zu sein wie Cunrat selber. Der ließ die Tür offen stehen, um frische Luft einzulassen, aber auch, damit er überhaupt etwas sehen konnte. Vier Bettgestelle aus rohen Brettern standen in dem kleinen Raum, jedes mit Strohsack, Kopfkissen und Pfühl, und dazwischen kleine Truhen aus ebenso roh behauenem Holz. An der Wand boten ein paar hölzerne Haken die Möglichkeit, Mantel und Kapuze aufzuhängen.
»Das da hinten ist dein Bett, Stammler!«, wies ihn Joß an. Er war wohl schon über 30, hatte graue Haare und einen schmutzigen Bart, und wie der Lehrjunge wirkte er müde.
Cunrat reagierte nicht auf den neuen Spitznamen, er legte sein Bündel auf die Truhe neben dem Bett und hängte den Mantel an einen Haken. Dann besah er sich kritisch die Bettdecke und den Strohsack. Wenn er richtig gesehen hatte, waren ein paar Wanzen weggelaufen, als er die Decke gehoben hatte. Angewidert ließ er sie wieder fallen. Seine Mutter hielt das Bettzeug immer durch Ausräuchern sauber.
Joß hatte seinen Gesichtsausdruck bemerkt, aber er sagte nur: »Du wirst sowieso nicht viel Zeit darin verbringen.«
Dann wandte er sich zum Gehen, für Cunrat das Zeichen, sich ebenfalls an die Arbeit zu machen. Sie schlossen die Tür und gingen durch den Hof zurück in die Backstube, die mit den Lagerräumen und der Verkaufstheke das gesamte Erdgeschoss des Hauses einnahm. Bis zum späten Abend schleppten sie Mehlsäcke, bereiteten Teig und formten große und kleine Brote, die früh am nächsten Morgen gebacken werden sollten. Müde aßen sie dann ihr Vesper, ein Stück Speck mit Brot und Wein. Müde befeuerten sie anschließend den Ofen, damit die Glut rechtzeitig bereit sein würde. Und todmüde gingen sie schließlich zu Bett.
Diese Nacht war für Cunrat noch kürzer als Bäckersnächte es ohnehin sind. Er konnte nicht einschlafen, denn Joß und Uli schnarchten zum Balkenbiegen, während der Lehrjunge Mathis sich in den Schlaf weinte. So viele Dinge zogen im Dunkel an seinen Augen vorüber: die unendlichen Wellen des Bodensees, der Säntis, das gutmütige Gesicht des Weinhändlers und der große Käfig auf dem Bleicherstaad, das Lückenlachen von Bärbeli, der Trichterhut des Juden, die prächtigen Häuser von Costentz und die staubige Backstube mit dem gewaltigen Ofen, der unersättlich schien. So viele neue Dinge gab es zu bedenken und zu begreifen. So viele fremde Gerüche und Geräusche und Gefühle. Und dazu die Wanzen, die ihn zwickten.
Er wollte wieder nach Hause.
*
»Er kommt, er kommt!«
Bärbeli schrie aufgeregt und hüpfte ständig auf und ab, weil ihr die vielen Menschen die Sicht versperrten.
»Cunrat, siehst du schon etwas?«
Cunrat war so groß, dass er über alle Köpfe hinweg schauen konnte.
»N… nein, noch n… nichts!«
Sie hatten sich in der Nähe der St.-Pauls-Kirche aufgestellt, um den Einzug des Papstes zu beobachten. Es war ein Sonntag Ende Oktober um die Mittagszeit, und der Himmel war grau und verhieß nichts Gutes. Dennoch war die ganze Stadt in Erwartung des höchsten Herrn der Christenheit zusammengeströmt. Sogar Bäckermeister Katz, seine Frau und der kleine Mathis waren mitgekommen, nur die Gesellen hatten es vorgezogen, an ihrem freien Tag in die Trinkstube zu gehen.
Man hatte bereits vernommen, dass dem Papst auf seinem Weg von Italien nach Costentz ein Missgeschick passiert war, an seinem Wagen war auf der Fahrt über den Arlbergpass ein Rad gebrochen, der Karren war umgekippt und der Papst in den Schnee gefallen. Zum Glück war ihm weiter nichts passiert, am Samstag war er im Kloster Kreuzlingen angekommen, um jetzt am Sonntag mit seinem Gefolge in der Konzilsstadt Einzug zu halten. Alle Kleriker der Stadt und der Umgebung waren ihm entgegengezogen bis vor das Kreuzlingertor, und nun zogen sie wieder zurück und dem Papst voraus in einer langen Prozession durch den Vorort Stadelhofen und durch das Schnetztor, das Eingang in den inneren Mauerring gewährte, dann ging es vorbei an der St.-Pauls-Kirche und weiter durch die Plattengasse bis zum Münster.
Dicht an dicht drängten sich die Menschen, und Cunrat ließ seinen Blick über die Menge schweifen. Da entdeckte er plötzlich ein bekanntes Gesicht. Es war der dritte Passagier der Lädine, mit der er nach Costentz gekommen war. Das hagere Gesicht mit dem grauen Bart und der Narbe blickte immer noch gleich mürrisch wie bei seiner Ankunft in der Stadt. Dann schien auch er den Bäckergesellen wiederzuerkennen, seine Augen weiteten sich, und Cunrat wollte ihm schon grüßend zulächeln, doch da wandte sich der andere rasch ab und verschwand hinter den Rücken der Umstehenden.
In diesem Augenblick begann die Menge um Cunrat laut zu rufen: »Vivat, Papa!« Die Costentzer Fahne mit dem schwarzen Kreuz auf weißem Grund, die dem Zug vorangetragen wurde, erschien im Schnetztor, und die Stadtwache blies ihre grellen Trompetensignale. Die Stadtknechte hatten trotz ihrer Harnische alle Mühe, das Volk zurückzuhalten. Die Leute mussten sich jedoch in Geduld üben, denn als Erste kamen die kleinen Domschüler durch das Tor, danach die Franziskaner, dann die Augustiner und die Dominikaner, alle in ihrem jeweiligen Habit und mit ihren Standarten. Es folgten die größeren Schüler, die Kapläne der Stadt, die Chorherren von Sankt Stephan, Sankt Johann und Sankt Paul, dann die Benediktiner, die Domherren mit ihren Chorkappen und schließlich alle Äbte und Pröpste der städtischen und umliegenden Klöster.
Schließlich wurden neun weiße Pferde vorbeigeführt, von denen acht das Gepäck des Papstes trugen. Das neunte hingegen, an dessen Hals ein Silberglöcklein unablässig bimmelte, war mit einem roten Tuch bedeckt, von dem sich eine goldene Monstranz erhob. Sie wurde von brennenden Kerzen auf Silberständern erleuchtet, und vor und hinter den Pferden marschierten Zunftleute und Domherren mit weiteren Kerzen auf hohen Stangen.
Und dann kam er.
Der Papst ritt auf einem prachtvollen Schimmel, der fast gänzlich unter einem goldbestickten, roten Tuch verschwand. Das Pferd wurde von zwei Gefolgsleuten, dem Vernehmen nach zwei Grafen, am Zaum geführt. Papst Johannes hatte sein Priestergewand angelegt und trug eine schlichte weiße Inful auf dem Haupt. Cunrat war insgeheim ein wenig enttäuscht. Er hatte sich den Papst als großen, würdevollen Mann vorgestellt, aber unter der Inful schaute ein kleiner, feister Kerl mit Doppelkinn und abstehenden Ohren heraus, der mit dicken, behandschuhten und beringten Fingern das Volk segnete.
Über dem Papst erhob sich ein Baldachin aus goldenem Tuch, der von vier städtischen Patriziern getragen wurde: dem Bürgermeister Heinrich von Ulm, dem Vogt Hanns Hagen, dem Ammann Heinrich Ehinger und dem Kaufmann Heinrich Schiltar. Bäcker Katz kannte sie alle und wurde nicht müde, Cunrat zu erklären, wer wer war. Der Baldachin war ein Geschenk der Stadt Costentz an den Papst.
Das Schönste aber war, dass neben dem Papst ein Priester ritt, der Pfennige unter die Leute warf. Alle reckten sich nach dem silbernen Regen, und an manchen Stellen konnten die Stadtknechte das Volk kaum mehr in Schach halten.
»Ich hab einen, ich hab einen!«, freute sich Bärbeli, dabei hatte sie den Pfennig nur ergattern können, indem sie rücksichtslos den jungen Mathis zur Seite gestoßen hatte, sodass er zu Boden fiel und fast zertrampelt worden wäre. Cunrat konnte ihn gerade noch am Arm packen und hochziehen.
»Er g… gehört ihm!«, sagte er zu Bärbeli.
Die sah ihn entrüstet an. »Bist du verrückt geworden? Den hab ich gefangen!« Und sie steckte den Pfennig in ihren beachtlichen Ausschnitt.
Da griff Cunrat nach seinem Beutel und gab dem Jungen einen Pfennig von seinem eigenen Geld. Mathis strahlte ihn an, Bärbeli zog eine verächtliche Schnute. Auch Meister Katz, der die Szene beobachtet hatte, schien nicht sehr erbaut über Cunrats Großzügigkeit.
Doch der glanzvolle Zug war noch nicht zu Ende. Hinter dem Papst ritt auf einem mächtigen Ross ein Mann in glänzender Rüstung, der eine dicke, hohe Stange vor sich auf dem Sattel hielt. Von dieser Stange spannte sich ein Schirmdach aus rotem und gelbem Stoff über Reiter und Pferd, so groß, dass noch fünf weitere Pferde darunter Platz gefunden hätten. Oben auf der Stange befand sich ein goldener Knopf und darauf stand ein goldener Engel mit einem goldenen Kreuz in der Hand. Der Schirm war das Symbol des Papstes, das nun in der Bischofskirche aufgestellt werden würde.
Nach dem Reiter mit dem Schirm kamen die Kardinäle, neun an der Zahl, auf Pferden oder Maultieren. Sie waren in scharlachrote Mäntel gekleidet, die so weit über ihre Reittiere herabhingen, dass sie die Erde berührten. Auf dem Kopf trugen sie rote Kappen und darüber breitrandige rote Hüte mit seidenen Schnüren.
Den Abschluss bildete die lange Reihe von Gefolgsleuten der hohen Würdenträger, Soldaten und Pferdeknechte, Schreiber und Sekretäre, Köche und Diener. Unter diesen fiel ein Mann Cunrat besonders auf. Er hatte dunkles lockiges Haar, das an den Schläfen schon ergraut war, eine hohe Stirn mit vielen Falten vom Denken und eine etwas spitze Nase. Sein Gewand unter dem Reisemantel war rot wie das der Kardinäle, und auf dem Kopf trug er eine pelzverbrämte Mütze. Sein Maultier hatte an Gepäck schwer zu tragen, denn die Satteltaschen waren voller Bücher. Mit klugen Augen und einer Spur Verachtung blickte er über die Menge. Als er Cunrat sah, der einen Kopf größer war als die anderen, schaute er ihn einen Moment lang erstaunt an, dann begann er zu lächeln und schüttelte leicht den Kopf, als wundere er sich über den Anblick eines seltsamen Tieres.
Schließlich war der Zug zu Ende, und die Menschen folgten den Prälaten zum Münster, wo ein Tedeum angestimmt und die Vesper gelesen wurde. Alle Glocken läuteten. Doch die Bischofskirche war mehr als voll mit den Vertretern des Klerus, sodass die Menge sich zerstreute. Es war ja auch genügend andere Kurzweil geboten: Verkaufsstände aus Holz oder Zeltbahnen säumten den Münsterplatz, Spielleute unterhielten das Volk mit Puppenspielen und musikalischen Darbietungen, Wahrsager zogen die Aufmerksamkeit der Leichtgläubigen auf sich.
Bäcker Katz schickte Cunrat und Mathis, sie sollten schnell Körbe mit Wecken und Kuchen holen, denn viele Leute hatten jetzt Hunger, und nach der Freigebigkeit des Papstes saß auch bei ihnen das Geld locker.
Zäh drängten sich die beiden durch die Menge und rannten am Ende noch das Stück bis zur Backstube, um die Chance auf einen guten Verkauf nicht zu verpassen. Als sie zurück zum Münsterplatz kamen, hatten sie schon die Hälfte ihrer Waren verkauft, der Rest wurde ihnen fast aus den Körben gerissen, und am Ende konnte Cunrat dem Meister einen gut gefüllten Beutel Geld übergeben.
Bärbeli hingegen war selig über ihren eroberten Pfennig.
»Den werde ich mir um den Hals hängen, der wird mir Glück bringen!«, jubelte sie und sah dabei Cunrat erwartungsvoll an.
Dann bummelten die Frauen über den Krämermarkt beim Münster. Dort gab es alles zu kaufen, was sie begehren konnten: Kleider und Stoffe, Gürtel und Schnallen, Schuhe, Hauben, Taschen und Schmuck, außerdem seltene Gewürze und orientalische Duftöle. Meister Katz ging drei Schritte hinter ihnen und schaute missmutig drein. An seinem Gürtel baumelte der braune Lederbeutel mit den Einnahmen aus dem Brotverkauf.
*
Die Tage eines Bäckergesellen sind lang und die Nächte kurz. Zwischen Mehlstaub, Ofengluthitze und schweren Säcken fristet er sein Dasein; seine einzigen Freuden sind ein üppiges Essen, der Gang zur Badstube am Sonnabend, der Besuch der Messe am Sonntag und hin und wieder ein Abstecher in die Weinstube.
Cunrat gewöhnte sich langsam an die schwere Arbeit in der Backstube von Meister Katz, die so ganz anders war als in der beschaulichen Klosterpfisterei in Weißenau. Er war am Abend nicht mehr ganz so müde wie zu Beginn, und so ließ er sich von Joß und Uli öfters in eine Trinkstube mitnehmen. Deren gab es Unzählige in der Stadt, und auch wenn sie als Gesellen nicht zu allen Zutritt hatten, so konnten sie sich dennoch nicht über mangelnde Auswahl beklagen. Einmal fragte er sie nach der Weinstube Zur Haue von Meister Tettinger. Seine beiden Genossen kannten auch diese. Sie befand sich direkt neben dem größten Stadttor von Costentz, dem Hägelins- oder Rindportertor. Außerhalb dieses Tores, auf dem Brüel, lagen die Wiesen, Felder und Stallungen der Costentzer Bürger und des Bischofs, dort befanden sich auch die Schießstände der Bogen- und Armbrustschützen, wo regelmäßig Turniere abgehalten wurden, hier hatten die meisten Konzilsgäste ihre Pferde untergestellt. Diese Vorstadt, die von einem Wall umfangen war, wurde das ›Paradies‹ genannt, nach einem kleinen Frauenkloster, das hier vor langer Zeit gestanden hatte. Den frommen Klarissen war es jedoch offenbar vor den Toren der Reichsstadt zu turbulent geworden, und so hatten sie ihren Konvent rheinabwärts an einen stillen Ort bei Schaffhusen verlegt. Der Name indes war geblieben, und vom Paradies führte die Weiße Straße hinaus zum bischöflichen Schloss Gottlieben und weiter nach Schaffhusen oder Zürich.
Wegen des regen Verkehrs, der durch das Rindportertor flutete, hatte die Weinstube Zur Haue immer eine große Menge Kundschaft, weltliche wie geistliche. Die Schankstube mit dem breiten Holztresen und der vom Kaminrauch geschwärzten Balkendecke war auch bei den Stadtwachen beliebt, die vor ihrem Dienst am Stadttor gern noch bei Tettinger einkehrten. Er war bekannt dafür, dass sein Wein besonders gut schmeckte und nicht zu teuer war. Außerdem gab es in dem mehrstöckigen Haus eine ordentliche Anzahl von Schlafkammern, die an erlauchte und weniger erlauchte Konzilsgäste vermietet waren. Auch sie suchten in der Schänke Zuflucht vor der Kälte ihrer Schlafräume und der Einsamkeit in der fremden Stadt.
Als Cunrat mit seinen Kumpanen zum ersten Mal dort auftauchte, begrüßte ihn der dicke Wirt freundschaftlich.
»He, langer Lulatsch!«, schrie er ihm durchs ganze Lokal entgegen, »so sieht man sich wieder! Komm, ich spendier dir einen Krug!«
Joß und Uli sahen Cunrat erstaunt und bewundernd an, während er sich unbehaglich fühlte ob der plötzlichen Aufmerksamkeit. Sie setzten sich an einen Tisch, und der Wirt brachte vier Becher und einen Krug. Dann schenkte er ein, stieß mit allen an und hub laut zu einem Trinkspruch an: »Das ist mein Freund …« Hier stutzte er, offenbar hatte er den Namen seines Freundes vergessen.
»C…cunrat«, half der ihm schüchtern auf die Sprünge.
»Das ist mein Freund Cunrat aus Weißenau, der das beste Brot in der ganzen Stadt backt! Vivat!«
»Vivat!«, stimmten die anderen ein, dann fuhr Tettinger leiser fort: »Im Ernst, Cunrat, wie ist es dir denn bisher ergangen in Costentz? Hast du dich bei Meister Katz gut eingelebt?« Bevor Cunrat antworten konnte, fuhr er mit zweideutigem Grinsen fort: »Und das Bärbeli?«, er knuffte ihn freundschaftlich in die Seite, »wie ist die so? Hm?«
Dann warf er einen Seitenblick auf Joß: »Oder hat bei der Bäckerstochter schon jemand anderes sein Brot im Ofen?« Er lachte dröhnend über seinen Witz, Cunrat lachte ein bisschen mit, obwohl er den Sinn wieder einmal nicht recht verstand, während Joß seinen Becher hinabstürzte.
»He, Wirt!«, rief es da von einem anderen Tisch, »wir sind am Verdursten!«
»Ja, ja, bin schon unterwegs!«, antwortete Tettinger und stand schulterzuckend auf. »Wir sehen uns noch!«
Cunrat musste seinen Mitgesellen nun stotternd erklären, woher er den Weinhändler kannte, und da sie seinetwegen zu einem kostenlosen Trunk gekommen waren, verzichteten sie sogar auf bissige Kommentare und Nachäffereien wegen seiner Stammelei. Tettinger brachte später unaufgefordert einen weiteren Krug Wein, dann zog Joß ein Kartenspiel aus der Tasche, mischte und teilte aus.
»Ist d… das nicht verb… boten?«, fragte Cunrat ängstlich, denn wo er herkam, wurde jegliche Art von Spiel streng bestraft. Er hatte sich ohnehin schon gewundert, dass an den Nebentischen auch Tricktrack gespielt wurde.
»Keine Angst«, gab ihm Uli zur Antwort, »solange der Einsatz nicht mehr als einen halben Pfennig beträgt, hat der Rat das Spielen erlaubt. Nur um höhere Summen zu würfeln ist verboten.«
Sie erklärten Cunrat, wie das Spiel funktionierte, dann legten sie los. Der Geselle aus Oberschwaben hielt sich tapfer. Doch während sie spielten, erhoben sich plötzlich laute Stimmen am Tresen.
»Ist gut Fiorin, gut Gold! Viel teuer, viel gutt!«, schrie ein Soldat, offenbar ein Italiener mit dunklen Locken und Bart, und hieb mit der Faust auf den Tresen. Cunrat meinte, ihn im Gefolge des Papstes gesehen zu haben bei dessen Einzug in Costentz.
»Fiorin hin, Gold her, ich kann dir den nicht wechseln. Wer meinen Wein trinken will, muss mit Costentzer Pfennigen bezahlen, verstehst du?«, dröhnte Tettingers Bass durch die Stube.
»Ich nix Pfennige, ich gute Fiorin! Ist so wie undertfümzik Pfennige!« Dabei unterstrich der Soldat mit eindringlichen Gesten seiner Hände den gewaltigen Wert des Goldflorins, mit dem er seine Zeche bezahlen wollte.
Tettingers Stimme nahm einen gefährlich freundlichen Ton an: »Mein Freund, das mag sein, dass dein Florin 150 Pfennige wert ist, das ändert aber nichts daran, dass ich ihn nicht nehmen kann! Du bekommst erst dann deinen Wein, wenn du mir hier Pfennige auf den Tisch legst, verstanden?«
»Eh, porcamadonnasanta, ma chi crede di essere questo cretino, ist gutte Fiorin, mannaggia te, mannaggia!«, fluchte der Italiener und hieb noch einmal auf den Tisch. Einige Gäste waren bereits aufgestanden, um besser zu sehen, was da vor sich ging und im Zweifel mitzumischen, wenn es zu Handgreiflichkeiten kommen sollte.
Tettinger, der ein paar Brocken Italienisch verstand, brüllte nun ebenfalls: »Ich darf dir deinen Florin nicht wechseln, du Hund, das hat der Rat verboten, und beschimpfen lass ich mich von einem Aas wie dir schon gar nicht! Geh auf die Plattengasse zu einem Wechsler, und wenn du gute Costentzer Pfennige hast, komm wieder. Ansonsten lass dich hier nicht mehr blicken!« Und zur Bekräftigung schlug er ebenfalls mit der Faust auf den Tresen, dass die Krüge klirrten.
Ob er nicht verstanden hatte, dass der Wirt sein Goldstück nicht nehmen durfte oder ob er wegen der Schimpfworte beleidigt war – jedenfalls zog der Welsche sein Schwert. Ein Aufschrei ging durch die Weinstube – »ruft die Wache« – Tettinger griff nach einem Holzknüppel, den er für alle Fälle unter dem Tresen aufbewahrte, und einen Augenblick lang sah es so aus, als ob es zum Kampf kommen würde. Cunrat hielt den Atem an.
Doch da erhob sich vom hintersten Tisch, an dem er ganz allein gesessen und eine Bohnensuppe verspeist hatte, ein Mann. Er war groß und kräftig, trug ein grünes Wams, einen feinen Ledergürtel mit Kupferscheiben und lederne Beinlinge. Seine dunklen Haare und der graumelierte Bart waren akkurat geschnitten.
Er legte dem Soldaten die Hand auf die Schulter, der wirbelte herum und hielt nun dem Fremden sein Schwert entgegen.
»Senti«, redete ihn dieser mit ruhiger Stimme in seiner Sprache an, »l’oste non ti può cambiare il fiorino, è una legge del consiglio comunale, devi andare ad un banco per cambiare.«
An der Miene des Soldaten konnte man erkennen, dass der Mann ihm offenbar erklärt hatte, warum es nicht möglich war, dass Tettinger seinen Goldflorin nahm. Dennoch protestierte er wegen der Schimpfworte weiter, wenn auch etwas weinerlich: »Ma mi ha insultato, mi ha detto parolacce …«
»Non ti ha insultato, ha solo cercato di spiegarti la cosa. Dai, ti invito io!«
Nach einem Moment des Zögerns steckte der Soldat sein Schwert in die Scheide zurück, um die Einladung anzunehmen, der Fremde klopfte ihm auf die Schulter und wandte sich an den Wirt: »Herr Tettingerr, bitte gebben Sie uns eine Karaffa Wein von Rhein. Ick bezahle.« Damit legte er einen Haufen Pfennigmünzen auf den Tresen.
Tettinger verwahrte den Knüppel wieder unter dem Tisch. Er würde ihn gewiss noch öfter brauchen. Dann schenkte er einen Krug vom teuren Rheinwein ein und stellte ihn den beiden hin.
»Zum Wohlsein, Herr Conte!«
Die beiden Fremden standen noch eine ganze Weile am Tresen und unterhielten sich in ihrer Sprache, während in der Gaststube das Gemurmel wieder einsetzte.
Als Tettinger sich später noch einmal zu Cunrat und seinen Kumpanen gesellte, brannte er darauf, ihnen zu erzählen, dass der Herr der Conte Alessandro Sassino war, der mit seinem Diener bei ihm wohnte. Er stammte aus San Marino und war vom dortigen Fürsten zum Konzil nach Costentz gesandt worden. Er sei ein sehr frommer, gebildeter Herr, der viele Bücher dabei habe und immer studiere. Auch spreche er 15 Sprachen und kenne sich gar in den Gesetzen der Alchimie aus.
»Vielleicht hat er sogar den Stein der Weisen bei sich und kann Gold machen!«, flüsterte der Wirt ihnen hinter vorgehaltener Hand zu. Die drei Bäckergesellen blickten bewundernd auf den Conte.
»W… was ist d… denn ein C… conte?«, wollte Cunrat wissen.
»Zu Deutsch: ein Graf, ein edler Herr!«, antwortete Tettinger.
Die drei nickten andächtig.
Von da an war Cunrat ein regelmäßiger Gast in der Weinstube Zur Haue, auch wenn er fortan seinen Wein selber bezahlen musste und sich deshalb meist nur den billigen Knechtewein leisten konnte. Er verstand sich gut mit dem Wirt, der offenbar einen Narren an dem langen Bäckergesellen gefressen hatte – »wenn ich einen Sohn hätte, müsste er so sein wie du!« – und ihm wenigstens ab und zu einen Becher Rheinwein spendierte.
»Was soll’s?«, rief der Dicke fröhlich, wenn seine Schwester Karolina, Herrin am Herd über Bratspieß und brodelnde Dreifußtöpfe, ihn dabei ertappte und mit strengen Blicken strafte. Doch im Grunde hatte auch sie den jungen Bäcker in ihr Herz geschlossen, und Cunrat, der immer wieder vom Heimweh geplagt wurde, fühlte sich bei den beiden ein wenig zu Hause.
»Bald hab ich Geld im Überfluss!«, versicherte der Wirt ihm mehr als einmal im Vertrauen. »Das Konzil macht uns reich, nicht wahr?« Dann klopfte er dem Gesellen auf den Rücken, und Cunrat lachte und verschluckte sich und hustete auf sein Wohl. Bis zu jenem Tag im November.
*
Poggio Bracciolini an Niccolò Niccoli, am 31. Oktober, dem Tag des Heiligen Quintinius, im Jahre des Herrn 1414
Ich, Poggio, entbiete Dir, meinem Niccolò, einen herzlichen Gruß!
Vor drei Tagen sind wir in Costentz eingetroffen, unser Herr Papst und mit ihm ein großes Gefolge. Von des Papstes Missgeschick am Arlbergpass hast Du wohl schon vernommen, dass an der Kutsche ein Rad abbrach und er in den Schnee fiel. Was du vielleicht nicht weißt, ist, wie unser Herr darauf reagiert hat: »Jaceo hic in nomine diaboli! Ich liege hier im Namen des Teufels!«, hat er ausgerufen, als wir herbeigelaufen sind. Natürlich haben einige Leute im Gefolge getuschelt, dies sei ein böses Omen, und man solle den großen Widersacher nicht herausfordern. Ich glaube eher, dass hier wieder einmal das alte Ego unseres Herrn Papstes sich Bahn gebrochen hat, aus der Zeit, als er noch mit einem Piratenschiff die Meere befuhr und einen raueren Umgang pflegte als Pfaffen und Schreiber.
Bei unserem Einzug in der kleinen schwäbischen Stadt wurden wir von einer gewaltigen Volksmenge empfangen. Die Leute drängten sich in den engen Gassen, um uns willkommen zu heißen. Es lebt hier ein seltsamer Menschenschlag, rotgesichtig und derb, echte Barbaren. Allerdings sah ich auch manche Rose unter all den Dornen, hin und wieder gewahrte man doch ein hübsches Frauengesicht in der Menge. Außerdem mangelt es auch nicht an unendlichen Frauen, die von überall her dem Papst vorausgeeilt sind und die Stadt bevölkern, und unter diesen gibt es ebenfalls viele recht ansehnliche, Schwarze, Rote, Blonde …
Gleich nach unserer Ankunft entstand ein heftiger Streit um des Papstes prächtigen Schimmel. Nachdem unser Heiliger Vater vor dem Dom abgestiegen war, wollte sein Marschall den Hengst in den Stall bei der Bischofspfalz führen, da kamen plötzlich die Söhne des Bürgermeisters Heinrich von Ulm mit ein paar Knechten und forderten das Pferd ein. Es sei der Brauch, dass dem Bürgermeister als dem obersten Stadtherrn diese Gabe zustehe. Zunächst glaubte ich, dass sie anfangen würden zu kämpfen, aber schließlich gaben der Marschall und seine Leute nach. Es ist ja wichtig, dass wir zur Stadtregierung ein gutes Verhältnis wahren.
Doch will ich Dir nun ein wenig von Costentz berichten. Das Städtchen ist zwei Bogenschuss lang und einen Bogenschuss breit. Es liegt nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Wassern, nämlich dem großen Costentzer See und dem Rheinstrome. So eingekeilt, birgt es in seinen Mauern Platz für etwa 5000 Seelen, also etwa ein Zehntteil der Bürger von Florenz. Wenn man bedenkt, dass unsere Stadt vor der großen Pest doppelt so viele Einwohner hatte wie heute, dann magst du ermessen, wie klein dieser schwäbische Flecken ist. Ich frage mich nur, wo all die Teilnehmer des Conciliums Platz finden sollen, die noch erwartet werden. Unser Heiliger Vater wohnt ja in der bischöflichen Pfalz beim Dom, wir Schreiber und Sekretäre in der Küsterei direkt daneben. Aber es treffen täglich neue Delegationen ein, und jeder hohe Herr glaubt, nicht ohne eine beträchtliche Anzahl an Reitern und Fußvolk hier erscheinen zu können. Gerade heute sind wieder sechs Kardinäle angekommen – alle Anhänger unseres Papstes – und sie hatten nicht weniger als 272 Reiter bei sich sowie 20 Saum-pferde. Von überall strömen die Menschen herbei, Handwerker, Kaufleute, Wechsler und was sich sonst noch Gewinn verspricht vom Konzil. Die Preise in den Herbergen sind schon ins Unermessliche gestiegen. Ich weiß nicht, wie das noch werden soll.
Unser Gastgeber, der Bischof Otto, ist ein Sohn des Markgrafen Rudolf von Hachberg. Er ist einäugig und liebt den Prunk seines Amtes, das ihm – so verriet mir ein Sekretär im Vertrauen – von seinem Vater gegen gutes Geld erkauft wurde. Er hat es noch nicht einmal geschafft, sich zum Priester weihen zu lassen, obwohl ihn der Papst schon mehrfach dazu aufgefordert hat. Aber vielleicht ergibt sich ja während des Konzils eine Möglichkeit dazu. Er war jedenfalls sehr freundlich zu unserem Herrn Papst, hat sogar seine Räumlichkeiten noch prächtig ausstatten lassen für den Heiligen Vater, dann hat er die Pfalz verlassen und ist in das Haus eines reichen Bürgers umgezogen. Der vorherige Bischof Blarer hingegen, der sich eigentlich schon länger zurückgezogen und sein Amt abgetreten hat, lebt dennoch weiterhin hier in der Pfalz, wo er seine eigenen Räume besitzt. Diese muss er nun allerdings mit einigen Leuten aus dem Gefolge des Papstes teilen. Von ihm munkelt man übrigens, er habe während seiner Bischofszeit mehrere Leute umbringen lassen. Ahimé, es sind überall die gleichen Zustände!
Heute wurde auch die Rota eingerichtet, unser päpstliches Gericht. In der Kirche zum Heiligen Stephan, der Leutkirche von Costentz, wurden zwölf Gerichtsstühle aufgestellt, und von nun an werden dort jeden Montag, Mittwoch und Freitag die zwölf päpstlichen Richter Tribunal halten. Alle großen und ernsten Fälle sollen hier abgehandelt werden.
Darüber hinaus gibt es in Costentz noch das bischöfliche Gericht und das Gericht des Stadtrates. Jedes dieser Gerichte hat andere Zuständigkeiten, und du kannst dir vorstellen, dass die Stadt ein Tummelplatz geworden ist für die Herren Advokaten, die nun von allen Seiten nach Costentz strömen, um bald diesen, bald jenen vor irgendeinem Gericht in irgendeiner Causa zu vertreten und dafür gutes Geld zu kassieren.
Aber ich wollte dir ja Costentz beschreiben. Die Stadt hat schöne Häuser, allerdings nicht alle aus Stein erbaut wie bei uns, sondern viele mit Holzwerk ausgestattet. Wälder gibt es hier ja genug. Für die Häuser, die aus Stein errichtet sind, verwendet man einen grauen Sandstein aus einem Orte namens Rorschach am südöstlichen Ufer des Costentzer Sees. Die Fassaden sind bunt bemalt, was der Stadt insgesamt ein recht freundliches Aussehen verleiht.