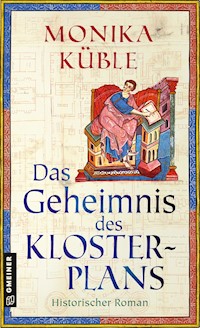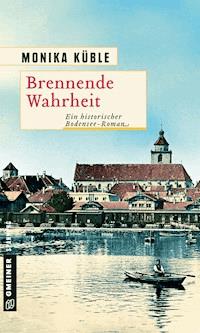
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1689 verschwindet in Radolfzell ein Mädchen spurlos aus einem adeligen Haushalt, doch nur die Schulmeisterin scheint sich dafür zu interessieren. Fast 200 Jahre später stößt der Dichter Joseph Victor von Scheffel auf einen Brief der Schulmeisterin und will daraus einen historischen Roman machen. Als nach einem Brand die verkohlte Leiche einer jungen Frau auftaucht, ist Scheffel überzeugt, dass es sich dabei um das vermisste Mädchen handeln muss. Doch in Radolfzell ist gerade ein weiteres Mädchen verschwunden. Wer ist die Tote? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Küble
Brennende Wahrheit
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Stadtarchiv Radolfzell
ISBN 978-3-8392-5274-1
Personen
Teil I
Johann Franz Nagel: Apotheker mit Geheimwissen
Maria Franziska Hauserin: Nagels zweite Gattin, eine Frau, die weiß, was sie will
Justina Stoffel: Dienstmagd beim Grafen von Fürstental
Rudolph von Fürstental: Ihr unstandesgemäßer Geliebter
Christoph von Fürstental: Sein Vater, ein mächtiger Adliger mit Amtshaus in Radolfzell
Franz Anton von Frühauf: Konsulent im Ritterschaftshaus
Theopont Riedmüller: Tagelöhner mit Hang zum Spiel
Eleonora Sernatinger: Lehrerin an der Mädchenschule
*
Teil II
Joseph Victor von Scheffel: Dichter mit Sommersitz in Radolfzell
Emma Heim: Seine geliebte Cousine
Malwine Schiesser: Unternehmungslustige Gattin des Schweizer Unternehmers Jacques Schiesser
Adelheid Hiller, genannt »Adele«: Ihr Dienstmädchen
Friedrich Werber: Diakon und wortgewaltiger Schriftleiter der »Freien Stimme« (ab 1887 Stadtpfarrer von Radolfzell)
Arsenius Pfaff: Hauptlehrer an der Volksschule, Leiter der Musikgesellschaft und des Münsterchores
Raphael Weinzierl: Arzt; gründete am Marktplatz eine Heil- und Badeanstalt
Franz Schmal: Bauunternehmer
Melchior Krumm: Apotheker(gehilfe)
Senesius Schneider: Kaufmann
Pauline Schneider: Seine Gattin
Zeno Bürgle: Flaschner und verliebt
Rosa Mautz: Dienstmädchen und verliebt
Anna Marie Ortlieb: Einst Lehrerin, jetzt Gesundbeterin
Prolog
»Das Feuer bringt es an den Tag!«, sagte die Frau leise. Sie stand am Fenster, und in ihrem rötlich erleuchteten Gesicht sah er blanke Angst.
Der Mann straffte sich in den Schultern und erwiderte ärgerlich: »Red nicht so daher! Du liest zu viele Schauergedichte. Wenn wir schweigen, wird nichts an den Tag kommen!«
»Der Nachbar hat gesagt, es brennt im ›Adler‹.«
»Und? Es wird alles einstürzen. Der Schutt wird den Keller bedecken. Wenn du nur deine Zunge hütest, kann uns nichts geschehen.«
Langsam schüttelte sie den Kopf. »Das Feuer bringt es an den Tag.«
Teil I:DasverhängnisvolleElixier
1. Kapitel: Nächtlicher Auftrag
Johann Franz Nagel schloss die Fensterläden seiner Apotheke in der Seegasse erst spät am Abend.
Den ganzen Tag waren Fuhrwerke den steilen Kirchbuckel herab zum Gredhaus gerollt, Staubfahnen hinter sich lassend. Der Oktober des Jahres 1689 hatte mit strahlendem Sonnenschein begonnen, fast schien es, als sei der Sommer noch einmal zurückgekehrt. Die Weinlese am Bodensee ließ sich dementsprechend gut an. Die Radolfzeller Bürger, von denen viele einen eigenen Weinberg vor den Toren der Stadt bewirtschafteten, fuhren ihre Karren gefüllt mit Trauben zunächst zum Torkel in der Seegasse oder auf der Mettnau. Den gekelterten Wein verkauften sie dann nach Übersee oder an eine der vielen Zapfwirtschaften in der Stadt, viele tauschten ihn beim wöchentlichen Fruchtmarkt im Kornhaus gegen Getreide ein, aber am liebsten tranken sie ihn selber. Was verschifft werden sollte, wurde zum Gredhaus, dem großen Lagerhaus am Seetor direkt gegenüber der Nagelschen Apotheke gebracht. Dort stapelten sich die Fässer mit all den Gottesgaben, Wein, Getreide oder Salz, bevor sie auf Lädinen verladen und über den Untersee in die Schweiz oder gar hoch zum Obersee bis nach Lindau verschifft wurden.
Nagel wischte mit einem feuchten Lappen noch den Staub von den Fenstern, dann löschte er sorgfältig alle Lampen und Kerzen, bevor er sich in seine Wohnung im ersten Obergeschoss begab. Mit einer Laterne in der Hand sah er sich stolz um. Die letzten Arbeiten waren noch nicht ganz fertig, denn Nagel hatte das Gebäude erst vor Kurzem bauen lassen. Die Außenwände bestanden aus grau getünchten Fachwerkmauern, während im Inneren Holzbohlenwände die Zimmer abteilten. Diese wurden mit farbigen Ornamenten bemalt, die Decken ließ der Apotheker mit feinem Stuck verzieren, die Böden mit glatt geschliffenen Dielen belegen. Einige Räume waren schon fertig, sodass es im Haus nach Gips und Farbe roch.
Einmal fertiggestellt, würde es ein prächtiges Haus werden, prächtig genug für Maria Franziska Hauserin, die er sich als Mutter für seine beiden Kinder, vor allem aber als Frau an seiner Seite wünschte. Er dachte an ihr klares, heiteres Gesicht mit der hohen Stirn, zu der das kleine runde Kinn einen reizenden Kontrast bildete, und musste unwillkürlich lächeln. Natürlich trauerte er um seine erste Gemahlin, die an einem inneren Leiden gestorben war, trotz der aufopfernden Pflege durch Maria Franziska. Keine seiner Kräutermischungen, kein Heiltrank hatte ihr helfen können, und so war er schließlich mit den beiden kleinen Söhnen allein zurückgeblieben. Zum Glück hatte Maria Franziska ihn tröstend unterstützt und sich auch um die Kinder gekümmert, ja, es war ihr Vorschlag gewesen, die alte Apotheke am Marktplatz, die von seinem Vater gegründet worden war, aufzugeben und ein neues Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft des Reichsritterschaftshauses zu errichten. Zu viele Erinnerungen waren mit dem alten Haus verbunden gewesen, und er spürte selbst, dass die Entscheidung richtig gewesen war, dass er in der neuen Apotheke leichter mit dem Verlust seiner Frau umgehen konnte. Die Kinder und Maria Franziska lebten noch bei seinen Eltern am Marktplatz, bis alles fertig sein würde, aber er zog es vor, jetzt schon in der neuen Apotheke zu wohnen.
Nagel trat in den Erker, den er über der Ecke an der Kreuzung hatte bauen lassen. Im Dunkeln konnte man nicht viel erkennen, aber tagsüber hatte er von hier aus alles im Blick: das Seetor und das Gredhaus, die Häuserreihen mit den Dachaufzügen in der Seegasse nach Osten zu ebenso wie den erkerbestückten Fachwerkgiebel des Chorherrenhofes und das Münster mit seinem gedrückten, viereckigen Turm und dem achteckigen Turmhelm. Auf der anderen Seite der Seegasse lag das Reichsritterschaftshaus. Es war neben dem Münster das größte Gebäude der Stadt, mit Eckquadern aus grauem Sandstein und einem eindrucksvollen Treppengiebel, und es stand seiner Apotheke so nahe, dass er manchmal glaubte, in die gegenüberliegenden Fenster hineingreifen zu können. So konnte er genau sehen, welch prächtige Stuckdecken die dortigen Räume schmückten und wie reich sie ausgestattet waren. Betreten hatte er das Haus noch nie, nur sein Vater war als Stadtrat schon bei manchen Anlässen dort zu Gast gewesen. Ansonsten verkehrten hier die Adligen der Region, die Herren von Bodman, Homburg und Hornstein, die von Schienen, Fürstental oder Ulm. In erster Linie diente es der »Freien Ritterschaft vom Sankt-Georgen-Schild des Kantons Hegau, Allgäu und Bodensee«, wie sich der Bund offiziell nannte, als Kanzleigebäude, aber im großen Saal des zweiten Obergeschosses wurden immer wieder auch Feste gefeiert.
Das letzte große Ereignis hatte zu Ehren der beiden Hausherren Senesius und Theopont am 4. Januar stattgefunden. Der Konsulent des Ritterschaftshauses, Franz Anton von Frühauf, hatte zu einem Gastmahl geladen, um das Fest der Stadtpatrone feierlich zu begehen. Während bei manchen Anlässen auch vereinzelt Frauen zugegen waren, hatte Nagel vom Rohbau seiner Apotheke aus an jenem Tag ausschließlich Herren an der langen Tafel sitzen und speisen sehen. Trotz der gepuderten Perücken erkannte er den österreichischen Reichsvogt Gervasius Burz von Seetal, den Grafen Christoph Ferdinand von Fürstental und seinen Sohn Rudolph sowie einige Hegauer Adlige. Die einzigen weiblichen Anwesenden waren die Dienstmägde gewesen, die das Essen servierten.
Heute jedoch blieben die Fenster des Festsaals dunkel. Nur in einem Zimmer des ersten Geschosses direkt gegenüber von seinem Erker sah Nagel noch Licht. Plötzlich trat dort ein Mann ans Fenster. Offenbar hatte er den Schein von Nagels Laterne wahrgenommen, denn er sah zu ihm herüber. Dann öffnete er das Fenster und bedeutete dem Apotheker, dasselbe zu tun. Es war der Konsulent Franz Anton von Frühauf, der ihm nun ohne Perücke, mit spärlichen grauen Haaren um die Glatze, gegenüberstand.
»Seid gegrüßt, Herr Apotheker!«
Nagel verneigte sich. »Ich grüße Euch ebenso, Euer Hochwohlgeboren.«
»Hört zu, ich benötige Eure Dienste. Kommt einen Augenblick zu mir herüber!«
Nagel war müde, und er wusste aus Erfahrung, dass die Adligen den Apotheker meist doch nur konsultierten, weil sie irgendein Pülverchen gegen Flöhe in der Perücke oder zur Steigerung ihrer Manneskraft haben wollten.
»Zu so nächtlicher Stunde soll ich Euch behelligen? Es ist sicher besser, wenn ich morgen bei Tageslicht komme!«
»Macht Euch keine Gedanken um die Stunde! Ihr könnt über die Wendeltreppe neben dem Kellereingang gehen. Mein Diener wird Euch öffnen.«
»Seid Ihr krank? Soll ich Euch eine Medizin bringen, Euer Hochwohlgeboren?«
»Ich habe gesagt, ich brauche Euren Rat. Fürs Erste.«
Damit schloss er das Fenster.
Nagel seufzte, dann nahm er die Laterne und folgte der Aufforderung des Ritters.
Wie besprochen wartete ein Diener am Eingang zur Wendeltreppe in der Seegasse und ging ihm voraus die Treppe hoch ins erste Geschoss. Das Zimmer, das er vorher erleuchtet gesehen hatte, war einer der Kanzleiräume. Ein Tisch und mehrere Schränke standen darin, wohl für Bücher und Akten, außerdem ein hohes Schreibpult. Dort wartete jedoch nicht nur der Ritter von Frühauf auf ihn, sondern ein weiterer Adliger, der im Gegensatz zum Konsulenten eine rotblonde Perücke auf dem Kopf trug, die ihm weit wallend über die Schultern herabfiel. Nagel war froh, dass er so ein Ungetüm nicht nötig hatte; er war noch ein junger Mann und sein dunkelblondes, streng gescheiteltes Haar lockte sich von selbst bis zur Brust, wo er es in einem eleganten Knoten zusammengenommen hatte.
»Ihr kennt den Grafen Christoph von Fürstental? Er gibt sich wieder einmal die Ehre, in unserem Städtchen zu weilen und in seinem Amtshaus nach dem Rechten zu sehen.«
Nagel verneigte sich vor dem Rotperückten, der in einem Lehnstuhl am Tisch saß: »Seid gegrüßt, Euer Hochgeboren!«
Der Graf nickte und sah ihn ungeduldig an, sagte aber nichts.
Da bemerkte Nagel erst, dass in einer Ecke des Zimmers, die vom Schein der Kerzen auf dem Tisch nicht mehr erleuchtet wurde, ein Mädchen stand. Sie mochte um die 16 Jahre alt sein, doch er konnte ihr Gesicht nicht recht sehen, weil sie den Kopf gesenkt hielt. Frühauf hielt es nicht für nötig, sie vorzustellen. Ihr langes, dunkles Haar hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten, ihr Kleid war aus grauem Wollstoff, darüber trug sie ein schwarzes Mieder. Nagel sah auf den ersten Blick, dass sie schwanger war.
»Ihr wisst«, sagte der Ritter von Frühauf, »dass die Sitten heutzutage verwahrlost sind und die jungen Frauen sich allzu leicht zu sündigem Tun hinreißen lassen.«
Da hob das Mädchen den Kopf und sah den Konsulenten an. Nagel erinnerte sich nun, dass er sie beim Gottesdienst im Münster schon einmal gesehen und länger betrachtet hatte, weil sie ausgesprochen hübsch war. Jetzt wunderte er sich jedoch, in ihrem Blick nicht Demut, sondern Trotz und Zorn wahrzunehmen. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch der Graf von Fürstental wischte mit einer Handbewegung ihren Wagemut weg. Ihr Kopf senkte sich wieder.
Etwas lauter fuhr der Ritter fort: »Dies gilt offenbar besonders für manche Dienstmägde, die nicht nur schamlos, sondern auch aufsässig sind und glauben, Standesgrenzen würden für sie nicht gelten.«
»Nicht so viel Gerede, Frühauf!«, fuhr ihm der Graf in die Parade.
Der Konsulent verneigte sich und setzte dann seine Erklärung fort: »Wie Ihr unschwer erkennen könnt, Herr Apotheker, hat dieses Mädchen gesündigt. Ihr Herr, der hochgeborene Graf von Fürstental, ist nicht gewillt, solches Tun in seinem Hause zu dulden. Sie hat jedoch keine Verwandten, zu denen sie gehen könnte, bis die Schande ans Tageslicht getreten ist. Auch gibt es hier kein Frauenkloster, wo sie unterkommen könnte.«
Das Mädchen hatte zu weinen begonnen, ihre Schultern zuckten vor Schluchzen.
»Hör auf, Justina!« Der kurze, wütende Befehl des Grafen genügte, das Mädchen verstummte und hielt sich beide Hände vor den Mund.
Johann Nagel ahnte, was nun kommen würde.
»Um diese arme sündige Seele von ihrer Last zu befreien, hat sich der Graf von Fürstental entschlossen, Euch um Hilfe zu bitten.«
Nagel sah den Grafen an, aber dessen Blick erschien ihm nicht hilfesuchend. Er war es gewohnt zu befehlen, nicht zu bitten.
»Was wollt Ihr von mir?« Nagel stellte sich ahnungslos.
»Aber, Herr Apotheker!« Nun lachte Frühauf verschwörerisch. »Das muss ich Euch doch wohl nicht erklären! Helft diesem armen Mädchen, die Frucht ihrer Schwachheit loszuwerden, sodass keiner ihr mehr einen Vorwurf machen und sie weiterhin in Frieden im Haushalt des Grafen leben kann.«
Nagel fragte sich, warum sie das nicht auch mit einem Kind konnte. In einem Haushalt wie dem der Fürstentaler spielte ein Kind mehr oder weniger keine Rolle.
»Ihr meint, ich soll ihr helfen abzutreiben?«
Frühauf zuckte bei diesem Wort zusammen, als ob er einen Peitschenhieb bekommen hätte. »Oft geht die Leibesfrucht ohne alles Zutun ab, allein durch Gottes Willen. Ihr sollt nur ein wenig nachhelfen.«
»Sie ist gewiss schon im fünften Monat. Da geht das nicht mehr so einfach!«
»Ich weiß, dass Ihr ein Mann von großem Wissen in allen Dingen der Heilkunst seid und für alle Gebresten ein Mittel kennt. Und nicht nur das, ich habe gehört, Ihr seid auch ein Adeptus der geheimen Lehren. Ist nicht sogar am Erker Eures neuen Hauses ein solcher abgebildet?«
»Was Ihr von mir verlangt, Herr Konsulent, ist ein Verbrechen, das von der Heiligen Mutter Kirche schwer bestraft wird.«
Da ging der Graf von Fürstental ungeduldig dazwischen. »Herr Ritter, Ihr habt mir gesagt, es gäbe keine Schwierigkeiten, Ihr könntet die Sache regeln! Stattdessen haben wir jetzt noch einen Mitwisser. Schickt den Pillendreher weg, wir werden eine andere Lösung finden.«
Das Mädchen sah ihn erschrocken an, und Frühauf machte eine rasche Verbeugung. »Einen Augenblick, Euer Hochgeboren!«
Dann nahm er Nagel an der Schulter und führte ihn zum Fenster. Dort wies er auf die neue Apotheke und sagte flüsternd, dass die anderen es nicht hören konnten: »Ihr habt ein wunderschönes neues Haus gebaut, Herr Apotheker! Da möchte man Euch doch beglückwünschen. Was für ein Jammer, dass Eure Gemahlin das nicht mehr erleben konnte. Woran ist sie eigentlich gestorben?«
Nagel verstand nicht, worauf der Ritter hinauswollte. »An einem inneren Leiden.«
»Ein inneres Leiden, ich verstehe. Verursacht wodurch?«
»Ich weiß es nicht, Euer Hochwohlgeboren. Das war ja das Schlimme, deshalb konnte ich ihr auch nicht helfen.«
»Wisst Ihr, was ich gehört habe, Herr Apotheker? Dass das Leiden einen Namen hat.«
Verständnislos sah Nagel ihn an. »Welchen Namen?«
»Maria Franziska Hauserin.«
»Maria Franziska hat meine Frau gepflegt.«
»Und am Ende lag sie auf dem Friedhof.«
Dem Apotheker brach der Schweiß aus. Was der Konsulent andeutete, war nicht mehr und nicht weniger, als dass die Frau, die er sich anschickte zu heiraten, seine erste Frau umgebracht hatte.
»Wie könnt Ihr es wagen, so etwas zu behaupten!«
»Pssst, es sollen nicht alle hören. Aber ich weiß, was ich gehört habe, und Ihr wisst es jetzt auch. Und wenn es unter uns bleiben soll, dann müsst Ihr dem Herrn Grafen helfen.« Er räusperte sich kurz, dann fügte er hinzu: »Ich meine natürlich, der Dienstmagd.«
»Wenn Ihr es so genau wisst, warum habt Ihr noch keine Anzeige gemacht? Das sind doch nur böse Gerüchte, von neidischen Menschen in die Welt gesetzt!«
»Manchmal, Herr Apotheker, ist ein Gerücht genug. Wenn Frau Hauserin aufgrund eines Gerüchts unter die Folter kommt, wird sie vielleicht bald ein Geständnis ablegen, und wer weiß, wem sie den Mord dann in die Schuhe schiebt!«
Nagel konnte keinen klaren Gedanken fassen. Maria Franziska war doch immer so gut gewesen zu ihm und zu Anna. Sie hatte als Hebamme seiner Frau bei der Geburt der Kinder beigestanden, den Haushalt versorgt und sogar hin und wieder in der Apotheke ausgeholfen. Mit der Zeit hatte sie immer mehr Aufgaben übernommen, vor allem, als Anna krank geworden war. Sie war ihm unentbehrlich geworden. Und nun sollte sie seine Frau ermordet haben? Das konnte er sich nicht vorstellen.
Doch wenn er genau darüber nachdachte, schien es ihm gar nicht mehr so unmöglich. Hatte er ihr nicht in der Apotheke viele Kräuter und Substanzen gezeigt, unter denen auch einige giftige waren? Was, wenn das Gerücht die Wahrheit sagte? Aber auch wenn nicht, der Konsulent hatte recht, falls die Obrigkeit davon erfuhr, würde Maria Franziska verhaftet und gefoltert werden. Am Ende würde man sie hinrichten, und vielleicht würde sie unter den Qualen der Folter tatsächlich auch ihn beschuldigen. Falls sie seine Frau vergiftet hatte, lag der Schluss ohnehin nahe, dass das Gift aus seiner Apotheke stammte und er in den Mordplan eingeweiht gewesen war. Auf jeden Fall würde es schlecht für ihn ausgehen. Aber Johann Nagel spürte, dass all dies nicht der Grund für seine Entscheidung war.
Wenn die Geschichte der Wahrheit entsprach, dann hatte Maria Franziska es für ihn getan, sie hatte für ihn gemordet und ihr Seelenheil geopfert. Mehr konnte eine Frau nicht tun für den Mann, den sie liebte.
»Ich bringe Euch morgen etwas vorbei.«
2. Kapitel: Unheimliche Begegnung
Theopont Riedmüller stammte aus einer einfachen Familie. Seine Eltern waren gottesfürchtige Fischersleute. Sie hatten ihn nach einem der Hausherren benannt, im Münster zur Taufe getragen, zur Kommunion geführt und firmen lassen. Ihre Schuld war es nicht, dass er dem Spielteufel verfallen war. Nächtelang saß er in den Schenken von Radolfzell und trank und spielte. Die Wirte hatten meistens Mühe, ihn loszuwerden, wenn sie schließen wollten, außer wenn er gewonnen hatte. Dann stürmte er aus der Schenke und ließ jeden, den er traf, lautstark wissen, dass das Glück ihm an diesem Tag hold gewesen war. Häufig lud er die Vorbeikommenden dann ein, mit ihm die nächste Schenke aufzusuchen, um seinen Sieg zu feiern. Mehrmals hatte er den Hexenturm schon von innen gesehen, denn die Obrigkeit hatte strenge Gesetze gegen die Spielsucht erlassen, und diese wurden vor allem gegen Spieler wie Riedmüller zur Anwendung gebracht. Wer wegen eines derartigen Delikts verurteilt wurde, durfte nicht einmal mehr seine Kinder zum Betteln schicken. Spielteufel und Armut – diese Verbindung war für die Stadtoberen eindeutig, weshalb die Herren, die im Ritterschaftshaus öfter dem Spiel frönten, keine Verfolgung durch die Stadtbüttel befürchten mussten.
An jenem Tag hatte Fortuna nicht auf Theoponts Seite gestanden. Nachdem es dem Wirt der »Sonne« endlich gelungen war, ihn vor die Tür zu setzen, ging er langsam durch die Seegasse zum Grienen Winkel, wo seine Eltern in einem windschiefen Häuschen wohnten. Es war ihm nie gelungen, einen eigenen Haushalt zu gründen wie seine Geschwister, aber das störte ihn nicht. Ihm genügte der Strohsack in der Küche seiner Mutter.
Auf dem Heimweg benötigte er einen guten Teil der Straße, und wenn es ihm widerfuhr, dass er die Richtung verlor und an eine Mauer oder einen Baum stieß, dann zog er seinen verbogenen Dreispitz und entschuldigte sich förmlich bei dem Angestoßenen. Nie erhielt er eine Antwort auf seine Höflichkeit. Außer an diesem Abend.
»Riedmüller, willst du dir einen Batzen Geld verdienen?«, sagte plötzlich eine Stimme aus dem Dunkel.
Theopont erschrak zu Tode. »Wer seid Ihr? Wenn Ihr der Leibhaftige seid, muss ich Euch sagen, dass ich nicht bereit bin, meine Seele zu verkaufen!« Schwankend bekräftigte er seinen Entschluss durch heftiges Schütteln seines erhobenen Zeigefingers. »Niemals! Dass Ihr es nur wisst!«
»Es geht nicht um deine Seele. Und ich bin nicht der Leibhaftige.«
Nun löste sich der Mann von der Mauer und trat in die Helligkeit des Mondlichts.
»Ihr seid doch der Leibhaftige, Ihr habt kein Gesicht.«
Der Fremde trug einen schwarzen Umhang und einen ebenfalls schwarzen Dreispitz. Vor das Gesicht hatte er ein Tuch gebunden.
»Ich habe ein Gesicht, aber das musst du nicht sehen. Ich brauche deine Hilfe.«
»Und wie groß wäre der Batzen Geld, den Ihr bezahlt?«
»Drei Gulden.«
»Fünf!«
»Du weißt doch gar nicht, worum es geht! Drei Gulden sind eine Menge Geld, dafür musst du als Tagelöhner im Gredhaus wenigstens eine Woche arbeiten.«
»Wenn Ihr mich um diese Zeit ansprecht, ohne Euer Gesicht zu zeigen, ist die Sache mindestens fünf Gulden wert.«
Nach kurzem Zögern antwortete der Schwarze: »Gut. Fünf Gulden. Komm mit!«
Theopont Riedmüller wusste nicht, dass er in diesem Augenblick doch seine Seele verkauft hatte.
Die Tote lag unter einem Tuch hinter einem Stapel Fässer. Der Keller des Ritterschaftshauses wurde durch die Fackel des Schwarzmaskierten nur spärlich erhellt, und die Bewegung der Flamme ließ unheimliche Schatten über die schimmelschwarzen Wände taumeln. Es roch nach feuchter Erde und nach etwas Süßlich-Verdorbenem. Theopont Riedmüller war schon fast wieder nüchtern vor Angst, und ihm kamen zunehmend Zweifel, ob sein Führer nicht doch der Teufel war. Der zog nun mit einer raschen Handbewegung das Tuch über der Toten zur Seite. Theopont schlug eine Hand vor Mund und Nase, aber es war zu spät. Schnell wandte er sich zur Seite und spuckte alles aus, was er am Abend zu sich genommen hatte. Der Schwarze wartete, bis er fertig war. Dann fragte er: »Geht’s?«
Theopont nickte nur und wischte sich den Mund mit dem Sacktuch ab. Danach sah er sich das tote Mädchen genauer an. Sie lag auf dem Rücken, das Gesicht zur Seite geneigt. Hübsch war sie gewesen mit ihren langen schwarzen Haaren, aber nun wirkte sie ein wenig aufgedunsen.
»Das ist ja Justina! Justina Stoffel.«