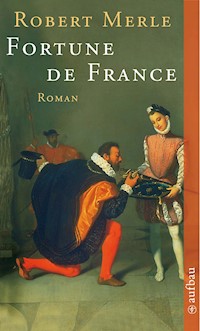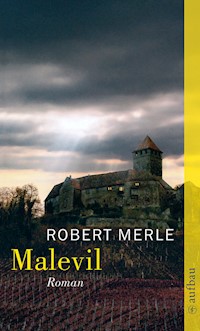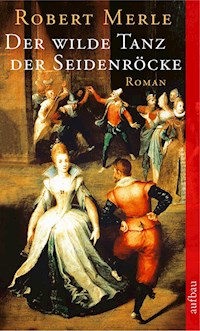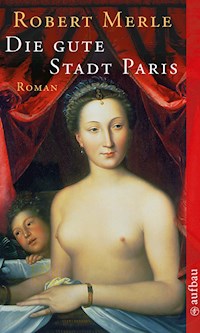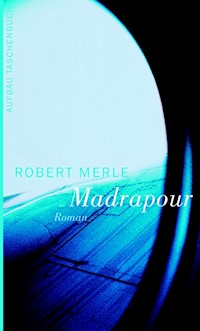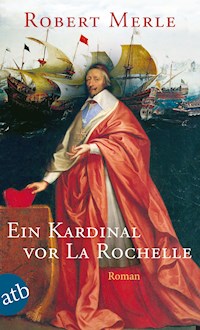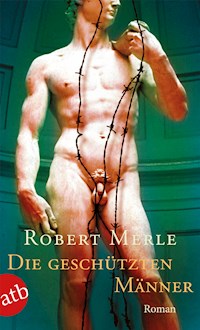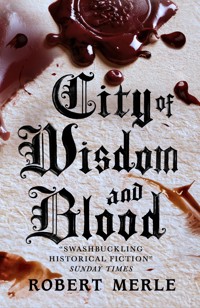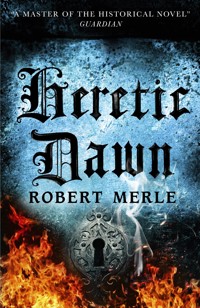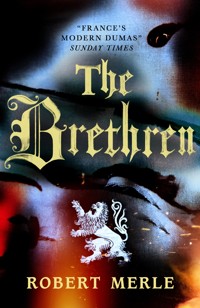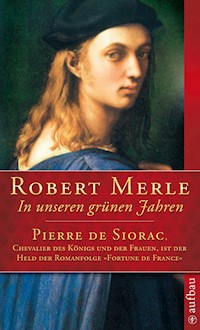
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fortune de France
- Sprache: Deutsch
Mit Latein, Charme und Pistole
Sommer 1566. Der junge Pierre de Siorac ist unterwegs nach der Universitätsstadt Montpellier, wo er Medizin studieren will. Schon lange schwelt der Bürgerkrieg zwischen französischen Katholiken und Protestanten, und Pierre braucht all seinen Mut, aber ebensoviel List, und nicht zuletzt seinen unwiderstehlichen Charme, um in so gefährlichen Zeiten am Leben zu bleiben.
»Ein Feuerwerk an Geist, Witz und Ironie.«Passauer Neue Presse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Robert Merle
In unseren grünen Jahren
Roman
Aus dem Französischen von Andreas Klotsch
Aufbau-Verlag
[Menü]
Impressum
Titel der Originalausgabe
En nos vertes années
ISBN E-Pub 978-3-8412-0172-0
ISBN PDF 978-3-8412-2172-8
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2293-4
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Übersetzung erschien erstmals 1996 bei Aufbau, einer Marke der
Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
En nos vertes années © Robert Merle
Die Originalausgabe ist 1979 bei der Librairie Plon in Paris erschienen
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design
unter Verwendung des Gemäldes »Bindo Altovito« von Raffael
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBENTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
[Menü]
|5|Professor Charles Mion zugeeignet
[Menü]
|6|… dieser fortwährende glücklose Kampf gegen den Tod, der des Mediziners Los ist, aber auch, so meine ich, seine Würde ausmacht.
[Menü]
|7|ERSTES KAPITEL
Ha gewiß! Wie begeistert ich auch sein mochte, in jenem Monat Juni, mit meinem lieben Bruder Samson und unserem Diener Miroul über Berge und Täler die großen Straßen Frankreichs hin zu galoppieren, war mir bisweilen doch das Herz gar schwer, weil ich die im Sarladais gelegene Baronie Mespech weit hinter mir ließ. Wenig fehlte, daß mir mitten im Reiten die Tränen ins Auge drängten, wenn ich an das zinnenbewehrte große Nest dachte, in dem ich aus dem Ei geschlüpft war und Federn angesetzt hatte, vor den Wirren der Zeiten durch seine Mauern geschützt und mehr noch durch die Tapferkeit meines Vaters, meines Onkels Sauveterre und unserer Soldaten; denn treffend sagt unser perigurdinisches Sprichwort: Die einzig wehrhaften Mauern sind mutige Männer.
Ja nun! Wir waren inzwischen fünfzehn Jahre alt, hatten das Latein gut eingetrichtert in unsere Köpfe (wo neben der Langue d’oc schon das Französische sich eingenistet), überdies unsere Tapferkeit trefflich bewiesen zu Lendrevie – war es da nicht an der Zeit, uns der Daunenwärme unserer Barberine zu entheben, die Kinderjäckchen abzustreifen und (da wir das Pech hatten, Zweitgeborene zu sein, mein lieber Samson gar noch Bastard) unsere Studien voranzutreiben? Und zwar, so hatte mein Vater entschieden, in Montpellier.
In dieser Stadt hatte auch er in seiner Jugend studiert. Er mochte sie sehr. Und ihre Medizinschule, an der einst Rabelais seine Thesen verteidigte, schätzte er mehr als jede andere, inbegriffen die von Paris; er schätzte ihren Wagemut, ihre Fächervielfalt und ihre neuen Lehren, weshalb sie denn in dieser zweiten Hälfte des Jahrhunderts, so seine Worte, lebhafter glänzte als im voraufgegangenen Jahrhundert die Schule von Salerno.
Doch sehr lang und gefahrvoll war der Weg von Sarlat nach Montpellier, besonders für drei Hugenotten, die insgesamt keine fünfzig Jahre alt waren, überdies wir in wirren Zeiten reisten, |8|ausgangs der Kriege, in denen die Unseren und die Katholiken sich gegenseitig grausam abgeschlachtet hatten. Gewiß, jetzt regierte eine Art Frieden zwischen den zwei Parteien, jedoch ein grollender, zänkischer. Wieder aufgeflammt waren die Beunruhigungen der Unseren 1565, nach der Begegnung von Bayonne, denn da hatte sich Katharina von Medici, so das Gerücht, in Geheimverhandlungen mit dem Herzog von Alba bereitgefunden, zur Vermählung ihrer Tochter Margot mit Don Juan von Spanien das Blut der französischen Hugenotten beizusteuern. Aber Philipp II. hatte dann letztlich, und nicht ohne Überheblichkeit, davon Abstand genommen, sein eigen Blut abermals mit Frankreichs Thron zu verbinden. Und noch schlimmer: Im darauf folgenden Jahr hatte der sehr katholische König, erzürnt darüber, daß die Franzosen sich so nah seinen amerikanischen Besitzungen einnisteten, und jäh seine christlichen Glaubenssätze vergessend, in einem Überraschungsfeldzug unsere in Florida siedelnden Bretonen niedergemacht. Katharina von Medici war darob in einen so unmäßigen Zorn geraten, daß der Spanier an Frankreichs Hof Reputation verlor und, bei allem papistischen Eifer, nicht mehr so unverblümt die Ermordung unserer protestantischen Führer, insgleichen Verbannung oder Scheiterhaufen für die Masse unserer Brüder zu fordern wagte.
Als diese blutigen Ansinnen ausgeräumt waren, zumindest für eine gewisse Zeit, durfte Fortuna dem Land wieder lächeln. Der Friede schien gut zu keimen, die papistischen Eiferer verloren an Dreistigkeit, die gemäßigten Katholiken schöpften Hoffnung auf einen Ausgleich mit den Unseren. Trotzdem mußte, wer durch das Königreich ritt, auf Diebsgesindel gefaßt sein, das seit den Bürgerkriegswirren die Wälder behauste, an den Kreuzungen lauerte, die Brücken besetzt hielt und Maut forderte und außer Raub unendlich viele Grausamkeiten beging.
Freilich waren wir seit dem zartesten Kindesalter – kaum daß wir Barberines schönen Brüsten entwöhnt – im Waffenhandwerk geübt worden und ritten hier, des Ernstfalls gewärtig, kriegsmäßig gerüstet: Helm auf dem Kopf, den leichten Küraß schützend vor der Brust, das Kurzschwert am Schenkel, den Dolch im Gürtel; auch lugten die Griffe unserer Pistolen aus den Satteltaschen und prangten unsere Arkebusen auf dem Packpferd, das Miroul an der Leine mitführte. Und so meinten wir, Samson und ich, die Schurken wenig fürchten zu müssen. |9|Miroul jedoch, mit den Tücken der Landstraßen vertraut, obzwar ein junger Bursche, mahnte uns, wie schon mein Vater es getan, daß unser Heil nicht im Kampfe liege, weil ein Sieg zu nichts nutze wäre, wenn einer von uns argen Schaden nähme; das Heil liege in der Flucht, unsere Reitpferde seien schneller, und dies brächte uns Vorteil. Ein Ratschlag von Gewicht, denn bei Miroul war Vorsicht nicht die Tochter der Feigheit. Er erklomm Mauern mühelos wie eine Fliege, sein Pikenstoß traf schnell wie nur ein Armbrustpfeil – er ganz allein wog drei Soldaten auf. Man nenne mich nicht einen Gascogner Prahlhans: es ist die reine Wahrheit. Im übrigen wird es sich noch beweisen.
Der frühe Zeitpunkt dieser Reise mag überraschen, weil die Vorlesungen in Montpellier ja erst zu Sankt Lukas beginnen, also am 18. Oktober; doch ich hatte sehr wohl verstanden, daß mein Vater mich mit der so zeitigen Entsendung vom unsäglichen Weh befreien wollte, das mir der Tod der kleinen Hélix, meiner Milchschwester, bescherte. Einen Monat zuvor hatte sie, nach großem Leiden, in der Blüte ihrer neunzehn Jahre Eingang in den Herrn gefunden. Und ich war ihr in freundschaftlicher Liebe zugetan gewesen, uneingedenk ihres niederen Standes und wider allen Dünkel meines älteren Bruders François, der jetzt im Schutze unserer Mauern zurückblieb, auf daß er Baron würde, sobald der Herrgott meinen Vater zu sich riefe. Allerdings wird François gewiß noch viele Jahre warten müssen, denn mein Vater, dem Himmel sei Dank, war mit knapp über fünfzig noch voll Leben und Kraft; ein Jahr zuvor, als Sarlat von der Pest heimgesucht ward, hatte er Franchou, die Kammerjungfer seiner verstorbenen Ehegemahlin, aus der Vorstadt Lendrevie entführt und mit dem Degen in der Hand, Samson und mich an seiner Seite, einer Bande blutrünstiger Kerle die Stirn geboten.
Hugenotte war ich, ei gewiß, aber in geringerem Maße als mein Bruder Samson, nicht (wie er) seit dem ersten Atemzug mit dem Glauben der Reformierten getränkt. Mich hatte meine Mutter katholisch erzogen; auf ihrem Totenbett schenkte sie mir – der ich mit zehn Jahren unter dem nicht geringen Druck meines Vaters konvertiert war – eine Marienmedaille und nahm mir den Schwur ab, daß ich sie bis zu meinem Lebensende tragen würde. Weshalb ich denn, obzwar ein Reformierter, am Halse treulich besagtes Bildnis trug, das Zeichen katholischen Glaubens.
Waren mir etwa deshalb die Intimitäten, zu denen mich die |10|kleine Hélix verleitet hatte, weit weniger verdammungswürdig erschienen als meinem Halbbruder Samson, der nicht nur einzigartig schön war, sondern auch noch der reine Tugendbold dünkte? Er selbst war freilich, da außerehelich gezeugt, ein lebender Beweis, wie sehr mein Vater, der Hugenotte, vom rechten Pfad hatte abirren können, ohne daß der Herrgott die Frucht dieser Sünde mit seinem Zorn strafte – und ebensowenig den Sünder, denn trefflich gedieh unser Mespech, und groß war der Reichtum, den hugenottischer Sparsinn und die kluge Bewirtschaftung unserer Ländereien dort angehäuft hatten.
Mein Vater war sehr dagegen gewesen, daß wir unseren Ritt durch die mittelfranzösischen Berge nähmen, wo uns das Diebsgesindel leicht Hinterhalte legen konnte. Lieber sollten wir nach Cahors und Montauban reiten, dann den Weg über Toulouse, Carcassonne und Béziers wählen, wo die Straße in der Ebene hinführt, da freilich länger ist, aber auch sicherer, weil sehr belebt von Reitern und Fuhrwerken. Doch mitten auf der Reise, während wir in einer Vorstadt von Toulouse Einkehr hielten, in der Herberge Zu den zwei Engeln, erfuhren wir von der Wirtin, einer gewitzigten Wittib, daß vierzehn Tage zuvor ein Handelstroß, wiewohl gut verteidigt durch eine aus drei Männern bestehende Eskorte, zwischen Carcassonne und Narbonne ausgeraubt und massakriert worden sei von einer starken Bande, die ihre Schlupfwinkel in den Corbières-Bergen hatte.
Diese verdrießliche Nachricht gab uns zu denken, und auf dem Zimmer, das Samson und ich in den Zwei Engeln teilten – Mirouls Bett stand in einem Nebengelaß –, hielten wir Rat. Miroul saß etwas abseits und entlockte seiner Viole düstere Klänge, denn wir wußten nicht, welchem Heiligen, welchem teuflischen Kobold oder Nachtgespenst wir uns anempfehlen sollten, wir wagten nicht Fortsetzung unserer Reise bei so unmittelbarer Gefahr, aber noch weniger, unseren Vater hierüber zu verständigen, auf dessen Antwort es länger als zwei Wochen zu warten gälte.
»Zwei Wochen in der Herberge Zu den zwei Engeln!« rief Samson aus und schüttelte sein schönes Haar. »Das wäre der Ruin unserer Börse, schädlicher Müßiggang und Versuchung durch den Bösling …«
Miroul schaute mich an und zupfte dreimal seine Saite, die dreifache Gefahr zu unterstreichen, die unserer jungen Jahre an |11|diesem Ort harrte. Und ich meinerseits war überrascht: selbst dem unschuldhaften Samson war nicht verborgen geblieben, daß die drallen Serviermädchen, die hier in Überzahl bedienten, beileibe nicht vom Anstrich der zwei Engel auf dem Firmenschild waren, die sich freilich, da in Blech geschnitten, für ihre Tugend kein Verdienst zuschanzen konnten.
Gerade wollte ich auf Samsons Bemerkung antworten, als in der Rue de la Mazelerie, in der die Herberge gelegen war, gewaltiger Lärm aufbrandete: Hufgetrappel, Fluchen, Schreie. Ich eilte ans Fenster (und ich mußte es aufstoßen, um etwas sehen zu können, war es doch nicht aus Glas, sondern mit ölgetränktem Papier bespannt). Samson folgte mir, ebenso Miroul mit seiner Viole in der Hand, und im hereinbrechenden Abend sahen wir gut ein halbes Hundert Reisende von ihren braunroten Pferden – stämmige Tiere mit prallen Kruppen und langen Schwänzen – herab auf das glänzende Pflaster springen; Männer und Frauen in staubiger Kleidung aus allerdings gutem Stoff und von lebhaften Farben, bewaffnet mit Arkebusen, Pistolen oder Degen; die Weibsbilder mit einem breiten Langdolch an ihrer vollen weichen Hüfte, auf dem Kopf gegen die Sonne der mittäglichen Provinzen einen Hut so groß wie ein Schild. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters und Standes, aber hochgewachsen, mit breiten Schultern, das Haar strohfarben, die Augen blau; einige jedoch von ganz anderem Typ, klein, gedrungen, Haut und Haar dunkel. Aber alle zeigten sich sehr erfreut, daß die Unterkunft erreicht war, sie riefen, lachten, schwätzten ohrbetäubend, und in ihrer Freude, wieder Erdberührung zu haben, stießen, schubsten und umarmten sie einander, wechselten Zurufe über die ganze Straße hin und kreischten, was die Kehle hergab, unterdessen ihre großen Pferde dampften, mit den Hufen schlugen und, ihre blonden Mähnen schüttelnd, nach dem Hafer wieherten, daß einem das Trommelfell dröhnte. Kurz, Leute wie Tiere gebärdeten sich in der Rue de la Mazelerie so laut, daß man hätte meinen können, eine Armee aufrührerischer Taugenichtse belagere das Rathaus.
Die braven Toulouser der Vorstadt hingen allesamt in den Fenstern, starrten baß und stumm, mit Glubschaugen, und spitzten die Ohren ganz verdutzt, denn die Ankömmlinge redeten ein seltsames Kauderwelsch, darin sich französische Wörter (jedoch ohne den spitzen Akzent von Paris gesprochen) mit |12|einer fremdartigen Sprache mengten, die keiner braven Mutter Sohn verstand.
Die Truppe drängte schließlich mit unendlichem Geschiebe und Tumult hinein in die Herberge, unterdessen die Hausknechte herbeieilten und die Pferde in die Ställe führten, dabei sie Laute der Bewunderung ausstießen über deren stattliche Brust und gewaltige Kruppe. Unter unseren Sohlen – wir logierten im zweiten Stock – setzte sich der Krach fort, so laut, daß man hätte meinen können, die Mauern brächen zusammen. Wir vernahmen ein Klopfen an unserer Tür, und da Samson und ich am Fenster noch eben die Pferde betrachteten, befahl ich Miroul zu öffnen. Was er auch tat, mit der Viole in der Hand, von der er sich selbst beim Schlafengehen nicht trennte.
Es erschien – ich erkannte sie aus dem Winkel meines linken Auges – die Wirtin persönlich: braun, lebhaft und rührig, gut gekleidet in gelbem Rock und einem Schnürmieder von gleicher Farbe, aus dem so schöne, so runde, so aufregende Brüste hervordrängten, daß ein böser Mensch hätte sein müssen, wer solches darbot und nicht auch wünschte, daß man es betastete.
»Mein hübscher Junge, bist du nicht der Diener der schönen Edelleute aus dem Périgord, die da am Fenster ihre Zeit vertrödeln?« fragte die Wirtin in ihrem Toulousisch.
»Bin ich!« rief Miroul und zupfte eine höfliche Saite seiner Viole. »In deren Diensten steh ich und bin Euch augenblicklich ebenso ergeben, meine gute Wirtin«, fuhr er fort, eine andere Saite zupfend, womit er ihr wunderviel sagte über seinen Blick hinaus.
»Bei allen Heiligen!« rief die Wirtin lachend, »gut wetzt du deinen Schnabel, Diener, und spielst dein Instrument. Wie heißt du?«
»Miroul, zu Euren Diensten«, beschied der Brave, zupfte seine Viole und sang:
»Ein Auge blau, ein Auge braun,
das ist Miroul, ihr könnt es schaun …«
Mir krampfte sich das Herz zusammen, denn mit diesen Worten hatte die kleine Hélix ihn während ihres langen Sterbens begrüßt, sooft ihr Fieber nachließ und er dann, auf meine Bitte, mit seiner Viole kam, sie die Flammen ihres Leidens vergessen zu machen. Doch ich drängte die Erinnerung in die tiefe |13|Tasche des Vergessens zurück. Nach vorn wollte ich fortan schauen, nimmermehr in die Vergangenheit.
»Miroul«, sagte die Wirtin mit Wimperflattern, »in ein so zwiefarbenes Augenpaar habe ich nicht das mindeste Vertrauen. Denn mag das blaue Auge brav und sittsam sein, das kastanienfarbene ist schurkisch.«
Dies war so gut geschäkert, daß ich, von dem Prachtweib angezogen wie Feilspäne vom Magneten, meins dazutun wollte.
»Gevatterin«, sprach ich, indessen ich mich gänzlich umwandte und mit raschem Schritt auf sie zuging, »wann immer Ihr unsere Hilfe oder unsere Dienste begehrt, sie sind Euch gewiß bei so hübschem Antlitz und so viel fleischlicher Anmut!«
»Das sind Worte, die man je öfter je lieber hört«, erwiderte sie.
»Ich könnte sie Euch zu jeder Stunde wiederholen, sofern Ihr nur möchtet; bei Tag und bei Nacht.«
Aber die Wirtin vermeinte wohl, daß wir vom ersten Wort an zu schnell und zu weit vorgeprescht waren, sie antwortete nur eben mit einer Verbeugung, die freilich ein strenger Geist hätte tadeln können. Denn sie mußte, als sie sich aufrichtete, mit flinken Fingern ihre liebreizenden Vorzüge ins weiche Miedernest zurückdrängen.
»Moussu«, sprach sie und tat verwirrt, »kommen wir zur eigentlichen Sache: Uns sind da unversehens fünfzig normannische Pilger ins Haus gefallen, die sich allerfrommst nach Rom begeben, geführt von einem mächtigen Baron und einem halben Dutzend Mönche.«
»Ich hörte sie wohl!« sagte ich mit einem Lachen.
»Leider muß ich, um sie unterzubringen, je vier in ein Bett stecken, und in diesem Bette da«, sie wies auf unsere Lagerstatt, »seid Ihr nur zu zweit. Mein edler Herr, würdet Ihr für diese Nacht weitere zwei in Euer Bett aufnehmen wollen?«
»Männer oder Weiber?« fragte ich grinsend.
»Männer!« sagte Samson in ernstem Ton, vom Fenster herbeitretend.
Die Wirtin musterte ihn schweigend, während er sich in seiner ganzen mannhaften Schönheit vor ihr aufpflanzte. Sie seufzte tief, denn sehr wohl fühlte sie, was für ein Gottesengel da vor ihr stand, so gar nichts nütze für sie, die sonderlich die irdischen Engel liebte.
|14|»Also Männer«, sagte die Wirtin, mit neuerlichem Seufzer und einem leichten Wogen ihres Busens, woraus ich schloß, daß sie das eigene Bett gern den Pilgern überlassen hätte, um in unserem zu nächtigen.
»Männer ja, aber nicht Mönche!« sagte Samson mit seinem charmanten Lispeln, jedoch ein bißchen schroff.
Seine Worte schreckten die Wirtin auf, ihre Miene verfinsterte sich.
»Beim heiligen Joseph, bei der heiligen Jungfrau, bei allen Heiligen!« rief sie, »gehört Ihr etwa zu diesen pestenden Ketzern und Spießgesellen des Teufels, die keinen Gottesmann an ihrer Seite dulden?«
»Keineswegs, Gevatterin!« rief ich hastig, wußte ich doch, wie sehr die Hugenotten, seit dem Sieg von Montluc, in Toulouse verdächtigt und verfolgt wurden. »Mein Bruder meint das anders, er fürchtet, die Mönche könnten zu fett sein und zu viel Platz im Bett belegen.«
»Heiliger Jesus! Seid Ihr, Moussu, wie Euer Bruder auch, ein Feind der Wohlgenährtheit?« fragte die Wirtin, nun wieder lächelnd.
»Keineswegs!« Ich griff mit meinen Händen tapfer zu. »Es gibt Füllen, die sind dem Auge so gefällig, daß man ihren Besitzerinnen beim Tragen helfen möchte!«
»Aber, aber!« Sie klopfte mir auf die Finger, ohne verärgert zu sein. »Dies ist zum Anschauen da, nicht zum gemeinen Gebrauch.«
Hier zupfte Miroul seine Saite zwei- oder dreimal, als ironisches Echo, und die Wirtin lachte hellauf, mit einverständigem Blick.
»Wenn das Gegacker vorbei ist, möchte ich mich dann endlich ausziehen und hinlegen«, sagte Samson, etwas ungeduldig.
»Nur zu, das geniert mich nicht!« sagte die Wirtin, bar von Scham. »Wenn das Darunter dem Darüber entspricht, hätte ich Freude daran, Euch so zu sehen, wie Gott Euch geschaffen hat.«
»Pfui, Gevatterin!« sagte Samson, errötend, und wandte sich ab.
»Aber, aber! was für merkwürdige Edelleute!« rief die Wirtin. »Der eine zu heiß, und zu kalt der andere, und der Diener mit zwiefarbenen Augen. Ich habe aber noch eine weitere Bitte. |15|Heute morgen hörte ich Euch mit Eurem Bruder in einem Kauderwelsch reden, das sich wie das Französisch anhörte, das man in Frankreich spricht.«
»Und Ihr versteht es nicht?«
»Wir sprechen hier nur Okzitanisch«, sagte die Wirtin, »wie Ihr auch, Moussu, nur eben mit anderen Worten und einem anderen Akzent. Wißt, kein Bursche und kein Mädchen in dieser Straße versteht das Französisch aus Frankreich, weiß es zu lesen, geschweige zu schreiben. Ich allerdings«, sie richtete sich stolz auf, »ich kenne meine Zahlen.«
»Na, welche Wirtin nicht!« entgegnete ich lachend. »Aber Gevatterin, sagt mir doch freiheraus, daß Ihr mich als Dolmetsch für den normannischen Baron haben wollt.«
»Das ist es!« rief die Wirtin.
»Ich folge Euch«, sagte ich, schob die Dralle zur Tür hinaus und schloß sie hinter mir, glücklich darüber, Samsons Blick zu entwischen.
»Der Baron«, flüsterte mir die Wirtin zu, »heißt Caudebec. Bei der heiligen Jungfrau, mein edler Moussu, hört auf, mich zu kneifen, ich bin nicht Brotteig, der so geknetet werden muß.«
»Ist es meine Schuld, wenn Eure Treppe so finster ist? Muß ich mich da nicht festhalten?«
»Aber, aber! beim heiligen Joseph! haltet Euch sonstwo fest! Ja doch, nun erkenne ich: Ihr seid ein braver Christ und keiner von den üblen Ketzern, die uns unsere Tänze, unsere Spiele und Heiligenfeste verbieten möchten. Die Pest soll diese Mucker holen!«
»Wie heißt dieser Normanne?« fragte ich, nicht gewillt, ihr Erwiderung zu tun. Statt dessen gab ich ihr Küsse auf den Hals und den Brustansatz.
»Caudebec. Merkt Euch den Namen gut: Caudebec. Der Herr hält sich für so vornehm, daß er meint, alle Welt müsse ihn kennen.«
»Caudebec!« sagte ich.
»Ihr seid auch ein Chaudebec, ein hitziger Schnäbler!« Sie lachte und wand sich. »Bei allen Heiligen, Eure Lippen und Hände sind überall! Ihr bringt mich um mit Euren Küssen! Gebt gütigst Einhalt! Mich erwartet, der frommen Pilger wegen, in der Küche viel Arbeit!«
|16|Doch da ich nicht Anstalten machte, ihr zu gehorchen, weil ich spürte, wie sehr ihr Verdruß nur vorgetäuscht war, versetzte sie mir einen Rippenstoß, der mich zu Fall brachte, und sie mit, so fest hatte ich sie umarmt; wir stolperten die letzten Stufen hinab, purzelten hin mit lautem Krach, während im Saal unter den Pilgern Schweigen herrschte, weil gerade ein Mönch das benedicite beendete. Unsere Pilger, in nicht gar großer Sammlung, wiewohl andachtsvoll dreinblickend, schielten schon auf die Teller und harrten nur eben darauf, daß ein »Amen« sie von diesem Latein befreie; und wie ihnen nun die Wirtin und ich so plötzlich vor die Füße rollten, begannen alle zu lachen.
»Ruhe!« schrie mit Donnerstimme Baron Caudebec und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte aus Eichenholz. »Schämt ihr euch nicht, mit eurem Gelächter das heilige Gebet zu stören, nur weil ein Weib vor euren Augen hinfällt? Potz Daus! benimmt sich so ein Pilger, der frommen Sinnes unterwegs nach Rom ist? Ihr zeigt euch ja verdorbener als die Pariser Gaukler. Ruhe! sag ich. Wer an dieser Tafel das Maul aufreißt, solange das Gebet gesprochen wird, dem hau ich den Kopf in Stücke!«
Da trat Stille ein, und der Baron befahl:
»Bring es zu Ende, Mönch!«
»Aber … ich bin am Ende«, sagte der Mönch.
»Amen!« schrie da Baron Caudebec, und alle anderen riefen gleichfalls »Amen«, so laut, daß die Herberge bebte. Hierauf machten sie sich wie ausgehungerte Wölfe über die Fleischtöpfe her, schlangen tapfer Bayonner Schinken, gebratenes Perlhuhn, Trüffelomelette, Bigorrer Bratwurst, Wildbachforelle und eine Menge anderer Gerichte, für welche die Herberge Zu den zwei Engeln berühmt war. Und während die Pilger die Kinnladen eifrig betätigten, eilten ein Dutzend Serviermädchen von dem einen zum anderen und gossen lachend, dabei keck sich windend, aus ihren Krügen schwallweise von unseren guten Guyenne-Weinen in die gierigen Becher.
»Da seht«, sagte die Wirtin, unterdessen sie sich vom Boden erhob und ihr Mieder ordnete, »da seht (und ihr Auge schweifte befriedigt über die Tafel), was das für scharfe Zähne und für ausgetrocknete Kehlen sind!«
»Und was für dicke Zahlen morgen auf Eurer Schiefertafel, Gevatterin«, erwiderte ich lachend und klopfte mir den Staub ab.
|17|»Scht, edler Moussu«, sagte die Wirtin, den Mund nah meinem Ohr, obwohl das Okzitanische unseren Gästen nicht im mindesten geläufig war. »Diese braven Normannen dünken mir sehr betucht. Habt Ihr die goldenen Armreifen der stattlichen Damen da gesehen? Moussu, säumen wir nicht, mich ruft die Küche. Tut Ihr, wie besprochen. Und was mich betrifft (sie kniff mich funkelnden Auges in den Arm), ich werde Gelegenheit haben, Euch wiederzufinden, sei es Tag oder Nacht. Euch jedenfalls stets ergeben zu Diensten.«
Sie machte eine tiefe Verbeugung, hielt aber die Hand über dem Mieder, damit die Brüste nicht wieder ihrer Behausung entschlüpften, hier vor so frommer Versammlung.
»Monsieur!« rief Baron Caudebec, mit der Keule eines Perlhuhns auf mich zielend. »Wer seid Ihr, daß Ihr es wagt, taktlos unsere heiligen Gebete zu stören? Wäret Ihr nicht ein so junger Spund, würde ich Euch auf der Stelle meinen Degen durch die Leber stoßen!«
»Herr Baron Caudebec«, antwortete ich im Französisch der Pariser und verbeugte mich leicht, »habet die Güte, meine Leber zu schonen, auch wenn ich entschieden verneine, daß sie der Sitz des Denkens ist, wie Babylons Gelehrte fälschlicherweise behaupteten. Ich heiße Pierre de Siorac und bin der Zweitgeborene des Barons von Mespech aus dem Périgord. Ich reite nach Montpellier, die Medizin zu studieren, und hier bin ich, um mich Euch als Dolmetscher anzubieten, da ich des Okzitanischen kundig.«
»Holla, Euch schickt mir das Paradies aller Heiligen!« rief Caudebec, die Keule himmelwärts richtend. »Page, einen Schemel für diesen Edelmann! Hierher, nahe zu mir! Ihr seid mir die Rettung, mein Freund! In diesen Provinzen wähne ich mich verlorener als ein Christ in Maurenland! Dieses Bauernvolk hier versteht meine Sprache nicht!«
Der Baron erhob sich und legte mir huldvoll seine schweren Pranken auf Schulter und Rücken. Alles an ihm war von stattlicher Größe: sein Stiernacken, die ausladenden Schultern, der mächtige Brustkorb. Er hatte blondes Haar, einen dichten Schnauzbart, blaue Augen in einem karminroten Rundgesicht. Sein prächtiges Wams war etwas in Mitleidenschaft gezogen, weil er aß wie ein Türke; er warf die abgenagten Knochen hinter sich und wischte seine Finger an den Röcken der Serviermädchen |18|ab, die ihn nicht zu schelten wagten, denn beim geringsten Aufbegehren knurrte er, schaute zornig drein und drohte sogleich, dem Mädchen die Titten zu zersäbeln. Er sagte es auf französisch und wurde nicht verstanden, doch Blick und Ton waren beredt genug. Und hatte sich der Baron Finger und Schnauzbart von der Sauce gesäubert, befummelte er dem armen Ding noch ein bißchen den Hintern, war er doch ebenso lüstern wie fromm.
»Mein Freund«, rief er nach den Umarmungen, »Euer Wams ist noch ganz staubig vom Fallen vorhin. Holla, Page, nimm dem edlen Herrn das Wams ab und bürste es aus! Page, potz Daus! der Kerl schläft wohl! Herrgottspfingsten, ich hol ihm das Gedärme aus dem Leib!«
In Wahrheit gab er sich mit einer Backpfeife zufrieden. Der Schlingel wich ihr aus, schrie aber wie ein Schwein am Spieß. Dann entwendete er mir im Nu das Wams und eilte damit fort, denn der Spitzbube war mitnichten verschlafen, sondern ein Quecksilber und nicht minder ein Lügner und Frechling und hatte, fern den Ohren seines Herrn, ein arges Mundwerk. Ergötzlich übrigens zu sehen, wie er hinter dem Baron stand und die halb abgenagten Knochen auffing, was aber nicht des Pagen einzige Verpflegung war. Er plünderte auch die Schüsseln der Pilger, schnappte ihnen die besten Happen vor der Nase weg, sobald sie den Kopf abwandten. Rouen hieß dieser Page, nach der Stadt seiner Geburt, und das war schon eine recht merkwürdige Art, einen Christen zu benennen. Er hatte grüne Augen und auf dem Schädel einen wirren Busch roter Haare, so struppig und stachelig, daß kein Kamm der Welt gegen sie ankam.
Doch zurück zu meinem Bericht. Nachdem mir das Wams abgenommen worden, setzte ich mich im Hemd auf den Schemel zwischen dem Baron und einem untersetzten, breitschultrigen Mönch, dem die dichten schwarzen Brauen das Antlitz in zwei Hälften spalteten. Der brave Apostel saß beim Speisen recht weit ab vom Tisch, weil sein Schmerbauch sich gewaltig vorwölbte.
»Monsieur de Siorac«, wandte sich der Baron an mich, eine lange Bigorrer Wurst schlingend, die er sich im ganzen Stück eingeführt hatte, »dieser Mönch ist Bruder Antoine« – was sich, bei vollem Mund, so anhörte: »Müfer Mömpf ift Bruder Amtoam.« Als die Wurst verdrückt war, trank er, um nachzuspülen, |19|in einem einzigen Zug seinen Becher leer, dann fuhr er fort: »Bruder Antoine genießt mein volles Vertrauen. Er ist sehr gebildet. Er darf die Beichte abnehmen, und ich habe ihn meinen braven Pilgern zum geistigen Vater bestimmt.«
Bruder Antoine grüßte mit gütigem Kopfnicken, musterte mich indes aus seinen schwarzen Äuglein. Nur ja Vorsicht bei diesem Bruder! war mein Gedanke, vielleicht riecht er in mir den Hugenotten.
»Dieser Wein ist nicht von den schlechtesten!« rief der Baron, den Becher absetzend, und grapschte sich mit ganzer Hand eine zweite Wurst.
Nachdem das Beutestück in den Mund geführt war, fuhr der Baron fort:
»Der Grund meiner Pilgerreise, Monsieur de Siorac, ist, daß meine arme Frau an einem fortwährenden Fieber langsam hinsiecht. Mein Freund, Ihr habt es erraten: ich begebe mich nach Rom, um unseren heiligen Vater, den Papst, zu bitten, er möge die Jungfrau Maria bitten, daß sie sich beim Göttlichen Sohn für die Gesundung meiner Gemahlin einsetzt.«
Welch eine Abgötterei! dachte ich, und wie viele Vermittler: der Papst! und Maria! Warum nicht einfach den Herrgott bitten? oder als Vermittler nur eben den Sohn, wie es in den Evangelien steht? Doch ich fühlte Bruder Antoines bohrenden Blick auf mir lasten, blieb fein still und setzte lieblichste Miene auf.
»Monsieur de Siorac«, fragte Bruder Antoine mit süßester Stimme, »Ihr begebt Euch ganz ohne Besorgnis zum Studium nach Montpellier, obwohl es dort von Ketzern wimmelt?«
»Ein braver Christ fürchtet den Teufel nicht«, entgegnete ich mit einem Lächeln.
»Das nenne ich gut geantwortet!« rief der Baron. »Holla, Mädchen, Wein her!«
Doch das angerufene Serviermädchen stellte sich taub, und ich begriff warum.
»Mein Herr Dolmetscher«, sprach der Baron, »mehr als alle anderen Jungfern hier gefällt mir diese, und ich werde es sie die kommende Nacht spüren lassen. Sagt ihr, sie soll mir ihren Wein bringen, auf der Stelle, oder ich zersäbele ihr die Titten.«
»Ich gehe und sag es ihr«, antwortete ich und erhob mich, froh darüber, Bruder Antoines Auge zu entwischen und mich einer so hübschen Dirn zu nähern.
|20|Ich strebte auf das junge Mädchen zu, und um es zu besänftigen, legte ich ihm beide Hände auf die Hüften und bedachte es mit einem freundlichen Lächeln.
»Mein Kind, erzürne den Baron nicht gar zu sehr. Er wünscht sich deinen Wein.«
»Es ist … ich möchte nämlich nicht, daß dieser Esel mir den Rock vollschmiert, wie er es bei der Madeleine getan«, sagte sie.
»Und du, wie heißt du, Schätzchen?« fragte ich. Und mein Lächeln kostete mich keine Mühe, da ihre schönen schwarzen Augen mich bezauberten.
»Franchou heiße ich, edler Herr.« Sie machte eine Verbeugung und hielt den Weinkrug in die Höhe – ein sehr anmutiges Bild. Doch mich hatte vor allem der Name überrascht: Franchou! durchfuhr es mich, Franchou! Wie jenes Kammermädchen, das mein Vater vor der Pest aus der Vorstadt Lendrevie gerettet hatte!
»Franchou, wenn du dem Baron nicht gehorchst, will er dir die Brüste zersäbeln«, sagte ich.
»Jessas!« rief Franchou mit einem Quentchen Entsetzen im Gesicht, das mich entzückte. »Dies also kauderwelscht er in seinem französischen Patois. Heilige Muttergottes, würde er das tun?«
»Weiß ich nicht. Er ist ein Mann von wenig Geduld. Geh hin, Franchou! Ich werde die Wirtin bitten, für den Schaden an deinem Rock aufzukommen.«
»Großen Dank, mein edler Moussu«, sagte sie und schaute mich sehr freundlich an.
Leider ließ es die Kleine dabei nicht bewenden. Kaum hatte sie dem Baron eingeschenkt, betatschte der sie und versaute ihr mit seinen fettigen Fingern den Rock.
»Ha!« rief der Baron, »mir will scheinen, Herr Dolmetsch, Ihr habt nicht nur für meinen Heiligen gepredigt, sondern ebensosehr für den Euern, denn das Mädchen hat Augen nur für Euch!«
»Was sagt der Hornochs?« fragte Franchou.
»Daß du eine kleine Schwäche für mich hast.«
»Was allerdings wahr ist«, gestand Franchou freimütig.
»Monsieur de Siorac, Ihr habt um den Hals ein schönes Kettchen. Darf man sehen, was daran hängt?« fragte Bruder Antoine.
|21|Ich holte die Medaille unter dem Hemd hervor.
»Die Jungfrau Maria!« Er schlug das Kreuz. »Gebenedeit sei die Muttergottes! Und wer, mein Sohn, hat Euch diese schöne Reliquie geschenkt?«
»Meine Mutter«, sagte ich karg.
»Ganz gewiß ist Eure Mutter von vornehmer Geburt, da die Medaille aus Gold, edel gearbeitet und sehr alt ist.«
»Mitnichten«, erwiderte ich eilig. »Wir sind von jungem Adel. Mein Vater wurde auf dem Schlachtfeld von Ceresole zum Ritter geschlagen, und den Titel eines Barons erhielt er nach dem Sieg unserer Waffen vor Calais.«
Ich sagte die Wahrheit und täuschte dennoch, ganz wie mein Vater es zu Lendrevie im Gespräch mit dem Kapuziner gehalten. Denn mochte mein Vater, von niederer Geburt, erst jüngst geadelt worden sein, war meine Mutter doch, wie Bruder Antoine richtig geraten, vornehmen alten Geblüts: sie stammte von einem Castelnau ab, der in den Kreuzzügen gefochten hatte. Allerdings hätte ich Bruder Antoine diese Abkunft nicht dartun können, ohne einzugestehen, daß meine Mutter eine nahe Verwandte der Caumonts war, Herren von Les Milandes und Castelnau. Die Caumonts aber waren im ganzen Königreich dafür bekannt, daß sie im Périgord, im Quercy und im Agenais den reformierten Glauben unterstützten.
»Gewisserweise muß ich mich bei Euch entschuldigen, mein Sohn«, sagte Bruder Antoine, dabei er sich mir zuneigte und mich mit gefälligerem Blick bedachte. »Euer schwarzes Wams – recht merkwürdig auf dem Leib eines jungen Edelmannes – ließ mich in Euch einen jener abscheulichen Ketzer argwöhnen, die sich, in Maskierung, unter uns drängen, um unseren Glauben zu verderben. Aber Euer wackeres Auftreten und diese heilige Medaille überzeugen mich, daß es nicht an dem ist.«
»Was! Mein Dolmetscher ein Ketzer?« rief Caudebec. »Mönch, du träumst wohl!«
Er versetzte Franchou, um sie zu verabschieden, einen heftigen Klaps auf die Rundungen, schnappte sich eine Forelle und steckte sie sich mit Kopf, Schwanz und Gräten ins Maul. Franchou entfloh weinend und stöhnend, die Hand am Hinterteil, wo ihre Haut noch Stunden später arg gerötet war, das kann ich bezeugen.
|22|»Mein Sohn«, fuhr Bruder Antoine fort, ein Auge auf die Serviermädchen geheftet, »wenig fruchtet es uns, dem Herrgott, der alles sieht, verhehlen zu wollen, daß wir aus einem gar zerbrechlichen Ton sind. So schwach ist unser Fleisch, daß der Teufel uns mit jedem Weiberrock in Versuchung führt (er hielt den Blick nicht gesenkt, im Gegenteil). Und dies ist ein sehr einladendes Haus (er seufzte), wo man gut ißt, vorzüglich trinkt und wo diese jungen Mädchen – gäbe Gott, ich täuschte mich! – es gewohnt sind, vor jedem Gast ihre Hüften zu wiegen. (Er tat einen weiteren Seufzer.) Morgen, mein Sohn, will ich Euch die Beichte abnehmen.«
Ha, so ein Schurke! Er versuchte es mit Überrumpelung! Der Argwohn dieses Betbruders war, entgegen seiner Behauptung, nicht verflogen. Er verdächtigte mich weiter, und weil er wußte, wie sehr die Hugenotten die Ohrenbeichte verabscheuen, legte er diese üble Fallschlinge aus!
Ich setzte redliche Miene auf: »Bruder Antoine, noch weiß ich nicht, ob ich meine Nacht in Unschuld verbringe. Sollte dies nicht der Fall sein, will ich morgen gern auf Eure guten Dienste zurückgreifen, um mich von meinen Sünden zu reinigen.
Merkwürdige Sitte: es sündigt einer, er reinigt sich, sündigt wieder … Weiter kam ich nicht in meinen Überlegungen, denn Baron Caudebec brüllte jäh auf, faßte sich an den Hals und schrie, er sei am Sterben, ihm stecke eine riesige Gräte im Schlund, wir sollten sofort einen Reiter nach dem Barbier schicken. Auf der Stelle, potz Daus! Sofort, Himmelpfingsten! Oder er würde in diesem teuflischen Haus alles niedermetzeln, den Koch, die Küchenjungen, die Saucenverderber, die Serviermädchen bis hin zur Herbergswirtin!
Ich bat ihn, sich zu beruhigen. Bis man den Barbier auftriebe, zumal dies ein Sonntag, litte er noch viele Stunden Pein. Lieber solle er sich brav hinsetzen, den Mund weit aufsperren und ein bißchen Geduld zeigen, ich selbst wolle mein mögliches tun. Er fügte sich. Ich ließ mir einen brennenden Kien bringen, um die Tiefe seines Schlunds auszuleuchten – es stank gewaltig aus diesem Abgrund –, und ich entdeckte die Gräte: sie steckte eine halbe Daumenbreite hinter dem Zäpfchen. Ich schnitt mir zwei lange Holzstäbchen zurecht, die Enden zu Spateln geformt, und benutzte sie als Pinzette. So gelang es mir, den winzigen Grund dieses großen Gezeters herauszuziehen.
|23|Caudebec mochte seinen Sinnen nicht glauben, als er, zu seiner Erholung einen ganzen Weinkrug leerend, im Schlund keinerlei Schmerz mehr spürte.
»Potz Daus!« rief er und erhob sich auf die Beine. »Ein Wunder ist geschehen! Der Heiligen Jungfrau sei Dank! Und … (er umarmte mich so ungestüm, daß ich fast selbst erstickte) auch dir danke ich, mein gelehrter junger Freund. Du bist heute mein wahrhaftiger Sohn, denn mein leiblicher Sohn ist, verglichen mit dir, nur ein Riesentölpel, der kaum rechts von links zu unterscheiden weiß, überm Lesen radebrecht, noch schlechter schreibt als ich und nichts im Sinn hat als Fuchsjagd, Völlerei, Saufen, die Bauern schinden, die Kammermädchen pfählen. Die Pest über diesen Ignoramus! Der hätte seinen so qualvoll leidenden Vater glatt sterben lassen! Monsieur de Siorac, Ihr seid mir von der Jungfrau Maria und allen Heiligen gesandt. Euch hat der Himmel auf diesen Schemel bestellt, um einen armen Sünder zu retten! Mein lieber Dolmetsch, mein liebreicher Vetter, mein ewiger, unwandelbarer Freund, was begehrst du zum Lohn für diesen Dienst, den du der Baronie Caudebec erwiesen? Verlange, was du willst! Alles sei dein!«
Und er bewies, wie sehr ein normannischer Baron nach Art der Gascogner zu übertreiben vermag, denn er fuhr fort:
»Sag an, was wünschst du? Meine Börse? Mein Pferd? Meine Tochter?«
»Aber, aber!« wehrte ich ab, mit einem Lachen. »Eure Tochter im Tausch für eine Fischgräte?«
»Meine Tochter? Ich hab keine Tochter!« rief Caudebec und lachte herzerfrischend über sich und mich, auf normannische Art, die so plump nicht war.
»Nun gut«, erwiderte ich, »wenn Ihr schon von einem jungen Mädchen redet …« Ich flüsterte ihm einige Worte ins Ohr.
»Ha, Mordskerl!« rief er und lachte schallend. »Wüstling! Aber abgemacht! es kostet mich nicht viel. Obschon (er besann sich sofort wieder), ich hatte das Dämchen ins Auge gefaßt. Aber sei es (und er tat sehr großmütig), ich überlasse sie dir, mein Freund, da dies nun mal dein Begehr ist.«
Mir schien, er war recht erleichtert, so billig davongekommen zu sein – Schenken war, wie ich erraten hatte, seine Stärke nicht.
Unterdessen brachte der Page mein Wams zurück. Ich streifte es über, dann verabschiedete ich mich von Baron Caudebec, |24|von Bruder Antoine und von dieser frommen Versammlung, die ihr Mahl noch nicht zur Hälfte eingenommen hatte, denn weiterhin sah man sie die aus der Küche herbeigetragenen Fleischmassen tapfer schlingen. Am Treppenabsatz rief ich den Pagen:
»Holla, Rouen, zu mir!«
Er eilte herbei und starrte mich mit seinen grünen Augen an, schien sich nicht ganz wohl in der Haut zu fühlen.
»Rouen, du hast mein Wams ausgebürstet und schuldest mir darum vier Sols«, sagte ich leise zu ihm.
»Vier Sols, wie das, Herr?« Rouen sperrte das Maul auf.
»Aber genau. Die waren nämlich in meiner Tasche.«
»Vielleicht sind sie herausgefallen«, sagte Rouen, auf den Fußboden starrend, als suchte er sie.
»Glaube ich dir: aus meiner Tasche herausgefallen in deine hinein.«
»O nein, Herr!« versicherte er, ohne die Stimme zu heben. »Ich schwör’s, ich bin eine ehrliche Haut!«
»Geh mir, Rouen! Schwören zu dieser Stunde! Was geschähe, wenn ich meine Rechnung deinem Herrn vorlegte?«
»Er würde mich grün und blau schlagen!«
»Um dir diese Pein zu ersparen, Rouen, verständigen wir uns auf einen kleinen Handel. Falls du die vier Sols auf dem Fußboden findest, sollen sie nach gutem Finderrecht dir gehören. Und solltest du Bruder Antoine über mich reden hören mit dem Baron, erzählst du mir, was er gesagt hat.«
»Topp, es gilt!« sagte Rouen, mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr.
Ich kehrte zurück in mein Zimmer, sehr befriedigt darüber, auf welche Weise ich Bruder Antoine getäuscht. Ich hatte ganz nach meines Vaters Art gehandelt: die Wahrheit, so meinte er, schulde man nur Freunden, dem Feind sei mit List und Tücke zu begegnen, dabei er die Hugenotten oft mit den unterdrückten Hebräern der Bibel verglich.
Mein geliebter Samson hatte sich nicht entkleidet und nicht hingelegt, er fürchtete Heimsuchung unserer Bettstatt durch die von der Wirtin angekündigten Fremdlinge. Er hatte mit Unbedacht darauf beharrt, daß unsere Beischläfer Männer und nicht Weibsbilder sein sollten, war er doch selbst so schön und wohlgestalt, daß er einem Päderasten durchaus eine Versuchung hätte sein können.
|25|Ich fand ihn grübelnd, grollend und schweigsam auf seinem Schemel, sehr betrübt ob meiner langen Abwesenheit. Ihm gegenüber saß Miroul, der den Mund nicht aufzutun wagte, nur hin und wieder an einer Saite seiner Viole zupfte, seinem Herrn zur Tröstung und weil es so schön klang.
Mein lieber Samson zeigte sich sehr erregt, nachdem ich ihm meine Erwägung nahegebracht, daß wir uns diesen normannischen Pilgern anschließen und in ihrer Begleitung bis Montpellier reisen sollten: der Trupp sei groß und gut bewaffnet, mit ihm würden sich die Straßendiebe der Corbières-Berge nicht anzulegen wagen.
»Was! die ganze Zeit mit diesen Papisten leben?« rief er. »Eine Maske tragen? ihre Messen hören? vielleicht gar beichten?«
Ich warf mich auf, stemmte die Hände in die Hüften. »Mein Herr Bruder, ganz fehl ist Euer Murren«, sagte ich etwas kühl.
Dieser Ton traf ihn in einem Maße, daß ihm die Tränen kamen, so groß war die Liebe, die uns verband. Ich selbst konnte es nicht ertragen, daß er, ob wenig oder viel, meinerhalben litt, und eilte, innerlich sehr bewegt, auf ihn zu, umarmte ihn, küßte ihn auf beide Wangen. Darauf Miroul seine Viole zupfte.
Ich setzte Samson auf das Bett neben mich und sagte: »Bruder, erinnert Euch, wie klug unser Vater handelte, als er Euch die Verwaltung unserer Börse anvertraute, mir aber die Führung unserer kleinen Schar, dabei er mir riet, allenfalls den Ratschlägen Mirouls zu folgen, der besser als wir die Räuber der großen Straßen kennt.«
Hier senkte Miroul traurig das Haupt, denn seine ganze Familie war von einer solchen Schurkenbande niedergemetzelt worden, und ihm wäre Gleiches widerfahren, hätte er sich nicht geistesgegenwärtig im Heu versteckt.
»Aber das Brot brechen mit diesen blutrünstigen Papisten, die so viele der Unseren auf den Scheiterhaufen geschickt haben!« wandte Samson ein.
»Blutrünstig sind sie gewesen und könnten es wieder werden«, sagte ich, »doch zur Stunde regiert irgendwie Frieden zwischen ihnen und uns. Ansonsten sind diese Normannen zwar Götzenanbeter, aber brave Leute. Laß mich nur machen, mein lieber Samson.«
»Aber du weißt, ich kann nicht heucheln.«
|26|»Ich weiß es«, sagte ich und legte ihm den Arm über die Schulter. »Darum werde ich für uns beide Verstellung üben. Du, Samson, hältst den Mund, sagst keinen Ton, ich aber werde erzählen, du littest an einem zehrenden Fieber, und Miroul pflegt dich und wird auf alle Fragen, die man ihm stellt, mit Akkorden seiner Viole antworten. Was meinst du, Miroul?«
»Mein Herr und Meister, ich denke, Ihr habt recht«, erwiderte Miroul. »Weniger groß ist die Gefahr, mitten unter den Papisten zu reiten, denn allerwegen allein und auf unsere schwachen Kräfte angewiesen.«
»Was aber werden sie tun, wenn sie uns auf die Schliche kommen?« fragte Samson.
»Nichts, möchte ich wetten. Der Baron ist zwar ein Rohling, aber nicht grausam.«
Es klopfte an die Tür. Miroul öffnete, und es erschien, mit einem schweren Tablett in den Händen, Franchou.
»Meine Herrin sieht keinen Platz, Euch am Tisch unten im großen Saal unterzubringen, edle Herren, da dort die vielen Pilger aus dem Norden speisen«, sagte Franchou und hatte nur Augen für mich.
»Aber das ist uns doch sehr angenehm!« erwiderte ich.
Samson den Rücken zuwendend, half ich Franchou, die Last zu einem Tischchen in Fensternähe zu tragen, wo wir ungestört Blicke tauschen konnten.
»Mädchen«, sprach ich zu ihr, da ich vor meinem Bruder ihren Namen nicht nennen wollte, »ich werde mich mit dem Essen beeilen. Sobald du von deinem Tagewerk frei bist, kommst du und sagst mir, ob Baron Caudebec meine Dolmetscherdienste benötigt.«
Sie verstand sofort, und ihre leuchtenden schwarzen Augen gaben es mir zu erkennen.
»Zu Diensten, edler Moussu«, sagte sie und verbeugte sich tief, doch ihr Blick war mitnichten so demütig.
Das saftige Fleisch war ein Genuß, doch so wonnig ich speiste, meine Aufmerksamkeit richtete sich anderwärts: ich lauschte den Geräuschen draußen im Gang; dort hallten schwere, schlurfende Schritte: die Pilger begaben sich zur Nachtruhe. Was auch mein lieber Samson tat, nachdem der letzte Becher Wein geleert war. Angekleidet lag er ganz am Rande der Bettstatt, damit unsere Gäste Platz fänden.
|27|»Miroul«, flüsterte ich, »wenn die braven Leute kommen – und gebe Gott, daß ihre Schultern nicht zu breit und ihre Bäuche nicht zu dick sind –, dann sage ihnen, sie möchten sich leise gebärden, damit Samson nicht aufwacht.«
»Ich werde achthaben, Herr«, sagte Miroul. Und weiß der Teufel: wenn ihn etwas erheiterte und er es nicht zeigen wollte, blieb sein blaues Auge kalt, während das kastanienfarbene Feuer sprühte.
Irgendwer kratzte wie ein Mäuschen an der Tür, welche sich auftat, ohne daß jemand herein gesagt hätte.
»Mein edler Moussu, der Baron begehrt Eure Dolmetscherdienste«, sagte Franchou, die schönen vollen Wangen gebläht von so heiterer Lüge.
Ich sprang wie ein Ball in die Höhe.
»Sofort, ich eile! Miroul, hab gut acht auf meinen Bruder!«
»Ich wünsche Euch, Herr, gelungenes Dolmetschen in dieser Nacht«, antwortete Miroul, ernst wie ein Bischof auf der Kanzel, und zwackte seiner Viole zwei kleine Akkorde ab.
Ein ander Lied bekam ich am nächsten Morgen zu hören, als ich in aller Frühe auf dem Hof der Zwei Engel aus dem Brunnen Wasser schöpfte, um meine zeremoniöse Waschung zu betreiben – eine Gewohnheit oder Wunderlichkeit, die ich von meinem Vater habe, der in seinen Jugendjahren, damals noch nicht von Adel, zu Montpellier Medizin studierte und als eifriger Schüler des Hippokrates der Auffassung war, es gäbe eine natürliche Affinität zwischen dem Wasser und dem menschlichen Körper: das erste helfe dem zweiten, sich gesund zu erhalten. Möge es Gott gefallen – wenn ich mich hier zum Anwalt meines Vaters aufschwingen darf –, daß der Gebrauch des nassen Elements in unserem Jahrhundert und in diesem Königreich größere Verbreitung fände, auch unter den Standespersonen! Denn ich erlebte als Zwanzigjähriger, am Hofe Karls IX., vornehme hübsche Damen, die sich unendlich zierten und putzten, aber nie ein Bad nahmen. Und ist es nicht ein Jammer, daß diese zarten weiblichen Körper unter Seide und Zierat so schmutzig sind wie ein Landmann, der vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang die Scholle bewegt? Wie bald erspürt ein Mensch von feinem Riechorgan den Dreck unter den Parfums, mit denen unsere Schönheiten sich bestäuben!
|28|In Mespech verabscheute mein älterer Bruder François meine häuslichen Liebeshändel, ich aber ziehe es vor zu sagen: Es lebe Franchou, sofern Franchou sich in klarem Wasser wäscht. Und ein Pfui jener Prinzessin von Geblüt (ihren Namen werde ich nicht nennen), die sich bei Hofe zu rühmen wagte, sie habe den Schmutz von ihren Händen seit acht Tagen nicht entfernt! Und es ging nur um die Hände! Den Rest möge der Leser sich denken.
Ich war also dabei, mich zu besprengen, als in ihrem gelben Rock unsere schöne Wirtin daherkam, gar nicht liebenswürdig, sondern verdrossen und grimmig, mit mürrischer Braue, der Blick spitz wie ein Degen.
»Holla!« sagte sie in verbiestertem Ton, »unser stattlicher Hengst ist dabei, sich nach seinem Ritt schmuck zu striegeln!«
Und da ich in meiner Verwirrung keinen Mucks von mir gab, fügte sie mit hämischem Lachen hinzu:
»In den Knien etwas weich, will mir scheinen!«
»Ganz und gar nicht!« erwiderte ich, mich gereizt aufrichtend. »Und stets zu Euren Diensten, Gevatterin!«
»Ha, Schändlicher, das ist nicht wahr! Letzte Nacht habt Ihr meiner Speise die kalte Schulter gezeigt! Ihr habt nach anderem Hafer gewiehert!«
Da schon nicht zur Reue fähig, wagte ich es, ein klein bißchen unverschämt zu sein:
»Gevatterin, ich wollte eigentlich aus beiden Krippen futtern. Doch kaum hatte ich mich vor der einen eingerichtet, wurde mir der Halfter umgelegt.«
»Sofern dieser Halfter, wie ich vermute, aus zwei schwächlichen Armen bestand, hättet Ihr ihn abstreifen können. Ihr mögt Süßholz raspeln, soviel Ihr wollt, auf Euer Gerede gebe ich nichts mehr. Beginnt mit der einen und endet mit der anderen!«
»Aber Gevatterin, wenn ich zurückkehre ins Sarladische, liegt die Herberge Zu den zwei Engeln wieder an meinem Weg. Wir werden noch manche Gelegenheit haben, uns wiederzusehen.«
»Laßt die leeren Versprechungen! Räucherbraten mag ich nicht!« Sie wandte sich erregt ab, und über die Schulter hin fügte sie hinzu: »Ein Laffe, wer da glaubt, ich würde auf ihn warten!«
|29|Der »Laffe« war mir ein arger Nadelstich, den ich mir freilich mit meinem dummen Geprahle von den zwei Krippen verdient hatte.
»Nun denn, da zwischen uns keine Freundschaft mehr ist«, entgegnete ich frostig, »macht mir die Rechnung, Gevatterin, ich werde abreisen.«
»Die Rechnung ist schon aufgesetzt!« Mit einem Ausdruck von Triumph und Rache im Gesicht wandte sie sich wieder um. »Drei Essen zu je acht Sols: macht vierundzwanzig Sols. Ganze sechs Sols für das Zimmer, da Ihr es mit anderen geteilt habt. Zwölf Sols für die vier Pferde. Und dann, mein edler Herr, achtzehn Sols für das Mädchen, das Euch die Nacht so annehmlich gemacht hat.«
Mir verschlug es die Sprache. Schweiß rann mir plötzlich über den Rücken bei dem Gedanken, daß ich meinem lieben Samson – er gebot über unsere Börse – den Grund erklären müßte für eine so unmäßig große Zusatzausgabe.
»Was denn! Ich soll eine Gunst bezahlen, die man mir schenkt?« fragte ich.
»Hängt davon ab, wer sie schenkt«, antwortete die Wirtin.
»Potz Daus! wie der Baron sagen würde. Ich soll zahlen für ein Mädchen, das in mich vernarrt ist?«
»Ihr versteht mich nicht, Moussu!« sagte die Wirtin eiskalt. »Ihr zahlt nicht für besagtes Mädchen, sondern weil Ihr sie zu meinem Schaden eine ganze Nacht dem gemeinschaftlichen Gebrauch entzogen habt.«
»Ja wo bin ich denn hier?« rief ich, die Fäuste in die Hüften stemmend. »In einem Bordell?«
»Nicht doch, mein Herr!« gab die Wirtin zurück. »Ihr befindet Euch in einer ehrbaren christlichen Herberge, wo man sich um das Wohlbefinden der Reisenden sorgt.«
»Um das christliche Wohlbefinden!« bemerkte ich spöttisch.
Doch dann schwieg ich, weil ich spürte, daß solche Anzüglichkeit mir gewaltig auf die Nase zurückfiel. Auch stand die Wirtin unverrückbar wie ein Fels vor mir, weshalb ich Ton und Miene änderte: ich lächelte, beschenkte sie mit einem Blick, schmeichelte ihr. Alles vergebens! Sie wankte nicht. Bis ich endlich begriff, daß ich mich, um sie zu besänftigen, mit ihr auf andere Weise einigen mußte.
Das Wie kann sich der Leser selbst ausmalen, doch möge er |30|kein gar zu strenges Urteil über mich fällen, war ich doch eben erst meinem Nest in Mespech entflogen, ein junger Gimpel, der sich noch gern auf jedem Ast niederließ. Von Natur bin ich kein Bruder Leichtsinn. Zudem wollte ich meinen geliebten Bruder weder in seiner Seele noch in der Obwaltung unserer Börse kränken, und das wog schwer bei meiner Entscheidung.
Katzenjammer liegt mir hier freilich fern. Es war dies kein so großes Opfer, obwohl ich mich zunächst mürrisch dreinschickte. Aber die Wirtin war es wert, selbst nach den Ermüdungen der verstrichenen Nacht, den Hosenschlitz aufzutun. Tausend Teufel, welch feuriger Ofen! Und welch köstlicher Gedanke für mich, daß ich der Blasebalg war, der diese Schmiedeglut anfachte. Ach, welch ein Jammer, sann ich, erschöpft und zufrieden, während ich meinem Zimmer zustrebte (wo Samson noch schlummerte, im Verein mit zwei dicken Mönchen), welch ein Jammer, daß die dem Körper wie auch der Seele so zuträglichen Vergnügungen in des Herrgotts Augen als sündig gelten außerhalb der Ehe! So jedenfalls lehrt man es uns. Und es muß wohl auch wahr sein, wenn beide Glaubensrichtungen des Königreiches, die reformierte wie die katholische, sich darin einig sind.
[Menü]
|31|ZWEITES KAPITEL
Ich wollte vermeiden, daß Samson aufwachte; also begab ich mich in den Raum nebenan, schlüpfte in das leere Bett Mirouls, der sicherlich schon beim Striegeln der Pferde war, und streckte meine Glieder auf dieser schmalen Pritsche aus, die Lenden wohlig matt, die Lider schwer.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!