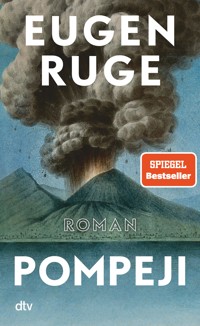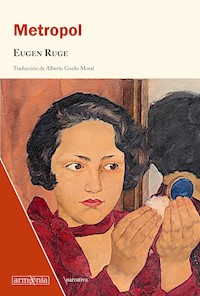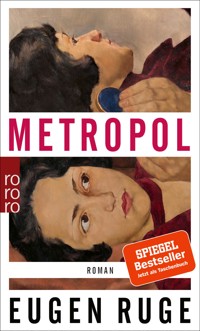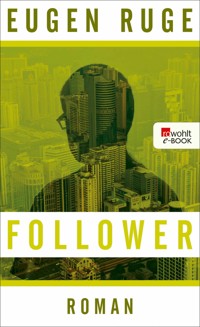9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
International gefeiert, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis - ein halbes Jahrhundert gelebter Geschichte, ein Familienroman voller überraschender Wendungen: groß durch seine Reife, seinen Humor, seine Menschlichkeit. Die Großeltern haben noch für den Kommunismus gebrannt, als sie aus dem mexikanischen Exil kamen, um ein neues Deutschland aufzubauen. Der Sohn kehrte aus der Sowjetunion heim: mit einer russischen Frau, der Erinnerung ans Lager und doch in dem Glauben an die politische Idee. Dem Enkel bleibt nur ein Platz in der Realität der DDR, und er flieht - an eben dem Tag, an dem sich Familie, Freunde und Feinde versammeln, um den neunzigsten Geburtstag des Patriarchen zu begehen. Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr 1989 und darüber hinaus reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt von Mexiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein weites Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, ungeheuer menschlich und komisch, Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht. 2009 erhielt Eugen Ruge für In Zeiten des abnehmenden Lichts den Alfred-Döblin-Preis. 2011 wurde der Roman mit dem Aspekte-Literaturpreis und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Er verkaufte sich bisher in 28 Länder, stand mehr als 40 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde von Matti Geschonneck nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase fürs Kino verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Eugen Ruge
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Roman einer Familie
Über dieses Buch
International gefeiert, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis - ein halbes Jahrhundert gelebter Geschichte, ein Familienroman voller überraschender Wendungen: groß durch seine Reife, seinen Humor, seine Menschlichkeit.
Die Großeltern haben noch für den Kommunismus gebrannt, als sie aus dem mexikanischen Exil kamen, um ein neues Deutschland aufzubauen. Der Sohn kehrte aus der Sowjetunion heim: mit einer russischen Frau, der Erinnerung ans Lager und doch in dem Glauben an die politische Idee. Dem Enkel bleibt nur ein Platz in der Realität der DDR, und er flieht - an eben dem Tag, an dem sich Familie, Freunde und Feinde versammeln, um den neunzigsten Geburtstag des Patriarchen zu begehen.
Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr 1989 und darüber hinaus reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt von Mexiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein weites Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, ungeheuer menschlich und komisch, Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht.
2009 erhielt Eugen Ruge für In Zeiten des abnehmenden Lichts den Alfred-Döblin-Preis. 2011 wurde der Roman mit dem Aspekte-Literaturpreis und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Er verkaufte sich bisher in 28 Länder, stand mehr als 40 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde von Matti Geschonneck nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase fürs Kino verfilmt.
Vita
Eugen Ruge, 1954 in Soswa (Ural) geboren, studierte Mathematik an der Humboldt-Universität und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. Er war beim DEFA-Studio für Dokumentarfilm tätig, bevor er 1988 aus der DDR in den Westen ging. Seit 1989 arbeitet er hauptberuflich fürs Theater und für den Rundfunk als Autor und Übersetzer.
2009 wurde Eugen Ruge für sein erstes Prosamanuskript «In Zeiten des abnehmenden Lichts» mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet.
2011 erhielt er den aspekte-Literaturpreis und den Deutschen Buchpreis.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: Stockwerk_/Plainpicture
ISBN 978-3-644-01411-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Widmung
für euch
1952
Über Neujahr waren sie ein paar Tage an der Pazifikküste gewesen. Ein Kaffeelaster brachte sie von dem kleinen Flugplatz nach Puerto Ángel. Ein Bekannter hatte den Ort empfohlen: romantisches Dorf, malerische Bucht mit Felsen und Fischerbooten.
Tatsächlich war die Bucht malerisch. Abgesehen von der betonierten Kaffeeverladerampe.
Der Ort selbst: zwanzig oder fünfundzwanzig Häuschen, eine verschlafene Poststelle und ein Kiosk, an dem es alkoholische Getränke gab.
Das einzige zu mietende Objekt war eine winzige, immerhin mit Ziegeln gedeckte Hütte (die die spanischstämmige Vermieterin «Bungalow» nannte). Darin stand, unter einem von der Decke herabhängenden Moskitonetz (das die Vermieterin «Pavillon» nannte), ein Eisenbett. Daneben zwei Nachttischchen. An ein paar hier und da in die Pfosten eingeschlagenen Nägeln hingen Kleiderbügel.
Vor dem «Bungalow» gab es eine überdachte Terrasse mit zwei wackligen Liegestühlen und einem Tisch.
– Ach, wie schön, sagte Charlotte.
Sie ignorierte die Fledermäuse, die kopfüber unter dem Dachvorsprung hingen, also im Grunde mitten im Zimmer, da, wie hier üblich, zwischen Wand und Dach ein handbreiter Spalt klaffte. Sie übersah das große, scheckige Schwein, das durch den Garten streunte und rings um den Verschlag, den die Vermieterin Bad nannte, die Erde aufwühlte.
– Ach, wie schön, sagte sie. Hier werden wir uns erholen.
Wilhelm nickte und ließ sich erschöpft im Liegestuhl nieder. Seine Hosenbeine rutschten hoch und gaben ein Stück seiner dürren, blassen Waden frei. Ohnehin mager, hatte er in den letzten Wochen noch einmal fünf Kilo abgenommen. Seine eckigen Gliedmaßen sahen aus wie der Liegestuhl, in dem er saß.
– Wir machen ein paar schöne Ausflüge in die Umgebung, versprach Charlotte.
Allerdings stellte sich heraus, dass es so gut wie keine «Umgebung» gab.
Einmal fuhren sie – mit einem Kaffeelaster – ins nahegelegene Pochutla und besuchten den chinesischen Kolonialwarenladen. Wilhelm stakste abwesend durch das über und über vollgestopfte Geschäft und blieb vor einer großen, polierten Schneckenmuschel stehen.
– Fünfundzwanzig Pesos, sagte der Chinese.
Das war allerhand.
– So eine wolltest du doch, sagte Charlotte.
Wilhelm zuckte mit den Schultern.
– Wir kaufen sie, sagte Charlotte.
Sie bezahlte, ohne über den Preis zu verhandeln.
Ein anderes Mal gingen sie zu Fuß bis Mazunte. Die Strände waren mehr oder weniger alle gleich, mit dem Unterschied, dass der Strand in Mazunte von dunklen Flecken übersät war. Den Grund dafür erkannten sie bald, nämlich als sie sahen, wie die Fischer eine gewaltige Wasserschildkröte bei lebendigem Leibe aus ihrem Panzer lösten.
Nach Mazunte gingen sie nicht wieder. Auch aßen sie keine Schildkrötensuppe mehr.
Dann war endlich Silvester. Die Männer des Dorfes hatten tagelang und unter großem Geschrei Kaffee verladen. Jetzt hatte man ihnen ihren Lohn ausgezahlt. Gegen drei Uhr waren alle betrunken und gegen sechs bewusstlos. Es wurde still im Dorf. Nichts rührte sich, niemand war zu sehen. Wie jeden Abend hatten Charlotte und Wilhelm sich ein kleines Feuer gemacht, von dem Holz, das der mozo ihnen für ein paar Pesos sammelte.
Es wurde früh dunkel, die Abende waren lang.
Wilhelm rauchte.
Das Feuer knisterte.
Charlotte tat so, als interessiere sie sich für die Fledermäuse, die lautlos wie Sternschnuppen im Schein des Feuers vorbeihuschten.
Um zwölf Uhr tranken sie Champagner aus Wassergläsern, und jeder aß seine Weinbeeren auf: ein hiesiger Brauch, zum Jahreswechsel zwölf Weinbeeren zu essen. Zwölf Wünsche – einer für jeden Monat.
Wilhelm aß alle Beeren auf einmal.
Charlotte wünschte sich zuallererst, dass Werner am Leben sei. Dafür verbrauchte sie gleich drei Beeren. Kurt lebte, von ihm hatte sie inzwischen Post. Er war, aus Gründen, die er im Brief nicht erwähnte, irgendwo im Ural gelandet, inzwischen verheiratet dort. Nur von Werner – nichts. Trotz der Bemühungen Dretzkys. Trotz der Suchanfrage beim Roten Kreuz. Trotz der Anträge, die sie beim sowjetischen Konsulat gestellt hatte – den ersten schon vor sechs Jahren:
– Bewahren Sie Ruhe, Bürgerin. Alles geht seinen Gang.
– Genosse, ich bin Mitglied der Kommunistischen Partei, und das Einzige, worum ich bitte, ist zu erfahren, ob mein Sohn lebt.
– Dass Sie Mitglied der Kommunistischen Partei sind, heißt nicht, dass Sie Sonderrechte genießen.
Das Schweinsgesicht. Erschießen sollen sie dich. Da hatte sie die Beere zerbissen.
Dann schon lieber Ewert und Radovan: je eine Beere.
Eine Beere, um die Strafe in Typhus umzuwandeln. In heilbaren Typhus. Eine, um die Typhusepidemie auf Ewerts Frau Inge auszudehnen, die neuerdings Chefredakteur war.
Auf einmal waren es nur noch drei Beeren. Jetzt hieß es haushalten.
Die zehnte: Gesundheit für all ihre Freunde – wer war das?
Die elfte: für alle Verschollenen. Wie jedes Jahr.
Und die zwölfte Beere … zerbiss sie einfach. Ohne sich etwas zu wünschen. Plötzlich war es geschehen.
Im Übrigen war es zwecklos. Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier.
Sie saßen hier – während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden.
Zwei Tage später flogen sie zurück nach Mexiko-Stadt. Am Mittwoch war Redaktionssitzung, wie immer. Wilhelm war zwar aus der Leitung der Gruppe abgewählt, hatte aber seine bisherigen Funktionen bei der Demokratischen Post behalten: Er machte die Abrechnung, verwaltete die Kasse, half beim Umbruch und bei der Verteilung der auf ein paar hundert Exemplare geschrumpften Auflage.
Aber auch Charlotte fühlte sich zur Teilnahme verpflichtet. Die Redaktionssitzung war einmal die Woche, und man wusste nicht recht, ob sie nicht gleichzeitig auch Parteiversammlung war. Je kleiner die Gruppe wurde, desto mehr vermischte sich alles: Parteizelle, Redaktionskomitee, Geschäftsführung.
Sieben waren noch übrig. Drei davon waren die «Leitung». Das heißt: zwei – seit Wilhelm abgewählt worden war.
Charlotte hatte Mühe, die Sitzung durchzuhalten, saß gekrümmt am Ende des Tisches und war kaum in der Lage, Radovan in die Augen zu schauen. Inge Ewert redete dummes Zeug, kannte nicht mal die Breite des Satzspiegels, verwechselte Kolumne und Signatur, aber Charlotte unterdrückte jeden Impuls, sich einzumischen oder einen Vorschlag zu machen, und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte.
Wegen «Verstoßes gegen die Parteidisziplin». Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr «Verstoß gegen die Parteidisziplin» hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als «uninteressant» abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal.
Sie fügte hinzu, dass Ewert in der Friedensfrage eine «defätistische Haltung» einnahm und dass Radovan in der für die politische Arbeit in Mexiko besonders sensiblen Judenfrage (die Demokratische Post hatte noch immer viele bürgerliche, jüdische Leser) gegen die Linie verstieß, die Dretzky, als er noch in Mexiko war, begründet hatte.
Das war unfair, sie wusste es. Aber war es fair, ihr einen «Verstoß gegen die Parteidisziplin» vorzuwerfen?
– Kannst du bis Anfang Februar etwas für die Kulturseite liefern?
Radovans Stimme.
– Eineinhalb Normseiten, regionaler Bezug.
Charlotte nickte und kritzelte etwas in ihren Kalender. Hieß das, sie war für den politischen Teil nicht mehr zuverlässig genug?
Abends badete sie – fast schon eine Gewohnheit am Tag der Redaktionssitzung.
Am Donnerstag und am Freitag gab sie Nachhilfeunterricht, Englisch und Französisch, jeweils drei Stunden (und verdiente an zwei Tagen mehr als Wilhelm in einer Woche bei der Demokratischen Post).
In der übrigen Zeit, bevor Wilhelm nach Hause kam, baumelte sie auf dem Dachgarten in der Hängematte, ließ sich vom Hausmädchen Nüsse und Mangosaft bringen und schmökerte in Büchern über präkolumbianische Geschichte: wegen des Artikels für die Kulturseite, so hieß die Ausrede, die ihr niemand abverlangte.
Am Wochenende las Wilhelm, wie stets, das Neue Deutschland, das immer im Packen und mit vierzehntägiger Verspätung aus Deutschland kam. Da er weder Spanisch noch Englisch konnte, war das NDsein einziger Lesestoff. Er las jede Zeile und war, mit Ausnahme von zweimal einer halben Stunde, die er mit dem Hund spazieren ging, bis zum späten Abend beschäftigt.
Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte.
Am Montag rannte Wilhelm gleich früh in die Druckerei, und Charlotte rief Adrian an und verabredete sich mit ihm gegen Mittag.
Schon lange hatte Adrian ihr die Kolossalstatue der Coatlicue zeigen wollen. Er hatte ihr oft von der aztekischen Erdgöttin erzählt, und sie kannte bereits ein Foto: eine grausige Figur. Ihr Gesicht war auf merkwürdige Weise aus zwei im Profil zu sehenden Schlangenköpfen zusammengesetzt, sodass je ein Auge und zwei Zähne einer der Schlangen gehörten. Aus ihrem Schoß schaute der totenschädelartige Kopf ihres Sohnes Huitzilopochtli hervor. Um den Hals trug sie eine Kette aus abgehauenen Händen und herausgerissenen Herzen: Symbol der Opferriten der alten Azteken.
Man habe sie vor mehr als hundertfünfzig Jahren unter dem Pflaster des Zócalo gefunden, sagte Adrian, während er an seinem Kaffee nippte und Charlotte ansah wie vor einer Prüfung.
Sie war zum ersten Mal in der Universität. Alles, selbst die Kaffeetassen in Adrians Büro, erschienen ihr heilig. Und Adrian selbst schien ihr noch imposanter, seine Stirn vergeistigt, seine Hände noch feiner als sonst.
– 1790 hat man sie ausgegraben und in die Universität gebracht, sagte Adrian. Aber der damalige Rektor entschied, sie wieder am Zócalo vergraben zu lassen. Drei Mal hat man sie wieder vergraben – so unerträglich fand man ihr Antlitz. Und auch danach stand sie noch jahrzehntelang hinter einer Leinwand und wurde Besuchern nur als eine Art Abstrusum gezeigt.
Sie folgte Adrian durch ein Labyrinth von Gängen und Treppen, dann standen sie im Innenhof, Adrian drehte Charlotte sanft um – und sie sah auf die Füße von Coatlicue. Sie hatte eine mannshohe Statue erwartet. Vorsichtig wanderte ihr Blick hinauf bis in vier Meter Höhe. Sie schloss die Augen, wandte sich ab.
– Ihre Schönheit, sagte Adrian, besteht darin, dass das Grauen in der ästhetischen Form gebannt ist.
Im Januar schrieb sie zwei Normseiten über die Dialektik des Schönheitsbegriffs in der Kunst des aztekischen Volkes.
Im Februar wurde ihr Artikel vom gesamten Redaktionskomitee einschließlich Wilhelms als zu theoretisch abgelehnt.
Im März begann es völlig unplanmäßig zu regnen, und Adrian machte ihr einen Heiratsantrag.
Sie hatte nichts mit Adrian. Allerdings hatte sie auch nichts mit Wilhelm, der seit seiner Abwahl aus der Parteileitung sexuell inaktiv war.
Sie saßen auf den Treppenstufen der Sonnenpyramide von Teotihuacán, wohin sie, nicht zum ersten Mal, mit Adrian gefahren war. Charlotte blickte über die tote Stadt hinweg auf die weite, hüglige Landschaft, die sich Tal von Mexiko nannte, obwohl sie in Wirklichkeit zweitausend Meter hoch lag, und glaubte plötzlich, dass sie in der Lage sei, den ganzen Dreck hinzuschmeißen.
Stattdessen: einmal im Leben die Königin der Nacht blühen sehen.
Aber als sie an diesem Abend nach Hause kam und Wilhelm neben dem Hund auf dem Fußboden sitzen sah, wusste sie, dass es unmöglich war.
Und davon abgesehen: Würde sie je ihre Söhne wiedersehen, wenn sie in Mexiko blieb?
Und davon abgesehen: Hatte sie wirklich vor, den Rest ihres Lebens Kinder reicher Leute zu unterrichten? Oder die Hausangestellten eines verwitweten Universitätsprofessors zu kommandieren?
Und davon abgesehen: mit neunundvierzig!
Im April kam ein Brief von Dretzky, komischerweise datiert auf den ersten April. Wie sie dem Briefkopf entnahm, war Dretzky inzwischen Staatssekretär im Bildungsministerium. Er ging mit keiner Silbe auf Charlottes Bericht ein. Vielmehr teilte er mit, dass zwei Einreisevisa im sowjetischen Konsulat für sie bereitlägen, und bat sie, umgehend die Rückreise anzutreten, um für ihre neuen Aufgaben zur Verfügung zu stehen: Charlotte sollte als Direktorin das Institut für Literatur und Sprachen an der demnächst zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft übernehmen, und Wilhelm, welcher, wie Dretzky schrieb, als sogenannter Westemigrant nicht, wie es sein Wunsch gewesen wäre, in den neuen Geheimdienst übernommen werden durfte – Wilhelm sollte Verwaltungsdirektor der Akademie werden.
An diesem Abend gingen sie durch den Almeda-Park, ließen sich im Strom der Menschen treiben. Von fern tönte eine Mariachi-Kapelle herüber, und sie aßen Tortillas mit Kürbisblüten wie früher.
Aber es war nicht wie früher.
Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte … Abwegige Idee: dass alles bloß ein Aprilscherz war. Aber war es nicht auch abwegig, dachte Charlotte, dass Dretzky Wilhelm zum Verwaltungsdirektor einer Akademie machen wollte? Wilhelm hatte nicht die geringste Ahnung von Verwaltung. Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts.
Zwar war er tatsächlich einmal – auf dem Papier – Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies – aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung – nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente.
In Mexiko hatte Wilhelm ewig gebraucht, um eine Arbeit zu finden, und was er schließlich fand, war eine – wenngleich gutbezahlte – Anstellung als Leibwächter eines Diamantenhändlers, die, abgesehen davon, dass es gegen Wilhelms proletarische Ehre verstieß, Leben und Eigentum eines Millionärs zu bewachen, vor allem deswegen deprimierend war, weil Wilhelm stets das Gefühl hatte, dass er für seine Dummheit bezahlt wurde. Mendel Eder hatte ihn angestellt, nicht obwohl, sondern weil er kein Spanisch sprach und es dem Händler durchaus gelegen kam, wenn ein Taubstummer neben ihm saß, während er seine Verhandlungen führte.
Erst spät, als die meisten Exilanten schon wieder in Deutschland waren, hatte Wilhelm begonnen, für die Demokratische Post zu arbeiten, aber auch wenn er in seinem Lebenslauf «Geschäftsführer der Demokratischen Post» als letzte Arbeitsstelle angegeben (und die Anstellung bei Eder zu «Frachtdienst Firma Eder» herunterstilisiert) hatte, musste Dretzky doch wissen, dass die Erstellung der Spendenabrechnung für die Demokratische Post nicht im Entferntesten mit der Verwaltung einer ganzen Akademie zu vergleichen war.
– Dann bin ich jetzt ja gewissermaßen dein Vorgesetzter, sagte Wilhelm und klopfte eine Zigarette aus seiner Schachtel.
– Wohl kaum, sagte Charlotte.
Was ging in diesem Kopf vor?
Schon mehrmals war ihnen die Rückkehr in Aussicht gestellt worden, aber immer war am Ende etwas dazwischengekommen. Zuerst war es am Durchreisevisum für die USA gescheitert. Dann war kein Geld mehr in der Reisekasse, weil andere Genossen wichtiger gewesen waren. Dann behauptete das sowjetische Konsulat, dass keine Papiere für sie vorlägen. Und schließlich hieß es, sie hätten die Erlaubnis zur Einreise wiederholt nicht genutzt, sodass sie sich nun gedulden müssten.
Aber dieses Mal schien es anders zu laufen. Tatsächlich wurden ihnen auf dem Konsulat Einreisevisa ausgehändigt. Sie bekamen eine direkte Schiffspassage, sogar mit Rabatt. Obendrein wurde Wilhelms Billett (warum ausgerechnet Wilhelms?) aus der Parteikasse erstattet – obgleich sie inzwischen genug Geld gehabt hätten, um die Überfahrt selbst zu bezahlen.
Charlotte begann sich um die Auflösung des Haushalts zu kümmern, kündigte Verträge und verkaufte die Königin der Nacht mit Verlust zurück an den Blumenladen. Es war erstaunlich viel zu erledigen, und erst jetzt merkte sie, wie sehr sie in das hiesige Leben verstrickt war; jedes Buch, dessen Mitnahme sie erwog, jede Muschel, jedes Figürchen, das sie vorsichtig in Zeitungspapier wickelte oder wegzuwerfen sich entschloss – alles war mit Erinnerungen an ein Stück Leben verbunden, das nun zu Ende ging. Aber gleichzeitig, während sie alles und jedes auf seine Brauchbarkeit im neuen Leben prüfte, begann auch ein Bild dieses neuen Lebens in ihr zu entstehen.
Sie erwarben fünf große Schrankkoffer, setzten einen Teil ihres kleinen Vermögens in Silberschmuck um und kauften von dem Rest verschiedene Dinge, von denen sie annahmen, dass sie im Nachkriegsdeutschland schwer zu bekommen waren, so beispielsweise eine Schweizer Reiseschreibmaschine (allerdings ohne «ß»), zwei Garnituren ausgesprochen praktischen Hartplastikgeschirrs, einen Toaster, zahlreiche Baumwolldecken mit indianischen Mustern, fünfzig Dosen des ebenfalls sehr praktischen Nescafés, fünfhundert Zigaretten, außerdem in reichlichem Umfang Kleidung, von der sie glaubten, dass sie sowohl dem Klima als auch ihrem neuen gesellschaftlichen Status entsprach. Statt heller, luftiger Sommersachen probierte Charlotte nun hochgeschlossene Blusen und dezente Kostüme in verschiedenen Grautönen an; sie ließ sich eine Dauerwelle machen und besorgte sich eine schlichte, aber elegante Brille, deren schmales schwarzes Gestell ihrem Gesicht eine glaubwürdige Strenge verlieh, wenn sie vor dem Spiegel den Blick einer Institutsdirektorin probierte.
So, zwar in alter Kleidung, aber mit neuer Brille und neuer Frisur, traf sie sich noch einmal, ein letztes Mal, mit Adrian. Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe.
– Warum sagst du das, wollte sie wissen.
Anstatt zu antworten, ergänzte Adrian:
– Und zehn andere auch – wegen zionistischer Verschwörung.
Adrian legte eine Herald Tribune auf den Tisch.
– Lies, sagte er.
Aber Charlotte wollte nicht lesen.
– Hier wird doch gerade bewiesen, sagte Adrian, während er mit dem Zeigefinger auf die Zeitung pochte, dass sich nicht das Geringste geändert hat.
– Kannst du bitte mal leiser sprechen, sagte Charlotte.
– Na bitte, sagte Adrian, du hast jetzt schon Angst. Wie soll das dort drüben werden?
Das Essen kam, aber Charlotte wollte nichts essen. Eine Weile saßen beide vor ihren gefüllten Chilis. Dann sagte Adrian:
– Der Kommunismus, Charlotte, ist wie der Glaube der alten Azteken: Er frisst Blut.
Charlotte nahm ihre Handtasche und rannte hinaus auf die Straße.
Fünf Tage später bestiegen sie das Schiff, das sie nach Europa bringen sollte. In dem Moment, da die Leinen gelöst wurden und der Boden unter ihren Füßen ein wenig, vielleicht nur um Millimeter nachgab, wurden ihre Knie weich, und sie musste sich mit äußerster Anstrengung an der Reling festhalten. Der Anfall verging, von Wilhelm unbemerkt, nach einer Minute.
Die Küste verschwand im Dunst, das Schiff wandte sich dem Ozean zu und begann, eine schnurgerade Spur Kielwassers hinterlassend, seine Fahrt. Der Wind frischte auf, an Deck surrten die Wanten, und bald waren sie umgeben vom endlosen Grau, das in jeder Richtung bis zum Horizont reichte.
Die Tage wurden lang, die Nächte noch länger. Charlotte schlief schlecht, träumte immer denselben Traum, in dem Adrian sie durch eine Art unterirdisches Museum führte, und wenn sie erwachte, fand sie nicht wieder zurück in den Schlaf. Stundenlang lag sie im Dunkeln, spürte das Stampfen und Schlingern des Schiffs, spürte, wie sein Rumpf im Ansturm der Böen erzitterte. Und zehn andere auch, hatte Adrian gesagt. Warum hatte sie nicht wenigstens die Namen gelesen? Fragen. Was machte Kurt im Ural? Warum gelang es dem Roten Kreuz auch nach Jahren nicht, Werner zu finden? Sie war eine schlechte Genossin. Ihr Kopf, wenn sie ehrlich war, verstieß ständig gegen die Parteidisziplin. Und fast hätte auch ihr Körper dagegen verstoßen.