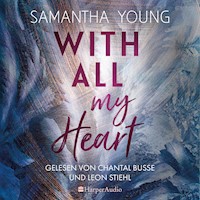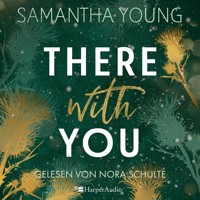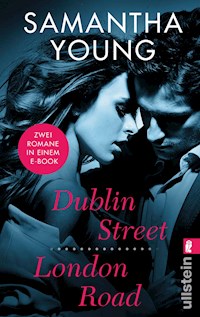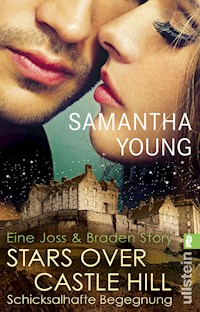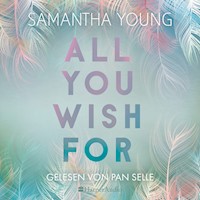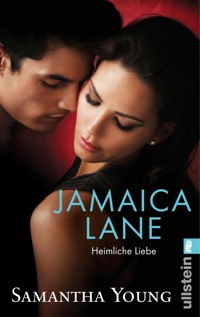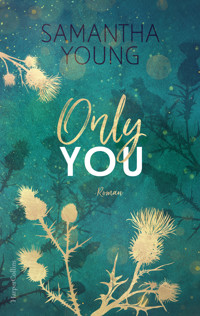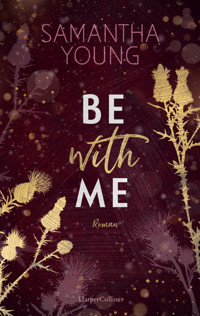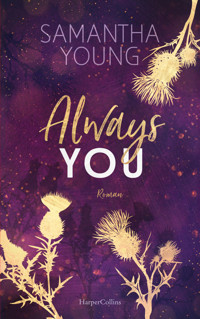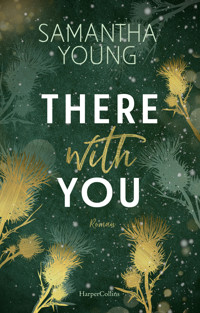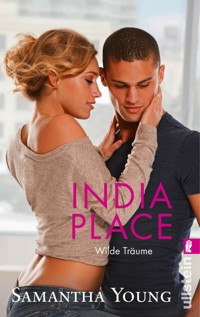
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Damals brach er ihr das Herz. Jetzt kämpft er um ihre Liebe. In nur einer einzigen Nacht erlebte Hannah Nichols den Himmel auf Erden - mit Marco, ihrer großen Jugendliebe. Doch am nächsten Morgen war er verschwunden und ihr Herz gebrochen. Fünf Jahre sind seitdem vergangen. Trotzdem ist sie nicht darüber hinweggekommen. Hannah weiß nur eins: Sie wird ihm niemals verzeihen. Hannah und Edinburgh zu verlassen, war der größte Fehler seines Lebens. Marco D'Alessandro bereut ihn jeden Tag. Endlich bietet sich eine Chance, Hannah zu zurückzugewinnen. Aber die Fehler aus der Vergangenheit wiegen schwerer als gedacht, und für eine gemeinsame Zukunft muss er alles riskieren … Endlich gehen die »Edinburgh Love Stories« weiter: Bestsellerautorin Samantha Young schenkt uns einen neuen Roman!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Als Hannah Nichols ihre große Liebe, Marco D’Alessandro, vor fünf Jahren das letzte Mal sah, brach er ihr das Herz. Nach einer einzigen leidenschaftlichen Nacht war er plötzlich verschwunden. Bis heute kann Hannah Marco nicht vergessen. Sein Charme, die männliche Ausstrahlung, das attraktive Lächeln und die eindringlichen Blicke haben sich für immer in ihr Gedächtnis gebrannt. Kein anderer Mann hat dagegen eine Chance.
Was Hannah nicht weiß: Auch Marco leidet unter der Trennung. Als er nach Edinburgh zurückkehrt, sucht er ihre Nähe. Obwohl die Spannung zwischen ihnen unübersehbar ist, lässt Hannah ihn immer wieder auflaufen, zu tief sitzt die Verletzung. Marco gibt trotzdem nicht auf. Alles, was er will, ist eine zweite Chance. Doch kaum hat er es geschafft, ihr Vertrauen zurückzugewinnen, kommt Hannah hinter ein langgehütetes Geheimnis, das ihr neues Glück zu zerstören droht …
Die Autorin
Samantha Young wurde 1986 in Stirlingshire, Schottland, geboren. Seit ihrem Abschluss an der University of Edinburgh arbeitet sie als freie Autorin und hat bereits mehrere Jugendbuchserien veröffentlicht. Mit Dublin Street und London Road, ihren ersten beiden Romanen für Erwachsene, stürmt sie die internationalen Bestsellerlisten.
Homepage der Autorin: www.samanthayoungbooks.com
Die Edinburgh Love Stories:
Dublin Street – Gefährliche Sehnsucht
London Road – Geheime Leidenschaft
Jamaica Lane – Heimliche Liebe
Fountain Bridge – Verbotene Küsse (E-Book)
Castle Hill – Stürmische Überraschung (E-Book)
Into the Deep – Herzgeflüster
Out of the Shallows – Herzsplitter
Samantha Young
India Place
Wilde Träume
Roman
Aus dem Englischen von Sybille Uplegger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0996-5
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014© 2014 Samantha YoungTitel der Originalausgabe: Fall From India Place(Published by arrangement with NAL Signet, a member of Penguin Group [USA] Fnc.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München,nach einer Vorlage von Steven MeditzTitelabbildung: © Claudio Marinesco
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Kapitel 1
Edinburgh
Oktober
An meinem ersten Arbeitstag als Lehrerin, als ich auf die Kopfsteinpflasterstraßen von Edinburgh hinausgetreten war, hatte ich mir etwas geschworen: Ich wollte alles tun, um einen persönlichen Zugang zu meinen Schülern zu finden.
Auch wenn das hieß, dass ich sie – und mich – mit meinen miserablen zeichnerischen Fähigkeiten in Verlegenheit brachte.
Ich nahm die Folie mit meinen stümperhaften Illustrationen vom Projektor und legte eine neue hin, auf der zwei Sätze standen.
Dann ließ ich den Blick über meine kleine, aus sechs Erwachsenen zwischen vierundzwanzig und zweiundfünfzig Jahren bestehende Klasse schweifen und lächelte schief. »So leid es mir auch tut, Ihnen meine genialen künstlerischen Fähigkeiten vorzuenthalten – ich glaube, es ist besser, wenn ich die Folie verschwinden lasse.«
Portia, mit zweiundfünfzig meine älteste Schülerin, grinste breit. Sie hatte immer gute Laune, mit der sie die oftmals angespannte Atmosphäre in dem kleinen Klassenzimmer auflockerte. Auch Duncan, ein dreiunddreißigjähriger Mechaniker, ließ ein belustigtes Schnauben hören, doch die übrigen vier in der Klasse starrten mich lediglich mit fast schreckhaft geweiteten Augen an, als wäre alles, was ich sagte und tat, ein Test für sie.
»Jetzt, wo Sie sich die Worte aus dem Sichtwortschatz eingeprägt und dank meiner bescheidenen Zeichenversuche hoffentlich auch in ihrer Bedeutung verstanden haben, sollen Sie sich mit ihrem Gebrauch in alltäglichen Sätzen vertraut machen. Für den Rest der heutigen Stunde möchte ich Sie bitten, jeden dieser beiden Sätze zehnmal abzuschreiben.« Ich beobachtete, wie die vierundzwanzigjährige Lorraine, eine ungeduldige und reizbare Schülerin, auf ihrer Unterlippe kaute. Ich wollte mir lieber nicht ausmalen, was sie ihrer Lippe antun würde, wenn sie erst meine nächste Aufgabe zu hören bekam. »Ich habe hier zwei kleine Büchlein für Sie. In dem einen stehen einzelne Wortbilder, im anderen ganze Sätze, die aus diesen Wortbildern zusammengesetzt werden können. Bitte suchen Sie sich als Hausaufgabe zehn dieser Sätze aus, die Sie dann jeweils zehnmal aufschreiben. Bitte bringen Sie die Hausaufgaben nächste Woche zum Unterricht mit.«
Lorraine wurde blass, und prompt zog sich mein Herz vor Mitgefühl zusammen. Lorraine war ein Paradebeispiel dafür, weshalb ich mich entschieden hatte, ehrenamtlich einen Erwachsenen-Alphabetisierungskurs im örtlichen Gemeindezentrum zu leiten. Einige Leute – wie zum Beispiel meine Freundin Suzanne – waren der Ansicht, ich könne nicht ganz richtig im Kopf sein, wenn ich während meines Referendariats als Englischlehrerin an einer Highschool in meiner Freizeit noch zusätzliche Kurse unterrichtete – und das ohne Bezahlung. Vielleicht hatten diese Leute recht, mein Arbeitspensum für die Schule war hoch, aber immerhin konnte ich mir den Alphabetisierungskurs mit einer anderen Lehrkraft teilen, so dass ich nur einen Abend pro Woche dafür opfern musste. Außerdem gab mir meine ehrenamtliche Arbeit endlich mal das Gefühl, etwas Sinnvolles zu leisten. Den Nutzen meiner Arbeit an der Schule zu erkennen fiel mir da oft wesentlich schwerer. Ich ahnte, dass ich noch häufiger während meines Berufslebens das Gefühl haben würde, trotz bester Bemühungen nicht das Geringste ausrichten zu können. Bei meiner Arbeit als Ehrenamtliche hingegen erfuhr ich diese Genugtuung jeden Tag. Die Erwachsenen, die ich unterrichtete, waren größtenteils arbeitslos, mit Ausnahme von Portia und Duncan. Duncan war von seinem Arbeitgeber dazu aufgefordert worden, seine Lese- und Schreibfertigkeiten zu verbessern. Und Portia, die sich bisher mit rudimentären Kenntnissen im Lesen und Rechnen durchgeschlagen hatte, war eines Tages zu dem Schluss gekommen, dass sie sich damit nicht länger zufriedengeben wollte. Den anderen jedoch fiel es aufgrund ihrer mangelnden Sprach- und Kommunikationsfertigkeiten schwer, einen Job zu behalten.
Natürlich war mir klar, dass Analphabetismus in diesem Land nach wie vor ein großes Problem darstellte, aber da ich selbst aus einer Akademikerfamilie kam und leidenschaftlich gern las, hatte ich mich bislang noch nie näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Bis zum vergangenen Jahr.
Während meiner Lehrerausbildung hatte ich ein Erlebnis gehabt, das mir auf ewig im Gedächtnis bleiben würde: Während eines Gesprächs mit dem Vater eines Schülers merkte ich, wie dieser plötzlich ganz nervös wurde, nachdem ich ihn gebeten hatte, sich die Schularbeiten seines Sohnes anzusehen. Ihm brach buchstäblich der Schweiß aus, bis er schließlich mit stockender Stimme gestand, dass er sie nicht lesen könne. Und als er zuvor eine Einverständniserklärung unterschreiben sollte, damit seine Tochter mit der Klasse eine Theateraufführung von Was ihr wollt besuchen konnte, hatte er mit zitternder Hand einen völlig unleserlichen Schnörkel aufs Papier gekritzelt.
Seine Angst und Scham gingen mir sehr nahe. Ich hatte Tränen in den Augen, so sehr bedauerte ich den Mann – ein erwachsener Mann, der sich beim Anblick von ein paar Wörtern auf einem Blatt Papier völlig verloren und hilflos fühlte. Es war hart, seinen inneren Kampf miterleben zu müssen, und noch am selben Abend informierte ich mich über Alphabetisierungskurse in meiner näheren Umgebung. Ich schickte ein paar Anfragen los, und etwa einen Monat später erhielt ich Antwort vom St. Stephen’s Centre, dem Gemeindezentrum meines Bezirks. Dort hatte gerade einer der Ehrenamtlichen aufgehört.
Obwohl meine Schüler zunächst ein wenig verhalten auf eine Lehrerin reagierten, die jünger war als sie selbst, bekam ich mit der Zeit doch das Gefühl, dass wir Fortschritte machten.
»Hannah, Ihr Kopf verdeckt das Wort zwischen ›waschen‹ und ›kalt‹«, bemerkte Duncan schelmisch.
»Ist das eine höfliche Art, mir zu sagen, dass ich einen dicken Kopf habe?«, fragte ich und trat zur Seite, damit alle die Folie sehen konnten.
Er grinste. »Nee, ist schon ganz hübsch, Ihr Kopf.«
»Danke. Den habe ich mir ganz alleine wachsen lassen«, gab ich scherzhaft zurück.
Duncan stöhnte über den lahmen Witz, aber seine Augen funkelten belustigt, während Portia hinter ihm kicherte.
Schmunzelnd betrachtete ich die tief über ihre Hefte gebeugten Köpfe meiner Schüler. Die Bleistifte bewegten sich mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit: Einige gruben mit quälender Langsamkeit Druckbuchstaben ins Papier, andere glitten halbwegs flüssig über die Linien. Aber bei Lorraine verging mir das Schmunzeln. Sie sah sich immer wieder nach den anderen um. Es schien sie regelrecht in Panik zu versetzen, dass die anderen so sehr in ihre Arbeit versunken waren.
Als sie merkte, wie ich sie beobachtete, machte sie ein finsteres Gesicht, ehe sie sich wieder ihrem Schreibblock widmete.
Ich hatte das ungute Gefühl, dass ich langsam den Draht zu ihr verlor.
Sobald ich das Ende der Stunde verkündet hatte, ging ich zu ihr, ehe sie entwischen konnte. »Können Sie noch kurz dableiben?«
Sie kniff die Augen zusammen und leckte sich nervös über die Lippen. »Hm. Wieso denn?«
»Bitte.«
Sie gab keine Antwort, blieb aber sitzen. Immerhin etwas.
»Danke für die Stunde heute Abend, Hannah!«, rief Portia mir zu. Ihre Stimme schallte so weit, dass man sie vermutlich noch am Empfang hören konnte. Im Unterricht sprach ich immer ein bisschen lauter als gewöhnlich, weil ich den Verdacht hatte, dass Portia schlecht hörte, es aber nicht zugeben wollte. Sie war eine glamouröse Frau, die entweder von unglaublich guten Genen oder einer unglaublich guten Anti-Aging-Creme profitierte. In jedem Fall konnte man sehen, dass sie großen Wert auf ihr Äußeres legte. Einzugestehen, dass sie nicht lesen und schreiben konnte, war eine Sache – aber ihre Schwerhörigkeit zuzugeben hätte bedeutet, ihr wahres Alter zu verraten, und sie wollte bestimmt nicht, dass irgendjemand sie für älter hielt, als sie sich fühlte.
»Gern geschehen!«, rief ich freundlich zurück. Ich lächelte und winkte zum Abschied, als auch die anderen sich bei mir bedankten und gingen.
Dann wandte ich mich wieder Lorraine zu. Es überraschte mich nicht, dass sie die Arme vor der Brust verschränkte und fauchte: »Hat doch sowieso keinen Sinn, wenn ich bleibe. Ich bin durch mit dem Scheiß hier.«
»Ich hatte schon geahnt, dass Sie so was sagen würden.«
Sie verdrehte die Augen. »Und wenn? Ist mir auch egal.« Mit diesen Worten strebte sie in Richtung Tür.
»Wenn Sie den Kurs jetzt hinschmeißen, stehen Sie wieder bei null. Dann sind Sie auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar.«
»Putzen gehen kann ich auch so.«
»Wollen Sie das denn?«
Lorraine fuhr herum. Ihre Augen spuckten Feuer. »Warum denn nicht? Ist das etwa nicht gut genug für Sie? Klar, Sie wären sich garantiert zu fein, um putzen zu gehen. Man braucht Sie ja bloß anzuschauen – was haben Sie schon für eine Ahnung, wie das ist, sich jeden Tag abzurackern? Nie Kohle zu haben? Und Sie sagen mir, dass ich was lernen soll? Das ist doch Verarsche.«
Nach außen hin ruhig, betrachtete ich Lorraines dunkle, dünne, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare, ihr billiges Make-up, die zerknitterten Discounter-Kleider und ihre dünne Regenjacke. Schließlich fiel mein Blick auf ihre abgewetzten, ausgetretenen Stiefel, in denen sie schon so manchen harten Tag hinter sich gebracht haben musste.
Lorraine war nur zwei Jahre älter als ich, aber in ihren Augen lag eine Härte, die sie viel älter erscheinen ließ. Ich wusste nichts über ihr Leben – ich wusste nur, dass sie unsicher war und Angst hatte und dass sie diese Angst nun an mir ausließ.
Wer weiß? Vielleicht passte es ihr auch nicht, wie ich mich ausdrückte, wie ich aussah, wie ich mich kleidete oder wie ich auftrat. Ich war gebildet. Ich war selbstbewusst. Sie nicht. Manchmal reichte das, um jemanden gegen sich aufzubringen. War ich die Falsche, um Lorraine zu unterrichten? Vielleicht. Aber so schnell wollte ich die Flinte nicht ins Korn werfen.
»Es gibt unterschiedliche Arten von harter Arbeit, Lorraine«, sagte ich leise. Ich wählte ganz bewusst einen Tonfall, der nicht zu freundlich war, damit sie sich nicht von oben herab behandelt fühlte. »Die Reinigungskräfte in der Schule, wo ich arbeite, schuften wie verrückt, um hinter den Schülern sauberzumachen.« Ich zog die Nase kraus. »Ich will nicht mal darüber nachdenken, was die so alles auf den Jungstoiletten finden. Aber ich schufte auch wie verrückt, um denselben Kids was beizubringen – ich bereite Stunden vor, korrigiere stapelweise Klassenarbeiten, auch abends und am Wochenende, ich gebe mein eigenes Geld für Lehrmittel aus, weil sie im Etat der Schule nicht vorgesehen sind, und ich bereite auch die Stunden für diesen Kurs hier vor, und zwar ohne Bezahlung. Ich weiß, was es heißt, hart zu arbeiten. Sicher, was ich mache, ist körperlich nicht so anstrengend wie Putzen, aber geistig schon.« Ich machte einen Schritt auf sie zu. »Sie sind harte körperliche Arbeit gewohnt, Lorraine. Das hier« – ich zeigte auf die Tafel – »ist komplettes Neuland für Sie. Das verstehe ich. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich bin hier, um Ihnen Lesen und Schreiben beizubringen, damit Sie sich auf einen Job bewerben können, den Sie wirklich wollen. Wenn Sie ewig weiter putzen gehen wollten, wären Sie nicht hier. Obwohl ich, ganz nebenbei bemerkt, finde, dass man auch für einen Putzjob lesen und schreiben können sollte. Man muss zum Beispiel Bewerbungen schreiben oder Anweisungen vom Arbeitgeber lesen können …« Ich sah, wie sie die Lippen zusammenkniff, und kam auf mein ursprüngliches Thema zurück. »Sie mögen mich nicht? In Ordnung. Damit kann ich leben. Sie müssen mich nicht mögen. Sie sollen mir bloß glauben, dass ich nicht hier bin, um Sie zu quälen oder bloßzustellen. Ich bin hier, um Ihnen etwas beizubringen. Und um von mir zu lernen, müssen Sie mich nicht mögen. Sie müssen nur sich selbst genug mögen, um daran zu glauben, dass es Ihr gutes Recht ist, mehr vom Leben zu verlangen.«
Schweigen trat ein.
Lorraine hatte die Schultern fast bis zu den Ohren hochgezogen. Nun sackten sie herab.
»Wollen Sie das versuchen?« Ich ließ nicht locker.
Lorraine schluckte, bevor sie einmal abgehackt nickte.
»Das heißt, wir sehen uns nächste Woche?«
»Hm.«
Ich seufzte innerlich und merkte, wie die Anspannung von mir abfiel. »Wenn ich mir irgendwas von Ihnen ansehen soll oder Sie gerne mal eine Einzelstunde haben möchten, dann sagen Sie einfach Bescheid. Es gibt hier in der Klasse keinen, der Sie scheitern sehen will. Sie sitzen alle im selben Boot. Die anderen verstehen das, auch wenn Sie denken, dass ich es nicht verstehe.«
»Ja, ja, schon gut.« Erneut verdrehte sie die Augen, bevor sie auf dem Absatz kehrtmachte und ging. »Machen Sie mal keinen Aufstand.«
Zugegeben, manchmal war es haargenau so wie in der Schule.
Schmunzelnd packte ich meine Sachen zusammen und machte mich auf den Weg. Ich knipste das Licht im Klassenraum aus und nickte. Wenn ich am Ende des Tages aus einer Klasse ging, wollte ich jedes Mal das Gefühl haben, einen Schritt weitergekommen zu sein – und mit mir diejenigen, die ich unterrichtete. Manchmal allerdings war ich einfach nur müde und gestresst.
Heute Abend hatte ich das Gefühl, dass Lorraine und ich einen Schritt weitergekommen waren.
Guter Laune und fest entschlossen, mir eine kleine Auszeit zu gönnen, schrieb ich zwei Freundinnen von der Uni, Suzanne und Michaela, eine SMS und verabredete mich mit ihnen für den Freitagabend zum Cocktailtrinken.
Als wir uns trafen, war vom ersten Moment an klar, dass Suzanne in Partylaune war und unbedingt einen Typen für eine heiße Nacht abschleppen wollte. Sie beäugte die Männer in der Bar an der George IV Bridge, als hielte sie nach dem saftigsten Stück Fleisch vom Büfett Ausschau. Sie registrierte meinen Blick, während wir uns einen Tisch suchten, und grinste mich an, als ich angesichts ihres Verhaltens in Gelächter ausbrach.
Michaela rollte bloß mit den Augen und nippte schweigend an ihrem Drink.
Ich hatte die beiden auf der Edinburgh University kennengelernt, nachdem ich ins Studentenwohnheim Pollock Halls gezogen war. Im zweiten Jahr hatten wir uns zusammen eine Wohnung genommen, aber im dritten Jahr war Michaela zu ihrem Freund Colin gezogen, so dass ich mir mit Suzanne eine kleinere Wohnung nahm. Nach dem Abschluss waren wir wohnungstechnisch getrennte Wege gegangen. Suzanne stammte aus Aberdeen, hatte aber eine Stelle bei einer großen Finanzberatung hier in Edinburgh bekommen. Sie verdiente ziemlich viel Geld, deshalb konnte sie sich auch eine Zweizimmerwohnung in Marchmont leisten. Ich für meinen Teil hatte einfach nur Riesenglück gehabt. Meine große Schwester Ellie und ihr Halbbruder Braden, der auch für mich so etwas wie ein großer Bruder war, verdienten beide gut, und so hatten sie mir als Geschenk zum Uniabschluss eine schicke Dreizimmerwohnung in der Clarence Street in Stockbridge gekauft. Nun wohnte ich genau in der Mitte zwischen dem Haus meiner Eltern am St. Bernard’s Crescent im Westen, dem Haus von Braden und seiner Frau Joss in der Dublin Street und dem von Ellie und ihrem Mann Adam in der Scotland Street im Osten. Sie alle waren nur einen kurzen Fußweg entfernt.
Meine Familie übertrieb es manchmal etwas mit ihrer Fürsorge. Das war immer schon so gewesen, und leider überkam mich deswegen von Zeit zu Zeit das Bedürfnis, ihren geballten Beschützerinstinkten zu entfliehen. Die Wohnung allerdings war etwas völlig anderes. Sie war das tollste, extravaganteste Geschenk, das ich jemals bekommen hatte – von meinem Lehrerinnengehalt hätte ich sie mir niemals leisten können. Ich war ganz überwältigt von Ellies und Bradens Großzügigkeit und würde den beiden auf ewig dankbar sein. Und ehrlich gesagt war ich sogar ganz froh, in unmittelbarer Nähe zu meiner Familie zu wohnen. Ich hatte nämlich eine stetig wachsende Schar von Nichten und Neffen, die mir genauso sehr ans Herz gewachsen waren wie ihre Eltern.
»Und? Schon einen entdeckt?«, fragte ich Suzanne, während ich die Männerauswahl in der Bar begutachtete. Neben der Theke standen ein paar attraktive Typen.
»Worauf du wetten kannst«, sagte Michaela. »Wahrscheinlich hat sie schon fünf entdeckt.«
Suzanne lachte. »Nicht alle haben mit achtzehn die Liebe ihres Lebens gefunden. Die sind eben gezwungen, jede Menge Frösche zu küssen, bis sie ihren Prinzen finden. Und einige haben auch gar kein Problem damit.«
Michaela und ich lachten. Suzanne hatte nicht ganz unrecht. Michaela kam nur deshalb auf unsere Clubabende mit, um nicht den Kontakt zu uns zu verlieren. Sie war glücklich mit Colin verlobt, einem Schotten, in den sie sich bereits in ihrem ersten Semester auf der Uni verliebt hatte. Sie hatte beschlossen, nach dem Studium nicht ins heimatliche Shropshire zurückzukehren, und stattdessen zusammen mit mir eine Lehrerausbildung im Moray House an der Universität absolviert. Genau wie ich wollte sie Englischlehrerin werden.
Meine beiden Freundinnen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Suzanne war laut und direkt. Sie flirtete für ihr Leben gern und war eine echte Dramaqueen. Michaela war die Stillste von uns dreien. Sie war loyal, immer freundlich und hatte ein großes Herz für ihre Schüler. Wenn ich mich amüsieren wollte oder Ablenkung brauchte, rief ich Suzanne an, aber wenn ich jemanden zum Reden brauchte, wandte ich mich an Michaela.
»Wie geht’s den Kindern?«, erkundigte sich Michaela bei mir. Ich wusste, dass sie sich damit auf meine nähere Verwandtschaft bezog, nicht auf meine Schüler.
»Sehr gut.«
»Und es kommt bald wieder Nachschub.« Sie grinste.
»Puh. Keine Ahnung, welcher Teufel die geritten hat.« Suzanne schüttelte sich. »Eigentlich müssten sie nach einem doch ihre Lektion gelernt haben.«
»Für Jo ist es das erste Kind.« Nicht dass ich damit etwas an Suzannes Meinung geändert hätte, dass Kinder unangenehme kleine Quälgeister waren, um die man am besten einen weiten Bogen machte.
Johanna MacCabe war vermutlich meine beste Freundin, obwohl zwischen uns ein Altersunterschied von sieben Jahren bestand. Als Braden seine Frau Joss kennengelernt hatte, hatte diese ihre gute Freundin Jo Walker in die Familie mitgebracht, und Jo war wenig später ihrer großen Liebe Cameron MacCabe begegnet. Die beiden waren seit zwei Jahren verheiratet, und nun erwartete Jo ihr erstes Baby.
Sie war nicht die Einzige, die schwanger war. Meine Schwester Ellie und ihr Mann Adam bekamen ihr zweites Kind. Sie hatten bereits einen süßen Zweijährigen namens William und hofften, dass es diesmal eine Nichte für mich werden würde.
»Sie ist bekloppt.« Suzanne verzog das Gesicht. »Aber na ja, mit wem rede ich? Lehrerinnen. Welcher Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte würde sich freiwillig dazu entschließen, in den Schuldienst zu gehen? Oho!« Sie hatte hinter mir etwas erspäht und riss die Augen auf – »Der ist aber ein Leckerbissen.«
Michaela und ich sahen uns vielsagend an, dann drehte ich den Kopf, um so unauffällig wie möglich den Mann, der Suzannes Interesse geweckt hatte, in Augenschein zu nehmen.
»Und da geht sie hin!«, sagte Michaela glucksend. Ich riss den Blick von dem großen Typen mit den aufgepumpten Oberarmen los, der exakt in Suzannes Beuteschema passte. Übertrieben mit den Hüften wackelnd, nahm sie Kurs auf ihn. »Keine Ahnung, wie man so was jedes zweite Wochenende machen kann. Immer ein anderer.«
Die Anzahl der Männer, mit denen Suzanne geschlafen hatte, bewegte sich im zweistelligen Bereich. Aber ich hatte kein Recht, über sie zu urteilen. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, solange sie vorsichtig war. Ich selber hatte mit One-Night-Stands nichts am Hut. Ehrlich gesagt, hatte ich mit Sex grundsätzlich nichts am Hut. Seit meinem ersten, letzten und zugleich einzigen Mal war ich ein gebranntes Kind. Es wäre mir nicht mal im Traum eingefallen, mit einem Mann ins Bett zu gehen, wenn ich nicht absolut sicher sein konnte, dass er meine Gefühle erwiderte.
Im Moment war ich zufrieden mit meinem Leben. Ich hatte so viel um die Ohren, dass mir für mehr als harmlose Barflirts ohnehin die Zeit fehlte, und das war auch überhaupt kein Problem für mich. Ich war noch jung. Ich hatte Zeit. Suzanne schien es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, jeden Frosch zu küssen, der ihr über den Weg hüpfte, bis sie irgendwann ihren Prinzen gefunden hatte.
Eben kam sie zurück an unseren Tisch, den Typen und seine beiden Freunde im Schlepptau. Sie setzten sich zu uns, und wir machten uns miteinander bekannt. Leider schoss sich Seb, der Typ, auf den Suzanne ein Auge geworfen hatte, ziemlich schnell auf mich ein, aber zum Glück schien einer seiner Freunde dafür umso mehr auf Suzanne zu stehen.
Seb war wirklich nett. Er stellte mir Fragen über mein Leben und ich ihm über seins. Wir lachten und unterhielten uns über alltäglichen Kram, und die Jungs spendierten uns die nächste Runde.
Ein paar Stunden später überlegten unsere neuen Bekannten, ob sie in einen Club weiterziehen sollten. Michaela war noch unentschlossen, also verschwanden Suzanne und ich kurz auf dem Damenklo, um uns ein bisschen frisch zu machen, während Michaela sich die Sache überlegte.
Wir standen an den Waschbecken und trugen gerade Rouge und Lippenstift auf, als Suzanne anfing: »Also … Seb ist doch wirklich eine Sahneschnitte. Ist so jemand wenigstens gut genug für dich, um das Ende der längsten sexuellen Dürreperiode in der Geschichte der Menschheit einzuläuten, oder machst du ihn wie so oft bloß scharf und lässt ihn dann abblitzen?«
Ich schnaubte. »Scharfmachen?«
Sie sah mich an, als wolle sie sagen: Du weißt ganz genau, was ich meine. »Klar, scharfmachen. Die atemberaubende Hannah Nichols krallt sich immer die heißesten Typen, flirtet ein paar Stunden lang mit ihnen, was das Zeug hält, und schickt sie dann mit geschwollenen Eiern und ohne Telefonnummer nach Hause.«
»Ich mache niemanden scharf«, widersprach ich. »Wenn ich kein Interesse an einem Mann habe, dann tue ich auch nicht so. Das ist eine harmlose Unterhaltung, mehr nicht.«
Wie so oft in letzter Zeit warf sie mir einen ungehaltenen Blick zu. Er sollte ausdrücken, dass sie keine Ahnung hatte, was in mir vorging. Nicht die geringste. »Herrgott noch mal, was ist bloß los mit dir? Und wann hakst du die Sache von damals endlich ab und suchst dir einen Neuen?«
Ich schüttelte den Kopf, als wüsste ich nicht, was sie meinte. »Bist du jemals auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht glücklich bin? Kommt es nicht darauf an? Glücklich zu sein? Und ich bin glücklich. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Familie, und ich liebe meine Freunde. Ich habe ein gutes Leben, Suzanne.«
Sie schüttelte verächtlich den Kopf. »Ja, klar. Red dir das nur ein.«
Ich spürte, wie mein Blut in Wallung geriet. »Was ist heute Abend eigentlich dein Problem? Ist es wegen Seb? Du kannst ihn gerne haben.«
Suzanne schaute mich durch zusammengekniffene Augen an. »Ich könnte ihn sowieso haben, wenn ich wollte. Dazu brauche ich nicht deine Erlaubnis.«
»Warum bist du dann so zickig?«
»Hey, red nicht mit mir, als wäre ich eins deiner Kinder in der Schule. Weißt du, du bist in letzter Zeit echt langweilig geworden.«
Ich lachte ungläubig auf, weil ich nicht begreifen konnte, wie unsere Unterhaltung auf einmal in dieses Fahrwasser geraten war. Suzanne war kein besonders taktvoller Mensch, und sie neigte manchmal dazu, andere ungeduldig anzufahren, aber an diesem Abend war sie richtiggehend gemein zu mir. So hatte sie sich mir gegenüber noch nie verhalten. »Zu meiner Verteidigung: Du benimmst dich wie ein Kind.«
»Ja, ja, laber du nur.« Sie rang, ganz Dramaqueen, in einer Geste nackter Verzweiflung die Hände. »Fragen wir Michaela einfach, ob sie noch mit in den Club will …« Ich war sicher, dass sie noch mehr sagen wollte, aber dann presste sie bloß die Lippen aufeinander und stolzierte aus der Toilette.
Ich wollte ihr gerade folgen, als ich eine SMS von Lucy bekam, einer Kollegin von der Schule. Sie wollte wissen, ob ich Lust hatte, mich mit ihr auf einen Drink zu treffen. Sie saß mit ein paar Freunden in einem Pub direkt um die Ecke in der Royal Mile und wusste, dass ich heute Abend ebenfalls unterwegs war. Ich schickte ihr eine Antwort, dann kehrte ich zu meinen Freundinnen zurück.
»Michaela will doch noch mitkommen«, verkündete Suzanne unbeschwert, als hätte sie mir nicht gerade auf dem Damenklo eine verbale Ohrfeige verpasst.
Ich umarmte Michaela und lächelte in die Runde. »Dann noch viel Spaß. Ich muss noch weiter.«
Ich ignorierte Suzannes gemurmelte Unmutsäußerungen und verließ die Bar – Schluss mit dem Drama und den knackigen Kerlen –, um mich für den Rest des Abends in der Gesellschaft von Menschen zu betrinken, die sich nicht darum scherten, ob ich solo war oder verheiratet, dünn oder dick, ehrgeizig oder faul. Sie amüsierten sich lediglich nach einem anstrengenden Arbeitstag ein bisschen, und mehr wollte ich selber auch nicht.
Das Leben war schön. Ich brauchte garantiert niemanden, der mir das Gegenteil einredete, nur weil dieser Jemand selber unzufrieden war.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen machte ich mich gleich nach dem Aufstehen fertig für Jos und Ellies Babyparty. Meine Mutter Elodie richtete sie bei sich zu Hause aus, nur für die Frauen. Die Männer kümmerten sich währenddessen um die Kinder.
Ich hatte gerade den Fön ausgeschaltet und mich hingesetzt, um mich zu schminken, als es an der Tür schellte. Ich erwartete niemanden und fragte mich, ob vielleicht eins der Mädels beschlossen hatte, vor der Party spontan vorbeizuschauen.
»Hallo?«, rief ich in die Gegensprechanlage.
»Ich bin’s«, erwiderte eine mir vertraute, tiefe Männerstimme.
Erfreut über den unerwarteten Besuch, antwortete ich: »Komm rauf.«
Als ich die Tür zu meiner Wohnung aufmachte, grinste mir Cole Walker entgegen. Er trat ein, ich hielt ihm die Wange hin, damit er mir einen Kuss geben konnte, und fragte ihn dann, ob er einen Kaffee wollte.
»Immer doch.« Er folgte mir in die Küche
Cole Walker war Jos kleiner Bruder. Er war ein Jahr jünger als ich, was man allerdings niemals vermutet hätte. Ich hatte noch nie einen Mann in meinem Alter getroffen, der so reif war wie Cole. Das war so, seit ich ihn kannte. Von seinem Verhalten her wirkte er eher wie ein Dreißigjähriger, jedenfalls nicht wie ein durchschnittlicher Mann mit einundzwanzig.
Unsere Freundschaft hatte sich in erster Linie dadurch ergeben, dass unsere Familien sich nahestanden, aber in dem Jahr, als ich siebzehn wurde, hatte sich unsere Beziehung noch vertieft. Seitdem sah ich ihn als meinen besten Freund an. Gelegentlich bedauerte ich es, dass unsere Gefühle füreinander nicht romantischer Natur waren, denn Cole zählte zu den anständigsten Männern, die ich je kennengelernt hatte, und wäre ohne Frage ein toller Freund gewesen.
Obwohl er ein bisschen hitzköpfig sein konnte – vor allem, wenn jemand seine Freunde verletzte oder ihnen dumm kam –, war Cole kein bisschen voreingenommen. Manchmal wirkte er etwas großspurig, und Leute, die ihn nicht kannten, fühlten sich dann leicht von ihm eingeschüchtert, aber ich wusste, dass er ein bodenständiger, aufmerksamer, kluger, kreativer, mitfühlender, treuer und besonnener Mensch war, auch wenn seine äußere Erscheinung denjenigen, die nach dem Aussehen urteilten, etwas anderes nahelegte.
Cole war ungefähr eins fünfundachtzig groß, breitschultrig und athletisch gebaut – sein nahezu perfekter Körper war durch Kampfsporttraining und wöchentliche Besuche im Fitnessstudio gestählt. Er hatte strubbelige rotblonde Haare – die seine Schwester ihm am liebsten abschneiden würde –, faszinierende grüne Augen und ein attraktives, normalerweise unrasiertes Gesicht. Trotzdem erregte er weniger mit seinem guten Aussehen Aufmerksamkeit, obwohl sich so mancher nach ihm umdrehte, sondern mit seinen Tattoos. An die Innenseite des Handgelenks hatte er sich einige Songzeilen stechen lassen, und hinten an seiner rechten Schulter prangten schwarze Federn, die sich über den gesamten Bizeps erstreckten und zu einem Adler mit ausgebreiteten Schwingen gehörten. In seinen Krallen hielt der Adler eine altmodische Taschenuhr. Coles linker Arm war noch frei, aber er dachte bereits über Ideen für einen Sleeve nach.
Zusätzlich hatte er noch das gleiche Tattoo wie Cam. Die zwei waren beste Freunde. Cole hatte es entworfen, als er fünfzehn war. Es bestand aus den Initialen J&C, umgeben von einem tribalartigen Design aus Ranken und Schnörkeln. Cam trug es auf der Brust, und sobald Cole achtzehn geworden war, hatte er sich dasselbe Motiv seitlich auf den Hals stechen lassen, direkt dort, wo sein Puls schlug.
Ich wusste, wie viel ihm das Tattoo bedeutete. Für Cam symbolisierte das »J&C« seine Liebe zu Jo, aber gleichzeitig auch seine Beziehung zu Cole. Bei Cole hingegen stand das »J&C« für Jo und Cam. Cole hatte es zu Hause ziemlich schwer gehabt. Seine Mutter Fiona war alkoholsüchtig gewesen und hatte sich nie um ihn gekümmert. Jo hatte ihn praktisch alleine großgezogen. Als Cole vierzehn war, hatte Jo herausgefunden, dass ihre Mutter ihn schlug, und wenig später waren sie dann zu Cameron gezogen, während Fiona in ihrer alten Wohnung ein Stockwerk über ihnen allein wohnen blieb.
Vor knapp zwei Jahren war Fiona an einem Herzinfarkt gestorben. Das war für Cole – aus den unterschiedlichsten Gründen – nicht einfach gewesen. Ich hatte versucht, mit ihm darüber zu reden, aber es war eins der wenigen Themen, über die er nie ein Wort verlor. Für ihn war Jo Schwester und Mutter in einer Person, und Cameron hatte ihnen das Leben gerettet. Die beiden waren alles, was er brauchte.
»Was machst du hier?«, fragte ich ihn, während ich ihm seinen Kaffee kochte. »Musst du nicht zur Arbeit?«
Cole studierte am Edinburgh College of Art, arbeitete aber darüber hinaus seit seinem sechzehnten Lebensjahr bei INKarnate, einem mehrfach ausgezeichneten Tattoostudio in Leith. Inhaber war seit mehr als fünfundzwanzig Jahren Stu Motherwell. Cole hatte bei ihm zunächst als Botenjunge angefangen, um sich mit dem Betrieb vertraut zu machen. Mit achtzehn hatte er dann eine Ausbildung in Teilzeit angefangen. Ich wusste, dass Cole für Stu fast wie ein Sohn war und er sich sehr auf ihn verließ. Vermutlich würde es nicht lange dauern, bis Cole den Laden mit ihm zusammen leitete.
»Heute geht’s erst später los«, antwortete Cole und nahm den Kaffee dankend entgegen. »In einer halben Stunde muss ich anfangen, aber ich wollte vorher noch kurz bei dir vorbeischauen.«
Ich lehnte mich gegen den Tresen und sah zu ihm auf. »Wieso? Ist alles in Ordnung?«
Er musterte mich einige lange Sekunden schweigend. »Das wollte ich dich eigentlich fragen. Bei allem, was jetzt gerade so los ist …«
Ich verstand, worauf er anspielte, und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Es ist alles gut. Ganz ehrlich.«
Er runzelte die Stirn. »Ich habe in letzter Zeit nicht viel von dir gehört und …« Er zuckte mit den Achseln.
»Cole, ich habe einfach nur wahnsinnig viel zu tun – die Schule, die ehrenamtliche Arbeit … Ich bin momentan total im Stress, deswegen kommt so ziemlich alles andere in meinem Leben zu kurz.«
»Das ist alles? Bist du sicher?«
Ich hob zwei Finger zum Schwur. »Ehrenwort.«
Sein Blick ging an mir vorbei zum Küchentisch, wo die Geschenke für die Babyparty fertig verpackt bereitlagen. Er entdeckte die zwei Kondompackungen, die ich Ellie und Jo zum Spaß schenken wollte, und grunzte kopfschüttelnd. »Heute beneide ich dich wirklich nicht.«
»Zwei hormonell übersättigte Weiber und ein Päckchen Kondome? Sieht so nicht dein typischer Freitagabend aus?«
Er lachte, weil wir beide wussten, dass das so gar nicht der Wahrheit entsprach.
Cole war kein Aufreißertyp. Er war auch kein Heiliger, das wusste ich, aber er bevorzugte eine feste Beziehung. Im Moment war er mit einer Studentin der Kunstgeschichte namens Steph zusammen.
»Ich brauche wenigstens Kondome.« Er lächelte gutmütig.
Ich verzog das Gesicht. »Bei mir ist es eine Weile her. Was soll’s.«
»Ich korrigiere: Es ist schon eine Ewigkeit her.« Er zog die Brauen zusammen. »Lässt du überhaupt mal jemanden ran?«
»Ich will eben nicht mit irgendeinem x-beliebigen Typen ins Bett steigen, Cole. Ich bin nicht Suzanne.«
»Habe ich auch nie behauptet. Aber nicht alle Männer wollen dich bloß flachlegen und sind am nächsten Morgen auf Nimmerwiedersehen verschwunden.« Seine Miene wurde weicher. »Du bist keine Frau, die ein Mann sitzenlassen würde, Hannah, aber du musst einfach mal jemandem die Chance geben, dir das zu beweisen. Du hattest noch nie eine Beziehung. Woher willst du wissen, dass es so schrecklich ist, wenn du es noch nie ausprobiert hast?«
Ich lachte. »Ich behaupte ja gar nicht, dass es schrecklich ist. Ich bin im Moment einfach lieber allein. Aber wo wir gerade von Beziehungen reden … wie geht’s denn eigentlich deiner besseren Hälfte?«
Cole seufzte. »Sie stresst gerade ziemlich. Ich habe ihr versprochen, dass ich nach der Arbeit bei ihr vorbeikomme, um ihr bei ihrer Seminararbeit zu helfen.«
»Ohhh«, säuselte ich zuckersüß. »Du bist so ein treusorgender Freund.«
Cole kippte den Rest seines Kaffees hinunter und stellte den Becher in die Spüle. Er beugte sich zu mir und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Wenn du Steph das nächste Mal siehst, könntest du ihr das dann sagen?«
»Dunkle Wolken am siebten Himmel?«, fragte ich, als ich mit ihm zur Tür ging.
»Sie nervt andauernd rum.«
»Bestimmt hört sie damit auf, wenn sich der Stress bei ihr etwas gelegt hat.«
»Hmm.« Er erwiderte mein Lächeln und trat in den Hausflur hinaus. »Viel Spaß unter der Dusche.«
»Viel Spaß beim Nachhilfeunterricht«, gab ich mit einem frechen Grinsen zurück. »Wer weiß? Vielleicht wird es ja eine richtig … lehrreiche Erfahrung.« Ich zog vielsagend die Augenbrauen hoch.
Cole lachte und sprang, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe herunter. »Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Kaum hatte ich das Haus meiner Eltern betreten, hörte ich aus dem Wohnzimmer die Kakophonie weiblicher Stimmen.
Dad kam in den Flur, gerade als ich die Haustür hinter mir schloss. Als er mich sah, begannen seine Augen zu leuchten.
»Hey, Dad.« Ich fiel ihm in die Arme und ließ mich von ihm drücken.
»Hi, Schatz.« Er küsste mich aufs Haar, löste sich dann von mir und strahlte mich an. »Wir haben uns aber lange nicht gesehen.«
Ich verzog das Gesicht. »Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so selten hier war. Ich hatte viel um die Ohren.«
Mein Dad war Professor für alte Geschichte an der Edinburgh University. Er war intelligent, begeistert von seinem Fachgebiet, gelassen und vor allem: sehr, sehr scharfsinnig. Seine Augen wurden schmal, als er mich musterte. »Bist du sicher, dass nicht mehr dahintersteckt?«
»Klar. Mir geht’s gut. Echt.«
»Du würdest es mir doch sagen?«
Er hatte allen Grund, misstrauisch zu sein. In meiner Vergangenheit hatte es da gewisse Vorkommnisse gegeben. Aber diesmal war ich absolut aufrichtig. »Ich bin darüber hinweg.«
»Clark! Clark, kannst du dich bitte um die Kanapees kümmern?« Die Stimme meiner Mum schallte aus der Küche bis in den Flur.
Dad riss in gespieltem Entsetzen die Augen auf. »Ich muss hier irgendwie raus. Hilf mir!«
Ich lachte. »Geh schon. Ich lenke sie ab.«
Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, gab mir einen Kuss auf die Wange und war verschwunden.
Eine Sekunde später kam Mum in den Flur marschiert. »Oh. Hannah.« Lächelnd und mit ausgebreiteten Armen kam sie auf mich zu. »Wie schön, dich zu sehen, Liebling.« Sie umarmte mich fest. »Hast du zufällig deinen Vater gesehen?«
»Äh. Der ist gegangen.«
Mum runzelte die Stirn. »Er sollte mir doch helfen.«
»Mum, er ist der einzige Mann hier. Ich finde es ungerecht, dass er bleiben muss, wenn die anderen Männer auch nicht hier sind.«
Sie machte »Pff!«, widersprach aber nicht. »Hilfst du mir dann?«
Ich zeigte ihr meine Geschenke. »Kann ich die erst mal abstellen?«
»Sicher. Im Wohnzimmer.«
Während Mum in die Küche zurückkehrte, ging ich ins Wohnzimmer, wo ich sofort von meiner Schwester und meinen Freundinnen umringt wurde. Ellie war als Erste bei mir. Genau wie damals bei William hatte sie nicht nur einen ziemlich dicken Bauch, sondern auch volle Wangen und noch vollere Lippen. Sie sah unheimlich hübsch aus, auch wenn sie selbst anderer Ansicht war. »Hannah.« Sie zog mich an sich, und ich umarmte sie etwas unbeholfen, weil ich ihren Bauch nicht quetschen wollte.
»Du siehst toll aus, Els.« Ich küsste meine Schwester auf die Wange und betrachtete dann ihren Bauch. »Du bist sogar noch dicker als letztes Mal.«
Els stöhnte. »Hör bloß auf. Neben Jo komme ich mir vor wie eine Hirschkuh.«
Jo lachte und schob Ellie beiseite, um mich ebenfalls in den Arm zu nehmen. »Mir kommt’s vor, als hätten wir uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen«, sagte sie und drückte mich.
Bis auf ihren kleinen Kugelbauch sah Jo gar nicht viel anders aus als sonst – sie war auch schwanger eine umwerfende Erscheinung. Ich fragte mich, wie viele der anderen Frauen im Raum sie wohl insgeheim dafür hassten, dass sie trotz Schwangerschaft noch so elegant aussah. »Ich hatte furchtbar viel Arbeit. Tut mir leid.«
»Ach, lass nur.« Sie tat es mit einem Lächeln ab. »Ich weiß doch, wie sehr du dich in der Schule reinhängst.«
»Okay, jetzt bin ich aber dran.« Ein melodiöser amerikanischer Akzent drang an mein Ohr, und Sekunden später lag ich in Olivia Sawyers Armen. »Es ist eine halbe Ewigkeit her«, beschwerte auch sie sich, aber ihre Augen strahlten, deshalb wusste ich, dass sie mir nicht wirklich böse war, weil ich mich in letzter Zeit so rargemacht hatte. »Deine Haare sind viel länger als beim letzten Mal.«
Olivia – oder Liv, wie wir sie nannten – hatte dunkle Haare, tolle Kurven und war gewissermaßen Jos Schwester. Livs Vater Mick war Jos Onkel und in ihrer Kindheit so etwas wie ein Vaterersatz für sie gewesen. Irgendwann war er dann nach Amerika geflogen, um für seine Tochter – Liv – zu sorgen, von deren Existenz er bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr nichts geahnt hatte. Vor sieben Jahren, nach dem Tod seiner Frau, Livs Mutter, war er nach Schottland zurückgekehrt. Liv war mitgekommen, weil sie gemeinsam neu anfangen wollten. Jo arbeitete mittlerweile in Micks Malerfirma, und Dad hatte Liv zu einer Stelle in der Unibibliothek verholfen. Neben dem beruflichen hatte auch das private Happy End für sie nicht allzu lange auf sich warten lassen. Sie hatte Nate Sawyer geheiratet, Cams besten Freund und einen der aufregendsten Männer, die ich je gesehen hatte.
Wir alle waren so vertraut miteinander, dass wir ein bisschen wie eine große Familie waren.
»Arbeit.« Ich zog unglücklich die Schultern hoch. »Das Referendariat verlangt einem ziemlich viel ab.« Dazu kam, dass Liv und Nate in ein Haus am Stadtrand umgezogen waren, in dem ihre wachsende Familie Platz hatte. Sie hatten eine vierjährige Tochter, die Lily hieß, und eine einjährige Tochter namens January. »Ich nehme an, Nate hat die Kinder?«
»Die Männer haben alle Kinder.« Joss grinste und kam mit einem Glas Champagner und Orangensaft auf mich zu. »Na, Süße?« Sie küsste mich liebevoll auf die Wange. »Es ist so schön, dich zu sehen.«
»Geht mir genauso.« Plötzlich kam mir ein Bild in den Kopf, über das ich schmunzeln musste. »Sind die Männer mit den Kindern unterwegs?«
Joss grinste. »Ja. Sie sind mit ihnen in den Zoo gegangen.«
Ich lachte prustend. »Vier Männer und fünf kleine Kinder? Die Jungs sind so was von chancenlos.«
Braden war der Vater der fast sechsjährigen Beth und des dreijährigen Luke. Joss war eine Amerikanerin, die zum Studium nach Edinburgh gekommen war. Mit vierzehn hatte sie ihre gesamte Familie – Mutter, Vater und ihre kleine Schwester Beth – bei einem Autounfall verloren. Ihre Mutter Sarah war Schottin gewesen, deshalb hatte Joss beschlossen, in der alten Heimat ihrer Mutter neu anzufangen. Nach dem Uniabschluss war sie bei Ellie eingezogen, hatte Braden kennengelernt und eine Affäre mit ihm angefangen, aus der schnell viel mehr geworden war. Sie waren seit sieben Jahren verheiratet und so ziemlich das glücklichste Paar, das ich kannte.
»Mal sehen, wer von ihnen heil wiederkommt«, murmelte Joss düster.
Nachdem wir eine Weile gescherzt hatten, hörte ich Mum nach mir rufen, also lief ich rasch in die Küche und half ihr dabei, das Büfett herzurichten.
Danach kamen wir alle im Wohnzimmer zusammen, machten jede Menge »Oooh« und »Aahh« beim Auspacken der Geschenke und lachten, als Jo mit der Kondomschachtel nach mir warf.
Ich saß da, lauschte den Gesprächen, genoss die unbeschwerte Atmosphäre und die nervöse Vorfreude auf die bevorstehenden Geburten. Keins der werdenden Elternpaare hatte das Geschlecht des Babys im Voraus wissen wollen, deshalb waren die meisten Geschenke geschlechtsneutral ausgefallen.
Ein paar Stunden später war ich ein bisschen beschwipst vom Champagner und brauchte ein Glas Wasser, also verschwand ich leise in der Küche. Joss heftete sich an meine Fersen.
»Hey.« Ich lächelte sie über die Schulter hinweg an, während ich das Wasser aus dem Kühlschrank holte und mir ein Glas eingoss.
Joss musterte mich kritisch. »Du siehst müde aus. Geht’s dir gut?«
»Ist gestern spät geworden. Außerdem macht mich der Gedanke an zwei weitere Babys ganz schlapp«, meinte ich scherzhaft. »Wahrscheinlich werde ich so oft Kinder hüten müssen, dass ich mein eigenes Leben vergessen kann.«
Joss stöhnte. »Ich kann dich total gut verstehen. Jo und Cam haben so oft auf Beth aufgepasst, da werde ich mich revanchieren müssen. Beth, Luke und noch ein Säugling? Das wird mein Untergang.«
»Soll Braden es doch machen.«
Sie lachte, doch dann ertönte eine Männerstimme: »Was soll Braden machen?«
Wir wandten uns um. Im Türrahmen stand Braden mit dem kleinen Luke auf dem Arm. Beth stürzte sich sofort auf ihre Mutter.
»Mummy, ich hab auf einem Pinguin gesessen!«, rief sie mit vor Aufregung überschnappender Stimme und klammerte sich an Joss’ Beine.
Joss umarmte sie und sah Braden mit großen Augen an.
Er lachte. »Es war kein echter.«
»Na, Gott sei Dank.« Joss hob ihre dünne, zerzauste Tochter hoch. »Ich dachte schon, wir hätten eine Klage am Hals.« Sie rieb ihre Nase gegen die von Beth. »War es schön bei den Tieren, Schätzchen?«
Beth nickte und drehte sich zu ihrem Vater um. Aber was auch immer sie hatte sagen wollen, war vergessen, sobald sie meiner ansichtig wurde. »Hannah!«, kreischte sie.
Sofort befreite sie sich aus Joss’ Armen und stürzte sich auf mich. Joss nutzte die Gelegenheit, um zu Braden zu gehen. Sie gab ihrem Sohn einen Kuss aufs Haar und ihrem Mann einen auf die Lippen. Ich bückte mich, um Beth in die Arme zu nehmen, die aufgeregt auf mich einplapperte. Der Lärmpegel im Haus schwoll an. Ich hörte January schreien und William kichern. Die bildhübsche kleine Lily, mit dunklen Haaren und dunkler Haut wie ihre Mutter, schlängelte sich an Joss vorbei und rannte, einen Plüschtiger in der Hand schwenkend, auf Beth und mich zu.
Ich fing auch sie in meinen Armen auf, während Braden und Joss aus dem Türrahmen traten, um einem gestresst wirkenden Nate Platz zu machen. Als er mich mit Lily sah, entspannte er sich ein wenig und warf Braden einen erleichterten Blick zu. »Ich habe Jan an Liv übergeben. Sie ist die Babyflüsterin.«
Plötzlich hörten wir Gelächter aus dem Wohnzimmer herüberschwappen.
»William.« Braden grinste. »Aus dem wird mal ein großer Komödiant.«
»Hannah!« Beth zog an meiner Hand, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Wir haben auch Löwen gesehen.«
»Und Tiger, Nanna«, fügte Lily mit ihrer Piepsstimme hinzu. Sie konnte meinen Namen noch nicht richtig aussprechen. Gleich darauf begann sie an der Pfote ihres Plüschtigers zu kauen.
»Was um alles in der …?«, hörten wir plötzlich eine vertraute, zu gleichen Teilen verwirrte und entsetzte Stimme von draußen. Wenige Sekunden später kam mein jüngerer Bruder Declan in die Küche, seine Freundin Penny an der Hand hinter sich herziehend. Dec war achtzehn und schon seit zwei Jahren mit Penny zusammen. Wir standen uns nicht so nahe, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich glaube, das hatte auch viel mit seinem Alter zu tun – und damit, dass er den Großteil seiner Zeit mit Penny zusammenklebte.
Sein Blick geisterte durch den Raum. Er wirkte wie vom Blitz getroffen. »Ist heute Sonntag?«
Ich lachte. Er bezog sich auf die berühmten Sonntagsessen meiner Mum. Natürlich hatten nicht alle jeden Sonntag Zeit, aber wenn, dann ging es immer laut und fröhlich zu, und das Haus platzte aus allen Nähten. »Nein. Heute ist Ellies und Jos Babyparty.«
Dec brummte verärgert. »Als ob diese Familie noch mehr Mitglieder bräuchte.«
»He«, mahnte Joss. »Du solltest dankbar sein, dass du eine Familie hast.«
»Ja, ja.« Er grinste schief. »Aber manchmal ist es auch ganz nett, wenn man nach Hause kommt, und keiner ist da.«
»Hmm.« Ich stand auf, die zwei Mädchen an den Händen haltend. »Und wir alle wissen genau, warum.« Dies sagte ich mit einem vielsagenden Kopfnicken in Pennys Richtung, bevor ich meinem Bruder zuzwinkerte.
Der verdrehte die Augen. »Mit dir stimmt echt was nicht.« Sanft schob er die wie üblich stumme und errötende Penny aus der Tür. »Wir sind dann oben.«
»Tut nichts, was ich tun würde!«, rief ich ihm hinterher. Braden, Nate und Joss lachten.
Nate schüttelte den Kopf. »Du bist ganz schön fies zu ihm.«
Ich sah ihn in gespielter Entrüstung an, ehe ich mich an die zwei Mädchen wandte. »Habt ihr das gehört? Tante Hannah ist doch nicht fies, oder?«
Beth schüttelte energisch den Kopf, und Lily, die offenbar die Frage nicht richtig verstanden hatte, nickte.
Kapitel 3
Im Haus war es still. Bis auf meinen kleinen Bruder und Penny waren alle gegangen. Zwar hatten mehrere Gäste meiner Mutter Hilfe beim Aufräumen angeboten, doch am Ende hatten wir alle nach Hause geschickt. Ich hingegen blieb noch, um ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen, obwohl in meiner Wohnung ein Stapel Klassenarbeiten zur Korrektur auf mich wartete.
Ich stellte gerade einige gespülte und abgetrocknete Teller in den Schrank, als meine Mutter fast zögerlich meinen Namen rief. Ihr verhaltener Ton machte mich sofort misstrauisch. Mit fragend hochgezogenen Brauen drehte ich mich zu ihr um.
Sie knetete nervös einen Schwamm, mit dem sie zuvor die Arbeitsflächen abgewischt hatte. »Dein Dad und ich wollten dich etwas fragen.«
Ich seufzte und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn ich euch schon wieder dabei helfen soll, eine Leiche verschwinden zu lassen, lautet meine Antwort genauso wie letztes Mal: Mit so was will ich nichts mehr zu tun haben.«
Mum musste schmunzeln. »Scherzkeks«, sagte sie trocken. »Nein … also …«
»Komm schon, Mum. Raus damit.«
Sie stieß zwischen gespitzten Lippen die Luft aus. »Ich habe Angst, es dir zu sagen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, wir würden dich hier nicht mehr wollen.«
»Siehst du das?« Ich zeigte auf mein Gesicht. »So sieht Verwirrung aus.«
Mum lachte leise. »Ich versuche nur dir zu sagen, dass wir dein altes Zimmer in ein Kinderzimmer umgewandelt haben.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Na ja, das macht doch Sinn. Die Kinder übernachten ja viel häufiger hier als ich.«
Mum schien bei meiner Antwort ein Stein vom Herzen zu fallen. »Du bist nicht sauer?«
»Nein, Mum.« Ich lachte. »Ich bin eine erwachsene Frau mit einer sehr schönen Wohnung nur eine Straße weiter. Die hat sogar ein Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer, genaugenommen.«
Sie rollte mit den Augen. »Mach dich nur lustig. Ich bin immer noch deine Mutter, und du bist mein Kind, und ich wollte nicht, dass du denkst, hier ist kein Platz mehr für dich. Wir haben ein Bett ins Kinderzimmer gestellt, du kannst also nach wie vor hier schlafen, wann immer du willst. Zu Weihnachten natürlich sowieso.«
Ich schüttelte den Kopf über die unnötige Sorge in ihren Augen, ging zu ihr und nahm sie in die Arme. »Ich kann nicht glauben, dass du Angst hattest, mir das zu sagen.«
Sie drückte mich. »So sind Mütter eben.«
Nach einer Weile lösten wir uns voneinander. »Aber meine alten Sachen habt ihr noch, oder?«
»Sicher. Wir haben sie in Kartons verpackt. Ich dachte, vielleicht kannst du sie mal durchsehen und entscheiden, was du behalten möchtest und was in den Müll kann.«
Ich hätte mich wirklich auf den Heimweg machen und mir meine Klassenarbeiten vornehmen sollen. Aber Mum und Dad baten mich fast nie um einen Gefallen, außerdem wusste ich, dass es ihnen eine große Hilfe wäre, wenn ich die Sache so schnell wie möglich in Angriff nahm. »Okay. Tja, dann fällt das Sonntagsessen für mich wohl aus. Ich habe nämlich einen ganzen Stapel Klassenarbeiten zu Hause liegen.«
»Ach, dann lass die Kartons ruhig erst mal, Schatz.«
»Nee.« Ich winkte ab und machte mich auf den Weg zur Treppe. »Wahrscheinlich hätte ich ohnehin keine Zeit gehabt.«
Obwohl ich mit den Veränderungen in meinem alten Zimmer gerechnet hatte, war ich nicht auf den kleinen Schock gefasst, den ich bekam, als ich es sah. Die einst cremefarbenen Wände waren in einem sanften Buttergelb gestrichen. Mein Doppelbett war verschwunden, an seiner Stelle standen jetzt ein wunderhübsches weißes Gitterbettchen und ein schmales Einzelbett im Zimmer. Die Poster waren abgenommen, meine alten Bücher wie auch die Fotos von meinen Freunden in Kisten verpackt.
Ich starrte auf die Kartons, die sich in der hinteren Ecke des Zimmers auf dem Fußboden stapelten. Darin steckten meine ganze Kindheit und Jugend. Meine Persönlichkeitsentwicklung. Lächelnd trat ich darauf zu.
Etwa eine Stunde später hatte ich mehrere Kartons mit Kleidern für die Wohlfahrt aussortiert und beiseitegestellt. Dad war zwischenzeitlich nach Hause gekommen und hatte kurz im Zimmer vorbeigeschaut, um hallo zu sagen und mir eine Tasse Tee und einen Keks zu bringen. Nun riss ich gerade einen Karton auf, der so schwer war, dass er nur Bücher enthalten konnte.
Es waren tatsächlich einige Bücher darin, aber darüber hinaus entdeckte ich auch noch meine alten Tagebücher. Mein Herz klopfte schneller bei ihrem Anblick, und ich nahm sie heraus, um sie beiseitezulegen. Ich hatte nicht die geringste Absicht, sie zu lesen. Niemals. Ich legte sie gerade auf den »Behalten«-Stapel, als zwischen den Seiten eines der Bücher, eines schwarz eingebundenen Notizbuchs aus meiner Teenagerzeit, ein Foto herausrutschte.
Jetzt klopfte mein Herz nicht mehr.
Es hämmerte.
Acht Jahre zuvor
Meine Englischlehrerin hatte mich gebeten, nach dem Unterricht noch kurz zu bleiben. Sie wollte mir vorschlagen, eine meiner Kurzgeschichten bei einem Wettbewerb einzureichen. Die bloße Vorstellung jagte mir eine Riesenangst ein: meine Geschichte … veröffentlicht, so dass alle möglichen fremden Leute sie lesen und darüber urteilen konnten, ob sie gut oder schlecht war? Nein danke. Ohne mich.
Woran lag es dann, dass ich mich, als ich wenig später aus dem Haupteingang in Richtung Tor lief, am liebsten in den Hintern gebissen hätte? Ich schaute mich um. Außer mir war fast keiner mehr da. Ich hatte den Bus verpasst. Wie es aussah, würde ich zu Fuß nach Hause gehen müssen.
Ich ließ den Kopf hängen und seufzte schwer.
Warum hatte ich nein gesagt? Wenn sie glaubte, dass meine Geschichte gut genug für den Wettbewerb war, hätte ich ihr einfach vertrauen sollen. Verdammter Mist. Manchmal war es wirklich lästig, so schüchtern zu sein. Immer öfter fragte ich mich, wieso ich das nicht irgendwie abstellen konnte. So jedenfalls konnte es nicht weitergehen.
Frustriert trat ich durchs Schultor. Mein Blick fiel auf drei ältere Jungs, die einen Fußball gegen die Schulmauer kickten und sich dabei unterhielten. Einen von ihnen erkannte ich wieder.
Marco.
Ich kannte seinen Nachnamen nicht, weil er in der Elften war und ich in der Neunten. Ich wusste überhaupt nur deshalb, wer er war, weil er so beliebt war, dass sein Name auch in den unteren Klassen die Runde machte. Und weil man ihn nur schwer übersehen konnte. Ziemlich groß. Ziemlich gutaussehend. Ich hatte gehört, dass er Ausländer war, aber es kursierten so viele Gerüchte über ihn, dass ich keine Ahnung hatte, was man glauben konnte und was nicht.
Hastig drehte ich mich weg, damit er nicht bemerkte, wie ich ihn angestarrt hatte. Ich wandte mich nach links und machte mich auf den Weg nach Hause. Ich war ungefähr vier Meter weit gekommen, als ich meine Schritte verlangsamte.
Ein Stück vor mir ging Jenks mit seiner Clique. Sie rauchten, lachten, grölten herum und warfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf. Sie waren in meinem Jahrgang. In der Siebten hatten wir noch im Klassenverband Unterricht gehabt. Das war anders, seit wir unsere Fächer selbst wählen konnten. Meine Freundinnen und ich waren gut in der Schule und hatten keine Lust, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Seit der Siebten hatten Jenks und seine Clique es deswegen auf uns abgesehen. Anfangs hatte es sich auf die Zeit während der Schule beschränkt – sie hatten uns »Strebersau«, »Arschkriecher-Tussi« oder »Opfer« hinterhergerufen. Doch seit einiger Zeit beschimpften sie uns auch beim Einsteigen in den Bus oder in den Pausen auf den Gängen, weil sie im Unterricht nicht mehr an uns herankamen. Ihre Beschimpfungen waren mit der Zeit immer widerlicher und gemeiner geworden.
Ich sah nach rechts und links, um sicherzugehen, dass keine Autos kamen, dann lief ich auf die andere Straßenseite, um den Jungs aus dem Weg zu gehen.
Leider hatte Jenks andere Pläne.
Er brüllte laut meinen Namen. Ich blieb stehen und starrte auf meine Füße.
Als wüsste mein Herz etwas, das ich nicht wusste, begann es hart gegen meine Rippen zu schlagen.
Ich hob den Kopf und erschrak, als ich sah, wie Jenks feixend über die Straße auf mich zuhielt. Er hatte seine beiden Freunde im Schlepptau. Sie hatten dasselbe dreckige Grinsen im Gesicht wie er.
»Na, was geht, Strebersau?« Jenks verstellte mir den Weg, und ich versuchte mich an ihm vorbeizudrücken.
Er packte mich am Arm und hielt mich zurück.
Ich bemühte mich, keine Angst zu zeigen, als er mir ganz nahe kam und sein Blick über meinen Körper glitt, so dass mir schlecht davon wurde. »Ich hab dich gefragt, was geht, Strebersau.«
»Nichts.« Ich schüttelte den Kopf und versuchte mich ihm zu entziehen, aber die drei umringten mich. »Ich komm zu spät nach Hause.« Ich wünschte, meine Stimme hätte mehr Kraft. Ich wünschte, ich könnte ihnen mal so richtig die Meinung sagen oder sie verprügeln oder einfach nur irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht länger dachten, ich wäre leichte Beute für sie.
»Wir wollen uns bloß ein bisschen unterhalten.« Jenks grinste mich an. »Du bist so eine arrogante Schlampe. Aber das warst du ja schon immer.«
Jenks’ Kumpel Aaron boxte ihn in den Arm. »Aber ein geiles Gestell. Ich würd die sofort nageln.«
Ich wurde blass und wich einen Schritt zurück.