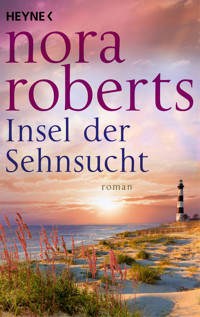
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein furchtbares Geheimnis dich einholt
Trotz der aufkeimenden Liebe zu Nathan, ihrem Freund aus Jugendtagen, hat die junge Fotografin Jo keine Augen für die Schönheit der Insel Desire, auf der sie aufgewachsen ist. Anonym werden ihr beängstigende Fotos zugestellt, die beunruhigende Schatten der Vergangenheit heraufbeschwören. Wieder kommen die Konflikte ihrer Familie ans Tageslicht, und Jo muss sich erneut mit dem Trauma ihrer Kindheit auseinandersetzen: Eines Nachts war ihre Mutter spurlos verschwunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Die erfolgreiche Fotografin Jo Hathaway hat ihr Leben fest im Griff – jedenfalls bis zu dem Tag, als sie in ihrer post anonyme Fotos findet: Schnappschüsse und Nahaufnahmen von ihr selbst. sie ist zutiefst beunruhigt – wer konnte ihr unbeobachtet so nahe Kommen und diese Bilder machen? Als dann auch noch Fotos einer wunderschönen, nackten, toten Frau geschickt werden, bricht Jo zusammen – diese Frau war ihre Mutter.
Jo war noch ein kleines Mädchen, als ihre Mutter eines Nachts spurlos verschwand. Der schmerzliche Verlust entzweite und zerstörte die Familie Hathaway Daraufhin floh Jo, wild entschlossen, ihre Familie und ihr Elternhaus nie mehr wieder zu sehen.
Widerstrebend beschließt sie nun, wegen dieser Fotos nach Hause zu fahren, um dort die Antwort auf ihre Fragen zu finden. Ihr Elternhaus auf der wildromantischen Insel Desire ist mittlerweile ein kleines Hotel, das ihr Bruder führt. Die Begegnung mit den Geschwistern und dem Vater führt erneut zu geschwisterlichen Rivalitäten, Eifersüchteleien, Schmerz und Bitterkeit.
Aber auch auf Desire ist Jo nicht sicher; wieder tauchen Fotos auf. Jos Freund aus Kindertagen, der Architekt Nathan Delaney, steht ihr zur Seite und aus Zuneigung wird schnell Liebe. Nathan aber scheint nicht nur über die Geheimnisse von Jos Seele Bescheid zu wissen... In der Konfrontation mit dem Mörder muß Jo schließlich ihrer eigenen, tragischen Vergangenheit stellen...
Die Autorin
Nora Roberts, geboren in Maryland, zählt zu den erfogreichsten Autorinnen Amerikas. Für ihre mehr als 150 in über 30 Sprachen übersetzten internationalen Bestseller erhielt sie nicht nur zahlreiche Auszeichnungen sonder auch die Ehre als erste Frau in die Ruhmeshalle der Romance Writers of America aufgenommen zu werden.
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Von Wind und Wetter geschüttelt komme ich zurück … Mein Körper ein Sack voller Knochen, gebrochen …
JOHN DONNE
Eins
Sie träumte von Sanctuary. Im Mondlicht erstrahlte das große Haus leuchtend weiß. Majestätisch auf einer Anhöhe gelegen, herrschte es wie eine Königin auf ihrem Thron über die Dünen im Osten und das Marschland im Westen. Das Haus, ein prachtvolles Denkmal menschlichen Hochmuts und Glanzes, ragte schon mehr als ein Jahrhundert nahe den Schatten des Waldes immergrüner Eichen auf, wo der Fluß in düsterem Schweigen dahinglitt.
Im Schutz der Bäume blinkten goldene Feuerfliegen, und die Tiere der Nacht erwachten zum Leben, bereit, zu jagen oder gejagt zu werden. Im Schatten, im Verborgenen, lauerte die Gefahr.
Kein Lichtstrahl erhellte die schmalen, hohen Fenster von Sanctuary. Kein Lichtstrahl fiel über die eleganten Veranden, die weiten Türen. Es herrschte tiefe Nacht, und vom Meer drang ihr feuchter Atem hoch. Die einzigen Geräusche, die die Dunkelheit zerrissen, waren der Wind im raschelnden Laub der hohen Eichen und das trockene Knacken der Palmwedel, die wie knochige Finger aneinanderschlugen. Die weißen Säulen bewachten die breite Veranda wie Soldaten, aber niemand öffnete ihr zur Begrüßung die mächtige Tür.
Bei jedem Schritt knirschten Sand und Muscheln unter ihren Füßen. Sie näherte sich dem Haus. Glockengeläut erklang im Wind, kurze Tonfolgen eines Liedes. Die Hollywood-Schaukel quietschte in ihren Ketten, aber niemand räkelte sich in ihr, um die Nacht und den Anblick des Mondes zu genießen.
In der Luft lag der Duft von Jasmin und Moschusrosen, noch verstärkt durch den Salzgeruch des Meeres. Allmählich hörte sie jetzt auch dies, das leise und stete Heranrollen des Wassers, das sich über Sand ergoß und sich dann wieder in sein eigenes Herz zurückzog.
Der Rhythmus, der beständige und geduldige Schlag, erinnerte alle Bewohner der Insel Lost Desire daran, daß das Meer jederzeit das Land samt allem, was sich darauf befand, zurückfordern konnte.
Und dennoch verspürte sie bei diesem Geräusch Freude; es war der Klang ihres Zuhauses und ihrer Kindheit. Damals war sie so frei und ungebunden wie ein Reh durch den Wald gelaufen, hatte die Sümpfe erkundet, war in jugendlicher Unbekümmertheit über die weißen Strände gerannt.
Jetzt war sie kein Kind mehr – und wieder zu Hause.
Mit schnellen Schritten nahm sie die Stufen, eilte über die Veranda und umschloß mit ihrer Hand den dicken Messingknauf, der wie ein verlorener Schatz glänzte.
Die Tür war verschlossen.
Sie drehte den Knauf nach rechts und nach links, stemmte sich gegen die schwere Mahagonifüllung. Laß mich rein, dachte sie, und das Herz begann in ihrer Brust zu hämmern. Ich bin zurück nach Hause gekommen. Ich bin wieder da.
Aber die Tür blieb verschlossen. Sie drückte ihr Gesicht gegen die hohen Glasscheiben daneben, aber drinnen herrschte undurchdringliche Dunkelheit.
Angst überkam sie.
Jetzt rannte sie – um das Haus herum, über die Terrasse, wo Blumen aus den Töpfen quollen und die Lilien eine farbenprächtige Revue aufführten. Die Musik des Glockenspiels verwandelte sich in einen harschen Mißklang, das Rauschen der Palmwedel in warnendes Zischen. Sie nahm den Kampf mit der nächsten Tür auf; weinend hämmerte sie mit den Fäusten auf sie ein.
Bitte, bitte, laß mich rein. Ich möchte zurück, zurück nach Hause.
Schluchzend stolperte sie den Gartenweg entlang. Sie wollte auf die Rückseite des Hauses, zur gazebespannten Schwingtür der hinteren Veranda. Sie war nie verschlossen – Mama war der Ansicht, daß eine Küche Besuchern immer offenstehen solle.
Aber sie konnte die Tür nicht finden. Dicht an dicht erhoben sich vor ihr die mächtigen Bäume; Zweige und herabhängende Flechten versperrten ihr den Weg.
Sie hatte sich verirrt. In ihrer Verwirrung stolperte sie über Wurzeln. Die Bäume bildeten mit ihren Ästen einen Baldachin, den der Mond nicht durchdringen konnte, und verzweifelt versuchte sie, in der Finsternis etwas zu erkennen. Der Wind frischte auf, heulte und versetzte ihr strafende Schläge mit flacher Hand. Die Palmwedel hieben wie Schwerter auf sie ein. Sie drehte sich um, doch da, wo zuvor der Weg gewesen war, verlief nun der Fluß und trennte sie von Sanctuary. Das hohe Gras am schlüpfrigen Ufer wogte wild hin und her.
In diesem Moment sah sie sich selbst, weinend und allein am anderen Ufer.
Und in diesem Moment wußte sie, daß sie tot war.
Jo kämpfte sich den Weg aus dem Traum. Als sie am Ende des Tunnels auftauchte, spürte sie beinahe noch seine scharfen Kanten auf ihrer Haut. Ihre Lungen schmerzten, und ihr Gesicht war naß von Schweiß und Tränen. Mit zitternder Hand tastete sie nach der Nachttischlampe und stieß in ihrer Hast, der Dunkelheit zu entfliehen, ein Buch und den überquellenden Aschenbecher zu Boden.
Als das Licht endlich brannte, zog sie die Knie an die Brust, umschlang sie mit den Armen und schaukelte sacht, um sich zu beruhigen.
Es ist ja nur ein Traum, sagte sie sich. Nur ein böser Traum.
Sie war zu Hause, in ihrem eigenen Bett, in ihrer Wohnung, Meilen entfernt von der Insel, auf der Sanctuary stand. Eine erwachsene Frau von siebenundzwanzig Jahren sollte sich nicht von einem albernen Traum verrückt machen lassen.
Aber sie zitterte noch, als sie nach einer Zigarette griff. Erst nach drei Anläufen gelang es ihr, das Streichholz zu entzünden.
Viertel nach drei zeigte der Wecker auf dem Nachttisch. Es wurde fast zu einer Gewohnheit. Dabei gab es nichts Schlimmeres, als um drei Uhr morgens nervös wachzuliegen. Sie streckte die Beine aus dem Bett und bückte sich nach dem umgekippten Aschenbecher. Die Schweinerei wollte sie erst am Morgen beseitigen. Sie saß auf der Bettkante, das übergroße T-Shirt bauschte sich über ihren Schenkeln, und sie zwang sich zur Ruhe.
Sie hatte keine Ahnung, warum sie ihre Träume zurück auf die Insel Lost Desire führten, zurück zu dem Haus, das sie mit achtzehn verlassen hatte. Aber die anderen Symbole, dachte Jo, konnte wohl jeder Psychologie-Student im ersten Semester deuten. Das Haus war verschlossen, weil sie bezweifelte, daß irgend jemand sie mit offenen Armen begrüßen würde, falls sie je nach Hause zurückging. Erst neulich hatte sie darüber nachgedacht und sich gefragt, ob sie den Weg überhaupt noch finden würde.
Sie war nun fast im Alter ihrer Mutter, als sie damals die Insel verlassen hatte. Als sie einfach verschwunden war und ihren Mann mit den drei Kindern zurückgelassen hatte, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen.
Hat Annabelle jemals davon geträumt, nach Hause zurückzukehren und vor einer verschlossenen Tür zu stehen, fragte sich Jo.
Sie wollte nicht weiter darüber nachdenken, sich nicht mehr an die Frau erinnern, die ihr zwanzig Jahre zuvor das Herz gebrochen hatte. Jo ermahnte sich, daß sie inzwischen längst darüber hinweg sein sollte. Sie konnte ohne ihre Mutter leben, ohne Sanctuary und ihre Familie. Sie hatte es geschafft – zumindest beruflich.
Geistesabwesend tippte sie die Asche von der Zigarette und schaute sich in ihrem Schlafzimmer um. Es war einfach und praktisch eingerichtet. Trotz ihrer vielen weiten Reisen gab es nur wenige Souvenirs. Außer den Fotos natürlich. Sie hatte die Schwarzweißabzüge mit Passepartouts versehen, gerahmt und diejenigen, die sie am beruhigendsten fand, in dem Raum aufgehängt, in dem sie schlief
Hier eine leere Parkbank mit schwarzem schnörkeligen Eisengestell. Und dort eine einsame Weide, deren filigranes Laub sich wie ein Spitzenschleier über einen spiegelglatten Teich ergoß. Der Garten im Mondschein war eine Studie in Licht und Schatten, Struktur und kontrastierenden Formen. Der menschenleere Strand mit der gerade den Horizont durchbrechenden Sonne verlockte den Betrachter regelrecht, in das Foto einzutreten und den rauhen Sand unter den Füßen zu spüren.
Sie hatte das Strand-Foto erst in der vorigen Woche aufgehängt, nachdem sie von einem Shooting in den Outer Banks von North Carolina zurückgekehrt war. Jo kam zu dem Schluß, daß sie vielleicht deshalb wieder an zu Hause gedacht hatte. Sie war nicht weit davon entfernt gewesen. Sie hätte nur noch ein kleines Stück in Richtung Süden nach Georgia fahren und dann auf die Insel übersetzen müssen.
Es gab keine Straße nach Desire, keine Brücke führte über den Sund.
Aber sie war nicht nach Süden gefahren. Sie hatte den Auftrag abgeschlossen und war nach Charlotte zurückgekehrt, um sich wieder in ihre Arbeit zu vergraben.
Und in ihre Alpträume.
Sie drückte die Zigarette aus und stand auf. Sie wußte, daß sie nicht mehr einschlafen würde, also schlüpfte sie in ihre Jogginghose. Die Arbeit in der Dunkelkammer würde sie auf andere Gedanken bringen.
Wahrscheinlich bin ich wegen des Buchprojekts so nervös, sagte sie sich, während sie das Schlafzimmer verließ. Es war ein riesiger Schritt in ihrer Karriere. Obwohl sie nie an ihren Arbeiten gezweifelt hatte, war das Angebot eines großen Verlagshauses, eine Auswahl ihrer Fotos zu einem Bildband zusammenzustellen, doch ziemlich unerwartet gekommen.
Naturstudien von Jo Ellen Hathaway, dachte sie, als sie sich in der kleinen Kochnische einen Kaffee machte. Nein, das klang nach einem wissenschaftlichen Projekt. Blicke ins Leben? Hochtrabend.
Sie lächelte flüchtig, strich ihr rotes Haar zurück und gähnte. Am besten machte sie nur die Aufnahmen und überließ die Auswahl des richtigen Titels den Experten.
Sie konnte sehr wohl unterscheiden, wann sie sich besser im Hintergrund hielt und wann es galt, Stellung zu beziehen. Eines von beiden hatte sie die meiste Zeit ihres Lebens getan. Vielleicht würde sie ja ein Exemplar des Buches nach Hause schicken. Was würde ihre Familie wohl davon halten? Würde der Bildband eines der Beistelltischchen zieren, wo ein Übernachtungsgast darin blättern und sich fragen konnte, ob Jo Ellen Hathaway wohl irgendwie mit den Hathaways verwandt war, die die Pension führten?
Würde ihr Vater es überhaupt aufschlagen und erkennen, was sie in all den Jahren gelernt hatte? Oder würde er nur die Achseln zucken, das Buch ungeöffnet beiseite legen und zu einem Spaziergang über seine Insel aufbrechen? Über Annabelles Insel.
Es war unwahrscheinlich, daß er heute noch an seiner ältesten Tochter interessiert sein würde. Und es war dumm von dieser Tochter, dieser Frage jetzt noch Bedeutung beizumessen.
Mit einem Achselzucken vertrieb Jo ihre Gedanken und nahm einen blauen Becher vom Haken. Während sie wartete, daß der Kaffee du chlief, lehnte sie sich an die Arbeitsplatte und schaute aus dem kleinen Küchenfenster hinaus.
Immerhin hatte es ein paar Vorteile, um drei Uhr morgens auf den Beinen zu sein. Das Telefon klingelte nicht. Niemand kam vorbei, niemand faxte ihr, niemand erwartete etwas von ihr. Und wenn sich ihr Magen nervös verkrampfte und ihr Kopf schmerzte, dann bekam das außer ihr selbst niemand mit.
Die Straßen jenseits des Küchenfensters waren dunkel und leer und feucht vom spätwinterlichen Regen. Eine Straßenlaterne warf eine kleine Lichtpfütze – einsames Licht, dachte Jo. Niemand sonnte sich darin. Die Einsamkeit barg so viele Rätsel. So unendlich viele Möglichkeiten.
Sie verspürte den Drang, den solche Szenen bei ihr oft auslösten. Sie ignorierte den Duft des frischen Kaffees, griff nach ihrer Nikon und schlüpfte barfuß hinaus in die frostige Nacht, um die ausgestorbene Straße zu fotografieren.
Das beruhigte sie wie nichts sonst. Mit der Kamera in der Hand und einem Bild im Kopf konnte sie alles andere vergessen. Mit bloßen Füßen patschte sie durch die eiskalten Pfützen und experimentierte mit verschiedenen Blickwinkeln. Ärgerlich und doch abwesend schüttelte sie ihr Haar nach hinten. Hätte sie es schneiden lassen, würde es ihr jetzt nicht ständig ins Gesicht hängen.
Sie machte fast ein Dutzend Aufnahmen, bevor sie zufrieden war. Als sie sich umdrehte, wanderte ihr Blick nach oben. Sie stellte fest, daß in ihrer Wohnung alle Lichter brannten. Es war ihr nicht aufgefallen, daß sie für den kurzen Weg vom Schlafzimmer in die Küche so viele angemacht hatte.
Mit geschürzten Lippen überquerte sie die Straße und veränderte erneut die Brennweite. Sie ging in die Hocke und richtete die Kamera nach oben, um die erleuchteten Fenster in dem dunklen Gebäude einzufangen. Höhle einer Schlaflosen, dachte sie. Mit einem leisen Lachen, das so unheimlich hallte, daß sie erschauderte, ließ sie die Kamera sinken.
Gott, vielleicht war sie ja verrückt. Würde eine normale Frau um drei Uhr morgens, nur spärlich bekleidet und vor Kälte zitternd, Fotos von ihren eigenen Fenstern machen?
Sie rieb sich die brennenden Augen und wünschte sich sehnlichst das einzige, das sich ihr immer zu entziehen schien. Normalität.
Dafür brauchst du Schlaf, dachte sie. Mehr als einen Monat hatte sie schon nicht mehr durchgeschlafen. Du mußt regelmäßig essen. Sie hatte in den vergangenen Wochen fünf Kilo abgenommen, und ihre lange Gestalt wirkte bereits knochig. Deine Gedanken müssen endlich zur Ruhe kommen. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals darauf Wert gelegt zu haben. Freunde? Sicher hatte sie Freunde, aber niemanden, der ihr so nahe stand, daß sie ihn mitten in der Nacht hätte anrufen können, um sich trösten zu lassen.
Familie. Nun, sie hatte eine Familie. Einen Bruder und eine Schwester, deren Leben sich von ihrem getrennt hatten. Einen Vater, der für sie fast ein Fremder war. Eine Mutter, von der sie seit zwanzig Jahren nichts mehr gehört oder gesehen hatte.
Nicht meine Schuld, machte sich Jo klar, als sie die Straße überquerte. Es war Annabelles Schuld. Alles war anders geworden, nachdem Annabelle Sanctuary den Rücken gekehrt und ihre vollkommen fassungslose Familie zerstört und mit gebrochenen Herzen zurückgelassen hatte. Das Dumme war, so sah Jo es, daß die anderen niemals darüber hinweggekommen waren. Sie schon.
Sie war nicht auf der Insel geblieben, um jedes Sandkorn zu bewachen, wie es ihr Vater tat. Sie hatte ihr Leben nicht darauf ausgerichtet, Sanctuary in Schuß zu halten, wie es ihr Bruder Brian tat. Und sie hatte sich nicht in alberne Phantasien und schnelle Abenteuer gestürzt wie ihre Schwester Lexy.
Statt dessen hatte sie studiert, gearbeitet und sich ihr eigenes Leben aufgebaut. Und wenn sie jetzt etwas zittrig auf den Beinen war, dann nur, weil sie es übertrieben hatte, weil sie sich zu großem Druck ausgesetzt hatte. Sie war ein bißchen ausgepumpt, nichts weiter. Ein paar Vitamine, und schon wäre sie wieder fit.
Vielleicht sollte ich mal Urlaub machen, dachte Jo, als sie den Schlüsselbund aus ihrer Tasche kramte. Es war schon drei – nein, sogar vier – Jahre her, daß sie ganz privat, ohne einen Foto-Auftrag in der Tasche, verreist war. Vielleicht Mexiko oder die Karibik. Irgendwo, wo es gemächlicher zuging und die Sonne schien. Einfach mal einen Gang runterschalten und zur Ruhe kommen. So würde sie den kleinen Durchhänger überwinden.
Als sie in die Wohnung kam, trat sie auf einen kleinen, quadratischen Briefumschlag, der auf dem Boden lag. Einen Moment lang stand sie wie angewurzelt da und starrte, eine Hand an der Türklinke, die andere um die Kamera gelegt, auf den Umschlag.
War er schon dagewesen, als sie die Wohnung verlassen hatte? Warum lag er direkt hinter der Tür? Der erste war vor einem Monat angekommen, zwischen ihrer gewöhnlichen Post, nur mit ihrem Namen in Druckbuchstaben darauf.
Ihre Hände begannen wieder zu zittern, als sie sich befahl, die Tür zu schließen und den Schlüssel herumzudrehen. Ihr Atem stockte, aber sie bückte sich und hob ihn auf. Vorsichtig legte sie die Kamera ab und öffnete den Umschlag.
Als sie den Inhalt herausnahm, gab sie ein langgezogenes, leises Stöhnen von sich. Das Foto war sehr professionell aufgenommen und auf Standardformat zurechtgeschnitten. Wie die anderen drei. Die Augen einer Frau, schwere Lider, mandelförmig, mit langen Wimpern und fein geschwungenen Brauen. Jo wußte, daß sie blau waren, tiefblau, denn es waren ihre Augen. Blankes Entsetzen spiegelte sich in ihnen.
Wann war das Foto entstanden? Wie und warum? Fassungslos schlug sie die Hand vor den Mund, starrte auf die Aufnahme und wußte, daß in diesem Moment der Ausdruck ihrer Augen perfekt mit dem auf dem Foto übereinstimmte. Panik überkam sie. Sie rannte quer durch die Wohnung in das kleine Gästezimmer, das sie als Dunkelkammer eingerichtet hatte. Hektisch riß sie eine Schublade auf, durchwühlte den Inhalt und stieß schließlich auf die Umschläge, die sie dort vergraben hatte. In jedem steckte eine andere Schwarzweißaufnahme, zehn mal fünfzehn Zentimeter groß.
In ihren Ohren pochte das Blut, als sie die Abzüge nebeneinanderlegte. Auf dem ersten waren die Augen geschlossen, als wäre sie im Schlaf fotografiert worden. Die beiden nächsten zeigten Schritt für Schritt das Erwachen. Die Lider ganz leicht geöffnet, nur einen Hauch der Iris zeigend. Auf dem vierten waren die Augen ganz offen, aber unscharf und umwölkt.
Sie hatten sie verunsichert, ja sogar nervös gemacht, als sie sie in ihrer Post gefunden hatte. Aber sie hatten ihr keine Angst eingejagt.
Und jetzt die letzte Aufnahme. Genau auf ihre Augen gerichtet. Auf ihre hellwachen, schreckerfüllten Augen.
Jo trat zurück und erschauderte. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben. Warum nur die Augen? fragte sie sich. Wie war ihr jemand so nah gekommen, ohne daß sie es gemerkt hatte? Wer auch immer es gewesen war, er mußte eben unmittelbar auf der anderen Seite ihrer Wohnungstür gestanden haben.
Erneut von Panik ergriffen, rannte sie in die Diele und überprüfte hektisch die Türschlösser. Ihr Herz hämmerte gegen die Rippen, als sie sich mit dem Rücken gegen die Tür fallen ließ. Dann wurde sie wütend.
Mistkerl, dachte sie. Er wollte sie terrorisieren. Er wollte, daß sie sich in ihrer Wohnung verkroch, beim Anblick ihres eigenen Schattens in Panik geriet und aus lauter Angst, daß er sie beobachten könnte, keinen Schritt mehr vor die Tür wagte. Sie, die in ihrem ganzen Leben nie Angst gehabt hatte, war ihm ausgeliefert.
Sie war allein in fremden Städten unterwegs gewesen, auf belebten Straßen und in einsamen Gassen, sie hatte Berge bestiegen und Urwälder durchquert. Mit ihrer Kamera als Schutzschild hatte sie nie eine Spur von Angst empfunden. Und jetzt zitterten ihre Knie wie Wackelpudding – nur wegen einer Handvoll Fotos.
Die Angst hatte sich langsam aufgebaut, das gestand Jo sich jetzt ein. Sie war in den letzten Wochen größer geworden, hatte sich in ihr vorangebohrt, nach und nach. Jo fühlte sich hilflos, ausgeliefert, so verdammt allein.
Sie riß sich von der Tür los. So wollte, konnte sie nicht leben. Sie würde es einfach ignorieren, verdrängen. Es tief in sich vergraben. Und sie war weiß Gott eine Expertin im Verdrängen von Traumata, kleinen oder großen. Und dies hier war nur eines mehr.
Sie würde ihren Kaffee trinken und sich an die Arbeit machen.
Gegen acht hatte sie den ganzen Kreislauf passiert: Sie hatte sich durch die Müdigkeit gekämpft, war durch nervöse Energie und schöpferische Ruhe geglitten, um wieder bei der Müdigkeit zu landen.
Sie konnte nicht mechanisch arbeiten, noch nicht einmal bei den einfachsten Handgriffen in der Dunkelkammer. Es war ihr wichtig, jeden Schritt mit voller Aufmerksamkeit zu erledigen. Und dazu mußte sie ruhig sein, mußte sie sowohl die Wut als auch die Angst in den Griff bekommen. Bei ihrer ersten Tasse Kaffee redete sie sich ein, den Sinn der Fotos erkannt zu haben. Jemand bewunderte ihre Arbeiten und wollte ihre Aufmerksamkeit erwecken, wollte ihren Einfluß für sein eigenes Werk nutzen.
Das machte Sinn.
Manchmal hielt sie Vorträge oder leitete Workshops. Außerdem hatte sie in den vergangenen drei Jahren drei größere Ausstellungen gehabt. Es war nicht sonderlich schwierig oder ungewöhnlich, ein Foto von ihr zu machen – oder mehrere.
Das war sicher eine Erklärung.
Wer auch immer es war, er war einfach nur kreativ. Er hatte den Augenbereich vergrößert, zurechtgeschnitten und ihr die Fotos als eine Art Serie geschickt. Obwohl die Abzüge aussahen, als seien sie erst kürzlich gemacht worden, gaben sie keinerlei Aufschluß darüber, wann oder wo genau die Aufnahmen entstanden waren. Die Negative konnten ein Jahr alt sein. Oder zwei. Oder fünf.
Definitiv hatten sie ihre Aufmerksamkeit geweckt, aber sie hatte überreagiert, es zu persönlich genommen.
In den letzten Jahren hatte sie immer wieder Arbeitsproben von Bewunderern ihrer Bilder bekommen. Normalerweise waren Briefe dabei, in denen ihre Fotos gelobt wurden, bevor die Absender zur Sache kamen und sie um Tips oder Unterstützung baten oder ihr ein gemeinsames Projekt vorschlugen.
Ihr beruflicher Erfolg war noch relativ jung. Sie hatte sich noch nicht an den Druck und die Zwänge gewöhnt, die der kommerzielle Erfolg und die Erwartungen mit sich brachten und die wirklich zur Last werden konnten.
Während sie ihren nervösen Magen ignorierte und den inzwischen eiskalten Kaffee schlürfte, gestand Jo sich ein, daß sie nie gelernt hatte, mit diesem Erfolg umzugehen.
Ich hätte alles viel besser im Griff, dachte sie und ließ den hämmernden Kopf über ihren schmerzenden Schultern kreisen, wenn mich die anderen in Ruhe das machen ließen, was ich am besten kann.
In ihrer Dunkelkammer hingen feuchte Abzüge zum Trocknen. Sie hatte den letzten Stapel Negative entwickelt und legte einen Kontaktbogen unter die Lampe auf ihrer Arbeitsplatte. Mit einer Lupe studierte sie Bild für Bild.
Einen Moment lang fühlte sie Panik und Enttäuschung. Die Bilder waren allesamt unscharf, verschwommen. Verdammt, verdammt, wie konnte das sein? War es der ganze Film? Sie bewegte sich, blinzelte und sah das vergrößerte Bild von hohen Dünen und Schilf plötzlich klar werden.
Halb aufstöhnend, halb lachend lehnte sie sich zurück und ließ ihre verspannten Schultern kreisen. »Nicht die Abzüge sind verschwommen und unscharf, du Idiotin«, murmelte sie. »Es liegt an dir.«
Sie legte die Lupe weg und schloß die Augen. Sie war zu antriebslos, um sich aufzuraffen und noch einen Kaffee zu machen. Sie wußte, daß sie dringend etwas essen mußte. Und sie wußte, daß sie Schlaf brauchte. Daß sie sich hinlegen sollte, alles von sich weg schieben und sich einfach fallen lassen.
Aber davor hatte sie Angst. Im Schlaf würde ihr sogar das bißchen Kontrolle entgleiten.
Sie dachte sogar schon daran, zum Arzt zu gehen und sich etwas für ihre Nerven geben zu lassen, bevor sie endgültig durchbrannten. Aber sofort mußte sie an die Psychiater denken. Bestimmt würden sie in ihrem Hirn herumschnüffeln, es durchwühlen und Dinge ans Tageslicht zerren, die sie eigentlich vergessen wollte.
Sie würde es in den Griff bekommen. Sie hatte Übung darin, Dinge zu regeln. Oder, wie Brian immer gesagt hatte, sie verstand es perfekt, sich den Weg freizuboxen, so daß sie alles selbst regeln konnte.
Welche Wahl hatte sie, hatten sie alle gehabt, als sie allein und verlassen auf jenem verdammten Fleckchen Land mitten im Nirgendwo festsaßen?
Bei diesen Gedanken überfiel sie Wut, ganz unvermittelt und heftig. Sie erzitterte, ballte die Fäuste im Schoß und mußte sich zwingen, die hitzigen Worte hinunterzuschlucken, die sie ihrem Bruder – der nicht mal da war – am liebsten entgegengeschleudert hätte.
Müde, sagte sie sich. Sie war einfach todmüde, sonst nichts. Sie mußte ihre Arbeit beiseite legen, das Schlafmittel nehmen, das sie neulich gekauft hatte, das Telefon abstellen und schlafen. Dann würde sie sich besser fühlen. Stärker.
Als die Hand auf ihre Schulter fiel, stieß sie einen gellenden Schrei aus und warf den Kaffeebecher von sich.
»Himmel, Jo!« Bobby Banes machte einen Satz zurück und ließ die Post fallen.
»Was machst du? Was, zum Teufel, machst du hier?« Jo sprang von ihrem Hocker auf, der krachend umfiel, während Bobby sie verblüfft anstarrte.
»Ich … du hast doch gesagt, du würdest um acht anfangen. Ich bin nur ein paar Minuten zu spät.«
Um Atem ringend, griff Jo nach der Kante ihrer Arbeitsplatte, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Um acht?«
Ihr Praktikant nickte vorsichtig. Er schluckte und kam ihr nicht näher. Sie sah für seine Begriffe noch ziemlich wild und angriffslustig aus. Er arbeitete schon das zweite Semester für sie und hatte sich eingebildet, nun langsam zu wissen, wie er ihre Anweisungen zu verstehen hatte, wie er am besten mit ihren Launen klarkam und wie er vermied, sie in Rage zu bringen. Aber er hatte keine Ahnung, wie er mit der brennenden Angst in ihrem Blick umgehen sollte.
»Warum, zum Teufel, hast du nicht angeklopft?« fuhr sie ihn an.
»Hab’ ich doch. Und als du dich nicht gerührt hast, dachte ich mir schon, daß du hier hinten in der Dunkelkammer bist, also hab’ ich mit dem Schlüssel aufgeschlossen, den du mir gegeben hast, als du neulich für den Auftrag unterwegs warst.«
»Gib ihn mir zurück. Sofort.«
»Klar, Jo.« Den Blick unverwandt auf sie gerichtet, kramte er in der Tasche seiner modisch verwaschenen Jeans. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Jo zwang sich zur Ruhe und griff nach dem Schlüssel. Die Angst ließ jetzt etwas nach, und die Sache war ihr eher peinlich. Um etwas Zeit zu gewinnen, bückte sie sich und stellte den umgekippten Schemel wieder auf. »Tut mir leid, Bobby. Du hast mir einen Mordsschreck eingejagt. Ich hab’ dich nicht klopfen hören.«
»Schon in Ordnung. Soll ich dir noch einen Kaffee holen?«
Sie schüttelte den Kopf und gab ihren zitternden Knien nach. Als sie sich auf den Schemel fallen ließ, zwang sie sich zu einem Lächeln. Er war ein guter Schüler – ein bißchen eingebildet wegen seiner Arbeiten, aber er war erst einundzwanzig.
Was sein Äußeres betraf, machte er einen auf Kunststudent: dunkelblonder, schulterlanger Pferdeschwanz und einen einzelnen goldenen Ohrring, der sein langes, schmales Gesicht betonte. Seine Zähne waren perfekt. Seine Eltern waren wohl Anhänger der Kieferorthopädie, dachte sie, während sie die Zunge über ihren leichten Überbiß gleiten ließ.
Aber er hatte ein gutes Auge und eine Menge Talent. Deswegen arbeitete er schließlich bei ihr. Jo war immer bereit zurückzuzahlen, was sie selbst bekommen hatte.
Weil seine großen braunen Augen sie noch immer argwöhnisch musterten, bemühte sie sich um ein etwas netteres Lächeln. »Ich hatte eine schlechte Nacht.«
»Sieht man.« Auch er unternahm den Versuch eines Lächelns. »Die Kunst besteht darin, zu sehen, was wirklich da ist, stimmt’s? Und du siehst wirklich erschlagen aus. Hast nicht geschlafen, was?«
Wenn Jo eines nicht war, dann eitel. Achselzuckend rieb sie ihre müden Augen. »Nicht viel.«
»Du solltest es mal mit Melatonin versuchen. Meine Mutter schwört drauf.« Er bückte sich, um die Scherben des Kaffeebechers zusammenzuklauben. »Und außerdem solltest du nicht so viel Kaffee trinken.«
Er warf ihr einen Blick zu und sah, daß sie gar nicht zuhörte. Sie ist mit den Gedanken schon wieder woanders, dachte Bobby. Wie so oft in letzter Zeit. Er sollte es besser aufgeben, seine Mentorin zu einer gesünderen Lebensweise bekehren zu wollen. Aber einen Versuch wollte er noch riskieren.
»Du hast dich wieder von Zigaretten und Kaffee ernährt, stimmt’s?«
»Ja.« Gedankenversunken und halb schlafend hing sie auf dem Schemel.
»Das Zeug wird dich noch umbringen. Und außerdem brauchst du mehr Bewegung. Du hast in den letzten Wochen fast zehn Pfund abgenommen und bist viel zu dünn für deine Größe. Bei deinen leichten Knochen neigst du zu Osteoporose. Du mußt deine Knochen und Muskeln stärken.«
»Hm-hmm.«
»Du solltest mal zum Arzt gehen. Wenn du mich fragst, hast du Anämie. Du bist ganz blaß, und in deine Tränensäcke könntest du deine halbe Ausrüstung packen.«
»Nett, daß du das bemerkt hast.«
Er hob die größten Scherben auf und warf sie in den Papierkorb. Natürlich hatte er es bemerkt. Ihr Gesicht zog die Blicke auf sich. Er hatte sie nie geschminkt gesehen. Ihr Haar trug sie meist zurückgebunden, aber jeder, der ein halbwegs gutes Auge besaß, konnte erkennen, daß sie es mit ihrem ovalen Gesicht mit den hohen Wangenknochen, den exotischen Augen und dem sinnlichen Mund besser offen tragen sollte.
Bobby fühlte, wie seine Wangen heiß wurden. Sie würde ihn auslachen, wenn sie wüßte, daß er ganz zu Beginn, als er gerade bei ihr angefangen hatte, ein bißchen in sie verknallt gewesen war. Inzwischen wußte er, daß es sowohl berufliche Bewunderung als auch körperliche Anziehung gewesen war. Über das mit der körperlichen Anziehung war er hinweg. Fast jedenfalls.
Aber kein Zweifel: Wenn sie nur das Geringste tun würde, um ihren Magnolienteint zu betonen, wenn sie nur ein bißchen Farbe auf ihren sinnlichen Mund und die länglichen Lider gegeben hätte, dann hätte sie einfach umwerfend aussehen können.
»Ich könnte dir Frühstück machen«, sagte er. »Falls du außer Schokoriegel und dem knatschigen Toast irgendwas im Haus hast.«
Jo atmete tief durch. »Nein, ist schon in Ordnung. Wir können unterwegs eine Kleinigkeit essen. Ich bin schon spät dran.«
Sie ließ sich vom Hocker gleiten und bückte sich nach der Post.
»Eigentlich könntest du dir’s doch leisten, mal ein paar Tage auszuspannen und gar nichts zu tun. Meine Mom kennt da eine tolle Fitneß-Farm in Miami.«
Seine Worte drangen nur noch als Summen an ihr Ohr. Sie hob den Umschlag auf, auf dem in säuberlichen Druckbuchstaben ihr Name stand. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Umschlag war dicker und schwerer als die anderen zuvor. Wirf ihn weg, sagte ihr der Verstand. Mach ihn nicht auf. Schau nicht rein.
Aber ihre Finger berührten schon die Klappe. Diesmal ergoß sich eine Flut von Fotos auf den Boden. Sie hob eines auf. Es war ein gut gemachter Schwarzweißabzug.
Diesmal nicht nur ihre Augen, sondern eine Ganzkörper-Aufnahme. Sie erkannte den Hintergrund – ein Park ganz in der Nähe, wo sie oft spazierenging. Ein anderes Foto zeigte sie in der Innenstadt von Charlotte, an der Bordsteinkante stehend, die Kameratasche über der Schulter.
»Hey, das ist ein tolles Bild von dir.«
Als sich Bobby bückte, um nach dem Abzug zu greifen, schlug sie nach seiner Hand und fuhr ihn an: »Finger weg. Faß bloß nichts an.«
»Jo, ich …«
»Komm mir bloß nicht zu nah.« Keuchend ließ sie sich auf alle viere fallen und durchwühlte hektisch die Abzüge. Alle zeigten sie bei ganz gewöhnlichen, alltäglichen Dingen. Mit Tüten beladen aus dem Supermarkt kommend, in ihr Auto steigend oder den Wagen verlassend.
Er ist überall, er beobachtet mich. Wo ich auch bin, was ich auch tue. Er jagt mich, dachte sie, und ihre Zähne begannen aufeinanderzuschlagen. Er jagt mich, und ich kann nichts tun. Nichts, außer …
Dann schaltete alles in ihr ab. Das Foto in ihrer Hand zitterte, als wäre eine plötzliche Bö in den Raum gefahren. Sie konnte nicht schreien. Sie schien keine Luft mehr in den Lungen zu haben.
Sie spürte ihren Körper nicht mehr.
Das Foto war brillant aufgenommen. Meisterhafter Umgang mit Licht, Schatten und Struktur. Sie war nackt, ihre Haut glänzte unwirklich. Ihr Körper war in einer Ruhepose arrangiert, das zerbrechliche Kinn nach unten gerichtet, der Kopf leicht angewinkelt. Ein Arm war über ihre Taille drapiert, der andere wie im Schlaf geschwungen oberhalb ihres Kopfes ruhend.
Aber ihre Augen waren geöffnet, ihr Blick starr. Die Augen einer Puppe. Tote Augen.
Einen Moment lang war sie wieder hilflos in ihrem Alptraum gefangen, sich selbst anstarrend und unfähig, den Weg hinaus aus dem Dunkel zu finden.
Aber selbst in ihrem Entsetzen erkannte sie die Unterschiede. Die Frau auf dem Foto hatte wallendes Haar, das ihr Gesicht wie ein Fächer umgab. Und das Gesicht war weicher, der Körper reifer als ihr eigener.
»Mama?« flüsterte sie und griff das Bild mit beiden Händen. »Mama?«
»Was ist los, Jo?« Erschüttert hörte Bobby seine eigene Stimme zittern und brechen, als er in Jos leere Augen blickte. »Was, zum Teufel, ist los?«
»Wo sind ihre Kleider?« Jo neigte den Kopf und begann, ihren Körper hin und her zu wiegen. Ihr Kopf war voller Geräusche, voller tosender, donnernder Geräusche. »Wo ist sie?«
»Nimm’s dir nicht so zu Herzen.« Bobby machte einen Schritt auf sie zu und bückte sich, um ihr das Bild aus den Händen zu nehmen.
Ihr Kopf fuhr herum. »Bleib stehen.« Das Blut schoß ihr wieder in die Wangen und färbte sie hochrot. In ihren Augen flakkerte ein seltsamer Ausdruck. »Faß mich nicht an. Faß sie nicht an.«
Erschreckt und verblüfft richtete er sich wieder auf und hob beschwichtigend die Hände. »Okay, okay, Jo.«
»Du darfst sie nicht anfassen.« Sie war kalt, so kalt. Sie schaute wieder runter auf das Foto. Es war Annabelle. Jung, unwirklich schön und so kalt wie der Tod. »Sie hätte uns nicht verlassen dürfen. Sie hätte nicht weggehen dürfen. Warum ist sie gegangen?«
»Vielleicht konnte sie nicht anders«, sagte Bobby leise.
»Nein, sie hat zu uns gehört. Wir haben sie gebraucht, aber sie hat uns nicht gewollt. Sie ist so schön.« Tränen rollten über Jos Wangen, und das Foto bebte in ihrer Hand. »Sie ist so schön. Wie eine Märchenprinzessin. Ich habe sie mir immer als Prinzessin vorgestellt. Sie hat uns verlassen. Sie hat uns verlassen und ist weggegangen. Jetzt ist sie tot.«
Ihr Blick verschwamm, ihre Haut wurde heiß. Sie drückte das Foto an ihre Brust, krümmte sich zusammen und weinte.
»Komm, Jo.« Behutsam berührte Bobby sie. »Komm mit mir. Du brauchst jetzt Hilfe.«
»Ich bin so müde«, murmelte sie und ließ sich von ihm aufheben wie ein Kind. »Ich will zurück nach Hause.«
»Okay, mach einfach die Augen zu.«
Mit dem Bild nach unten segelte das Foto sanft zu Boden, auf all die anderen Gesichter. Auf der Rückseite waren große Druckbuchstaben zu sehen.
TOD EINES ENGELS
Ihr letzter Gedanke, bevor die Dunkelheit sie umfing, war Sanctuary.
Zwei
Bei Tagesanbruch hing wie ein schwindender Traum noch Dunst in der Luft. Lichtstrahlen durchbrachen den Baldachin des Eichenlaubs und ließen den Tau glitzern. Ammern und Teichrohrsänger erwachten in ihren Nestern im dichten Geäst und sangen ihre Morgenlieder. Ein Kardinal schoß wie ein roter Blitz lautlos zwischen den Bäumen hindurch.
Er liebte diese Tageszeit. In der Morgendämmerung forderte noch niemand seine Zeit oder Energie, und er konnte allein sein, konnte seinen Gedanken nachhängen.
Brian Hathaway hatte noch nirgendwo anders als auf Desire gelebt. Und er hatte nie etwas anderes gewollt. Er war auf dem Festland gewesen und hatte Großstädte besucht. Einmal hatte er sogar spontan Urlaub in Mexiko gemacht, so daß man sagen konnte, er war schon im Ausland gewesen.
Aber Desire war, mit all seinen Vorzügen und Nachteilen, seine Heimat. In einer stürmischen Septembernacht vor dreißig Jahren war er hier geboren worden. In dem mächtigen eichenen Himmelbett, in dem er heute schlief, hatten ihn sein Vater und eine alte, Maiskolbenpfeife rauchende Schwarze, deren Eltern Haussklaven bei seinen Vorfahren gewesen waren, ans Licht der Welt geholt.
Miss Effie hieß die alte Frau, und als er noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte sie ihm oft die Geschichte seiner Geburt erzählt. Wie der Wind geheult und das Meer getost hatte, und wie seine Mutter in dem großen Haus, in dem mächtigen Bett niedergekommen war und ihn wie eine Kriegerin lachend aus ihrem Leib katapultiert hatte, direkt in die Arme seines ungeduldig wartenden Vaters.
Es war eine schöne Geschichte. Früher hatte sich Brian vorstellen können, wie seine Mutter gelacht und sein Vater gespannt darauf gewartet hatte, ihn in die Arme zu nehmen.
Jetzt war seine Mutter schon lange fort und die alte Miss Effie schon lange tot. Es war lange, lange her, daß sein Vater darauf gewartet hatte, ihn in die Arme zu nehmen.
Brian ging durch den sich allmählich lichtenden Morgennebel, unter hohen Bäumen hindurch, deren Stämme mit violetten und roten Flechten überzogen waren, durch das kühle, diffuse Licht, das die Farne und das Palmendickicht umgab. Er war ein großer, schlaksiger Mann, der in seiner Gestalt seinem Vater sehr ähnelte. Er hatte dunkles, widerspenstiges Haar, einen bräunlichen Teint und kühle blaue Augen. Frauen fanden sein schmales Gesicht melancholisch und sehr anziehend. Sein Mund war entschlossen und eher grüblerisch als fröhlich.
Und das fanden die Frauen ebenfalls anziehend – die Herausforderung, diese Lippen zu einem Lächeln zu bewegen.
Die fast unmerkliche Veränderung des Lichts verriet ihm, daß es Zeit war, nach Sanctuary zurückzukehren. Er mußte den Gästen Frühstück machen.
Brian fühlte sich in der Küche ebenso wohl wie im Wald. Auch das war ein Punkt, den sein Vater sehr seltsam fand. Und Brian hatte schon das eine oder andere Mal amüsiert bemerkt, daß sich Sam Hathaway fragte, ob sein Sohn wohl schwul sei. Denn wenn ein Mann kochte, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, konnte schließlich mit ihm irgendwas nicht stimmen.
Wenn es ihre Art gewesen wäre, offen über solche Dinge zu sprechen, hätte Brian ihm gesagt, daß er durchaus Spaß daran hatte, perfekte Baisers zuzubereiten, und beim Sex trotzdem Frauen bevorzugte. Aber er neigte nun mal nicht zu Vertraulichkeiten.
Und lag dieser Wunsch, andere Menschen auf Distanz zu halten, nicht in der Familie?
Brian bewegte sich im Wald so leise wie das Rotwild, das dort zu Hause war. Er entschied sich für den längeren Weg, der ihn am Half Moon Creek vorbeiführte, wo der Nebel wie weißer Rauch vom Wasser aufstieg und drei Hirschkühe gemächlich in der morgendlichen Stille ästen.
Es ist noch Zeit, dachte Brian. Auf Desire war immer Zeit. Er ließ sich auf einem umgestürzten Baumstamm nieder, um den Anblick der mit Morgentau bedeckten Blüten zu genießen.
Die Insel war an der weitesten Stelle nur zwei Meilen breit und weniger als dreizehn Meilen lang. Brian kannte jeden Zentimeter: den sonnengebleichten Sand der Strände, die kühlen, schattigen Sümpfe mit den urzeitlich wirkenden, behäbigen Alligatoren. Er liebte die weich geformten Dünen, die herrlich feuchten, wogenden, von jungen Kiefern und majestätischen Eichen gesäumten Wiesen.
Aber am meisten liebte er den Wald mit seinen dunklen Tiefen und Geheimnissen.
Er kannte die Geschichte der Insel und wußte, daß hier einst Baumwolle und Indigopflanzen angebaut, die Felder von Sklaven bestellt worden waren. Seine Vorfahren hatten auf diese Weise ein Vermögen gemacht. Die Reichen hatten dieses entlegene kleine Paradies als Spielwiese entdeckt, hatten hier Rotwild und Wildschweine gejagt, Muscheln gesammelt, im Fluß und im Meer gefischt.
Sie hatten im Glanz der kristallenen Kronleuchter rauschende Bälle gefeiert, im Spielsaal achtlos riesige Summen gesetzt, den guten Bourbon der Südstaaten getrunken und dicke Havannas geraucht. Sie hatten an den heißen Sommernachmittagen auf der Veranda gelegen und sich von Sklaven kühle Limonade servieren lassen.
Sanctuary war eine Enklave der Privilegierten gewesen – und das Vermächtnis eines zum Untergang verurteilten Lebensstils.
Mehr Geld noch war durch die Hände des Stahl- und Schiffsmagnaten gegangen, der Sanctuary zu seinem privaten Refugium gemacht hatte.
Und auch wenn das Geld inzwischen verbraucht war, stand Sanctuary noch immer. Und die Insel war noch immer in den Händen der Nachkommen dieser Baumwollkönige und Stahlbarone. Die über die Insel verstreuten Cottages, hinter den Dünen aufragend, in den Schatten der Bäume geschmiegt oder das breite Band des Pelican Sound überblickend, wurden von einer Generation an die nächste weitergegeben, so daß nie mehr als eine Handvoll Familien Desire ihre Heimat nennen konnte.
Und so sollte es bleiben.
Sein Vater kämpfte ebenso erbittert gegen Landerschließer wie gegen Umweltschützer. Auf Desire würde es keine Ferienhotels geben, und keine noch so wohlmeinende Institution konnte Sam Hathaway davon überzeugen, seine Insel zum Naturschutzgebiet erklären zu lassen.
Es ist, dachte Brian, das Denkmal meines Vaters für seine treulose Frau. Sein Segen und sein Fluch.
Heute kamen trotz oder vielleicht wegen der Abgeschiedenheit viele Besucher. Um das Haus, die Insel, die Stiftung erhalten zu können, hatten die Hathaways einen Teil ihres Zuhauses zu einer Pension gemacht.
Brian wußte, daß Sam es haßte, daß er jeden Schritt eines Fremden auf der Insel verabscheute. Dies war das einzige gewesen, worüber er seine Eltern jemals hatte streiten hören. Annabelle wollte die Insel für mehr Touristen zugänglich machen, wollte Menschen anlocken, um das gesellschaftliche Leben wiederanzukurbeln, das ihre Vorfahren so sehr genossen hatten. Sam hatte darauf bestanden, alles unverändert und unberührt zu lassen und die Zahl der Tagesausflügler und Übernachtungsgäste streng zu kontrollieren – wie ein alter Geizkragen seine Pennies. Brian glaubte, daß es das gewesen war, was seine Mutter schließlich fortgetrieben hatte – das Bedürfnis nach Menschen, nach Gesichtern, nach Stimmen.
Aber so sehr sich sein Vater auch bemühte, er konnte dem Wandel ebensowenig Einhalt gebieten wie die Insel dem Meer.
Veränderungen, dachte Brian, während sich das Wild mit synchronen Bewegungen abwandte und im Schutz der Bäume verschwand. Er selbst konnte auf Veränderungen verzichten, aber was den Hotelbetrieb betraf, waren sie notwendig gewesen. Und Tatsache war, daß es ihm Spaß machte, die Pension zu betreiben, Dinge zu planen und in die Tat umzusetzen, die tagtäglichen Abläufe zu steuern. Er mochte die Gäste, die Stimmen der Fremden; er liebte es, ihre Gewohnheiten und Erwartungen zu beobachten, und er hörte sich gerne die Geschichten ihrer unterschiedlichen Welten an.
Die Menschen störten sein Leben nicht – solange sie nicht blieben. In jedem Fall glaubte er nicht, daß Menschen auf lange Sicht blieben.
Annabelle war nicht geblieben.
Leicht irritiert von dem unerwarteten Schmerz einer zwanzig Jahre alten Narbe erhob sich Brian. Er schob den Gedanken beiseite, wandte sich um und schlug den gewundenen, leicht ansteigenden Weg nach Sanctuary ein.
Als er aus dem Schatten der Bäume trat, herrschte gleißendes Licht. Es traf auf den Wassernebel des Springbrunnens und verwandelte jeden einzelnen Tropfen in einen Regenbogen. Brian betrachtete den hinteren Teil des Gartens. Die Tulpen wucherten wild. Die Nelken sahen ein wenig zerzaust aus, und die … was, um Himmels willen, war das rote Zeug da eigentlich? fragte er sich. Er war bestenfalls ein mittelmäßiger Gärtner und bemühte sich nach Kräften, den Garten in Ordnung zu halten. Die zahlenden Gäste erwarteten neben blitzblank polierten Antiquitäten und exquisiten Mahlzeiten eben auch gepflegte Gartenanlagen.
Sanctuary mußte für die Besucher tipptopp in Schuß gehalten werden, und das bedeutete viel Arbeit. Aber ohne zahlende Gäste hätten sie Sanctuary nicht halten können. Und so, dachte Brian, während er nachdenklich auf die Blumen hinabschaute, sind wir in einem Teufelskreis gefangen. Es war wie eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz biß. Eine ausweglose Falle.
»Ageratum.«
Brian blickte auf. Er mußte gegen die Sonne blinzeln, um das Gesicht der Frau scharf sehen zu können. Aber er hatte sie schon an der Stimme erkannt. Irritiert stellte er fest, daß sie ihm gefolgt sein mußte, ohne daß er sie bemerkt hatte. Es war nicht das erste Mal, daß Dr. Kirby Fitzsimmons ihn irritiert hatte.
»Ageratum«, wiederholte sie lächelnd. Sie wußte, daß sie ihm auf die Nerven ging, und das betrachtete sie als Fortschritt. Es hatte schließlich fast ein Jahr gedauert, bis sie ihm diese Reaktion entlockt hatte. »Die Blumen, die du da anfunkelst. Der Garten müßte mal wieder in Ordnung gebracht werden, Brian.«
»Werd’ ich schon erledigen«, entgegnete er und besann sich auf seine wirksamste Waffe. Schweigen.
In Kirbys Gegenwart fühlte er sich immer ein wenig befangen. Es waren nicht nur ihre Blicke. Sie war ziemlich attraktiv, vorausgesetzt, man stand auf grazile Blondinen. Aber Brian glaubte vielmehr, daß seine seltsame Befangenheit mit ihrer Art zusammenhing, die alles andere als grazil war. Sie war effizient, kompetent und schien zu allem und jedem einen Kommentar auf Lager zu haben.
Ihre Stimme war für Brian der Inbegriff der High Society Neuenglands. Oder, wenn er in weniger gnädiger Stimmung war, der Inbegriff der verdammten Yankees. Außerdem hatte sie diese Yankee-Wangenknochen. Und meergrüne Augen und eine ganz leichte Stupsnase. Ihre Lippen waren voll – nicht zu breit und nicht zu schmal. Noch etwas, das an ihr verwirrend perfekt war.
Ständig rechnete er mit der Nachricht, daß sie zurück aufs Festland gegangen sei, das kleine Cottage, das sie von ihrer Oma geerbt hatte, hinter sich abgeschlossen und die Idee begraben hätte, auf der Insel eine Arztpraxis zu betreiben. Aber sie blieb Monat um Monat und wurde mehr und mehr Teil des Inselalltags.
Und ging ihm unter die Haut.
Sie lächelte ihn immer noch an, und in ihrem Blick lag wieder dieser belustigte Ausdruck. Dann strich sie sich eine sanftgewellte Strähne ihres weizenblonden, locker auf ihre Schultern fallenden Haars zurück. »Ein herrlicher Morgen.«
»Es ist noch früh.« Er vergrub seine Hände in den Hosentaschen. In Kirbys Gegenwart wußte er nie so genau, was er mit ihnen anfangen sollte.
»Aber nicht zu früh für dich.« Sie legte den Kopf auf die Seite. Herrgott, was für ein Vergnügen, ihn anzusehen. Seit Monaten hatte sie gehofft, mehr mit ihm zu machen, als ihn nur anzusehen, aber Brian Hathaway war einer dieser Einheimischen, die nur schwer rumzukriegen waren. »Das Frühstück ist wohl noch nicht fertig?«
»Erst ab acht.« Das wußte sie doch ebensogut wie er. Schließlich kam sie oft genug.
»Ich kann warten. Was gibt’s denn heute Besonderes?«
»Weiß ich noch nicht.« Da sie sich nicht abschütteln ließ, nahm er resigniert in Kauf, daß sie sich gleichzeitig mit ihm in Bewegung setzte.
»Ich plädiere für Zimtwaffeln. Davon könnte ich einen ganzen Berg verdrücken.« Sie räkelte sich, die Finger über dem Kopf ineinander verschränkt.
Er bemühte sich zu ignorieren, wie sich ihr T-Shirt über ihre kleinen, festen Brüste spannte. Kirby Fitzsimmons zu ignorieren war für ihn zum Full-time-Job geworden. Er bog um die Hausecke und sprang geschmeidig über die Frühlingsblumen, die den Weg aus Muschelkies säumten. »Du kannst im Salon warten. Oder im Speisezimmer.«
»Ich würde aber viel lieber in der Küche sitzen. Ich sehe dir gerne beim Kochen zu.« Bevor er sich eine Ausrede einfallen lassen konnte, war sie schon durch die hintere Tür in die Küche geschlüpft.
Und wie immer war die Küche blitzblank. Kirby mochte es, wenn ein Mann ordentlich war, ebenso wie sie einen durchtrainierten Körper und einen wachen Kopf schätzte. Brian verfügte über diese drei Eigenschaften, und deshalb fragte sie sich, wie er wohl als Liebhaber war.
Sie hoffte es eines Tages herauszufinden. Wenn sich Kirby etwas vorgenommen hatte, erreichte sie es normalerweise auch. Sie mußte nur seinen Schutzpanzer knacken.
Es war kein Desinteresse. Sie hatte bemerkt, wie er sie beobachtete, wenn er in seltenen Augenblicken einmal nicht auf der Hut war. Es war reine Sturheit. Und auch die gefiel ihr. Sie mochte seine Gegensätze.
Als sie sich auf den Hocker an der Frühstückstheke setzte, war ihr klar, daß er kein Wort mehr von sich geben würde, wenn sie nicht stocherte. Das war die Distanz, die er zwischen sich und den anderen aufrechterhielt. Und sie wußte, daß er ihr eine Tasse seines wirklich vorzüglichen Kaffees eingießen und sich daran erinnern würde, daß sie ihn mit Milch trank. Das war seine angeborene Gastfreundschaft.
Kirby gönnte ihm einen Augenblick Ruhe und nahm einen Schluck dampfenden Kaffee. Sie hatte ihn nicht aufgezogen, als sie sagte, daß sie ihm gerne beim Kochen zusah.
Normalerweise waren Küchen vielleicht eine weibliche Domäne, aber diese hier war absolut männlich. Genau wie ihr Besitzer, dachte Kirby, mit seinen großen Händen, dem widerspenstigen Haar und dem kantigen Gesicht.
Sie wußte – denn es gab auf dieser Insel wenig, was einer nicht vom anderen wußte –, daß Brian die Küche acht Jahre zuvor renoviert hatte. Er hatte das Dekor bestimmt, hatte die Farben und Materialien ausgesucht. Er hatte eine richtige Werkstatt daraus gemacht, mit Arbeitsplatten aus Granit und Schränken aus glänzendem Edelstahl.
Es gab drei breite Fenster mit einfachen Rahmen aus naturbelassenem Holz. Unterhalb der Fenster stand eine rauchgraue Eckbank für Mahlzeiten im Familienkreis, obwohl die Hathaways, soweit sie wußte, selten zusammen aßen. Der Boden war cremefarben gefliest, die Wände weiß und ohne irgendwelche Verzierungen.
Aber es gab auch gemütliche Akzente: die glänzenden Kupfertöpfe, die an Haken hingen, die aus Pfefferschoten und Knoblauchknollen geflochtenen Zöpfe, das Regal mit den antiken Küchenutensilien. Sie konnte sich vorstellen, daß er sie eher praktisch als gemütlich fand, aber sie gaben dem Raum Wärme.
Den aus Backsteinen gemauerten Herd hatte er frei im Raum stehen lassen, und jetzt erinnerte er an die Zeiten, als die Küche das Herzstück des ganzen Hauses gewesen war, ein Ort, an dem man zusammenkam und verweilte. Sie mochte es, wenn er im Winter Feuer im Herd machte und sich der Geruch des brennenden Holzes mit dem der vor sich hin köchelnden Eintöpfe oder Suppen vermischte.
Der professionelle Großküchen-Herd kam ihr dagegen wie eine Maschine vor, für deren Bedienung man Ingenieur sein mußte. Andererseits hieß Kochen für sie, eine Tiefkühlmahlzeit aus der Gefriertruhe zu holen und in die Mikrowelle zu werfen.
»Ich mag diesen Raum«, sagte sie. Brian war damit beschäftigt, in einer blauen Keramikschüssel zu rühren, und brummte nur kurz. Sie betrachtete es als Antwort und ließ sich vom Hocker rutschen, um sich noch einen Kaffee einzuschenken. Dann trat sie hinter ihn und schaute ihm über die Schulter, wobei sie seinen Arm streifte. Beim Anblick des Schüsselinhalts mußte sie grinsen. »Waffeln?«
Er trat von einem Bein aufs andere. Ihr Duft war ihm im Weg. »Das wolltest du doch, oder?«
»Ja.« Sie hob ihre Kaffeetasse und lächelte ihm über den Rand hinweg zu. »Ist nett, wenn man bekommt, was man will. Findest du nicht?«
Sie hat die verdammtesten Augen überhaupt, dachte er. Als Junge hatte er an Meerjungfrauen geglaubt. Alle hatten sie Augen wie Kirby gehabt. »Solange du nur Waffeln willst, ist das auch kein Problem.«
Er trat zurück, ging um sie herum und nahm das Waffeleisen aus dem Küchenschrank. Nachdem er es angeschlossen hatte, drehte er sich um und stieß mit ihr zusammen. Automatisch faßte er mit seiner Hand nach ihrem Arm, um ihr Halt zu geben. Und zog die Hand nicht weg.
»Du bist mir im Weg.«
Sie beugte sich nach vorne, nur ein wenig, und genoß das Kribbeln in ihrer Magengegend. »Ich dachte, ich könnte dir helfen.«
»Womit?«
Sie lächelte, ließ den Blick von seinen Augen zum Mund und wieder zurück wandern. »Womit auch immer.« Was soll’s, dachte sie und legte ihre freie Hand auf seine Brust. »Brauchst du nichts?«
Sein Puls beschleunigte sich. Seine Finger schlossen sich fester um ihren Arm, ohne daß er es verhindern konnte. Er dachte darüber nach, o ja, er dachte wirklich darüber nach. Wie würde es sich anfühlen, sie an die Arbeitstheke zu drängen und sich zu nehmen, was sie ihm ständig unter die Nase hielt?
Dann würde sie wahrscheinlich nicht mehr so frech grinsen.
»Du bist mir im Weg, Kirby.«
Er hielt sie immer noch fest. Ein eindeutiger Fortschritt, dachte sie. Sein Herzschlag hatte sich unter ihrer Hand beschleunigt. »Ich bin dir jetzt schon fast ein Jahr im Weg, Brian. Wann wirst du endlich etwas dagegen tun?«
Sie sah ein rasches Aufflackern in seinen Augen, bevor sie sich zu einem schmalen Schlitz verengten. Vor Spannung setzte ihr Atem kurz aus. Endlich, dachte sie und schmiegte sich an ihn.
Er ließ ihren Arm los und trat so plötzlich und abrupt zurück, daß sie diesmal beinahe aus dem Gleichgewicht geraten wäre. »Trink deinen Kaffee«, sagte er. »Ich hab’ noch viel zu tun.«
Zufrieden stellte er fest, daß er offensichtlich den richtigen Knopf erwischt hatte, denn ihr herausforderndes Lächeln war verschwunden. Ihre feinen Brauen hatten sich zusammengezogen, ihr Blick war finster geworden, und ihre Augen funkelten wütend.
»Verdammt, Brian, wo ist das Problem?«
Mit einer geschickten Handbewegung ließ er den Teig von der Schöpfkelle auf das heiße Waffeleisen fließen. »Ich habe kein Problem.« Während er das Waffeleisen schloß, warf er ihr einen schnellen Blick zu. Ihr Gesicht war rot angelaufen und ihr Mund zusammengekniffen. Sie ist fuchsteufelswild, dachte er. Gut so.
»Was soll ich also tun?« Sie ließ die Kaffeetasse so heftig niedersausen, daß die heiße Flüssigkeit auf seine blitzblanke Arbeitsfläche spritzte. »Soll ich hier demnächst nackt aufkreuzen?«
Seine Mundwinkel zuckten. »Hm, gar nicht so schlecht, die Idee. Danach könnte ich die Preise erhöhen.« Er legte den Kopf zur Seite. »Vorausgesetzt, du siehst nackt gut aus.«
»Ich sehe nackt toll aus, und ich habe dir genug Gelegenheiten gegeben, das selbst herauszufinden.«
»Ich glaube, ich schaffe mir lieber meine eigenen Gelegenheiten.« Er öffnete den Kühlschrank. »Willst du Eier zu den Waffeln?«
Kirby ballte die Fäuste, erinnerte sich dann aber an den Eid, den sie abgelegt hatte: Sie wollte heilen, nicht verletzen. Sie drehte sich auf dem Absatz um. »Steck dir deine Waffeln sonstwohin«, murmelte sie und verschwand durch die Hintertür.
Brian wartete, bis er die Außentür mit einem lauten Krachen ins Schloß fallen hörte, bevor er sich ein Grinsen erlaubte. Diesen kleinen Machtkampf hatte er wohl gewonnen, und er beschloß, sich zur Belohnung ihre Waffel schmecken zu lassen. Er ließ sie gerade auf den Teller gleiten, als die Tür aufflog.
Lexy warf sich kurz in Pose, eher eine alte Gewohnheit als der Versuch, ihren Bruder zu beeindrucken. Ihre üppige Haarpracht ringelte sich in zahllosen Spirallocken bis auf die Schultern hinab und leuchtete in ihrer aktuellen Lieblingsfarbe: renaissancerot.
Sie mochte diesen Tizian-Look und betrachtete ihn gegenüber dem Vanilleblond, das sie in den vergangenen Jahren getragen hatte, als enorme Erleichterung. Blond zu sein bedeutete nämlich eine ganze Menge Arbeit.
Das Renaissancerot war nur eine Nuance heller und leuchtender als ihr natürlicher Haarton und paßte gut zu ihrem Teint, dem milchigen Weiß mit einem Anflug Rosa. Von ihrem Vater hatte sie die changierenden haselnußbraunen Augen geerbt. An diesem Morgen erschienen sie dunkler, so wie das Meer an einem bewölkten Tag, und waren sorgfältig mit Eyeliner und Wimperntusche geschminkt.
»Waffeln«, bemerkte sie. Ihre Stimme klang wie das Schnurren einer Katze. Sie hatte es so lange geübt, bis es ganz natürlich klang. »Mmmh, lecker.«
Unbeeindruckt riß Brian die erste Ecke heraus und stopfte sie sich in den Mund. »Ist meine.«
Lexy schüttelte ihre Zigeunermähne zurück, schlenderte zu der Frühstückstheke und setzte einen hübschen Schmollmund auf. Sie klimperte mit den Lidern und schenkte ihrem Bruder, als er ihr den Teller zuschob, ein betörendes Lächeln. »Danke, mein Süßer.« Sie legte ihre Hand auf seine Wange und drückte ihm einen Kuß auf die andere.
Lexy hatte die für eine Hathaway untypische Angewohnheit, andere zu berühren, zu küssen und zu umarmen. Brian konnte sich erinnern, daß sich Lexy nach dem Verschwinden ihrer Mutter oft wie ein junges Hündchen in die Arme der anderen geschmiegt hatte und gestreichelt sein wollte. Mein Gott, dachte er, damals war sie erst vier. Er wuschelte ihr durchs Haar und reichte ihr den Sirup.
»Ist schon jemand auf?«
»Hmm, das Paar im blauen Zimmer zerwühlt gerade die Betten, und Tante Kate duscht.«
»Ich dachte, du wärst heute mit dem Frühstück dran.«
»Bin ich auch«, antwortete sie mit vollem Mund.
Er musterte kritisch ihr kurzes, hauchdünnes, wild gemustertes Kleid. »Ist das deine neue Uniform?«
Sie schlug die langen Beine übereinander und ließ ein Stück Waffel zwischen ihre Lippen gleiten. »Gefällt sie dir?«
»Du wirst dich mit den Trinkgeldern bald zur Ruhe setzen können.«
»Klar.« Sie lachte kurz auf und schob die Waffel auf ihrem Teller herum. »Davon hab’ ich schon immer geträumt: irgendwelchen Leuten Essen servieren, ihr schmutziges Geschirr abräumen und ihr überflüssiges Kleingeld einstecken, damit ich mich eines Tages in Glanz und Gloria zur Ruhe setzen kann.«
»Wir haben alle unsere geheimen Phantasien«, sagte Brian leichthin und setzte eine Tasse Kaffee mit viel Milch und viel Zucker neben ihr ab. Er verstand ihre Verbitterung und Enttäuschung, auch wenn er ihr nicht zustimmen konnte. Er liebte seine Schwester, und deshalb fragte er sie feixend: »Möchtest du meine hören?«
»Du willst bestimmt den Betty-Crocker-Rezept-Wettbewerb gewinnen.«
»Hey, das wär ’ doch was!«
»Ich wäre beinahe berühmt geworden, Bri.«
»Aber du bist doch berühmt. Alexa Hathaway, die Insel-Prinzessin.«
Sie rollte die Augen und griff nach der Kaffeetasse. »Ich hab’ nicht mal ein Jahr in New York überstanden. Nicht mal ein verdammtes Jahr!«
»Wer will das schon?« Allein bei der Vorstellung wurde ihm übel. Überall Gedränge, Verkehr, Gestank.
»Ist nicht so einfach, auf Desire Schauspielerin zu werden.«
»Wenn du mich fragst, Schatz, du machst es ganz prima. Und wenn du schmollen willst, nimmst du die Waffeln am besten mit hoch in dein Zimmer. Du verdirbst mir nämlich die gute Laune.«
»Du hast’s gut.« Energisch schob sie die Waffeln von sich. Brian erwischte den Teller gerade noch rechtzeitig, bevor er von der Tischplatte rutschte. »Du hast hier alles, was du willst. Du lebst einfach so vor dich hin, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Du machst immer wieder die gleichen Dinge. Daddy hat dir das Haus praktisch übergeben, damit er den ganzen Tag lang über die Insel trotten und aufpassen kann, daß sich niemand auch nur an einem seiner kostbaren Sandkörner vergreift.«
Sie rappelte sich von ihrem Hocker hoch und breitete theatralisch die Arme aus. »Und auch Jo hat, was sie will. Sie ist eine bekannte Fotografin mit fetten Aufträgen und reist in der Weltgeschichte herum, um ihre Bilder zu machen. Und was hab’ ich? Einen tollen Lebenslauf mit ein paar Werbespots, ein paar Statistenrollen und einer Hauptrolle in einem Stück in Pittsburg, das gleich nach der Premiere abgesetzt wurde. Und jetzt sitze ich wieder hier, decke Tische und mache fremden Leuten das Bett. Ich hasse es.«
Er wartete einen Moment, dann applaudierte er. »Gut gebrüllt, Lex. Und deine Worte kannst du auch gut plazieren. Deine Gestik läßt allerdings zu wünschen übrig.«
Ihre Lippen zitterten, aber dann strafften sie sich. »Verdammter Kerl!« Erhobenen Hauptes stolzierte sie aus dem Raum.
Brian griff nach ihrer Gabel. Scheint so, als wäre das heute mein zweiter Sieg, dachte er und beschloß, sich auch über ihr Frühstück herzumachen.
Eine Stunde später verkörperte Lexy lächelnd wieder den totalen Südstaaten-Charme. Sie war eine ausgesprochen begabte Kellnerin, was sie in New York vor dem Verhungern bewahrt hatte, und bediente die Gäste voller Freundlichkeit und Anmut.
Sie trug jetzt einen engen Rock, kurz genug, um Brian zu ärgern, was durchaus beabsichtigt war, und einen ärmellosen Pulli, der ihren Körper ihrer Meinung nach am vorteilhaftesten zur Geltung brachte. Sie hatte eine tolle Figur und arbeitete hart, damit sie auch so blieb. Ganz egal, ob Kellnerin oder Schauspielerin, das war ihr Kapital. So wie ihr strahlendes Lächeln.
»Soll ich Ihren Kaffee nicht lieber noch mal aufwärmen lassen, Mr. Benson? Wie schmeckt Ihnen das Omelett? Brian ist ein ausgezeichneter Koch, finden Sie nicht auch?«
Da Mr. Benson ihre Brüste zu schätzen schien, beugte sie sich noch etwas weiter vor, damit er für sein Trinkgeld auch was geboten bekam, bevor sie sich dem nächsten Tisch zuwandte.
»Sie reisen heute ab, nicht wahr?« Sie warf den frisch Verheirateten ein entzückendes Lächeln zu. »Ich hoffe, daß Sie uns bald wieder besuchen.«
Sie segelte durch den Raum und sah sofort, ob ein Gast Lust auf einen kurzen Plausch hatte oder lieber in Ruhe gelassen werden wollte. Wie gewöhnlich war unter der Woche nicht viel los, und sie hatte genug Zeit, um den Speiseraum zu ihrer Bühne zu machen.
Aber eigentlich träumte sie davon, vor vollen Häusern zu spielen, auf den großen New Yorker Bühnen. Aber statt dessen, dachte sie, das sommer-sonnige Lächeln fest im Gesicht, spiele ich die Rolle der Kellnerin in einem Haus, das sich niemals verändert, auf einer Insel, die sich niemals verändert.
Seit hundert Jahren hat sich nichts verändert, dachte sie. Lexy machte sich nicht viel aus Geschichte. Für sie war die Vergangenheit langweilig und so unabänderlich in Stein gehauen wie Desire und seine Handvoll Bewohner.
Die Pendletons heirateten die Fitzsimmons oder die Brodies oder die Verdons. Das waren die vier großen Familien der Insel. Manchmal tanzte ein Sohn oder eine Tochter aus der Reihe und heiratete jemanden vom Festland. Manchmal zog sogar jemand weg, aber die allermeisten blieben und lebten Generation für Generation im selben Cottage – höchst selten gesellte sich mal ein neuer Name zu den alteingesessenen.
Es ist alles so … vorhersehbar, dachte sie, als sie ihren Bestellblock umblätterte und den nächsten Tisch anstrahlte.
Ihre Mutter hatte einen Mann vom Festland geheiratet, und nun herrschten die Hathaways über Sanctuary. Es waren die Hathaways, die hier gelebt und gearbeitet hatten, die nun schon seit mehr als dreißig Jahren Schweiß und Herzblut investierten, um das Haus zu halten und die Insel zu bewahren.
Aber Sanctuary war noch immer das Haus der Pendletons, oben auf dem Hügel, und so würde es immer bleiben.
Es schien kein Entrinnen zu geben.
Sie stopfte die Trinkgelder in ihre Tasche und räumte das schmutzige Geschirr ab. In dem Moment, in dem sie die Küche betrat, wurde ihr Blick frostig. Es machte sie wütend, daß Brian die kalte Schulter nicht zu bemerken schien, die sie ihm vor die Nase hielt.





























