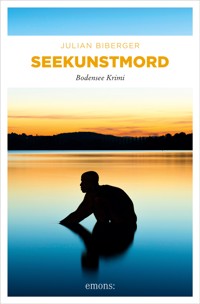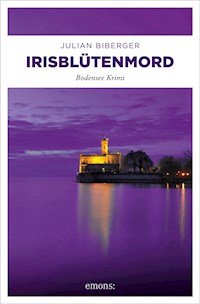
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bodensee Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein außergewöhnliches Debüt und eine Geschichte, die eine vollkommen unerwartete Wendung nimmt. An einem Naturstrand in Langenargen wird ein Toter gekreuzigt aufgefunden. Bald folgen im Nachbardorf Eriskirch weitere altertümlich anmutende Morde, an den Tatorten findet sich jeweils eine getrocknete Irisblüte. Wie hängt die Blume mit den Todesfällen zusammen? Die Spur führt die Friedrichshafener Kommissare Marc Steingruber und Clara Meißner zu einem Jahrhunderte zurückliegenden Verbrechen im Tettnanger Wald, das dem Fall eine neue Dimension gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julian Biberger, Jahrgang 1989, lebt in Meckenbeuren am Bodensee. Obwohl der promovierte Ingenieur acht Jahre lang in Sport und Kultur als freier Journalist tätig war und den deutschen Musiker Kay One in der PR-Beratung begleitete, entschied er sich für eine Karriere in der Automobilbranche. Die Leidenschaft für das geflügelte Wort und die Begeisterung für Krimis sind ihm geblieben. Ebenso die tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat am Bodensee. In seiner Freizeit ist er als passionierter Läufer auf den bodenseenahen Laufstrecken und als begeisterter Wildlife-Fotograf in der Natur anzutreffen.
Dieses Buch ist ein Roman. Mit Inhabern öffentlicher und geistlicher Ämter oder anderer Funktionen wie Bürgermeister, Pfarrer, Klostervorsteherin, Sekretärin oder Ähnlichen sind zu keiner Zeit reale Personen gemeint. Einige Ereignisse sind an historische Begebenheiten sowie an reale Geschehnisse angelehnt. Mancherlei Örtlichkeit ist des atmosphärischen Lokalkolorits wegen adaptiert. Dieses Buch hat keinerlei Anspruch auf einen Tatsachenbericht. Die Ortskundigen mögen mir daher einige Freiheiten bei der Beschreibung der Örtlichkeiten nachsehen.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: IMAGO/imagebroker
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-884-9
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Für Mama und Papa,
Schwester und Schwager,
Oma und Opa,
Eli.
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Friedrich Nietzsche, »Jenseits von Gut und Böse«
Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Sie kennt kein Gesetz, kein Mitleid. Sie riskiert alles und tritt erbarmungslos alles nieder, was ihr im Weg steht.
Agatha Christie, »The Last Séance« aus »The Hound of Death and Other Stories«
Der Hass ist die Liebe, die gescheitert ist.
Søren Aabye Kierkegaard,
Vergelt’s Gott, Iris.
Ein Sturm zieht auf.
Gewaltig. Zerstörerisch.
Ein Sturm, der durch die Lande zieht.
Er wütet. Er tobt.
Ein Sturm, der durch die Gassen fegt.
Er reinigt. Er richtet.
Ein Sturm, der die lodernde Glut schürt.
Wunden. Nimmerheil.
Ein Sturm, der brandend durch die Felder streift.
Kreuzzug. Blutsühne.
Ein Sturm, der elende Unseelen birst.
Entschlossen. Ungeheuerlich.
Ein Sturm, der Rache sät.
Gierig. Tödlich.
Tilgt die unauslöschliche Schande.
Wirbelnd, peitschend, tosend.
Er verzehrt Dich innerlich.
Seelenfraß.
Du, trewe Mutter.
Alsdann, dein ganzes Sein gedenke mir.
Auf ewig. Muttertreu. Behüte.
Vergelt’s Gott, Iris.
Vergeltung.
***
Iris, mein. Irisblau. Violetter Schimmer. Tödliche Heilung. Gelbe Male, von bräunlichen Adern durchzogen. Vergiftete Mütterlichkeit. Aus ihrer hängenden Brust hebt sich ein Schwert empor. Geschmiedet in Lilaglut. Ein Schwert, sie zu richten. Tod. Verfall. Vergänglichkeit. Seelenfraß. Transzendenz. Zweigeist. Ein Körper, zwei Seelen. Weltengang. Hinfort! Ewig. Hinfort! Irisblütenmord.
Prolog
Welcher ein trewe Mutter find
der hat Schätz vber alle Welt
er seh nur datz er jhrs vergelt.
10.November 1639
Gedankenverloren stand Clara Melchin auf der Wiese der lichten Anhöhe des Lindenbuckels am Rande des Tettnanger Waldes. Gebannt richtete sie ihren Blick auf die nördlich gelegenen, verheerten Überreste der Hauptstadt zur Grafschaft Tettnang der Herren von Montfort. Der kalte Wind, der die Baumkronen im Reigen tanzen ließ und die nassen Gräser der Wiese sanft wiegte, strich durch ihr langes schneeweißes Haar. Clara fröstelte es. Der dünne Leinenstoff ihrer Schürze und das Unterkleid mochten keinen rechten Schutz gegen die aufziehende Kälte bieten. Sie schmiegte sich in ihren braunen Umhang. Auch das weiße Häubchen, das ihr Haupt zierte, schonte ihre Ohren nur mäßig vor dem anhaltenden Wind. Dennoch stimmte all das Clara nicht verdrießlich. Immerhin trug der Wind ihre Gedanken davon.
Der Martinisommer, der im November die letzten Schönwettertage mit sich zu bringen pflegt, war in diesem Jahr ausgeblieben. Stattdessen hatte sich tagsüber eine Regenfront über das Land ergossen und eine stramme Brise mit sich geführt. In der Ferne tat sich die Richtstätte am Galgenberg auf. Dort war die leibeigene Dienstmagd Anna Lohrin anno 1625 wegen Hexerei und Pakten mit dem Teufel enthauptet und verbrannt worden.
Claras Blick schweifte vom Torschloss über die lausig vernarbte Schneise der Verwüstung hinüber zum Turmstumpf der linker Hand aufragenden Burgruine. Die schwedischen Kavallerieregimente, derer drei, waren sechs Jahre zuvor im Kampf für die protestantische Sache in Tettnang eingefallen. Ganze dreiunddreißig Wochen hatten sie die Stadt belagert, waren brandschatzend, plündernd und mordend durch die Gassen gestreift. Als sie endlich abgezogen waren, blieb unsägliches Leid zurück. Die meisten Behausungen lagen in Schutt und Asche. Kaum mehr als zwölf Dutzend gräuelgeplagte Seelen waren in der einst blühenden Montfortstadt verblieben. Wen Eisen und Feuer verschont hatten, auf den hatte der von den Schweden durch die Stadttore gelotste Schwarze Tod gelauert. Flucht und Hungersnot hatten schließlich ihr Übriges getan. Im Lande kursierte die weitläufige Ansicht, es sei im gesamten Schwäbischen Kreis kein Ort übler verwüstet worden als Tettnang.
Eigenartig. Es mochte grotesk anmuten, doch einzig der elendige Anblick dieser Relikte unbarmherziger Zerstörung vermochte es, Clara ein Gefühl der Leichtigkeit und Beschwingtheit einzuhauchen. Für eine kurze Zeit entfloh sie dem leidlichen Irdischen und tauchte in die berauschenden, befreienden Weiten der Gedankenlosigkeit ein. Dabei lag die Realität, ihre triste Realität, ihr zur Wirklichkeit gewordenes Grauen, gerade einmal ein Fünftel eines Tagesmarsches entfernt. In einer zwanzig Fuß langen und zehn Fuß breiten Bauernhütte an der Schussen in Eriskirch, wo die Wände lediglich aus einer Holzpfostenkonstruktion mit Weidenastgeflecht bestanden. Den Boden bildete festgestampfter Lehm, und das Dach war aus einem Schilfgedeck gefertigt. Strohsäcke dienten als kärgliche Schlafstätte.
Als Claras Vater Jakob noch gelebt hatte, hatte sie mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Lukas ein beschauliches Bürgerhaus in Ölschwang südöstlich der Reichsstadt Ravensburg bewohnt. Als Papiermacher hatten sich ihre Eltern verdingt und eine der drei dort am Flappach angesiedelten Papiermühlen bewirtschaftet. Ja, sie waren wirklich gesegnet gewesen. Konnte die Papiermacherei, wenn auch nicht gerade an des Kaisers Tafel, doch eine ganze Familie ernähren.
Hinter ihrem Fachwerkhaus hatte Claras Mutter Anna eine kleine Gartenparzelle unterhalten. Jahr um Jahr hatte sie bei der städtischen heilkundigen Kräuterfrau ein halbes Pfund Iriszwiebeln gekauft und am Fuße einer knorrigen Haselnussstaude ein Beet mit prächtig anzusehenden Blauen Schwertlilien bestellt. Jene Irisblüte, die dem Ritterstand von edlem Gemüt einst als die ihrige gegolten hatte. Bei Gott, sie waren gesegnet gewesen. Bis vor fünf Jahren.
Eines unheilvollen Abends hatte der Schwarze Tod auch an die Pforte ihres Lumpenkellers geklopft. Still und sanft hatten sich seine gichtigen Klauen um die Kehlen ihres Vaters und ihres Bruders gelegt und schonungslos den Lebenssaft aus ihnen gepresst.
Schon des Längeren war in der Bürgerschaft über ihre Familie gemunkelt worden: Die Anna Melchin hat einmal nach einem Streit mit einem Händler auf dem Viehmarkt die Schande in der Geige über sich ergehen lassen müssen. Und hat der liebe Herrgott nicht zweien ihrer Kinder just bei der Geburt das Leben verwehrt? Das muss eine gerechte Strafe gewesen sein. Die Anna Melchin muss sich nach dem Luzifer verzehrt haben, sich ihm mit Leib und Seele hingegeben haben …
Und dann war da diese wunderliche Clara Melchin. Das kleine Mädchen mit den schneeweißen Haaren und den lila schimmernden Augen. In der ganzen Reichsstadt ward noch nie zuvor ein solch sonderbares Mädchen gesehen. Schon gar nicht in einer Welfenstadt, deren edle Töchter von alters her rabenschwarzes Haupthaar zierte. Manch einer hatte gar behauptet, diese sonderliche Clara sei eine weitere Strafe Gottes. Ein Satansbraten.
Und nun hatte die Anna Melchin dem Gatten und dem Sohn auch noch die Teufelsseuche auf die Leiber gehetzt. Das roch nach Satanswerk und dunkler Zauberei. Die Anna Melchin musste eine Hexe sein. Und eine Gabelreiterin musste brennen. Gemeinsam mit ihrer Höllenbrut.
Allein der Gunst des Landvogts war es zu verdanken, dass der Kelch der Flammen an ihnen vorübergezogen war. Der Landvogt mochte die Melchins gut leiden. Auf ihren Papierbögen ließ er sich aufgrund der herausragenden Qualität nur allzu gern bei der Jagd porträtieren. So hatte er über die beiden Unglückseligen lediglich ein Stadtverbot verhängt und sie zu Claras Oheim auf das Land nach Eriskirch verbannt.
Claras Blick verharrte noch immer auf dem Turmstumpf der Burgruine der Montfortstadt. Deren Lustgarten war einst so schmuck anzusehen gewesen. Wunden waren ungleich schneller geschlagen, als sie heilen konnten. Sie spürte, wie sie der Anblick der verbrannten und verheerten Stadt fesselte.
Ein plötzlicher Anflug von Scham überkam Clara. Der liebe Herrgott versagte derlei Gedanken. Doch es war die überwältigende Ohnmacht dieser städtischen Wunden, die sie ihre eigenen vergessen ließ. Wunden, die wie nimmer verheilende Narben tief in Claras Seele klafften und ihr das Herz vom rechten Fleck entrückten. Sie drohte in der Leere zu ertrinken. Ihr Zustand glich dieser zerrütteten Burgruine. Die Liebe ihrer Mutter, dessen war sich Clara in diesem Moment bewusst wie nie zuvor, war der Strohhalm, der sie über Wasser hielt.
Dingdong! Dingdong! Dingdong! Dingdong! Dingdong!
Unversehens wurde Clara zurück in das irdische Hier und Jetzt entführt. Aus der Ferne vernahm sie die Glockenschläge der Loretokapelle. Es läutete bereits zur fünften Stunde. Die hereinbrechende Dämmerung kündigte sich an. Clara musste noch den Marsch von der Anhöhe durch den Tettnanger Wald nach Eriskirch zurücklegen. Und sie wusste, dass ihre Mutter in tiefer Sorge um sie sein würde. Sie hatte ihr strengstens untersagt, den Tettnanger Wald in der Dämmerung allein zu durchschreiten. Gottverboten.
Man munkelte, in den Wäldern des schwäbischen Umlandes hause ein gar schreckensvoller Walddämon. Ein Gehilfe des Teufels, der auch mit den hiesigen Hexen seine Bündnisse eingehe. Die Menschen nannten ihn Nachtfraul. Denn, so murmelte man hinter vorgehaltener Hand, in seine Fänge gerieten bei Einbrechen der Dämmerung vornehmlich Kinder, die in die Tiefen der Wälder verschleppt würden. Dort stellte er mit ihnen unaussprechliche Dinge an. Schlitzte ihre Bäuche auf. Weidete sich an ihren Gedärmen. Stach ihnen die Augen aus und aß sie. Er war riesenhaft und überall am Körper behaart. Ein pechschwarzes Gesicht hatte er. Nachtfarbener Wolfskopf. Flammende Iris. Lilaglut in den Bestienaugen. Schwarzes, buschiges Haupthaar und ein wuchernder Wurzelbart. Dazu rübenlange Klauen. Und seine Brust behauste die gar entsetzlich lodernde Feuersinbrunst der Hölle. So zumindest hatte ihn des Müllers Sohn zu Langenargen beschrieben. Das einzige Kind, das den Fängen des Nachtfrauls je entkommen war. Zuletzt hatte er im Allgäu in den Wäldereien um die Reichsstädte Kempten und Wangen sein Unwesen getrieben. Jüngst aber war er vom Müllerssohn in der Herrschaft Argen am Fluss unweit von Langenargen gesichtet worden.
Clara hatte den Rückweg angetreten und bereits gut die Hälfte des Heimwegs hinter sich gebracht. Als sie den Wald betreten hatte, hatten noch die letzten Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterdach gelinst. Die Gedanken an den schrecklichen Nachtfraul hatte sie wieder beiseitegeschoben. Nun hielt die Dämmerung Einzug und legte einen Schleier der Dunkelheit um die Baumkronen. Die im Wind flüsternden Gräser am Wegesrand waren noch feucht, und die Regentropfen perlten an den Farnen entlang zu Boden. Ganz in der Nähe musste ein Specht eifrig einen Baumstamm bearbeiten. Noch immer pfiff ein leichter Wind durch die Wipfel und ließ die tanzenden und wippenden Blätter rascheln. Der Wald stimmte mit seinen ganz eigenen Klängen ein nächtliches Lied an. Doch etwas Schreckliches lag in der Luft. Eine unheilvolle Sinfonie. Aus der Ferne vernahm Clara Wolfsgeheul.
Mit einem Mal blieb sie wie angewurzelt stehen. Sie hatte ihn erblickt. Zwei düsterdunkle Augen. Auf einem herabhängenden Buchenast saß direkt vor ihr ein Waldkauz und machte keinerlei Anstalten, in die nahende Nacht zu entschwinden. Eisern hielten die knopfrunden schwarzen Augen aus dem rundlichen hell und dunkel umrahmten Gesichtsschleier heraus Claras erstarrtem Blick stand.
Sie ballte ihre kalten Hände zu Fäusten. Nervös scharrte sie mit den Spitzen ihrer Holzschuhe über den Waldboden. Der Waldkauz war ein unheilvoller Bote des Todes.
Kuwitt! Kuwitt! Kuwitt!
Clara zuckte zusammen. Mit klagendem Gesang stimmte der Kauz in das Lied des Waldes ein. Beinahe war ihr, als hätte er ihr »Komm mit!« entgegengegeifert. Doch da war noch etwas anderes. Eine tiefe Stimme.
Clara hörte es am Rande des Pfades im Unterholz rascheln. Schemenhaft nahm sie hinter sich eine Gestalt wahr, die polternd den Schutz des Unterholzes verließ und sich alsdann auf dem Waldpfad aufbäumte.
Eine große Pranke ergriff Clara harsch an der rechten Schulter. Sie spürte die Gestalt näher und immer näher an sie herantreten. Sie bekam bereits den warmen, keuchenden Atem in ihrem Nacken zu spüren. Er stellte ihr die Härchen auf. Fleddrige Lippen schürzten sich eng an ihrem Ohr. Der ihnen entströmende modrige Geruch kroch ihr in die Nase und benebelte ihre Sinne. Gehechelt drangen die barschen Worte in ihre Ohrmuschel: »Komm mit!«
Eine Gänsehaut überkam Clara am ganzen Körper. Ihr sackte das Herz in den Unterrock. Und dennoch pumpte es ihr das Blut wie wild bis zum Halse. Sie war nur zu einem klaren Gedanken imstande. Wie ein Blitz schoss er durch ihren Kopf. Der Nachtfraul!
Langsam wandte Clara sich um. Doch sie erblickte keineswegs die Fratze eines teufelsgehörnten Walddämons. Sondern einen monströs hochgewachsenen, verderblich dreinblickenden Mann. Er trug ein weißes, schmutzbeflecktes Leinenhemd, eine braune, löchrige Hose und einen waldgrünen Umhang. Sie starrte in ein kohlegeschwärztes Gesicht. Wildes pechfinsteres Haupthaar, in dem sich Zweige und Flechten verfangen hatten. Es wucherte unter der spitzen Kapuze der Gugel hervor, die ihm Schultern und Kopf bedeckte. Ungepflegtes Brusthaar und ein verfilzter Bart. Die Stimme klang rau und ungefüge. Die Fingernägel der Pranke, die sie so grob an ihrer zarten Schulter fasste, waren lang und dreckig. Er musterte sie durchdringend. In seinen wirren Pupillen spiegelte sich im fahlen Glanz des Vollmonds ihre lila schimmernde Iris. Als würden seine Augen all das widerfahrene Leid, das in ihr noch junges, engelsgleiches Gesicht geschnitten war, gierig aufsaugen.
Der Waldkauz, der das Geschehen von seinem Ansitz aus verfolgt hatte, drehte seinen Kopf zu beiden Seiten und öffnete seinen schwefelgelben Krummschnabel. Kuwitt! Kuwitt! Kuwitt! Klagend verkündete er ein letztes Mal das drohende Unheil, ehe er seine weiten Schwingen ausbreitete, sich schwungvoll von seinem Ast erhob und aus den Baumkronen in die Nacht entschwand.
»Komm mit!«, knurrte der stämmige Hüne erneut. Seine fleischige Pratze ergriff Claras kalte, weiche Hand und zerrte sie abseits des Pfades in den Wald hinein.
Erst jetzt erblickte sie den Dolch, der dem Rohling an seiner linken Hüfte zwischen Gürtel und Hemd baumelte. Auf der wippenden Klinge spiegelte sich das Licht des Vollmondes. An ihr zeichnete sich eine dunkelrote Verkrustung ab. Das Blut der unzähligen Kinder, die bereits verschwunden und nimmermehr zurückgekehrt waren. Und den Dolch dürstete es offenkundig nach frischem Lebenssaft.
Clara war über sich selbst erstaunt. Über ihre ungeahnte Furchtlosigkeit. Es war nicht diese unumstößliche Gewissheit, hier und heute in diesem Wald sterben zu müssen, die ihr die Kehle zuschnürte. Es war die schonungslose Klarheit, dass sie ihre Mutter Anna nie mehr sehen würde. Niemals mehr würde sie sich von ihr behutsam und umsorgend in die gütigen Arme schließen lassen können.
Die Erkenntnis pflanzte sich in Claras Kopf und schlug quälende Wurzeln. Ihr betäubender Dunst zog durch ihr Haupt. Wie ein schwerer Kloß sackte er durch ihre Kehle und nistete sich in ihrer Brust ein. Ein kaltes, hässliches Wechselbad der Gefühle.
Mitleid, mit sich selbst. Den einzigen Menschen, der ihr noch geblieben war, ihre treu liebende Mutter, würde sie nie mehr wiedersehen.
Wut. Nicht auf den Nachtfraul. Er war ein Schmerzwandler. Sie fühlte sich von ihm gesucht. Heimgesucht. Befallen. Er nahm ihr inneres Leben. Entseelte sie. Er war ihr unauslöschlich in Fleisch und Blut übergegangen. Der Nachtfraul raubte ihre Sinne und mit ihnen ihren Schmerz. Er nahm auf verstörende Weise all das Leid von ihren kleinen Schultern.
Nein, blinde, stumpfe Wut verspürte sie diesem hochgewachsenen Unmenschen gegenüber. Dieser Widerling verschleppte sie. Und mit jedem Schritt in den Wald fühlte sie sich mehr um ihre sehnlichst geliebte Mutter beraubt.
Ihre linke Hand rutschte in ihre Schürzentasche und ertastete das Bündel mit dem Holztäfelchen und der getrockneten Irisblüte.
Sie erinnert mich an dich, mein Schatz. An den wunderhübschen Lilaschimmer in deinen Augen. Sie strahlen Güte und Weisheit aus. Diese Eigenschaften hast du von deinem Vater geerbt. In dir, meine Iris, lebt er weiter. Sieh diese Irisblüte als Zeichen, dass ich immer für dich da sein werde. All mein Tun, mein ganzes Sein als treue Mutter, sei dir angediehen.
Mit diesen bewegenden Worten hatte ihre Mutter sie bedacht, als sie ihr das Bündel mit dem Versprechen, sie ewiglich zu beschützen, geschenkt hatte.
1
Ans Kreuze soll er.
Es sehen, ein letztes Mal.
Auf dass er sühne.
17.Juni 2019
Er zerrte mit der letzten Kraft, die noch in seinen erschlafften Muskeln schlummerte, an seinen Fesseln. Doch das dünne Nylonseil, das seine Arme auf dem Balken hielt, gab einfach keinen Millimeter nach. Scharf schnitt es sich in seine Handgelenke. Jedes Zerren entfaltete einen Höllenschmerz. Jedes Heben und Senken seines Brustkorbs setzte eine Leidenswelle frei. Als würde ihm ein Profipitcher der Major League aus kürzester Distanz einen Baseball mit Fullspeed in den Rippenbogen schmettern.
Er hatte bei den Besuchen seines in den Staaten in Boston studierenden Patensohnes im Fenway Park schon dem einen oder anderen Heimspiel der Red Sox beigewohnt. Aber er war nie auch nur in die leiseste Versuchung geraten, als Flitzer über die Absperrbande zu klettern und zwischen Pitcher und Batter todesmutig die menschliche Zielscheibe abzugeben. Doch exakt so musste sich ein solch wuchtiger Treffer anfühlen.
Zu weiteren halbklaren Gedanken war er nicht mehr wirklich imstande. Dafür hatte eine Artillerie an Pitchern gesorgt, die ihn mit einer ganzen Armada von Baseballs beschossen hatte. Beinahe im Sekundentakt hatte ein solcher Ball seine Haut und die darunterliegenden Muskeln in ein aufbrausendes Meer aus unsäglicher Pein verwandelt. Auf der Fläche, die einmal sein unversehrter Rücken gewesen war, loderte ein nie enden wollendes Höllenfeuer.
Er hatte zwischen den Pappeln Blut verloren. Sehr viel Blut. Seine Knie pochten und hämmerten. Nach dieser Marter war er auf allen vieren zu Kreuze gekrochen. Im buchstäblichen Sinn. Die spitzen Steine des Naturstrandes hatten ihm die Kniescheiben zerschunden.
Nun lag er rücklings auf dem Balken und spürte, wie sein warmes Blut am Holz entlangrann. Hitzewallungen durchströmten seinen ausgelaugten Körper. Die kalten Regentropfen benetzten seine Haut und perlten an ihr hinab.
Fokussiere dich! Denk nach! Er versuchte, seine Gedanken zu sammeln und zu ordnen. Doch er war nicht mehr recht bei Sinnen. Einzig und allein eine Frage geisterte in seinem Kopf herum: Warum?
Er blinzelte. Das Denken zermürbte ihn. Das Einzige, woran er sich erinnerte, war der Landesteg in Langenargen. Es war ein lauer Sommerabend gewesen. Montag. Seinen Porsche Cayenne hatte er direkt vor der Uferpromenade in der Oberen Seestraße neben dem Naturkostladen geparkt. Der hatte um diese Zeit bereits geschlossen. Dann war er an der Touristeninformation entlang auf den Landesteg geschlendert.
Vor dem kleinen Eis-Kiosk am Ufer hatte eine Dame mittleren Alters die Tasten eines schwarzen Feurich-Klaviers liebkost: »Die Fischerin vom Bodensee«. Begleitet von einem Akkordeon in den Händen eines ergrauten, bärtigen Seemanns auf einem kleinen Fischerkahn in der Bucht der Anlegestelle. Ein spontanes Hafenduett.
Auf dem Flanierplätzchen, dem Noli-Platz, hatten sich die Touristen vor dem silberblechernen Foodtruck die Füße wund gestanden. Und auf dem Steg hatte es von Abendschwärmern nur so gewimmelt. Alle bestaunten sie das grandiose orangerote Farbenspiel des Sonnenuntergangs. Er selbst hatte seine Motoryacht am Landungssteg beim kleinen Hafen zu später Abendstunde aufgesucht, um sie für einen romantischen Bodenseetörn am Wochenende auf Vordermann zu bringen. Den Rest der Woche war sein Terminkalender völlig zugekleistert.
Erst die Abtreibung bei Annegret nach dem Mittag. Der Frau eines alten Bekannten den Stammhalter abzutreiben, das war vielleicht unangenehm gewesen. Erst recht nach der Eieraktion im vergangenen Jahr. Beim Fünf-Uhr-Termin am Nachmittag war es dann bei der Vakuumaspiration seit Ewigkeiten einmal wieder zu Komplikationen gekommen. Das hatte ihn länger in der Klinik gehalten. Es war sicherlich bereits neun gewesen, als er nach dem großen Reinemachen die Reling verlassen hatte.
Flugs war er noch nach Eriskirch gedüst, zum Supermarkt, dessen lange Öffnungszeit sich mit seinen arbeitswütigen »Late Sessions« in der Klinik vertrug. Zwei Flaschen Champagner Rosé hatte er gekauft. Ein edles Tröpfchen, zum Kaltstellen auf seiner Motoryacht. Schließlich sollte es beim Bodenseetörn am Wochenende zwischen ihm und seiner Mail-Bekanntschaft »LakeEssi666« knistern. Dass er heute trotz des langen Arbeitstags schon alles vorbereiten wolle, das hatte er ihr vorgestern im Liebestaumel geschrieben. Zum ersten Mal würden sie sich jenseits des Mailpostfachs begegnen. Ein vollbusiges Rasseweib. Zwischen seiner Gattin und ihm war der Ofen der Liebe lange schon erloschen.
Bei der Rückkehr zum Landesteg war ihm dann dieser dämliche Pick-up mit den geladenen Holzlatten ins Auge gefallen. Der so dreist und sperrig seinen vorherigen Parkplatz und den nebenan gleich mit zugeparkt hatte. Die Musik des Hafenduos hatte bereits ein Ende gefunden. Auch der Eis-Kiosk war längst geschlossen. Keine stracciatellaschlotzenden Touris mehr. Einen einsamen, zigarrepaffenden Obdachlosen hatte er im Vorbeilaufen auf der Sitzbank vor dem Tourismusamt im Licht der Straßenlaternen wahrgenommen. Die Terrasse des Hafenhotels war geschlossen gewesen. Der Foodtruck hatte die Schotten auch dicht gemacht. Keine flanierenden Einheimischen. Der Landesteg war wie leer gefegt gewesen. Abgesehen von dem lässig gegen die steinerne Stegmauer lehnenden Dammglonker.
Moment! War da nicht noch jemand neben der Bronzestatue gewesen? Kapuzenvermummt? In einer Fischerkutte? Oder war es der Obdachlose gewesen? Er konnte sich nicht mehr klar erinnern. Alles war so schnell gegangen.
Er hatte noch das Körbchen mit den Sektflaschen abgestellt, um die Leine an der Relingspforte zu lösen. Im nächsten Moment war ihm ein nasses Tuch auf Mund und Nase gepresst worden. Dann waren ihm auf einen Schlag all seine Sinne geschwunden.
Wieder zu sich gekommen war er am Seeufer der Malerecke. Zwischen einer Baumgruppe im Gras kniend. Bis auf die Unterhose entblößt. Die Arme an die Baumstämme gefesselt. Regen war auf seine Schultern geprasselt und in kalten Schlieren den nackten Rücken herabgeträufelt.
Eine gefühlte Ewigkeit hatte er nur die Klänge der Windböen, der an das Ufer gespülten Wellen, der rieselnden Regentropfen und der im Föhn raschelnden Blätter vernommen. Dann das Klackern der Steine unter seelenruhigen, ja fast schon lethargischen Schritten. Gespenstisch. Unheilvoll. Aus den Augenwinkeln hatte er eine Kapuzengestalt ausgemacht. Etwas war ihr am Regenmantel entlanggestreift. Etwas, das herabgehangen und im faden Schein des am Strand aufgestellten LED-Strahlers wie ein Bündel Kordeln ausgesehen hatte.
Wenige Augenblicke später waren es nicht mehr nur die Regentropfen, die auf seinen nackten Rücken eingeprasselt waren. Er hatte schreien wollen. Bei jedem Schlag. Hatte seine Schmerzen in die Weiten der Bodenseebucht brüllen wollen. Doch seine Jammerlaute waren tief in seinem Rachen in dem mit Motoröl und Benzin vollgesogenen Lappen jäh verdumpft.
Jetzt lag er in der tödlichen Falle, gebrochen, und blickte dem Schicksal entgegen. Seinem grausamen Schicksal. Festgezurrt. Mit dem letzten Jota an Kraft hatte er sich auf den langen Holzbalken gezogen und war dort rücklings liegen geblieben. Regentropfen beträufelten sein glühendes, schweißüberströmtes Gesicht. Auf seinem Knebel schmeckte er den säuerlichen Geschmack von Erbrochenem. Warum? Warum? Warum? Wie ein Presslufthammer wummerte die Frage durch seinen Schädel.
Zum ersten Mal vernahm er die Stimme seines Peinigers. Die Kapuzengestalt hatte sich neben ihm herabgebeugt. Keine Handbreit von seinem rechten Ohr entfernt. Er konnte den Saum des Regenmantels durch sein schweißnasses Haar streifen spüren, als die Lippen sich spitzten. »Ich werde dich nun ans Kreuz nageln.«
Scharf wie ein Messer gingen ihm diese Worte durch Mark und Bein. Sie kappten all die Rettungsseile hinaus aus seinem diffusen Gedankenfiebersumpf. Die vom Wind getragene Stimme klang fürchterlich ruhig und gefasst. Gleichsam lag etwas Verstörendes in ihr. Eine sadistische Note.
»Komm, öffne deine Hände, damit ich sie festnageln kann.« Mit einer ruhigen Bewegung streichelte sein Peiniger über sein rechtes Handgelenk. »Presst du sie zusammen«, drang es perfide an sein Ohr, »verkrampfen deine Sehnen.«
Ihn überkam ein eiskalter Schauer. Eine nicht zu ertragende Ruhe lag in dieser Stimme. Sie passte nicht zu der manischen Grausamkeit.
»Und wenn deine Sehnen verkrampfen, wird es umso schmerzvoller.«
Entmutigt. Er war über sich selbst entsetzt. Entgegen jeglichem Überlebensinstinkt leistete er der Aufforderung Folge. Selbstaufgabe. Eigentlich müsste jede Faser seines Körpers in den Überlebensmodus schalten. Er müsste dagegen ankämpfen. Sein Wille müsste ihn antreiben, Widerstand zu leisten. Doch das tat er nicht. Der Wille war ihm zwischen den Bäumen mitsamt seinem Mageninhalt aus dem Leib geprügelt worden. Er lag benebelt da, wie im Delirium. Wohl wegen des hohen Blutverlusts.
»Na also. Du bist einsichtig. Wir wollen doch nicht, dass du unnötig leidest. Moment … möglicherweise wollen wir das schon! Gehen wir frisch ans Werk.«
Etwas Metallisches scharrte über die Steine. Er drehte seinen Kopf nach rechts. Was er dort sah, ließ ihn schaudern. Lange Metallnägel und ein Fäustel.
»Na, na, na. Du schaust besser weg. Leid ist ungleich besser zu ertragen, wenn man es nicht kommen sieht.«
Die Worte demütigten ihn zutiefst. Tatsächlich aber wollte er nicht sehen, wie ihm die Nägel durch den Körper getrieben wurden. Welcher gottverlassene Mensch wollte das schon? In seiner Verzweiflung presste er beide Augen fest zusammen. Sein Herz pochte zum Zerbersten. Er spürte, wie die Spitze des Nagels auf seinem Handgelenk ansetzte. Der bloße Druck des feindseligen Fremdkörpers fühlte sich qualvoll an. Der Metallstift huckelte über seinem Rasepuls auf und ab.
Stille. Lediglich ein sanftes Rauschen der vom Wind getriebenen Wellen.
Klonk!
Reflexartig versuchte er seine Finger zusammenzukrümmen. Nie geahnte Qualen spülten durch seinen Körper. Dicke Blutstropfen spritzten der Kapuzengestalt mitten ins Gesicht.
»Nicht anspannen!«, schnaubte die herrische Stimme. »Ich hatte es dir gesagt. Wer nicht hören will, muss eben fühlen.«
Klonk! Klonk! Klonk!
Bestialisch stechender Schmerz. Gleißende Hitze. Schweißausbruch. Die stumpfen Hammerschläge rückten für ihn in weite Ferne. Ihm schwanden die Sinne.
Der Nachtfraul fixierte sein Opfer mit zusammengekniffenen Augen. Die Blutstropfen auf seiner Stirn tanzten zusammen mit den träufelnden Regenperlen seine Schläfen entlang.
Er musste wieder zu sich kommen. Er sollte das Leid zu spüren bekommen. Der Nachtfraul hatte es eingesogen, das ganze Leid. Inhaliert. Zug um Zug. Und er musste es ihm einhauchen. Zug um Zug.
Vergelt’s Gott, Iris. Vergeltung. Diese Stimme. Der Nachtfraul hat’s geflüstert. Diese Stimme. Mutterseelenallein im Gedankenstyx. Sie dröhnte der Kapuzengestalt im Schädel umher.
Die Augenlider des Gepeinigten zuckten. Er kam wieder zu sich. Beide Handgelenke hatte der Nachtfraul ihm an den Querbalken genagelt. Schmerzverzerrte Zuckungen.
Der Nachtfraul erhob sich. Die tief ins Gesicht gezogene Kapuze verschleierte seinen dämonischen Genuss. Der Leuchtkraft des Bodenstrahlers, den er nach der Tortur zwischen den Bäumen neben dem Kreuz aufgestellt hatte, blieb er verborgen. Der schwarze Mantel der Nacht tat sein Übriges. Er war ein Seelenfresser. Ein Wiederkäuer. Er fraß das leidgeplagte Innerste und spie die Krux auf ihre Schinder. Um sie zu läutern. Und diesem Mistkerl hauchte er das Leid nicht zu knapp ein.
Er bestaunte sein bisheriges Werk wie ein Künstler die Früchte seiner Muse. Er kniete sich neben die Füße, ergriff den rechten Knöchel und zerrte das Bein lang. »Los, leg deine Füße auf dem Balken ab!«, ermutigte er sein Opfer mit eiseskalter Stimme.
Widerstand war zwecklos. Der ausgemergelte Körper hatte längst keine Kraft mehr. Verzweifelt schleifte dieser Abschaum seine Beine über den Steinschotter auf den Holzbalken.
Ungeduldig ließ der Nachtfraul den Fäustel gegen das Holz tippeln. »Interessant«, merkte er spöttisch an. »Du positionierst deine Haxen nebeneinander. Zwei Füße, zwei Nägel. Übereinander wäre das, was da kommen mag, weitaus weniger schmerzhaft geworden.«
Der kümmerliche Wurm schickte sich an, seine Beine in kläglichem Gebaren übereinanderzulegen. Wie erbärmlich. Das würde er ihm nicht durchgehen lassen.
Grob zerrte der Nachtfraul sie ihm wieder auseinander. Er spuckte Wut und Galle. »Du hast dich entschieden, also stehe dazu!« Rabiat verdrehte er diesem Häufchen Elend das Knie. Sachte ließ er kurz darauf seine lederbehandschuhten Finger über die Ferse streichen. Dann setzte er die kalte Metallspitze auf dem Fersenbein an. Das ließ dem Wicht angst und bange werden. Recht so. Der Nachtfraul witterte sie, die Todesfurcht. Er labte sich daran.
Klonk!
Sein Opfer brüllte die letzten Quäntchen Leibeskraft in den Knebel, als sich der Nagel durch die Nervenbündel bohrte. Die Tortur kannte kein Pardon. Sie kannte keine Grenzen. Pures, nacktes Leid. Der Nachtfraul bespie ihn damit. Es quetschte ihm den Schweiß aus den geschundenen Poren. Entsetzen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Nachtfraul ergötzte sich daran. Dann erschlafften die Gesichtszüge seines Opfers.
Motorengeräusch. Sein Kreislauf musste kollabiert sein. Er musste dieses Mal eine halbe Ewigkeit ohnmächtig gewesen sein. Jetzt versuchte er, den Kopf anzuheben. Aber sein Körper versagte es ihm. Panik überrollte ihn. Zum ersten Mal in dieser Nacht wurde ihm seine Lage in ihrer ganzen Abscheulichkeit bewusst. Die Endgültigkeit. Das elendigste Martyrium auf Erden.
Er zwang seinen schwindenden Verstand, einen klaren Gedanken zu fassen. Warum? Das ganze Universum seiner wirren Gedanken umkreiste diese eine Frage. Womit um alles in der Welt hatte er das verdient? Hatte er jemandem aus seinem Patientenkreis derart geschadet, dass man ihm so etwas Grausames antun würde? Er konnte sich beim besten Willen keiner Behandlung entsinnen, die eine solche Schreckenstat auch nur ansatzweise erklären könnte. Oder doch? Aber waren die alten Bekannten so seelisch verroht, ihm solche Grausamkeiten auf den Leib zu hetzen? Oder war jemand seinem geplanten Seitensprung auf die Schliche gekommen? Seine Gattin? Nein, so abscheulich grausam war sie nicht.
Das, was ihm hier widerfuhr, trug die scheußlichste aller Fratzen, mit der sich blanker Hass nur zu offenbaren vermochte.
Der Motorlärm wurde lauter. Rettung! Ein Speedboot. Ein ruheloser Wasserbegeisterter. Womöglich ein Pärchen auf der Suche nach nächtlicher Romantik an einem entlegenen Ort.
Ein Platschen. Gefolgt von watenden Schritten durch das seichte Wasser. Trügerische Hoffnung. Als sich über ihm die Silhouette der dunklen Kapuzengestalt aufbäumte, erlosch der schwächlich glimmende Funke schneller, als er aufgekeimt war.
Andächtig stiefelte sein Schinder an das Kopfende des Kreuzes. Ihm war, als würde diese satanische Bestie bewusst langsam an ihm vorbeischreiten. Ein Klacken über seinem Kopf. Ein feuchtes Seil tätschelte seine schmerzglühenden Wangen.
Die Lippen der Kapuzengestalt kamen seinem Ohr abermals so nahe, dass er den regenkalten Atem an seinem Ohrläppchen spürte. »Genieße die Aussicht … solange du noch kannst.« Das war das letzte Mal, dass die unheimliche Stimme an sein Ohr drang.
Der Nachtfraul begab sich zurück in das Speedboot und manövrierte es langsam und stetig vom Seeufer weg. Das Holzkreuz und mit ihm sein Opfer begannen, auf dem knirschenden Steinschotter des Naturstrandes ein Stückchen zum Ufer hin zu rutschen. Das Abschleppseil traf mit wippenden Bewegungen auf den geschundenen Körper. Dann stockte das Kreuz abrupt und fing an, sich allmählich in die Höhe zu richten. Mit einem forschen Poltern sackte es in die Mulde. Ein Ruck ging durch den Körper des Gepeinigten.
Der Nachtfraul leckte sich seine Lippen. Das schmerzte ja beim bloßen Zusehen. Er beugte sich über den Bug und schnappte sich die bereitgelegte Lanze. Mit dieser im Anschlag watete er zurück an Land.
Warum? Rasende Kopfschmerzen. Er verspürte Luftnot. Als laste ein nasses Tuch auf seinen Atemwegen. Sein Brustkorb ließ ihn am ausgestreckten Arm verhungern. Kein Heben. Kein Senken. Er konnte seinen Oberkörper nicht aufrichten, ohne die verdrehten Beine mit äußerster Qual zu strecken. Fieberwellen. Panikschübe. Berstender Schmerz in den genagelten Fersen. Er lag in seinen letzten Zügen. Doch kein Atemschöpfen ohne Höllengang.
Sein Opfer durchlitt einen Teufelsritt. Vergeblich mühte sich der Torfkopf ab, am Kreuz das Stehaufmännchen zu geben. Wie behämmert. Selbst im Todesringen erkannte er seine Frevel nicht. Der Feigling gierte in seiner armseligen Verblendung einzig nach Luft. Der Nachtfraul hatte diese Kanalratte zum Tanz gebeten. Er führte. Und er schwang das Tanzbein.
Der Regen tröpfelte auf die Speerspitze und glitt in gewundenen Bahnen am Schaft hinab. Ein letztes Mal Verderben und Elend speien. Der Nachtfraul setzte den Stich. Durch die rechte Brust dieses Mistkerls. Und durch das linke Schulterblatt wieder hinaus.
Tausendmal durchdacht. Abertausende Male durchträumt. Doch erst zum zweiten Mal durchlebt in seiner uferlosen Vergeltungssucht. Der Stoß ging ihm erstaunlich leicht von der Hand. Wie das Messer durch die schmierzarte Butter. Er zog den Speer heraus. Blut quoll aus der Stichwunde.
Es war eine dieser lauen Juninächte, und der Nordföhn kündigte sich bereits in vollen Zügen an. Er hatte die Regenwolken vertrieben und ließ nun die Wellen sturmartig gegen das Ufer peitschen. Im kalten Licht des Vollmonds türmten sich die Wassermassen auf. Ihr Kamm brach in tosend weißer Gischt, und sie perlten in die Tiefe. Wie schon bald seine Lebensgeister.
Die Kapuzengestalt hatte von ihm abgelassen und war hinter dem Kreuz verschwunden. Gewiss beobachtete ihn sein Peiniger von dort.
Sein Puls war am Gefrierpunkt. Er musste Unmengen an Blut verloren haben. Er rang nicht mit dem Tod. Er sehnte ihm entgegen. Warum? Schwer hing ihm sein Kopf vornüber. Seine grauen Haarsträhnen klebten ihm schweißnass auf der Stirn. Was hatte ihn hier überrollt? Er war nie sonderlich gläubig gewesen. Als tiefreligiöser Mensch hätte er seinen Beruf wohl nicht guten Gewissens ausüben können.
Er war dem Sterben nahe, das spürte er. Unter erheblicher Anstrengung hob er ein letztes Mal sein bleiernes Haupt an. In der Ferne spiegelte sich auf der Uferzunge das golden erleuchtete Schloss Montfort im Wasser. Der auberginefarbene Schein fraß sich hinter der fauchenden Gischt in den Nachthimmel. Vor ihm warf der Vollmond eine silbergolden schimmernde Bahn über den Bodensee. Er richtete seinen Blick auf das Schweizer Seeufer. Der Föhn brachte klare Sicht. Das leuchtende Mondrund stand hoch über den Appenzeller Alpen. Entlang des dicht besiedelten Seeufers funkelte eine Lichterkette. Dort. Da oben thronte das Geviert majestätisch auf der Hügelzunge. Im Glanz des satten Mondes konnte er es schemenhaft erahnen.
Er riss seine Augen sperrangelweit auf. Wie Schuppen fiel es ihm von den lebensmüden Lidern. Aber natürlich! Dort lag sie. Die Antwort auf das Warum. Er sah es. Er wusste es.
Mit dieser Erleuchtung nahm er seinen letzten Atemzug. Langsam senkten sich seine Augenlider. Erloschen war die Sicht auf das Geviert auf der Hügelzunge. Seine Gliedmaßen erschlafften, und sein Kopf kippte neuerlich vornüber. Das Leben entwich seinem Körper. Mit ihm der Schmerz. Ohnmacht. Ewig gallige Ohnmacht. Erlösende Umnachtung. Die süßbittere monochrome Melancholie der Dunkelheit.
2
Maximilian war vor Freude die Brust geschwellt. Es war wieder einmal Dienstag. Und das bedeutete vorlesungsfrei. Vor allem aber bedeutete es für ihn Zeit, um das berauschende Gefühl der Freiheit auf dem Wasser in vollen Zügen auskosten zu können. Er studierte in Weingarten Maschinenbau und war einer dieser Nesthocker, die das partygeschwängerte Highlife im Studentenwohnheim scheuten. Stattdessen genoss er lieber weiterhin Kost und Logis im Elternhaus im geruhsamen Langenargen.
Der allseits gefürchtete Prüfungszeitraum, der das Grundstudium besiegeln würde, stand vor der Tür. Dem Lernstress und den Büchertürmen auf seinem Schreibtisch im Dachgeschoss wollte er an diesem Morgen entfliehen. Den Kopf freibekommen. Das Segel in den Wind legen und die Wellen reiten. Unerschöpfliche Freiheit – seine große Leidenschaft war seit Kindesbeinen das Windsurfen.
Ein Grund mehr, das behagliche Elternhaus nicht zu verlassen. Schließlich lag das Schwäbische Meer vor der Haustür. Und der Sommer stand in den Startlöchern. Sonne, Strand, Siesta. Das Langenargener Ufer erstrahlte in der warmen Jahreszeit zur Riviera am Bodensee. Und der war ein wahres Mekka für Wassersportler. Wer brauchte da schon Hawaii oder den Lago Maggiore?
Der Wecker hatte zu einer gar unchristlichen Zeit geklingelt. Fünf Uhr. Das war sein auf studentisch getrimmter Biorhythmus so gar nicht gewohnt. Doch es würde sich lohnen. Er hatte extra am Vorabend dem lokalen Wetterbericht im Radio gelauscht. Von einem über Nacht anhaltenden Föhnwind war die Rede gewesen, und das Falschfarbenbild der Wetterapp hatte ihm Windgeschwindigkeiten bis vierzig Kilometer pro Stunde angezeigt. Ideale Voraussetzungen. Dieser blöde ominöse Bombenfund vor dem Langenargener Yachthafen konnte ihm den Wellenritt auch nicht vermiesen. Der hatte sich zum Glück als falscher Alarm herausgestellt, wie der erleichterte Sprecher der Lokalnews gerade im Radio verkündete. Möglicherweise eine Spinneraktion dieser übersprudelnden Antiabtreibungsbewegung. Das war ihm aber auch eigentlich herzlich schnuppe.
Rasch schlüpfte Maximilian in seinen grauen Kapuzenpullover und streifte sich die Trainingshose über die Beine. Nebenbei schaufelte er den notdürftig angerührten Müsli-Naturjoghurt-Mansch in sich hinein. Dann klemmte er sich sein Surfbrett unter den Arm und machte sich frohen Mutes auf den Weg zur Malerecke.
Maximilian bewohnte mit seinen Eltern eines der gestaffelten Reihenhäuser in der Eisenbahnstraße. Er lief zunächst das kurze Stück in Richtung See zum am Rande des Ortskerns gelegenen Schloss Montfort. Er mochte den prunkvollen Anblick dieses im Stil englischer Neogotik und unter maurischer Einfärbung erbauten Lustschlosses. Mit seiner streng symmetrischen Blockbauweise aus rot und ocker gebänderten Ziegellagen, dem Aussichtsturm mit den bekrönten Zinnen, dem herrschaftlichen Schmuckfries und den mächtigen orientalischen Pilastersäulen und geschwungenen Eselsrückenbögen an den Fenstern hatte es den Platz jener Burgruine eingenommen, die Annette von Droste-Hülshoff ihrerzeit als die schönste von ihren Augen je erblickte geadelt hatte.
Es dämmerte noch, und die Straßenlaternen tauchten die Promenade in fahles Licht. Auch das mochte Maximilian besonders leiden. Um diese Zeit tummelten sich noch keine Touristen auf der Uferpromenade. Mittags, spätestens aber zur Nachmittagszeit, wimmelte es zu dieser Jahreszeit dann nur so von Menschen. Zu dieser frühen Stunde konnte er die Flaniermeile schnellen Fußes durchschreiten. Und das war wichtig. Er sollte ja nicht umsonst so herrgottsfrüh aus dem Bett gefallen sein.
Maximilian wollte vor dem Nervenkitzel in den Wellen des Bodensees auf dem naturbelassenen Steinstrand der Malerecke einen besonderen Moment genießen. Das malerische Alpenpanorama. Wie sich der Altmann und der Säntis bei Sonnenaufgang allmählich am Horizont emporhoben. Ein Anblick für Götter. Als habe der Schöpfer persönlich den Pinsel über dem gegenüberliegenden Seeufer geschwungen. Zumal der Föhnwind eine klare Sicht auf die atemberaubende Kulisse des Alpsteinmassivs versprach. Die Chancen standen gut, dass er die Malerecke noch für sich allein hatte. Die wenigsten Spaziergänger und Hundebesitzer trudelten so gottallmächtig früh ein. Nach dem skurrilen Hoax zum Bombenfund gleich zweimal nicht.
Auf dem letzten Wegstück zum Langenargener Surfrevier bog er an der kleinen Stichstraße rechts zur Malerecke ab. Die gut bestückten Bücherwägelchen, die mittlerweile über Langenargen hinaus bekannt waren und die Touristen bei schönem Wetter mit allerlei Schmökern und Antiquarien erfreuten, begrüßten ihn so früh am Morgen noch nicht. Dafür spross und blühte der fliederfarbene Blauregen an jeder Ecke. Und neben dekorativem Strandgut-Holz floss der alten Brunnenfrau unterhalb der wilden Weinreben an dem romantischen Appartementhaus der ehemaligen Rotgerberei das Wasser aus der Amphore.
Maximilian konnte schon das Rauschen der an den Ufersaum schwappenden Wellen hören. Der ungestüme Bodensee rief mit geradezu magischer Kraft nach ihm. Angesichts der grenzenlosen Weite des Bodensees und der Imposanz der Voralpen konnte er sich innerlich sammeln, bevor er aufs Wasser ging. Fast geschafft. Er brauchte nur noch die kleine Stichstraße, in der sich seeseitig die Ferienvillen und trauten Heime betuchterer Anwohner wie Perlen aneinanderreihten, hinter sich zu lassen. Er ging an einer mächtigen Trauerweide gefolgt von einer ausladenden Rosskastanie vorbei. Hinter diesem grünen Vorhang hielten sich die Prachtbauten in ersehnter Anonymität.
Nun ging er rascher. Obwohl er diesen Sport schon so lange betrieb, war er vor seinen Seegängen immer aufgeregt. Sein Bauch kribbelte. Er durchschritt die beiden Sperrpoller – die heilige Pforte zur Malerecke.
Er legte noch einen Zahn zu. Beinahe hätten seine Haxen ihn selbst vor Aufregung überholt. Doch urplötzlich versagten die Beine ihm den Dienst. Wurden eigenartig wackelig. Zittrig und wachsweich. Und auch das Surfbrett, das er fest unter den Arm gepackt hatte, schepperte von einer Sekunde auf die andere zu Boden.
Maximilian blieb wie versteinert stehen. Er versuchte zu begreifen, was seine noch ungläubigen Augen ihm dort vorgaukelten. Doch das war kein aberwitziger Streich. Das war der blanke Horror. Ihm stockte der Atem, denn ihm bot sich an diesem stürmischen Dienstagmorgen nicht das erwartete glanzvolle Panorama. Was er dort unten am Ufer ein wenig links von den beiden Bäumen erspäht hatte, das wirkte so über die Maßen deplatziert, dass er es im ersten Moment gar nicht so recht einzuordnen wusste.
Wie paralysiert näherte er sich einige Schritte. Roboterschritte, denn sein Verstand hatte ausgesetzt. Fast so, als würde das sich vor ihm auftürmende Elend dadurch greifbarer werden. Begreifbarer. Doch dem war nicht so. Diese Szenerie des Grauens, die gehörte hier nicht hin. Nicht an die sonst so idyllische Malerecke. Nicht an sein Surferparadies.
Es schüttelte ihn. Das da. Es erschütterte ihn in seinen Grundfesten. Solche Szenen kannte er bislang nur aus Filmen. Doch nicht einmal in einem hartgesottenen Schweden-Krimi zu später TV-Stunde, mochte dessen Regisseur auch allzu viel blutdürstender Freigeist ins eigene Fleisch übergegangen sein, hatte er jemals zuvor solche Szenen gesehen. Das hier, das wirkte eher wie aus einem Horrorstreifen, der in einen Kessel voll überbordendem Katholizismus geplumpst war.
Das Holzkreuz. Maximilians Augen klebten daran fest. An dessen Vorderseite musste ein lebloser Mensch hängen. Auf dem Kopfende hockte ein Kolkrabe. Sein blutverschmierter Schnabel … Maximilian wollte diesen Gedanken nicht zu Ende denken. Der pfeildurchbohrte Schwan am Fuße des Kreuzes komplettierte den schauerlichen Anblick.
Seine unbändige Lust auf einen wilden Ritt auf den Wellen des aufbrausenden Bodensees war mit einem Mal wie weggeblasen. Seine Malerecke war entweiht. Dieser grausige Fund drehte ihm den Magen um. Er hatte es gar nicht kommen sehen, da stemmte er schon beide Hände auf die Knie und entledigte sich über seinem Surfbrett der halb verdauten Müsli-Kreation. Sein taumelnder Körper folgte einem stumpfen Mechanismus. Ohne sich die Flocken seines Erbrochenen aus den Mundwinkeln gewischt zu haben, wanderte seine Hand in die Hosentasche und fischte nach dem Handy.
3
Der Blätterreigen tippte gegen die Fensterscheibe. Ein Ausläufer des Föhnsturms beutelte den Kirschbaum im Garten gehörig durch.
Ihr Handy brummte ebenfalls Sturm. Ein nicht enden wollendes Surren. Dabei befand sie sich noch im verheißungsvollen Reich des Halbschlafes. Die Nacht war kurz gewesen. Viel zu kurz. Turbulent. Schlaflos. Vollmondnächte raubten ihr zurzeit den Schlaf.
Sturmklingeln Stufe zwei. Wattig drang der nervtötende Ton an ihr unter den warmen Bettdeckenzipfel gebettetes Ohr. Das Glück war wie eine Aubergine in der Schale auf dem Kühlschrank. Hatte es nicht so oder so ähnlich geheißen? In dem Gedicht, das ihr letztens untergekommen war?
Clara fühlte sich im Moment selbst wie eine Aubergine. Eine, die ihre Zeit in der Schale auf dem Kühlschrank überzogen hatte und nun ganz schrumpelig war. Das war ja mal ein tolles Glück. Ihr Schädel brummte und hämmerte. Wie nach einer durchzechten Nacht zu ihrer besten Zeit im Venedig des Nordens. Hamburger Nächte waren damals lang gewesen. Glück fühlte sich irgendwie anders an.
Das penetrante Geplärre ihres nimmermüden Diensthandys war mittlerweile in ein schrilles Klingeln übergegangen. Stufe drei. Es hallte in ihrem Brummschädel wider wie das dröhnende Schiffshorn von einem der vielen aus dem Hamburger Hafen auslaufenden Containerkolosse.
Kraftlos griff sie nach dem zweiten Kissen und zog es über ihren Kopf. Doch Widerstand war zwecklos. Sie schnaubte und schubste das Kissen wieder von sich. Entnervt pustete sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Umständlich robbte Clara einmal quer über das Bett, um nach dem krakeelenden Ding auf dem Nachttisch zu greifen. Krachend fiel es zu Boden. So hievte sie sich zum Bettrand, griff erneut nach dem Teufelsknochen und nahm ab. »Clara Meißner?«, knurrte sie in ihr Smartphone.
»Clara, fünfzehn Minuten. Ich hole dich ab. Wir haben einen Mord!«
Tuten. Einfach aufgelegt. Marc, der Mann der tausendundeins Wörter. Aber immerhin blieb Clara eine Viertelstunde, bis ihr ruppiger Kollege bei ihr aufschlug. Das würde reichen, um den restlichen Fruchtsalat aus dem Schälchen zu verschlingen und sich selbst in Schale zu werfen. Aber sie war auch keine normale Frau. Nicht mehr. Nein, das war Haarspalterei. Die Axt war aber am Seelenbaum. Mehr. Schon mitten durch.
Clara erhob sich schlaftrunken aus ihrem Bett, schlurfte barfuß über die kalten Fliesen zum Kühlschrank hinüber und nahm das abgepackte Schälchen heraus, das ihr die Vermieterin tags zuvor dankenswerterweise vor die Tür gestellt hatte. Sie kramte einen Löffel aus der Spüle und pflanzte sich an den Tisch.
Clara hatte sich vor sechs Monaten in das Einzimmerappartement eingemietet. Normalerweise, das hatte ihr die Hauseigentümerin bei ihrem Einzug erklärt, blieben die Mieter, zumeist Feriengäste, nur wochenweise. Doch sie war ein sehr gern gesehener Langzeitgast. Und als Kriminalhauptkommissarin verlässlich zahlende Kundschaft.
Clara schätzte ihr kleines Appartement. Mit einem Bett, einer Küchenzeile, einer kleinen Tischecke, einem Kleiderschrank und einem Bad war es auf das Nötigste beschränkt. Alles in einem Zimmer. So herrlich unkompliziert. Es erfüllte seinen Zweck. Die massiven Holzmöbel, die terrakottafarbenen Bodenfliesen, die weißen Scheibengardinen und die rot-weiß karierte Bettwäsche verliehen dem Raum ein richtig uriges Flair. Die Lage trug ihr Übriges dazu bei.
Das Ferienappartement befand sich im Obergeschoss eines bäuerlich anmutenden Landhauses in der Fünftausend-Seelen-Gemeinde Eriskirch. Ein behagliches Erholungsnest am Bodensee, eingebettet in eine bezaubernde Uferlandschaft mit einem Schilfgürtel, einem Auwald und prächtigen Riedwiesen. Ein verträumter und durch und durch zufriedener Ort, der sich aus fünfzehn locker in die Landschaft eingestreuten Ortsteilen zusammensetzte. Manche von ihnen bestanden lediglich aus vereinzelten Wohnhäusern, Gehöften und Weilern. Die Ferienwohnung lag im Ortsteil Moos, einem zwischen weiten, üppigen Grünflächen, Wald und Obstplantagen in die Natur eingepflanzten Hort des Einklangs und der Ruhe. Hier sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht, und Clara konnte von hier aus nicht nur den Alpenblick bewundern, sondern fußläufig auch den Bodensee und das Eriskircher Ried erreichen.
Sie genoss diese Ruhe. Eriskirch konnte nicht mit Flaneuren und Shoppingtreiben und schon gar nicht mit dem hektischen Nachtleben des Großstadtdschungels aufwarten. Damit hatte Clara in Hamburg ausreichend Bekanntschaft gemacht.
Sie hatte nach der Matura an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen studiert. In ihren ersten Berufsjahren hatte es sie in den Schwarzwald verschlagen, nach Lörrach. Zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, als das Web 2.0 gerade en vogue geworden war. In die Tücken und Lücken des World Wide Webs hatte sie sich damals richtig reingefuchst. Nach einigen Dienstjahren bei der dortigen Kripo war sie dann zum Landeskriminalamt Hamburg übergesiedelt. Sie hatte nach der schwierigen Zeit mit ihrer Mutter in der Schweiz einfach Abstand gebraucht. Beinahe hätte es sie in den Stuttgarter Kessel oder nach Karlsruhe verschlagen. Doch der Bodensee und der Schwarzwald hatten als natürliche Barriere nicht ausgereicht. Es hatte der hohe Norden ganz am anderen Ende Deutschlands sein müssen.
Seit einem halben Jahr war sie nun bei der Friedrichshafener Polizeidirektion. Die ersten Wochen an der Seite von Kriminalhauptkommissar Marc Steingruber waren steinig gewesen. Und steinig war noch die blumigste Umschreibung. Eher felsig, wenn nicht gar hohe Klippen. Clara war in übergroße Fußstapfen getreten. Das hatte man sie gleich an ihrem ersten Tag im Kommissariat an allen Ecken spüren lassen. Die Stapfen eines Mammuts. Sie hatte den pensionierten Horst Haberle beerbt. Und der Horst, der hat’s genau genommen. Dem Horst, dem war nichts, aber auch gar nichts entgangen. Von diesem heroischen Geist der allzeit penibel ermittelnden Spürnase hatten ihr die neuen Kollegen bis zum Erbrechen vorgeschwärmt.
Doch bei aller Glorifizierung des Horst Haberle war Clara ihr Ruf vom Landeskriminalamt Hamburg nach Friedrichshafen vorausgeeilt. Sie hatte den vergangenen Herbst in Japan zugebracht. Und sie war als diejenige Mordkommissarin zurückgekehrt, die den Shiraito-Katana-Fall bravourös gelöst hatte.
Das LKA Hamburg hatte sich an die Fersen einer hochkarätigen Kunstschmugglerbande geheftet. Bei deren letztem Coup in der Hamburger Kunsthalle war ein Wachmann zur falschen Zeit am falschen Ort und letzten Endes mausetot gewesen. Dicke Fische also. Clara hatte die Fährte aufgenommen und die Bande bis nach Tokio verfolgt. Der dortige Auftraggeber, Tagayuki Shusaki, war ein bekennender Kunstliebhaber gewesen.
Gewesen. Sie hatte den an der Universität Tokio lehrenden Professor noch keine Woche observiert, da war er ermordet worden. Der achtundfünfzigjährige Philosoph war in der Präfektur Shizuoka an den Shiraito-Wasserfällen auf der Halbinsel Itoshima am Fuß des Mount Fuji von einer Wandergruppe tot aufgefunden worden. Statt auf das herbstlich rote Laubkleid des uralten Banryu-Ahorns waren sie auf den mystisch anmutenden Leichnam getroffen. Er hatte hinter einer Front unzähliger seidendünner Fäden des Schneeschmelzwassers des Fuji zusammengesunken auf dem Felsplateau gekniet. Ein Katana hatte seine linke Brust tief durchbohrt.
Die Tokioter Mordkommission hatte Clara wegen eines möglichen Zusammenhangs mit dem Kunstraub um ihre Unterstützung gebeten. Sie war anfänglich von einem Selbstmord ausgegangen. Die dortigen Rechtsmediziner und der Waffentechniker der Kriminalpolizei hatten ihr aber unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es sich um Mord handeln musste. Nie und nimmer hatte sich der kniende Professor ein solch langes Katana nahezu waagerecht in die eigene Brust rammen und dabei noch das Herz durchbohren können. Um die Rippenbögen zu durchstoßen, hätte der Schwertgriff mit beiden Händen fest umfasst und der Stoß mit Wucht ausgeführt werden müssen. Auch wäre der leblose Körper bei einem Harakiri zur Seite weggesackt. Eine Inszenierung also.
Unter diesen Gesichtspunkten hatte Clara gemeinsam mit den japanischen Ermittlern den Tatort noch mal genauestens unter die Lupe genommen und keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und sie war es dann gewesen, die auf der am See gelegenen Landzunge ein blutverschmiertes Taschentuch mit den Initialen T.M. im Gras gefunden hatte.
Relativ zügig hatten die Ermittler den zerstreuten Doktoranden Tomoya Mikami im Visier gehabt. Ein komischer, eigenbrötlerischer Kauz. Geradezu besessen von seinem Doktorvater. Und ein ausgebildeter Kampfsportler. Er hatte an der Universität den Selbstverteidigungskurs in Jiu-Jitsu unterrichtet. Bei der Mordwaffe hatte es sich um ein Zierstück aus der Vitrine im Trainingsraum der Kampfsportstätte gehandelt. Unter der erdrückenden Beweislast war der Promotionsstudent schließlich eingeknickt und hatte den Mord gestanden. Und Clara hatte sich im Land der aufgehenden Sonne als durchwegs versierte Mordermittlerin einen Namen gemacht. Auch wenn sie gegen die Lieblingsspürnase »Detektiv Conan« nicht anstinken konnte – die Ermittlungsleistung war ähnlich spektakulär und aufsehenerregend gewesen.
Es hupte lautstark vor dem Fenster ihres Ferienappartements. Marc. Da hatte sie die Viertelstunde doch mächtig unterschätzt.
Clara ließ ihren halb verputzten Fruchtsalat stehen, warf sich eine schwarze Bluse über und begab sich an den Schrankspiegel. Socken übergestülpt und einbeinig hüpfend in die Jeanshose gezwängt. Die Morgendusche musste entfallen. Sei’s drum. Sie hatte ja noch in der Nacht ausgiebig geduscht.
Ohne ihre üblichen Accessoires würden sie aber keine zehn Zebras aus dem Haus bekommen. Clara nahm sich das über dem Stuhl hängende rote Haarband mit den weißen Pünktchen, streifte es sich über den Kopf und rückte es in ihrem schulterlangen gelockten Haar zurecht. Anschließend huschte sie ins Badezimmer, nahm die beiden goldenen Kreolen von der Ablage und steckte sie sich an die Ohren.
Sie begutachtete sich im Spiegel. Mit ihren bald neununddreißig Jahren hatte sie sich gut gehalten, kaum Falten im Gesicht. Sie steuerte straff auf die vierzig zu. Midlife-Crisis? Dafür hatte sie keine Zeit. Sie hatte andere Sorgen. Zugegeben, die Haare waren schwarz gefärbt, weil sie sich als Schneeweißchen nicht mehr sehen konnte. Die prägnant spitze Nase hatte sie von ihrer Mutter. Nicht aber die Katzenaugen. Und ihre Iris waren dermaßen tiefblau, dass sie an manchen Tagen wie Kobalt funkelten. Im Sonnenschein nahmen sie gar einen sanften Violettstich an. Ihre Mutter hatte helle rehbraune Augen gehabt. Jedoch den gleichen Lilastich. Vor ihrer Erblindung. Jetzt waren ihre Pupillen und Iris weiß.
Claras Hang zu Haarband und Kreolen und ihr dunkler Teint hatten ihr bei ihren LKA-Kollegen in Hamburg den Spitznamen »Esmeralda« eingebrockt. Auch wenn die sommerliche Hauttönung künstlich war und von einer Bräunungscreme herrührte. Eigentlich hatte sie leichenblasse Haut. Ein Muggeseggele an alemannisch angehauchtem Kauderwelsch reichte im hohen Norden aber auch schon vollkommen aus, um als exotischer Sonderling abgestempelt zu werden. Wenn sie sich nicht konzentrierte, um die Dialektbabbelei im Zaum zu halten, färbte das Schweizerdeutsch ihre Zunge unmerklich ein.
Ein lang gezogener Huper. Clara schnappte sich das ebenfalls über dem Stuhl hängende Holster mit ihrer Dienstwaffe und die olivgrüne Jacke vom Kleiderhaken, schwang sich ihre Handtasche um und steuerte auf die Haustür zu, wo sie in ihre weißen Sneaker schlüpfte. Dann eilte sie durchs Treppenhaus hinunter.
Marc Steingruber warf der ihm zum Jahresbeginn an die Seite gestellten Kollegin einen vorwurfsvollen Blick zu, als sie seinen komfortablen Audi A6 in Schwarzmatt bestieg. Clara wusste inzwischen, dass er es hasste zu warten. Er saß auf heißen Kohlen. Doch die peinliche Stille wich schnell.
»Na, ist dein fahrbarer Untersatz immer noch in der Werkstatt?«, fragte er, während er in mehreren Zügen den Wagen, der nicht für schmale Schleichwege gebaut war, wendete.
Clara verdrehte die Augen. Ihr knallroter Toyota Yaris, ihre Knutschkugel, hatte den Geist aufgegeben. Vermutlich ein Marderbiss.
Sie liebte den unschuldigen dörflichen Charakter, den Eriskirch verströmte. Von so manch einem ihrer LKA-Kollegen in Hamburg war sie müde belächelt, ja fast schon verspottet worden, weil sie sich nach ihrem durchschlagenden Erfolg in Japan doch tatsächlich in die Niederungen einer normalen Mordkommission am Bodensee versetzen lassen wollte. Doch der Tapetenwechsel war bitter nötig gewesen! Ihre Mutter war erblindet und auf eigenen Wunsch hin aus dem Kloster in der Schweiz in ein betreutes Altersstift nach Langenargen übergesiedelt. Langenargen war der Ort ihrer Kindheit. Clara konnte verstehen, dass es ihre Mutter dorthin zurückzog. Und sie wollte nach dem Verlust ihrer Sehkraft für sie da sein. Aus Hamburg heraus ein Ding der Unmöglichkeit. Alles wäre aus Hamburg heraus unmöglich gewesen. Das Leben war vergänglich. Japan war wie ein Weckruf gewesen.
Marcs Wagen hatte mittlerweile das kurze Waldstück bei Moos hinter sich gelassen und war an der Kreuzung auf die Landstraße in Richtung Langenargen abgebogen. Clara blickte zu ihrem Kollegen hinüber und musterte ihn. Er nahm nicht nur die Kurven rasant wie ein Stuntman. Er hatte auch das Erscheinungsbild eines Actionstars. Der sieht aus wie Til Schweiger!, schoss es Clara unwillkürlich durch den Kopf, als sich der Wagen geschmeidig in die Kurve legte. Kein anschmachtendes Wow. Nein, mit Männern war sie definitiv durch. Eher eine Art Aha-Erlebnis.
Mit seinen fünfunddreißig Jahren fühlte Marc sich fit und stark und männlich. Auch das hatte Clara begriffen. Er war sportlich und durchtrainiert, die Sorte Mann, die nach einem kräftezehrenden Triathlon gleich noch den nächstbesten Gipfel erklomm. Und tatsächlich war Marc ein passionierter Läufer. Einer, der auch Berge hochwuselte. Der stattliche, muskulöse Körperbau konnte sich sehen lassen. Die kurzen dunkelblonden Haare und das Kinngrübchen verliehen ihm diese extreme Ähnlichkeit mit Til Schweiger. Auch der Dreitagebart.
Ja, sie hatte diese Marotte. Immerzu suchte sie in ihren Mitmenschen Ähnlichkeiten mit prominenten Persönlichkeiten. Bei sich selbst hatte sie aufgrund der Katzenaugen und der spitzen Nase eine Prise Andrea Sawatzki diagnostiziert. Obwohl sie überhaupt keine roten Haare hatte.
Auch Marc hatte nicht die für den zwischen Manta, Explosionen und diversohrigen Knuffeltieren heimischen Filmstar so typischen verkniffenen Augen. Satte, schilfgrüne, leicht mandelförmige hatte er. Er näselte auch nicht so nervtötend. Vorne trug er das Haar ein wenig länger und zur Tolle gegelt. Rockabilly-like. Verwegen. Und dann war da noch dieses kidneybohnenförmige Muttermal auf Marcs Stirn oberhalb der rechten Augenbraue. Dennoch brachte sein unverhohlener Hang zu schluffigen Bootcut-Jeans und Kaschmirpullovern den Rollfilm in Claras Kopf mächtig in Schwung. Marc war der Tschiller, Schweigers »Tatort«-Alter-Ego, mit der Kidneybohne.
Auch wenn sie eher der Sportmuffel war, so hatten sie und ihr Kollege doch eine Gemeinsamkeit. Beide hatten sie kein glückliches Händchen für intakte Beziehungen. Marc lebte von seiner Noch-Ehefrau Andrea getrennt. Sie war mit ihrem gemeinsamen Sohn Paul in ihrem Haus in Konstanz geblieben. Die Scheidung stand bevor, und es war nicht aus der Luft gegriffen, dass ihr das alleinige Sorgerecht für den neunjährigen Spross zufallen könnte.
Marc war schon immer Vollblutkommissar gewesen. Zu oft fristete er auch die Abendstunden in seinem Büro im Friedrichshafener Kommissariat, oder er schleppte seine Fälle gedanklich oder gleich stapelweise in Akten mit nach Hause. Für seine Familie war er dadurch ein wandelnder Geist in den eigenen vier Wänden gewesen, förmlich aufgefressen von den ihn belastenden Mordfällen. Dass er dann auch noch seine dienstfreie Zeit an den Wochenenden allein auf seinen Laufstrecken entlang des Obersees zwischen dem Konstanzer Trichter und der Bregenzer Bucht verbringen musste, hatte die ganze Sache nicht einfacher gemacht. Nun hatte er den Salat. Von seiner eigenen Frau vor die Haustür gesetzt.
Er hatte sich mit Sack und Pack in einer kleinen Dachgeschosswohnung in der Fußgängerzone der Friedrichshafener Innenstadt einquartiert. Immerhin konnte er sich jetzt den allseits gefürchteten Stop-and-go-Verkehr zwischen Friedrichshafen und Meersburg schenken. Außer dem unschlagbar kurzen Arbeitsweg konnte er diesem Schlamassel aber nur wenig abgewinnen. Seinen Sohn Paul sah er seit der Trennung nur noch selten.
Clara war es mit ihrem Thorsten nicht besser ergangen. Mit ihm hatte sie in Hamburg ein prunkvoll im Landhausstil gehaltenes Architektenhaus direkt an der Alster bewohnt. Doch bis auf den Wohnsitz hatten sie wenig bis gar nichts gemein gehabt.
Thorsten war Chefarzt in der Herzchirurgie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die liebesschwachen Pumpen zweier von Grund auf verschiedener Menschen hatte er nicht flicken können. Er war über zehn Jahre älter als sie. Nicht selten hatten sie sich nach der Arbeit wegen der Abendgestaltung in den Haaren gelegen.
Clara genoss den Feierabend gern auf der Couch. Ein Glas Rotwein zur Hand und ihre Lieblingssitcoms auf dem Bildschirm. Das Programm für Unterprivilegierte, wenn man Thorsten Glauben schenkte. Er war da anders gestrickt. Seine filigranen Hände, die tagsüber die Herzen seiner Patienten höherschlagen ließen, klimperten abends gern auf den Tasten des sündhaft teuren Steinway-Flügels. Das war aber bei Weitem noch nicht der größte Reibungspunkt gewesen.
Kinder. Bei diesem leidigen Thema waren die Funken erst so richtig geflogen. Tongewaltiger Knatsch inklusive. Je mehr Thorsten seine Manneskraft hatte schwinden sehen, desto unerbittlicher und fordernder war er in dieser Angelegenheit geworden. Clara wollte auf Gedeih und Verderb keine Kinder. Nicht nur, dass sie den Raubbau am eigenen Körper nicht hatte erdulden wollen. Diesem Argument hatte Thorsten ohnehin relativ zügig den Wind aus den Segeln genommen. Leihmutterschaft. Das magische Wort. Das nötige Kleingeld hierfür hatten sie gehabt.
Doch Clara wollte nicht nur keine Kinder bekommen. Sie wollte partout keine Kinder haben. Und ganz besonders keine Kinder aufziehen. Einen Cedric, der unter Genickstarre leiden würde, weil er immerzu seinen trendig lang gewachsenen Pony aus der Stirn schleudern musste? Eine Pia-Sophie, raus aus der Wiege, rein in den Influencer-Beauty-Salon? Oder einen Kevin, der die Augen seiner Brudis küsste?
Aber das kratzte lediglich an der Oberfläche. Fassade wahren. Ihr Hemmnis lag weitaus tiefer vergraben. Warme Mutterworte? Sie wäre stumm. Muttergefühle? Taub. Mutterliebe? Blind im Herzen. Nie hatte sie Mutterliebe erfahren. Nie würde sie eigene Mutterliebe aufbringen können. Nein, diesem Fass ohne Boden wollte sie sich nicht hilflos aussetzen. Nicht in einer Million Jahren. Dieser Kelch konnte getrost an ihr vorübergehen.
Und das war er. Sie hatte den Kelch zerbrochen, unverblümt Tatsachen geschaffen. Gekappte Eierstöcke. Das Öl im zu lange auf Sparflamme gehaltenen Feuer. Die Fronten waren danach hart wie Beton gewesen. Vor die Tür hatte er sie nicht setzen müssen. Sie hatte freiwillig ihre Siebensachen gepackt und war in eine biedere Einliegerwohnung in der Innenstadt gezogen. Die Scheidung hatte sie eingereicht. Mittlerweile war es nur noch der Nachname, der sie mit ihm verband. Scheiternde Beziehungen. Eine Berufskrankheit der Kommissare.
Die große Blitzerkiste am Straßenrand hatte Marc eben erst in allerletzter Sekunde registriert. Gerade noch rechtzeitig, um beherzt auf die Bremse zu tappen. Oft war es das Offensichtliche, das man übersah. Er blickte sich nach seiner schweigsamen Beifahrerin um. Der Ruckler hatte sie nicht aufgerüttelt. Sie schaute gedankenverloren aus dem Fenster.
Eigenartig. Sie hatten noch kein Sterbenswörtchen zu ihrem bevorstehenden Mordfall gewechselt. Gerade überquerten sie den Bahnübergang am Ortseingang bei Langenargen. Rechter Hand stach Marc ein besonders hübsches Backsteinhaus ins Auge. Dessen Außenfassade hatte eine überreiche Blauregenstaude mit ihren schlangenartigen blauvioletten Blüten in unbändigem Wuchs erobert.
Marc fuhr den Wagen in den kopfsteingepflasterten Ortskern und drosselte das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit. Schließlich wollte er den Smiley auf der Tempoanzeige nicht mit bedröppelter Lätsche sehen. Sofort sprang ihm der übergroße gelbe Wegweiser gegenüber der Kirche ins Auge. »Uferpromenade 0,1km«, teilte er mit. Eine Zeile tiefer prangte neben der Aufschrift »Katholische Kirche« ein Pfeil, der auf das Kirchengebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeigte. Marc musste schmunzeln. Verirren konnte man sich in dieser Seelenbaumel-Oase nicht. Örtliches Navi im Wohlfühlpaket kostenlos inbegriffen. Ein Schilderdschungel, für den der gute Kolumbus auf seiner Suche nach Indien sicherlich sein letztes Edelmannhemd gegeben hätte.
Sie passierten rechter Hand das Altersstift, in das sich Claras Mutter hatte einquartieren lassen. Links folgte das Langenargener Rathaus, davor auf dem Marktplatz der Fischerbrunnen mit den wasserspeienden Fischen im Netz. Der wurde an Ostern immer so herrlich aufgeschmückt. Jetzt im Sommer wurden auf dem Brunnentrog bei Rast und Ruhe die Eiswaffeln geknuspert.
Schließlich ließen sie den Ortskern hinter sich. Auf der Oberen Seestraße erblickte Marc den knallroten Steinbau des ehemaligen Amtshauses mit seinem Staffelgiebel. Die eingemauerte Kanonenkugel war ein echter Hingucker. Diese hatten die streitlustigen Truppen Napoleons im Mai 1800 vom Bodensee aus in die Fassade des vormaligen Gebäudes gedonnert. Sein Blick verfinsterte sich. Der Mord letzte Nacht war dem Örtchen ebenfalls tief ins Mark hineingedonnert worden.
Am Ende der Straße lag die kleine Stichstraße zur Malerecke vor ihnen. Weit kamen Marc und Clara allerdings nicht, denn es wimmelte bereits von Transportern der regionalen und überregionalen Medien. Marc stellte hinter der Kolonne den Motor ab.
»Wie … ist der Fall denn gelagert?«, fragte ihn Clara endlich.