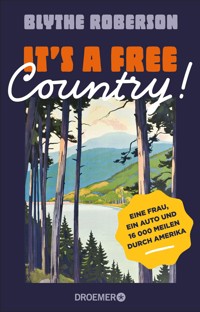
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Roadtrip ihres Lebens: Eine junge Frau reist allein quer durch die USA Als Blythe Roberson ihren Job bei einer Late-Night-Show kündigt, um in einem alten Prius 16.000 Meilen durch die USA zu fahren und mehrere Dutzend atemberaubend schöne National-Parks zu bewandern, treibt sie vor allem eine Frage um: Was bedeutet eigentlich Freiheit und warum manifestiert sich unsere Sehnsucht danach ausgerechnet im Reisen? Warum brechen jedes Jahr Hunderttausende Touristen zum selben Roadtrip auf und machen dieselben klischeehaften Selfies für Instagram? Ein spannender Reisebericht, der die USA in allen Facetten zeigt Auf der Suche nach Antworten bereist Blythe einige der atemraubendsten Natur-Wunder der USA: - mehrere Dutzend Nationalparks, darunter den Glacier National Park, den Wind Cave National Park und den Yosemite National Park - den Pacific Coast Highway - die Wüste des Südwestens – mit einem spektakulär schlechten Timing mitten im Juli Scharfsinnig und gleichzeitig witzig analysiert die junge Frau dabei Amerikas Schattenseiten. Sie wirft einen Blick auf drängende Probleme wie Klimawandel, Rassismus, Sexismus und Post-Trumpismus. So entsteht das Porträt einer zerrissenen Nation, die auf Land errichtet wurde, das ihren Gründungsvätern nicht gehörte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Blythe Roberson
It’s a free country!
Eine Frau, ein Auto und 16000 Meilen durch Amerika
Aus dem amerikanischen Englisch von Christiane Bernhardt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Blythe Roberson ihren Job bei einer Late-Night-Show kündigt, um in einem alten Prius 16.000 Meilen durch die USA zu fahren und mehrere Dutzend atemberaubend schöne National-Parks zu bewandern, treibt sie vor allem eine Frage um: Was bedeutet eigentlich Freiheit und warum manifestiert sich unsere Sehnsucht danach ausgerechnet im Reisen? Und wie kommt es, dass sich jährlich Hundertausende Menschen auf der Suche nach Freiheit auf denselben Roadtrip begeben, um an den immer gleichen Hotspots dieselben klischeehaften Selfies für Instagram zu machen?
Auf der Suche nach Antworten führt sie uns nicht nur durch spektakuläre und vielfältige National-Parks, zum Ozean und den Pacific Coast Highway hinunter, und - in einem spektakulär schlechten Timing - mitten im Juli durch die Wüste des Südwestens, sondern spricht auch Amerikas Schattenseiten und drängende Probleme an: So zeichnet Roberson in ihren scharfsinnigen und gleichzeitig witzigen Analysen das Porträt einer zerrissenen Nation, die mit dem Klimawandel, Rassismus, Sexismus und Post-Trumpismus zu kämpfen hat und die auf Land errichtet wurde, das ihren Gründungs-Vätern nicht gehörte.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Hinweis
Wir leben in einem freien Land
Die Plains
Hermergency
Eine ziemlich komplexe Fleischmaschine
Das ist wirklich schwer
Leaves of gas, grass, or ass
Der Intermountain West
Ein seltsamer Kaktus, bei dem es richtig läuft
Warum ist dieser Stein nicht berühmt?
Der Wedgie-Test
Wo sperren sie nachts die Bisons hin?
Habt ein bisschen Respekt, for fuck’s sake
Die Westküste
Heroischer Naturabenteurer
Das Leben eines normalen Menschen führen
Nichts für ungut, ihr Wolken
Gegen die Ausbeutung des Yosemite
Nationalparks sind beschissen
Der Südwesten
Bäume sehen, solange es noch Bäume gibt
Zuschauen und brüllen
Okay, Marfa ist voll nice
Rückkehr zu den »Toilette Frauen«
Dank
Für alle, die mir auf meinem Weg geholfen haben
Zur Wahrung der Privatsphäre wurden Namen und verschiedene Charakteristika der Personen geändert, die ich auf meiner Reise getroffen habe.
Einleitung
Wir leben in einem freien Land
Du kannst nur so und so viele Gedichte über das Freisein lesen, Joni Mitchells Reisealbum Hejira nur so und so oft anhören, bevor in deinem Inneren etwas zerreißt. Am 17. Januar 2019 starb die Dichterin Mary Oliver, und ich saß an meinem Schreibtisch im Büro und ignorierte meine Arbeit, um ihr Gedicht »Moments« zu lesen, das davon handelt, das Leben voll auszukosten, solange man lebt, und dass das Langweiligste überhaupt ist, Vorsicht walten zu lassen.
Fuck, dachte ich. Ich muss kündigen.
In diesem Moment traf ich die Entscheidung, und zwei Monate später tat ich es. Und dann, weil man so etwas nach einer Kündigung offiziell tun muss, begab ich mich auf einen Great American Road Trip, einen Großen Amerikanischen Roadtrip.
Ich hatte bereits jahrelang davon geträumt, einen langen Roadtrip zu machen, aber natürlich klappte es nie. In diesen Jahren begann ich, glaubwürdig zu behaupten, Google Maps sei meine Lieblingshomepage, dass ich die ausgefeilten Roadtrips, die niemals Wirklichkeit wurden, dort »zum Spaß« plante. Meist entwarf ich meine theoretischen Reisen mit der Idee, etwas über sie zu schreiben. Zu Beginn träumte ich von einem Roadtrip, auf dem ich alle Männer besuchen würde, für die ich je Gefühle gehabt hatte, um »sie zu interviewen« (rumzumachen). Diese Idee verdankte ich weniger der Überzeugung, dass daraus ein spannendes Buch würde, als der Erkenntnis, dass meine Crushes sich über das ganze Land verteilt hatten, was eine interessante Route versprach.
Dann wurde mir Folgendes klar: Auch wenn ich eine puritanische Bitch bin, die sich keinen Spaß zugestehen kann, ohne sich dabei eine Hausaufgabe zu geben, war es mir sehr wohl erlaubt, einen Roadtrip zu machen, ohne darüber zu schreiben. Und so verbrachte ich die nächsten dreieinhalb Jahre, immer wenn ich freihatte, mit Roadtrips. Im Laufe dieser Reisejahre dachte ich darüber nach, warum ich unbedingt mit einem Auto durch Amerika fahren wollte, warum ich mich einmal in einen Typ verknallt hatte, nur weil er mir von seinem Roadtrip erzählte. Ich dachte über die kanonischen amerikanischen Reiseerzählungen nach, in denen der Roadtrip als Inbegriff der Freiheit inszeniert wird. Und ich fragte mich, warum der amerikanische Kanon so wenig Reiseliteratur enthält, die von Frauen verfasst wurde, und was das für mich bedeutete, eine Frau, die unterwegs sein wollte.
Als mein Gehirn sich nicht mehr allzu sehr an ein regelmäßiges Einkommen und eine arbeitgebergebundene Krankenversicherung klammerte, nachdem ich entschieden hatte, es sei vernünftig und tatsächlich sogar richtig gut, meinen Job zu kündigen, um mich auf das Schreiben zu konzentrieren und, na ja, also, frei zu sein, beschloss ich, eine amerikanische Reiseerzählung aus weiblicher Sicht zu verfassen. Mein Buch sollte die folgende Frage beantworten: Was wäre geschehen, hätte Reiseschriftsteller Bill Bryson seine Tage bekommen? (Die Frage, was passiert wäre, wenn Jack Kerouac seine Tage bekommen hätte, stellte sich erst gar nicht: Er wäre ausgeflippt und hätte seinen Roadtrip abgebrochen. Es hätte der Beatgeneration ein Ende gesetzt.)
Ich würde also losfahren und darüber schreiben. Aber … wohin wollte ich eigentlich fahren? Für eine Reise, die so lang ist, dass sie ernsthafte Reflexion verdient, braucht man eine organisatorische Leitlinie. Meine war eine abgewandelte Version eines »optimierten« Roadtrips durch die Nationalparks. In den vergangenen Jahren hatte ich mehrere Artikel über Menschen gelesen, die alles genau berechnet und die – rein mathematisch – beste Strecke gefunden hatten, um alle Nationalparks in den aneinandergrenzenden 48 Bundesstaaten zu besuchen. Ich wusste noch nicht, in welchen Parks ich am Ende campen, in welchen ich nur ein paar Stunden wandern und welche ich ganz auslassen würde, aber ich wusste, dass ich eine dieser von einem Algorithmus generierten Superkarten als Orientierungshilfe benutzen wollte.
Meine Entscheidung, monatelang am Stück zu campen und zu wandern, war keine Mutprobe. Es sollte keine Feuertaufe werden, um herauszufinden, ob ich meinen Rucksack einen Berg hinaufschleppen könnte oder etwas über mich selbst lernen würde, wenn ich in der freien Natur schlief. Wandern hatte mir bereits etwas über mich beigebracht, zum Beispiel: Wenn ich länger als fünf Minuten Sport treibe, werden mein gesamtes Gesicht und mein Körper knallrot und bleiben es für den Rest des Tages. (Ich habe irische Vorfahren.) Dafür fühle ich mich wohl in der Natur, es fühlt sich richtig an; ich bin ein Outdoor-Typ. Wandern gehört zu den drei Dingen, die mir wirklich am Herzen liegen, neben Tennis und Dramaserien über erfolgreiche Frauen, die zu viel trinken.
Meine Liebe fürs Campen und Wandern kann ich auf einen Kindheitsausflug an den Devil’s Lake zurückführen, einen State Park in Wisconsin, etwa drei Stunden Fahrt von dort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. An den Ufern des Devil’s Lake stehen an die 150 Meter hohe Quarzitklippen. Für Kinder, die in der Eintönigkeit flacher Maisfelder aufwachsen, eine Sensation. Eines Sommertags quetschte mein Stiefvater TB – dessen echter Name Tom Brandes ist, der von meinen Freund*innen und mir irgendwann TB Ice getauft wurde, typisch 2000er – alle Kinder aus der Nachbarschaft hinten in seinen weißen Kidnapper-Van und fuhr uns für einen Campingausflug an den Devil’s Lake, ohne dass auch nur eine*r von uns angeschnallt gewesen wäre. Rückblickend betrachtet, wählte er den Devil’s Lake wohl nicht aufgrund seiner majestätischen Klippen, sondern eher, weil drei Stunden Fahrt die Maximalzeit sind, die man mit einer Meute nicht angeschnallter Kinder hinten im Van fahren kann, ohne aufgrund eines Schwerverbrechens verhaftet zu werden.
Am zweiten Tag unseres Ausflugs nahm TB das – zumindest in meiner Erinnerung – Dutzend Kinder auf eine von einem Ranger geführte Wanderung mit. Am Ende der Wanderung beschrieb der Ranger eine Felsformation, die alle, die sich dafür interessierten, in etwa 150 Metern Entfernung bestaunen konnten. Nach einer halben Stunde keimte in uns der Verdacht, dass wir mehr als nur etwa 150 Meter gelaufen waren. Genau genommen hatten wir keine Ahnung, wo wir uns befanden. In seiner Funktion als einziger Erwachsener erklärte uns TB, dass wir umkehren und unsere Schritte zurückverfolgen müssten. Doch wir – 25 vorpubertäre Rowdys – waren viel zu aufgedreht. »Nein!«, schrien wir. »Wir wollen weitergehen!« Tom wiederholte, wir hätten uns verlaufen und es wäre besser, umzukehren. »Wir leben in einem freien Land! Lasst uns darüber abstimmen!«, forderten wir, und die Kinder überstimmten den Erwachsenen vierzig zu eins.
Und so liefen wir tiefer in den Wald. Wir liefen an einer Spalte in einem gigantischen Quarzit-Block vorbei und tauften sie trunken vor Macht auf den Namen »TBs Arschritze«. Wir malten uns aus, unwiederbringlich verloren zu sein, auch wenn wir rückblickend betrachtet mindestens einen Wegweiser passierten. Wir wanderten ein Geröllfeld hinab, das unserer Ansicht nach unmöglich Teil des Wanderwegs sein konnte, aber definitiv dazugehörte.
Ich fühlte mich, als sei alles möglich; vielleicht war es das erste Mal, dass ich jeden Moment bewusst erlebte. Ich fühlte mich hellwach. Und damit war ich nicht allein. Der Ausflug weckte in allen der 400 anwesenden Kinder ein tiefes Verlangen, auf unbefestigter Erde zu schlafen. Auch 20 Jahre später gehen diese Kinder aus der Nachbarschaft und ich immer noch zusammen zelten. Wir erklimmen Berge und duschen eine Woche lang nicht. Und jedes Mal versuchen wir erneut, verlorenzugehen.
Der Unterschied zwischen den Ausflügen mit meinen Freund*innen und der Reise, die ich bald ganz allein antreten sollte, war, dass ich nicht eine Woche unterwegs wäre, sondern monatelang. Allerdings hatte ich keine Vorstellung, wie viele Monate genau. Ich hatte eine Liste der Parks und die Reihenfolge, in der ich sie besuchen wollte, sonst hatte ich, in Sachen Planung, nichts. Diese Ungewissheit war für mich weit unangenehmer, als mitten in der Wüste auf hartem Untergrund zu schlafen oder, wie ich es dann ebenso oft tat, im Prius meines Stiefvaters, weil ich zu faul war, mein Zelt aufzubauen. Ich bin eine Planerin. Von Natur aus. Ich bin »überspannt«. Ich bin jemand, der für eine einwöchige Reise ein achtseitiges Google-Dokument vorbereitet. Doch diesmal flog ich an einem Dienstag los und hatte keine Ahnung, wo ich am Mittwoch schlafen würde. Der Versuch, das Universum eine Woche lang meinem Willen zu unterwerfen, war das eine. Die Erwartung, die Reise würde sich meinem Willen monatelang am Stück unterwerfen, schien derart aussichtslos, dass ich es erst gar nicht versuchte. Studien zeigen, dass der halbe Spaß einer Reise in der Planung besteht; in diesem Fall bestand der halbe Spaß wohl in der Frage, ob es mir gelingen würde, mich einen Sommer lang einfach treiben zu lassen.
An dieser Stelle folgt, was ich bereits geklärt hatte: Als Ausgangspunkt sollte mir die optimierte Nationalpark-Route dienen, die ich jedoch leicht abwandeln würde, sodass sie nur Parks enthielt, von denen ich bislang kein Junior-Ranger-Abzeichen hatte – kleine Plastikanstecker, die man sich im Rahmen des Junior-Ranger-Bildungsprogramms verdient, indem man ein Arbeitsheft für Kinder ausfüllt. Ich war verrückt nach ihnen, seit ich meinen ersten am Devil’s Lake bekommen hatte, einen Anstecker, der mit einem Pilz geschmückt war. Er ist unglaublich gut gealtert: Bei meinen Freund*innen, die entweder Halluzinogenen zugeneigt sind oder Pilzsammel-Accounts auf Instagram folgen, ist er der absolute Hit (insgesamt entspricht das 100 Prozent meiner Freund*innen).
Der einzige Grund, warum ich möglicherweise ohne festen Reiseplan durchkommen würde, war mein Plan, jede Nacht wild zu campen, da ich die Reise ohne Einnahmequelle antrat. Erst wenige Jahre zuvor hatte ich von einem Freund erfahren, dass man in Nationalforsten sowie auf öffentlichen, durch das Bureau of Land Management verwalteten Flächen kostenlos übernachten konnte. Es gab sogar eine Website mit beliebten Zeltplätzen, aber mein Freund riet mir dazu, solche Plätze für mich zu behalten, damit sie nicht zu bekannt würden. Anscheinend folgte auch die Benutzeroberfläche der Website diesem Rat: Sie war unübersichtlich und verwirrend. Sie erweckte den Eindruck, als sei sie zuletzt vor der Erfindung des Internets aktualisiert worden.
Wildcampen bedeutet kein Zugang zu Annehmlichkeiten wie Sanitäranlagen – man kann sich glücklich schätzen, wenn man ein Plumpsklo findet, was, wie der Name nahelegt, eine Klobrille über einem großen Loch im Boden ist. Fließendes Wasser gibt es eigentlich nie. Duschen sind ganz offensichtlich ausgeschlossen. Aber, sehr wichtig: Es kostet nichts. Und da man für einen kostenfreien Zeltplatz oft tief in ein Naturschutzgebiet hineinfahren muss, kommt es vor, dass man inmitten einer umwerfend schönen Naturkulisse übernachtet.
Aufgrund der Abgeschiedenheit der meisten Gratiszeltplätze hätte ich oft keinen Zugang zum WLAN – was den Reiz, Naturlandschaften und unberührte Orte zu besuchen, ja gerade ausmachte. Die Jahre, in denen ich als Mitarbeiterin des Recherche-Teams für The Late Show with Stephen Colbert arbeitete, überschnitten sich mit den Jahren, in denen Donald Trump als Präsident kandidierte und gewählt wurde und dann damit fortfuhr, die Schlagzeilen mit einer psychotisch anmutenden Anzahl schrecklicher Entscheidungen, Aussagen und Skandalen zu dominieren, die teils seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung und teils der psychologischen Kriegsführung Steve Bannons zu verdanken waren, die die Bevölkerung Amerikas gegen Leid abstumpfen sollte. Jahrelang gehörte es also zu meinem Job, immer zu wissen, was Trump und sein Gefolge gerade im Schilde führten. Ich freute mich darauf, während meiner Reise nicht ständig online sein zu müssen. Wie so viele Amerikaner*innen habe auch ich ein schlechtes Gewissen wegen der Zeit, die ich damit verbringe, auf Bildschirme zu starren. Allerdings steige ich auch liebend gern auf einen Berg, setze mich an einen schönen Aussichtspunkt und checke meine E-Mails.
Dennoch, ich hoffte, dass es mir gelingen würde, mich auf diese Reise einzulassen. Ich hoffte, für ein paar Monate ohne meine Freund*innen und mein Drama auszukommen, meinen pawlowschen Instinkt, dank dem ich 400 Mal am Tag Instagram aufrief, lange genug ignorieren zu können, um das Unterwegssein wirklich zu erleben. Ich vermutete und hoffte, dass, wäre ich wirklich präsent, eine Form der Alchemie wirksam werden und mein Vorhaben (eine unverschämt lange Urlaubsreise) transzendieren würde, damit ich zum Kern von irgendetwas vorstoßen könnte. Zum ersten Mal in meinem Leben gestand ich mir zu, frei zu sein und in Vollzeit zu schreiben. Und genau davon wollte ich erzählen.
Ich war fest entschlossen: Ich wollte einen Großen Amerikanischen Roadtrip machen. Ich hatte ein paar Fragen, über dich währenddessen nachdenken wollte, auch wenn sich viele erst noch ergeben würden – Fragen zur Geschichte der Parks, die Teil der finsteren Geschichte Amerikas ist; zu den riesigen Menschenmassen, die die Parks heimsuchen; wie viele Wochen eine Frau allein im Auto unterwegs sein kann, bevor sie äußerst gereizt oder horny wird – oder beides. Auch wenn mir jedes Mal Stresspickel sprießen, wenn meine Pläne durchkreuzt werden, wusste ich, ich würde akzeptieren müssen, dass diese Reise über mich bestimmen würde und nicht etwa umgekehrt. Und so buchte ich eines Tages mitten im Frühjahr 2019 ein Flugticket nach Chicago.
I
Die Plains
1
Hermergency
Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, wie es so schön heißt. Aber das ist falsch: Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit der Überlegung, was man einpacken soll.
Wie packt man für eine Reise mit unbestimmtem Ende quer über einen Kontinent? Ich plante, einen Frühling und Sommer lang weg zu sein und sowohl schneebedeckte Berge als auch Wüsten zu erkunden. Ich wollte Kleidung einpacken, in der ich mich sexy fühle und wie ich selbst, würde zugleich jedoch aus einer Reisetasche leben und über lange Strecken nicht duschen können. Ich würde wandern und schwimmen und vom Regen überrascht werden; etwas einzupacken, das nicht nass oder schmutzig werden durfte, ergab also keinen Sinn. Es war eine große Herausforderung, denn selbst an Tagen, an denen ich Zugang zu meinem gesamten Kleiderschrank habe, fällt es mir schwer, ein stimmiges Outfit zusammenzustellen.
Jede Entscheidung stellte mich vor neue Probleme. Ein Beispiel: Welche meiner Baseballkappen würde mich nicht wie Teil der Ostküstenelite aussehen lassen? Eine New-Yorker-Kappe war ein offensichtliches No-Go. Meine Yankees-Kappe kennzeichnete mich etwas weniger offensichtlich als New Yorkerin oder doch wenigstens als New Yorkerin, die »Sport« mag und nicht »Lange Artikel von Jill Lepore«. Ich hatte eine Harry-Styles-Kappe, eine schlichte schwarze Schirmmütze, auf der nur »Harry« stand – mit ihr wäre alles möglich gewesen, hätte nicht jede*r, der oder die mich mit der Kappe sah, gleichermaßen angenommen, dass sie sich auf Harry Connick Jr. bezog, einen Schnulzenschreiber. Auch wenn ich nicht wusste, welche Art chaotische Energie solche Leute zu diesem Schluss verleitete, war das nicht die Energie, von der ich mich auf meiner Reise leiten lassen wollte.
Bei jedem Teil, das ich einpackte, stellte ich mir die folgende Frage: Werde ich aufgrund dieses Kleidungsstücks ermordet werden? Wenn ich anderen davon erzählte, dass ich demnächst allein durch Amerika fahren wollte, war die erste Reaktion immer, dass ich umgebracht würde. Manchmal, ganz selten, gab mir mein Gegenüber stattdessen einen Ratschlag, wie man nicht ermordet wird. Mein baldiges Ableben war für sie noch wahrscheinlicher, wenn ich ihnen erzählte, dass ich vorhätte, hauptsächlich inmitten der Pampa wild zu campen. Sie waren überzeugt, dass dies zu Schlagzeilen führen würde wie »Frau beim Wildcampen getötet« oder »Leichnam vermisster Frau endlich gefunden, ermordet, nachdem sich Polizeibeamte fragten, wo der dämlichste Ort zum Campen sei und dann dort nachsahen« oder »Neue Einzelheiten: Beine getöteter Camperin offensichtlich wochenlang nicht rasiert«. Unter den »Blythe wird ermordet«-Truthern befand sich auch TB. In den Wochen vor meinem Abflug nach Chicago, wo meine Reise beginnen sollte, versuchte er, mich davon abzubringen, mir seinen schwarzen Prius auszuleihen. Nicht weil er Angst hatte, dass ich damit einen Unfall verursachen würde (davon gingen ohnehin alle aus). Sondern weil er glaubte, der Prius würde mich nicht ausreichend davor schützen, umgebracht zu werden.
TB ist von Mord und Totschlag besessen; meinen Tod vorherzusagen, ist für ihn wie ein Hobby. Er ist jemand, dem mehrere seiner Kinder unabhängig voneinander Ich ging in die Dunkelheit (über die wahre Suche nach dem Golden State Killer) zu Weihnachten schenkten. Am Telefon wollte mich TB davon überzeugen, den Campingbus zu nehmen, den er aus irgendeinem Grund kürzlich gekauft hatte.
»Nimm ihn bloß nicht«, unterbrach ihn meine Mom. »Der Bus ist hässlich und verbraucht viel zu viel Benzin.«
»Er ist nicht hässlich, innen ist er wirklich hübsch«, protestierte TB. »Er schafft zwölf Meilen pro Gallone.«
Idealerweise hätte ich meine Reise in einem kompakten Fahrzeug angetreten, einem, das leicht zu handhaben ist, sich für unwegsames Gelände eignet und einen geringen Benzinverbrauch hat. Ein Pluspunkt wäre gewesen, hätte das Auto alle Fremden, die mir begegneten, auf der Stelle darüber informiert, dass ich übrigens cool bin. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich die Straße in einem Jeep erobert oder vielleicht einem Geo Tracker, ein Fahrzeug, über das ich so gut wie nichts wusste, außer, dass es wie ein Jeep aussah und die ungemein hippe, lilahaarige Frau, die meine Haare schnitt, einen hatte. Die Sache ist nur, dass es nie nach mir geht und ich gewillt war, mich mit »leicht zu fahren«, »Fahrleistung mehr als zwölf Meilen pro Gallone« und wenn nicht »für unwegsames Gelände geeignet, ohne dem Auto zu schaden«, dann wenigstens »schon so zerbeult, dass man problemlos gegen ein paar Steine fahren kann, ohne dass es etwas ausmacht« zufriedenzugeben. In diesem Sinne war der Prius meines Stiefvaters, der augenscheinlich einen Hagelsturm überstanden hatte und mindestens einen Zusammenstoß mit einem Auto-förmigen Objekt, genau das, was ich brauchte.
Dass ich als Frau plante, monatelang allein unterwegs zu sein, ließ alle, mit denen ich sprach – Freund*innen, Kolleg*innen, Fremde – an einen gewaltsamen Tod denken. Und dabei waren diese Leute anscheinend ganz normal! Anders als TB konnten sie einem, wenn sie eine GPS-Koordinate hörten, nicht von einer jungen, mir selbst durchaus ähnlichen Frau erzählen, die kürzlich innerhalb eines Radius von zehn Meilen ermordet wurde. Aber über das Folgende waren sich alle einig: Ich wäre allein. Ich würde in Gefahr schweben. Ich würde umgebracht werden. Es sei denn! Ich kaufte jede Menge unglaublicher Produkte, einzig dafür entwickelt, ebendies zu vermeiden. So wie wir Frauen Ratschläge erteilen, um nicht vergewaltigt zu werden, anstatt Männern Ratschläge zu erteilen, um Frauen nicht zu vergewaltigen, überhäuften mich meine Mitmenschen nicht nur mit Ratschlägen, um nicht ermordet zu werden, nein, sie brachten mich auch der Lass-Dich-Nicht-Ermorden-Industrie näher.
Eine der wichtigsten Produktkategorien des industriellen Lass-Dich-Nicht-Ermorden-Komplexes sind Geräte zur Standortverfolgung. Beinahe jede*r, dem oder der ich von meiner Reise erzählte, empfahl mir einen Standort-Tracker. Allen Menschen in der Welt zu erlauben, mich wie den Lieferstatus einer Pizza von Domino’s zu tracken, würde mich natürlich nicht davor bewahren, umgebracht zu werden. Wenn überhaupt würde es ihnen ermöglichen, so schnell wie möglich herauszufinden, dass ich umgebracht wurde.
Dann waren da die Produkte, die mich davor schützen sollten, ermordet zu werden, oder es doch wenigstens etwas weniger attraktiv machen sollten, mich zu ermorden. Als ich zwei Frauen bei Drinks von meinen Reiseplänen berichtete, erzählte mir eine von einer Website namens Damsel in Defense, auf der ihre Mutter ihr eine pastellfarbene Elektroschockpistole gekauft hatte. Ich rief die Website auf; für 70 Dollar bekam man einen Elektroschocker, der, in sanftem Licht auf einer Couch neben einer Reihe von Dekokissen fotografiert, exakt aussah wie ein Sexspielzeug. Man konnte außerdem Notfallpfeifen kaufen oder, wie sie auf der Website genannt wurden: »Hermergency Necklaces«. Sie hatten auch ein auffälliges Teil im Angebot, aus hellblauem Aluminium, mit einer schlanken silbernen Spitze. Ich zeigte den beiden Frauen meinen Handybildschirm.
»Sorry«, sagte ich. »Das soll ich mir aber nicht in den Hintern schieben, oder?«
Wird einem ständig der eigene, kurz bevorstehende, gewaltsame Tod vorhergesagt, ist das nicht nur eine emotionale Belastung, mit der sich Männer vor einer Reise nicht auseinandersetzen müssen. Es ist auch eine finanzielle Belastung. Männer müssen sich nicht anhören, dass sie auf ihren Solo-Reisen umgebracht werden, ergo müssen sie keine 70 Dollar für einen Elektroschocker ausgeben. Sie decken sich nicht mit Pfefferspray ein. Was sie einpacken, sind Dinge, die sie in der Wildnis schützen – ein Messer oder eine Dose Bärenspray (eine Art Pfefferspray, das benutzt wird, um Bären abzuschrecken und nicht, das ist wichtig, um sich selbst damit einzunebeln wie mit einem Insektenspray) –, aber nicht vor anderen Menschen. Ich habe keinen Freund, der eine Elektroschockpistole oder eine besonders schrille Trillerpfeife besitzt oder dem seine Familie nahelegte, ebenjene Dinge zu besorgen, bevor er allein loszog. Und Freunde mit einem Stiefvater wie TB – der mir anbot, mir eine Pistole zu beschaffen – habe ich erst recht keine. Ich beschloss, nichts zu kaufen, wofür Männer kein Geld ausgeben müssen. Bärenspray sollte als Schutz genügen. Auch wenn ich es am Ende vergaß.
Ich wusste, dass ich auf meiner Reise nicht ermordet würde. Das war doch klar! Zugleich kann ich nicht leugnen, dass mich der Gedanke daran, auf meiner Reise zu sterben, umtrieb: Vielleicht würde ich in einen Autounfall verwickelt oder von einer Klippe stürzen oder ein Reh … würde mich töten. Oder ich würde doch ermordet werden, klar. Es dauerte lange, bis ich mich an den Gedanken gewöhnte, die Reise immer nur wenige Tage im Voraus zu planen; danach war es leicht, meine Sterblichkeit zu akzeptieren. Wir alle müssen eines Tages abtreten! Und wenn ein Reh das Verlangen verspürt, mich zu töten, sollte dieser Wunsch respektiert werden.
Manche gingen davon aus, dass ich auf Güterzüge aufspringen oder per Anhalter durch Amerika reisen würde, was beides natürlich sehr viel gefährlicher ist, als sich auf eine lange Autofahrt zu begeben; ich hatte nichts von beidem vor. Dass mir ein Auto zur Verfügung stand, das ich ausleihen konnte, und Geld für Benzin, war ein Privileg. Ich hatte nicht vor, es mir schwerzumachen, nur um irgendwie »real« zu sein; ich habe mich schon vor Langem damit abgefunden, dass ich nicht »real« bin. Ich hatte nicht vor, authentisch zu sein, so wie der Typ Mann, der sich aufgrund seines Treuhandfonds derart schlecht fühlt, dass er in die Wildnis trampt, um dort zu sterben. Ich habe keinen Treuhandfonds, aber hätte ich einen, würde ich mir von dem Geld einfach einen Geo Tracker kaufen.
Dabei war die Welt eigentlich gar nicht so gefährlich. Die Mordrate in den Vereinigten Staaten ging zurück – zumindest bevor uns Corona den Gesellschaftsvertrag über Bord werfen ließ. Es war nur so, dass die True-Crime-Serien, die meine Mom, mein Dad und meine Freund*innen mir gegenüber zitierten, wenn sie mir haargenau erklärten, wie ich zerstückelt werden würde, es aussehen ließen, als lebten wir in größerer Gefahr als je zuvor. »Wir« bezieht sich dabei auf einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung; oder, wie es meine Freundin Madelyn mir gegenüber einmal formulierte, als all meine anderen Freund*innen davon überzeugt waren, dass ich auf einem ersten Date beim Wandern außerhalb der Stadt ermordet würde: »Die True-Crime-Industrie zielt darauf ab, weißen Frauen Angst vor allem zu machen.«
Eine Frau zu sein, birgt gewisse Risiken, aber ich hatte gelernt, auf mich aufzupassen, und es wollte mir nicht in den Kopf, warum diese Risiken auf einem einsamen Berg irgendwo im Nirgendwo größer sein sollten als in meinem Alltag in Brooklyn, wo ich von betrunkenen Männern jeden Alters umgeben war, die vor meinem Apartment herumlungerten und den ganzen Tag redeten und nachts lauthals grölten. Unsere Gesellschaft ist von der Idee, Städte seien für Frauen im Alleingang gefährlich, ebenso besessen wie von der, alleine auf Reisen zu sein, sei für Frauen gefährlich. Wenn ich das eine entgegen aller Wahrscheinlichkeit so lange überlebt hatte, konnte das andere da wirklich so schlimm sein, wie die Gesellschaft es aussehen ließ?
Am ersten Morgen meines Großen Amerikanischen Roadtrips holte mich meine Mom vom O’Hare International Airport in Chicago ab und fuhr mich nach Wisconsin, um den Prius abzuholen. Am zweiten Morgen meines Großen Amerikanischen Roadtrips hatte ich noch immer keine konkreten Pläne, um wirklich aufzubrechen und irgendwohin zu fahren. Und so ging ich in ein Café, schüttete mir eine Tasse Cold Brew direkt ins Gehirn und googelte »Wie kommt man zum Isle-Royale-Nationalpark«.
Solltest du noch nie vom Isle-Royale-Nationalpark gehört haben, bist du damit nicht allein. Im Jahr vor meiner Reise besuchten nur 18479 Menschen die Hauptinsel, was den Isle Royale zum am wenigsten besuchten Nationalpark der Vereinigten Staaten macht. Vielleicht klingt 18479 nach einer ganzen Menge Leute, wenn du, anders als ich, noch nie in einem Apartmentgebäude in Brooklyn mit 18479 anderen Menschen gewohnt hast. Aber betrachten wir es doch einfach einmal so: 2019 war der am meisten besuchte Nationalpark der Great-Smoky-Mountains-Nationalpark mit 12,5 Millionen Besucher*innen. Für den Great Smoky Mountains ist eine Zahl wie 18479 nicht mehr als ein Rundungsfehler.
Die Isle Royale ist eine 45 Meilen lange, neun Meilen breite Insel im Lake Superior; sie liegt näher an Kanada und Minnesota, gehört aber zu Michigan. Diese Insel sowie 450 kleinere umliegende Inseln, die mit einem Wasserflugzeug oder den paar wenigen Fährlinien erreicht werden können, bilden den Isle-Royale-Nationalpark.
Als ich in einem Café saß und versuchte, ein Fährticket zu kaufen, wusste ich nichts davon. Damals wusste ich nur zwei Dinge über den Park, beide hatte mir TB erzählt. Erstens kannte TB jemanden, dessen Bruder das ganze Jahr über auf der Isle Royale gelebt hatte, bis er vor Kurzem an … Botulismus? … gestorben war, da er sich ausschließlich von Konserven ernährte. Diese Geschichte machte mich gleich aus mehreren Gründen skeptisch: Zum einen lautet die offizielle Einwohnerzahl der Insel null, und außerdem schien es aufgrund der relativ geringen Größe des Parks und der Existenz von Flugzeugen wahrscheinlich, dass, würde eine Person heimlich auf der Insel leben, irgendjemand es früher oder später bemerkte. Andererseits: Wenn es in irgendeinem Land jemanden geben könnte, für den Freiheit bedeutet, illegal und ohne jeglichen Komfort auf öffentlichem Grund zu leben und es den Demokraten so richtig zu zeigen, indem er das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Campbell’s-Suppen-Dosen ignorierte, dann definitiv in Amerika. Insofern: Wer weiß?
Zweitens war mir bekannt, und an dieser Stelle möchte ich TB zitieren, dass »sie versuchen, Wölfe auszuwildern, weil die Elchpopulation völlig außer Rand und Band ist.« So ist es! Der Park ist für seine Elchpopulation bekannt: 2019 gab es hier 2060 Elche. Dabei waren die Elche erst vor relativ kurzer Zeit auf die Isle Royale gelangt – sie kamen Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie als Mutprobe vom Festland zur Insel schwammen. Die Wölfe folgten ihnen etwa 40 Jahre später, indem sie eine Eisbrücke von Kanada aus überquerten, worüber ich mir noch nicht einmal einen Scherz erlauben werde, weil es einfach zu krass ist.
Seit beide Arten zusammen auf der Isle Royale leben, haben ihre Bestände mal ab-, mal zugenommen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn auch wenn wir kulturell bedingt zwar vielleicht von der Idee beflügelt sind, einen Elch zu sehen, gibt es auch so etwas wie »zu viele Elche auf einer Insel« (was natürlich die Prämisse meiner erfolgreichen Sitcom Die Elch-Insel sein wird). Die Elche fressen und trampeln alle Bäume und Pflanzen nieder, auf die Vögel, andere Säugetiere und Insekten für ihr Überleben angewiesen sind. Oder, wie es so schön heißt: Füttert man einem Elch einen Muffin, wird er das Ökosystem des Isle-Royale-Nationalparks zerstören. Und genau das ist im Lauf der letzten 15 Jahre geschehen. Im Jahr 2005 lebten 30 Wölfe und 385 Elche in dem Park. Dann verringerte sich die Wolfpopulation aufgrund von Inzucht, da infolge des Klimawandels weniger oft Eisbrücken entstehen und keine neuen Wölfe auf die Insel gelangten, um den Gen-Pool aufzufrischen. 2017 waren auf der Hauptinsel nur noch zwei Wölfe übrig – und 1600 Elche. Die Elche waren, wie es TB so treffend formulierte, völlig außer Rand und Band.
Die große Frage lautete: Soll der National Park Service als Verwalter der Isle Royale etwas zur Regeneration der Wolfspopulation unternehmen? Gemäß dem Wilderness Act von 1964 soll grundsätzlich nicht eingegriffen werden. Laut einem Gastbeitrag in der New York Times von den drei Wissenschaftlern, die entscheiden sollten, ob neue Wölfe in dem Park ausgewildert werden oder nicht, sei es verlogen, Nichteingreifen über alles zu stellen, da der Mensch durch den Klimawandel selbst in die ursprünglichsten Regionen des Planeten bereits eingegriffen hat. Letztlich entschieden sie sich für die Wölfe. Und so begaben sich 2019 zwölf Wölfe auf eine unvorhergesehene Reise in den Isle-Royale-Nationalpark – ganz wie ich.
Ich sah mir die Fahrpläne der Fähren an und beschloss, einen Tagesausflug zu machen: Ich wollte auf der abgelegenen Spitze der Oberen Halbinsel von Michigan zelten, dann, früh am Morgen, zu der etwa dreistündigen Überfahrt zur Isle Royale aufbrechen und am späten Nachmittag wieder zurückfahren. Der Mann, der ans Telefon der Fährgesellschaft ging, sagte, es seien noch Tagestickets erhältlich, und fragte mich, wo ich übernachtete. Instinktiv – dieser Fähr-Perversling sollte auf keinen Fall erfahren, wo ich schlief, nur damit er mich im Schlaf ermorden könnte – log ich.
»Bei … meinem … Stiefvater«, sagte ich.
»Okay«, antwortete der Mann von der Fährgesellschaft. »Check-in ist morgen um sieben.« Natürlich wollte er nur wissen, ob ich mich in der Umgebung aufhielt und die frühe Fähre schaffen würde. Dieser Mann will dich gar nicht umbringen, wurde mir da bewusst. Nimm dich nicht so wichtig.
Die erste Etappe meiner Reise führte mich in Richtung Norden. Da die Obere Halbinsel zu den Launen der Geografie gehört, betrat ich damit allerdings wieder die Eastern Time Zone. Alle Grenzen sind brutal, kolonialistisch und willkürlich, doch auf mich wirkt es besonders willkürlich, dass die Obere Halbinsel zu Michigan gehört und nicht zu Wisconsin. Sie grenzt ganz genau an einen Bundesstaat, und, Überraschung: Es ist nicht Michigan. Mit dieser Ansicht stehe ich allerdings allein auf weiter Flur, und es ist keine Flur, die auch nur irgendjemand für ein interessantes Gesprächsthema hält. Und so dachte ich im Stillen darüber nach, als ich über verlassene Landstraßen durch Pinienwälder im Norden Wisconsins fuhr und versuchte, es bis um 18 Uhr (Eastern Time) zum Besucherzentrum der Isle Royale in Houghton zu schaffen.
Und auch wenn ich eine Stunde verlor, nur weil ich gemäß eines 183 Jahre alten Vertrags »in Michigan« war (ja, klar), schaffte ich es rechtzeitig zum Besucherzentrum. Ich schnappte mir mein Junior-Ranger-Heft, setzte mich in mein Auto und öffnete jede App, die ich während der vergangenen 60 Minuten, seit meiner letzten Pinkelpause, so geflissentlich ignoriert hatte. »Du wirst gleich auf ein paar schönen Straßen unterwegs sein«, schrieb mir ein Freund, der eine Weile in Copper Harbor gelebt hatte, wo ich am nächsten Tag mit der Fähre ablegen würde. Er hatte recht: Die letzte Stunde meiner Fahrt durch immer spärlicher besiedeltes Land war, als würde ich durch ein Bild im Wohnzimmer meines Vaters fahren. Die Straße schlängelte sich sanft durch dichte Birkenwälder, bis sie am Strand des Lake Superior auf einmal endete.
Ich fuhr den »Hausberg« hinauf (ein großer Hügel), um mir einen besseren Ausblick zu verschaffen: Immergrüne Bäume, so weit das Auge blicken konnte, auf dem Festland und ein paar kleinen Inseln parallel zur Küste. Derart bezaubernd, dass es, ehrlich gesagt, geradezu wahnsinnig war.
Am nächsten Morgen um sieben Uhr war ich am Fährhafen, und ja, damit gebe ich an. Die Zeit zwischen Erwachen und Losfahren wurde dadurch beschleunigt, dass ich am Vorabend, als ich versuchte, meine idyllische kleine Lagerstätte herzurichten, feststellen musste, dass das Zelt, das mir TB ausgeliehen hatte, komplett unbrauchbar war (fehlende Stangen, zerrissene Plane). Nachdem ich TB angerufen und um Erlaubnis gebeten hatte, das »Zelt« zu entsorgen, verbrachte ich meine erste Nacht als Soloreisende stattdessen eingerollt auf dem Beifahrersitz des Prius. 1,58 Meter groß zu sein: ein Lifehack.
Ich ging zur Anlegestelle der Isle-Royale-Fähre und begab mich zu einem Picknicktisch, in langer Tradition von Menschen, die bis zum Check-in auf der Fähre nichts anderes zu tun haben, als aufs Wasser zu starren und über ihr Leben zu sinnieren. Den Check-in führte ein Mann durch, der wie Steve Bannon aussah, vorausgesetzt, Steve Bannon wäre nur halb so ungesund und würde ebenfalls auf der Oberen Halbinsel in Michigan herumlungern, statt überall in Europa winzige Baby-Hitler zu erschaffen. »Bevor wir anfangen, noch eine Anmerkung«, sagte der gesunde Bannon. Er wies auf die Isle-Royale-Fähre und auf eine etwa 1,20 Meter hohe Leiter, die wir erklimmen mussten, um an Bord zu gelangen. »Vor sieben Jahren befand sich das Deck auf der gleichen Höhe wie der Steg. Man konnte einfach vom Steg auf das Boot treten. So stark ist der Wasserspiegel des Lake Superior seitdem gestiegen.« Ich blinzelte und fragte mich, ob der Mann wohl Anmerkung mit düstere Mahnung zum drohenden Untergang unseres Planeten verwechselt hatte. »Okay! Auf, an Bord!«
Im Inneren der Fähre saß ich an einem Tisch mit zwei Frauen und unterhielt mich drei Stunden mit ihnen. Für dich mag das schrecklich klingen, so wie für mich, bin ich doch eine Person, die es bekanntermaßen hasst, mit Fremden zu sprechen. Aber es war reizend. Die Frauen stellten sich als Debbie und Meg vor, ein Mutter-Tochter-Gespann aus Green Bay, das zusammen auf die Isle Royale fuhr, weil Debbie als junges Mädchen einmal da gewesen war und seither davon träumte, eines Tages mit ihren Töchtern zurückzukehren. Wir unterhielten uns über Wisconsin und Timothée Chalamet (für den ich damals schwärmte, ich war ja noch keine 30) und über das Reisen. Nach zwei Stunden fiel mir auf: »Ihr seid die ersten, die nicht gesagt haben, ich würde auf meiner Reise ermordet werden.«
»Ach, du wirst schon nicht ermordet werden«, sagte Debbie. »Wenn du in New York überlebt hast, schaffst du das auch unterwegs.«
Selbstredend ist es wahr, dass Frauen in Großstädten und auf Reisen ermordet werden können. Etwas, das die Feministin und Autorin Adrienne Rich als die »Rolle männlicher Gewalt bei der Unterwerfung der Frau« bezeichnet. Wenn sich an diesen Orten aufzuhalten, bedeutet, dass man als Frau in Gefahr ist, kann man dort nie gänzlich ungezwungen sein; ein Teil der Aufmerksamkeit wird immer wieder abgezogen.
Statistisch betrachtet sind es nicht Frauen, die wirklich Angst davor haben sollten, Roadtrips zu machen oder nach New York zu ziehen: Laut der Vereinten Nationen sind etwa 80 Prozent aller Mordopfer weltweit Männer. Dasselbe gilt auch für die Vereinigten Staaten, und zwar seit Jahrzehnten. Besser gesagt: Männer werden eher öffentlich und eher durch die Hand eines Fremden zum Opfer. Frauen eher durch jemanden, den sie kennen, genau an dem Ort, der eigentlich unser Zufluchtsort sein sollte: unser Zuhause oder das von jemandem, der uns nahesteht. Gut möglich, dass die häusliche Sphäre ganz abenteuerlos und zugleich der gefährlichste Ort für uns ist. Dennoch versuchen die True-Crime-Industrie und unsere Gesellschaft im Allgemeinen, Frauen davon zu überzeugen, ebendort zu bleiben, weil, was für ein Zufall, sie dort die unbezahlte Sorgearbeit leisten können, die unsere äußerst schlecht konzipierte Wirtschaft am Laufen hält.
Die Geschichten, die wir uns erzählen – beispielsweise, dass Frauen unterwegs nicht sicher seien – verschärfen dieses Problem: Wenn sich Frauen beim Reisen nicht sicher fühlen, hält dies mit großer Wahrscheinlichkeit einige Frauen davon ab, weswegen weniger Frauen ihren Freundinnen von ihrem tollen Roadtrip erzählen, auf dem sie nicht ermordet wurden. Ob Jack Kerouac wohl geraten wurde, sich nicht auf seine Reisen zu begeben? Nein, wahrscheinlich sagten die anderen viel eher etwas wie: »Unbedingt, von mir aus kannst du gerne für ein paar Monate verschwinden und mich verdammt nochmal in Ruhe lassen.«
Als ich die ersten kleinen Inseln sah, die die Isle Royale umgeben, kamen mir die Tränen. Ich verhütete erst seit ein paar Monaten mit einer Hormonspirale, und jetzt war einfach alles, nun ja, viel zu schön.
Wir gingen an Land, und ich durfte keine Zeit verlieren. Ich winkte Meg und Debbie zum Abschied, die in die Rock Harbor Lodge eincheckten, und machte mich auf, den Ausgangspunkt eines Wanderwegs zu suchen. Am Vortag, im Besucherzentrum in Houghton, hatte ich dem diensthabenden Ranger erklärt, ich hätte vor, nur den Nachmittag auf der Insel zu verbringen, und fragte, was ich in der Zeit unternehmen könne. Er gab mir eine Landkarte und empfahl mir eine vier Meilen lange Wanderroute auf einer schmalen Halbinsel, von Rock Harbor zu einem Felsvorsprung namens Scoville Point. Mir blieben nur etwas mehr als drei Stunden, die, wie mir der Ranger versicherte, dafür ausreichen sollten, auch wenn es bereits ein Jahr her war, dass ich ernsthaft gewandert war, und ich nicht wusste, ob ich schnell genug gehen konnte. Ich eilte durch den Hafen, fand einen Wanderweg, der richtig aussah, und tauchte in den Wald ein.
Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken, deswegen sage ich es lieber gleich: Ich habe auf der Isle Royale keinen der 2060 außer Rand und Band geratenen Elche gesehen. Und natürlich auch keinen der zwischenzeitlich 14 auf der Insel lebenden Wölfe, die damit beschäftigt waren, sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen und ihrem Job – Elche zu fressen – nachzukommen. (Seit 2019 hat sich die Wolfspopulation verdoppelt und die Elchpopulation fast halbiert.) Aber das spielte keine Rolle. Ich freute mich darüber zu wandern, in eine neue Landschaft einzutauchen und beim Herumlaufen mehr über sie zu erfahren. Ich ging meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung nach, und da es kalt und eine schicke rote Strickmütze der Temperatur angemessen war, sah ich währenddessen auch noch aus wie ein sexy Steve Zissou. Ich raste den Weg entlang, füllte dabei mein Junior-Ranger-Heft aus, lauschte den Geräuschen der Natur, bestaunte die Vegetation und notierte meine Erkenntnisse.
Alles um mich herum war, so leid es mir tut, atemberaubend! Der Lake Superior wird völlig unterschätzt. Oder vielleicht hielt ich ihn nie der Reise wert, weil er so weit im Norden liegt. Oder vielleicht kam es daher, dass der Lake Michigan in meiner Wahrnehmung im besten Fall »Meh« und im schlimmsten »Rühr das Wasser bloß nicht an, sonst bekommst du Hepatitis« ist, was mich zum Schluss verleitete, alle Großen Seen seien gleich. Jedenfalls war ich auf die Erhabenheit des Lake Superior absolut unvorbereitet. Plötzlich lichtete sich der Pinienwald und gab den Blick frei auf eine felsige Küste und aufgepeitschtes saphirblaues Wasser bis zum Horizont. Immer wieder führte der Weg über Holzplanken durch Gebiete, in denen sich die Erde in Senken zwischen den Steinen sammelte, wo das Wasser nie ganz abfließen konnte und Sumpfpflanzen wie Dotterblumen gediehen. Als ich den Scoville Point schließlich erreichte, blickte ich zum Horizont, zwischen mir und dem Festland meilenweit nichts als See. Da dachte ich, verdammt, kaum zu glauben, dass die Elche hierher geschwommen sind. Diese Irren!
Für die Rückfahrt wieder auf der Fähre, machte ich es mir auf einem Sitz bequem – ich hatte einen ganzen Vierertisch für mich. Und dann. Tauchte auf der Hälfte der Strecke plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Mann auf und fragte, ob er sich zu mir setzen dürfe. Jeder, der nach zwei Stunden auf einem Boot ganz plötzlich einen Sitzplatz braucht, bedeutet Ärger. Außerdem schien er irgendwie gereizt, was in meinem Inneren den Alarm auslöste, den ich über die Jahre in New York entwickelt hatte, in denen ich versuchte, nicht ermordet zu werden. Aber da ich als Frau sozialisiert wurde und mir daher beigebracht worden war, höflich und entgegenkommend zu sein, und weil ich immerhin einen ganzen Tisch für mich allein hatte, ließ ich ihn. Er lümmelte sich auf die Bank mir gegenüber und tat, was alle Männer tun, die in der Nähe einer Frau sitzen, die sie nicht kennen: Er ging mir auf die Nerven.
»Was liest du da?«, fragte er mich.
Ich zeigte ihm das Cover meines Buchs: Yes Means Yes: Visions of Sexual Power and a World Without Rape. Es war das eine Buch, das kein Mann als Aufhänger zum Flirten nutzen kann.
Aber irgendwie versuchte er es trotzdem. Eine ganze Stunde lang stellte er mir eine Frage nach der anderen, während ich mich ganz offensichtlich weigerte, darauf einzugehen. Schließlich begriff er, dass er seinem Ziel (meine Telefonnummer zu bekommen? mich davon abzuhalten, mehr über Rape Culture zu erfahren?) nicht näherkam, indem er mich nervte. Und so beschloss er, mir den Rest des Weges so unangenehm wie möglich zu machen. In der letzten Stunde der Fahrt bewegte er seine Beine sukzessive in meine Richtung und begann, sie zu spreizen, bis kein Platz mehr für mich unter dem Tisch übrig war. Und für diese eine Stunde ließ ich mir das gefallen. Auf der Isle-Royale-Fähre, von den gespreizten Beinen eines widerlichen Typen in die Ecke gedrängt, fragte ich mich, wie lange ich jemanden mit meiner Ermordung fortschreiten lassen würde, bis ich ihn aufforderte, doch bitte damit aufzuhören.
Als ich den Mann endlich bat, seine Beine zu bewegen, waren wir beinahe wieder in Copper Harbor, doch irgendwie war ich trotzdem stolz auf mich. Ich war stark! Ich war dabei, meine soziale Konditionierung zu überwinden und für meine körperliche Selbstbestimmung einzustehen!
Und dann schnappte ich mir meinen Rucksack, ging von der Fähre und setzte mich eine halbe Stunde neben das Hafenbüro, bis ich sicher war, dass der Mann weg war und mir nicht zu meinem Zeltplatz folgen konnte.
2
Eine ziemlich komplexe Fleischmaschine
Das Problem am Draußenschlafen ist, dass man sehr früh aufwacht. Man kann Jahre damit verbringen, sich mit größter Sorgfalt eine urbane Identität als Künstlerin zu konstruieren, die um drei ins Bett geht und bis zur Mittagszeit schläft, und trotzdem nach zwei Tagen auf einem längeren Campingtrip feststellen, dass man um 21 Uhr fix und fertig ist und um halb sechs morgens nicht nur wach, sondern topfit und bereit, loszumarschieren. Zur gleichen Zeit aufzuwachen wie 80-jährige oder wie Benjamin Franklin, der diesbezüglich allerdings log, ist, offen gesagt, peinlich. Aber so war es nun einmal. Und dann verbrachte ich den ganzen Tag damit, in Richtung Westen zu fahren, über die Obere Halbinsel und durch die Northwoods Wisconsins.
Als ich nachmittags in Duluth, Minnesota, ankam, hatte ich seit 32 Stunden keinen Kaffee mehr getrunken und stand kurz davor, ein Verbrechen zu begehen. Ich parkte vor einem trashigen Diner, das gute Yelp-Reviews hatte, und bestellte mir etwas zu Mittag und einen Cold Brew von der Größe meines Oberkörpers. Ich fuhr zu einem anderen Diner, um noch mehr Kaffee zu trinken, zu einem dritten, um Eis mit Kaffeegeschmack zu essen, ging zu Walmart, um mir ein Zelt zu kaufen, und verbrachte die Nacht auf einem KOA-Campingplatz. (KOA steht für »Kampgrounds of America« und ist eine privat geführte Kette mit Campingplätzen in den Vereinigten Staaten und Kanada, wobei die Tatsache, dass »Campground« mit »K« geschrieben wird, derart albern ist, dass die Idee in den USA entstanden sein muss.) Die Geräusche junger Menschen um mich herum, die Spaß hatten, und das Gefühl, jeder einzelne Ast des Waldes würde mich durch mein billiges Zelt hindurch piksen, lullten mich in den Schlaf. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zum Voyageurs-Nationalpark.
Der Voyageurs war noch so ein Park, über den ich fast nichts wusste. Der einzige Grund, warum ich überhaupt wusste, dass so etwas wie der »Voyageurs« existierte, war ein Nationalparkkalender, den mir eine Freundin vor ein paar Jahren geschenkt hatte. Ich blätterte zum Juni und auf einmal stand da ein Elch in einem See und darunter stand das Wort Voyagers, nur dass es so geschrieben war wie in einem Gruppenchat, den ich mit ein paar Leuten führe, die alle britische Pässe und mehrere Pelzmützen besitzen und zum Spaß Wörter willkürlich französisch schreiben. Ich starrte auf das Kalenderblatt und den Elch. So etwas gibt es also in Amerika?, dachte ich. Krass.
Der Park liegt im abgelegenen Norden Minnesotas an der Grenze zu Kanada und besteht aus einem Labyrinth miteinander verbundener Seen. Vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden diese miteinander verbundenen Seen von biberpelzhandelnden, kanupaddelnden französisch-kanadischen Teenagern genutzt, die man als Voyageurs bezeichnete. Dem Gesetzestext von 1971 zufolge, der die Gründung des Parks ermöglichte, »trugen jene Voyageurs maßgeblich zur Erschließung des Nordwestens der Vereinigten Staaten bei«. Es stimmt also, was man sagt: Um die Welt zu verändern, braucht man nur einen Traum und ein Kanu.
Es war kühl und regnerisch und zu früh in der Saison, als dass bei meiner Ankunft im Voyageurs viel losgewesen wäre. Die Rangerin am Infopunkt des Ash-River-Besucherzentrums war um die 60. Sie wirkte wie eine dieser ernsthaften Frauen, die sich in den Dienst der Nationalparks stellen, um der Erde etwas zurückzugeben und um Kindern etwas über die Schönheit der Natur beizubringen. Sie wirkte nicht wie eine Frau, die sonderlich amüsiert wäre, wenn eine 28-jährige Person, die aus New York angeflogen kam, fragte, ob sie am Junior-Ranger-Programm teilnehmen dürfe.
Junior-Ranger-Abzeichen zu sammeln, war die organisatorische Leitlinie meiner Reise. Worum also geht es dabei genau? Das Junior-Ranger-Programm gibt es nicht nur für Nationalparks, sondern auch für National Monuments und an anderen Orten, die vom National Park Service (NPS) verwaltet werden. Teilnehmenden wird ein pädagogisch wertvolles Arbeitsheft ausgehändigt, das nach einer gewissen Anzahl von Aufgaben als abgeschlossen gilt und gegen ein Abzeichen eingetauscht werden kann. Die Abzeichen sind aus Holz, Stoff oder Plastik, und ich war verrückt nach ihnen. Ich war bereit, so viele Wortsuchrätsel, die die Namen der im Park heimischen Tiere beinhalteten, zu lösen wie nötig; ich war bereit, so lange zu wandern, bis ich einen Treffer landete (»Insekt«, »Kot«); egal welcher von einem Ranger oder einer Rangerin geführte Programmpunkt an jenem Tag geboten wäre, ich würde mitmachen: Ich würde mein Junior-Ranger-Abzeichen in jedem Park bekommen, den ich besuchte. Entscheidend dabei ist übrigens, dass das Programm zwar auf Kinder zugeschnitten und für sie bestimmt ist, es aber allen Altersgruppen offensteht.
Wenn ich um ein Heft bat, erzählten mir die Ranger*innen manchmal, sie hätten erst kürzlich einer uralten Person ein Heft oder Abzeichen ausgehändigt. (Wahrscheinlich taten sie das, damit ich mich angesichts meiner peinlichen Bitte, an einem Kinderprogramm teilnehmen zu dürfen, nicht so schämte.) Als ich auf einem Roadtrip im Südwesten den Petrified-Forest-Nationalpark besuchte, erzählte mir die Rangerin dort, sie habe das Petrified-Forest-Junior-Ranger-Abzeichen gerade eben einem 103 Jahre alten Mann verliehen. »Er sagte, es sei das letzte Nationalpark-Junior-Ranger-Abzeichen, das er noch gebraucht habe«, meinte sie.
»Aha«, erwiderte ich. »Dann kann er jetzt also sterben.« Die Rangerin verzog keine Miene.
Warum ich meine Reise um den Erwerb jener Abzeichen herum geplant habe?
Nun, ich liebe Ferienhausaufgaben. Nationalparks zu bereisen, in denen ich mir noch kein Abzeichen verdient hatte, schien außerdem eine gute Methode, viele schöne Orte kennenzulernen, an denen ich noch nicht gewesen war. Der wichtigste Grund war letztlich aber, dass es meiner Reise eine Struktur verlieh; und eine Struktur – egal welche – war für diese ergebnisoffene Reise essenziell, die ich unmittelbar nach meiner Kündigung unternahm.
Es war völlig unmöglich, in den zwei oder drei Monaten, die ich mir selbst gönnte, um mich auszutoben, alle Naturlandschaften zu sehen, die Amerika zu bieten hat, all die verschiedenen Lebensstile auf mich wirken zu lassen, die Antiquitätengeschäfte aller Kleinstädte abzuklappern, in jeder Großstadt des Landes in identisch aussehenden alternativen Cafés mit weißen Metrofliesen und jeder Menge Grünpflanzen Kaffee zu trinken. Aber ein Junior-Ranger-Abzeichen in den von mir erkorenen Nationalparks zu bekommen, das war machbar. Es war eine große Aufgabe, die aus Dutzenden kleineren Aufgaben bestand, von denen mir jede das befriedigende Gefühl verleihen würde, wirklich etwas erlebt zu haben. Sollte ich es schaffen, von jedem Park ein Junior-Ranger-Abzeichen zu ergattern, würde ich qua Gesetz Innenministerin werden. Und als Extra-Bonus kam hinzu, dass es nicht schwer war, weil sich das Programm an Zwölfjährige richtete.
Mit dem Heft in meinen (erwachsenen) Händen, saß ich vor dem Voyageurs-Besucherzentrum in meinem Prius und löste so viele Aufgaben, wie ich konnte, in der Hoffnung, das Schlimmste des Regens bald ausgesessen zu haben. Bei einer Aufgabe war ich dazu aufgefordert, die Kleidung eines Voyageurs aus dem 18. Jahrhundert mit der eines heutigen 16-jährigen zu vergleichen. Beide wurden als »junge Männer« bezeichnet – obwohl, wie alle wissen, jeder Cis-Mann unter 35 kein Mann ist, sondern ein Kind. Von dem Voyageur, der aufrecht in Unterkleid und einer kleinen Nikolausmütze dastand, zog ich Linien zu seinem Altersgenossen aus dem 21. Jahrhundert, der sich in Hoodie und Trucker-Kappe fläzte. Die Aufgabe wirkte wie ein passiv-aggressiver Seitenhieb, der sich gegen alle Teenager richtete, aber auch wie eine verpasste Gelegenheit, sich vorzustellen, dass 200 Jahre nach »der Erschließung des Nordwestens der Vereinigten Staaten« auch anders aussehende Menschen in diese Landschaft eintauchen konnten. Ich war an große Institutionen gewöhnt, die sich wenigstens ansatzweise in Diversität versuchten, aber das Voyageurs-Junior-Ranger-Heft hielt an der Vorstellung fest, Abenteuer seien einzig weißen, kerngesunden »Männern« (im Teenageralter) vorbehalten.
Und tatsächlich sind die Besucher*innen von Nationalparks größtenteils weiß: Gemäß einer 2011 durchgeführten Umfrage des NPS waren nur 21 Prozent der Besucher*innen People of Color. Schwarze Menschen sind in den Parks besonders unterrepräsentiert: 14 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sind Schwarz, aber nur sieben Prozent der Nationalparkbesucher*innen. Die Tatsache, dass die Besucher*innen der Nationalparks überwiegend weiß sind, ist ein komplexes Problem und verschiedenen Ursachen geschuldet, von denen eine höchstwahrscheinlich die mangelnde Repräsentation in den Parks sein dürfte. Ich spreche nicht nur von Teenagern, die in Arbeitsheften für Kinder abgebildet sind: Laut eines Berichts der gemeinnützigen Organisation Partnership for Public Service besteht die Belegschaft der Parks zu 80 Prozent aus weißen Mitarbeiter*innen.
Wie weiß die Nationalparks sind, hat auch mit ihrer geografischen Lage zu tun: Die meisten Parks befinden sich im Westen des Landes und der ist überwiegend weiß. Einer Umfrage des NPS von 2018 zufolge zählen die Entfernung zu den Nationalparks und der Mangel an Transportmöglichkeiten zu zwei der am häufigsten von BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) angegebenen Gründe, warum sie keine Anlagen des NPS besuchen. »Tom Brandes’ Toyota Prius, Baujahr 2015« war, wie ich erkannte, eine individuelle Lösung für ein strukturelles Problem. Wenn der NPS und seine Unterstützer*innen mit dem Schriftsteller und Umweltaktivisten Wallace Stegner darin übereinstimmten, die Parks seien Amerikas »beste Idee«, dann stellt sich mir die Frage, warum sie keine größeren Anstrengungen unternehmen, diese Idee allen Amerikaner*innen zugänglich zu machen?
Hätte ich meinen Roadtrip vor dem Losfahren tatsächlich geplant, hätte ich gewusst, dass man den Voyageurs am besten per Boot erkundet und dass Bootstouren erst ein oder zwei Wochen später starteten, wenn der Frühling auch im Norden Minnesotas Einzug hält. Nun war ich also allein und fühlte mich ein wenig dämlich, als ich durch den Wald in Richtung eines Aussichtspunkts namens Beaver Pond Overlook wanderte. Ich lief über glitschige, moosbedeckte Steine, und als ich Halt fand und nach oben blickte, stand da ein riesiges Reh knapp zehn Meter entfernt, direkt über mir auf einem schmalen Felsvorsprung. Ganze fünf Minuten lang musterten das Reh und ich einander; es erinnerte mich an Cheryl Strayed und den Fuchs in Der große Trip,





























