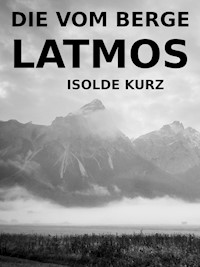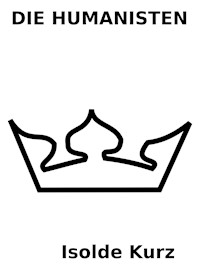Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Italienische Erzählungen
Isolde Kurz
Italienische Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-33-1
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Schuster und Schneider
Mittagsgespenst
Pensa
Die Glücksnummern
Erreichtes Ziel
Ein Rätsel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Schuster und Schneider
Paul Andersen war, wie so mancher junge Künstler vor ihm, auf einer Studienreise in Italien hängen geblieben und hatte niemals wieder den Rückweg nach Deutschland gefunden. Über seine Aussichten gab er sich selber keiner Täuschung hin, er besaß weder Vermögen, noch die nötige Protektion, um sich auf dem fremden Boden vorwärts zu bringen, auch war sein Talent und sein Selbstgefühl von dem überwältigenden Anblick der großen Alten allmählich so zusammengedrückt worden, dass er es kaum mehr wagte, den Pinsel in eigener Sache einzutauchen, sondern sich zumeist auf das Kopieren alter Bilder warf. An diese Aufgabe wandte er den ganzen Ernst und Fleiß und die unermüdliche Treue seiner tiefgründigen Natur und die Eigentümlichkeiten der alten Meister wurden ihm mit der Zeit so geläufig, dass für ein ungeübtes Auge seine Kopien von den Originalen kaum zu unterscheiden waren. Darüber ging freilich die eigene schöpferische Kraft zu Grunde und sein Interesse beschränkte sich bald ganz auf das Ausdenken technischer Kunstfertigkeiten im Behandeln der Farben und Leinwand, wodurch er seinen Arbeiten auch noch das Aussehen des Alters gab und sie den Urbildern auf Haaresbreite vollends annäherte.
Obgleich er nun so hoch über dem Tross der Kopisten stand, wie die alten Meister über ihm, brachte er sich doch nur kümmerlich fort, denn er wusste sich keine Geltung zu verschaffen und fast alle seine Bestellungen gingen durch dritte Hand, wobei die Hälfte der Einnahmen unterwegs blieb. Dennoch zog er dieses trübe schattenhafte Dasein dem freundlichen aber spießbürgerlichen Sonnenschein seiner heimischen Verhältnisse bei weitem vor, und war gesonnen, in Florenz zu leben und zu sterben. Nie gönnte er sich eine Abwechslung oder Zerstreuung, die Geld gekostet hätte und die ängstliche Gewissenhaftigkeit, mit der er über seine Ausgaben wachte, wurde ihm im Lauf der Jahre zur zweiten Natur. Das Erdarbte brachte er seiner Braut, einem blonden schüchternen Mädchen, das als Gouvernante in einer kinderreichen deutschen Fabrikanten-Familie auch nicht auf Rosen gebettet war. Diese trug es mit dem ihrigen auf eine Bank, wo sie sich von einem Kommis, der ihr persönlich bekannt war, beim Ankauf der Papiere beraten ließ. Paul Andersen mischte sich nie in dieses Geschäft, er war bei aller Besonnenheit ein wenig Fantast und sah das Geld für eine dämonische, dem Menschen feindselige Natur an, mit der er so wenig wie möglich zu schaffen haben mochte, ja er fühlte sich immer ordentlich erleichtert, wenn die kleinen Summen, die er bei Seite legen konnte, nicht mehr in seinen Händen waren.
In der Via Ghibellina bewohnte er hoch oben im dritten Stockwerk eines alten Hauses zwei dürftig eingerichtete Zimmer, deren eines mit Bilderrahmen, Mappen und Skizzenbüchern angefüllt war und deshalb das Atelier hieß, obwohl er nicht darin malte. Eine zerbröckelnde steinerne Terrasse, die an seinen Korridor stieß und auf den sogenannten »Garten«, einen gepflasterten Hof mit mehreren Bäumen hinuntersah, wurde ihm von der Wirtin noch unentgeltlich zum Trocknen seiner Bilder überlassen.
Diese Terrasse war seine einzige Freude, denn er, dem alles andere fehlschlug, hatte eine glückliche Hand für Blumen und schuf sich den trübseligen Winkel, den zuvor nur Waschseile mit aufgehängten Hemden und zerrissenen Strümpfen zu schmücken pflegten, in ein kleines Paradiesgärtlein um, in dem es das ganze Jahr hindurch Frühling war. Aus Sämereien und Setzlingen zog er seine Blumen, die sich Kopf an Kopf in dreifacher Abstufung die steinerne Ballustrade hinandrängten, während dunkle Blattpflanzen, deren ihm keine je verdarb, in diesem Farbenkonzert den Grundbass spielten. Der Duft seiner Terrasse füllte wetteifernd mit dem Firnisgeruch der Bilder das ganze Haus. Jeden Abend schleppte er selber einen großen Eimer Wasser, der den Tag über im Hof gesonnt werden musste, seine drei Treppen hinauf, um die Blumen zu begießen, und wenn er sich auch in den heißesten Monaten nicht entschließen konnte, die Stadt zu verlassen, so geschah es ebenso sehr aus Rücksicht auf seine Blumen, wie auf sein Budget.
Im Winter wurde die Terrasse durch große Glasscheiben, den einzigen Luxus, den Paul Andersen sich gestattete, geschützt. Dorthin zog er sich zurück, wenn die Tramontana das Haus rüttelte und er zu sparsam war, um einzuheizen, und in den schwülen Sommernächten, wo die Zimmer vor aufgespeicherter Tageshitze dampften, saß er draußen auf seiner Terrasse beim Schein der Lampe lesend oder in einsamer Grübelei.
Ab und zu aber wurde dies stille, heimliche Blumenland der Schauplatz einer lärmenden Orgie. Dies geschah, wenn es dem Bewohner des ersten Stockwerks, dem tollen Baron Neubrunn, einfiel, die gemeinsamen Freunde zu einer Bowle auf Andersens Terrasse einzuladen. Dann widerhallte der schweigsame Hofraum von deutschen Studentenliedern, italienischen Operettenmelodien und einem Gewirr lachender, trunkener Stimmen, durch die Neubrunns Bass wie ein Trompetentusch hindurchklang. Und Paul Andersens weiße, zärtliche Azaleen, seine stolzen Marschall-Niel-Rosen und lachenden Chrysanthemen wunderten sich über die seltsamen Reden, die in solcher Nacht an ihren Ohren vorüberrauschten, noch mehr aber wunderten sie sich über ihren Herrn, der aufgelöst von Weingenuss und Wohlbehagen unter den ausgelassenen Gästen saß und seinen ganzen innern Menschen in einem Strom von Lebenslust badete. Nur dass er jedes Mal nach einer solchen Entladung sich auf lange Zeit um so hartnäckiger in sich selbst verbiss, wofür ihn sein Freund Neubrunn, dem ein Tag wie der andere im Genuss verging, einen Greis ohne Vergangenheit schalt.
Dieser Neubrunn, ein missratener Litterat und herabgekommener Adliger, hatte eine ganze Flucht schönmöblierter Zimmer im ersten Stock inne, für die er seit Jahren den Mietzins schuldig war. Sein auf unzähligen Mensuren zerhacktes Gesicht, das sich schon aufzuschwemmen begann, verriet nur noch durch den edlen Knochenbau, dass es einst auf der Universität dem »schönen Neubrunn« gehört hatte, aber sein athletischer Wuchs war trotz der lotterigen Lebensweise geschmeidig geblieben und die unverwischbaren Kennzeichen edler Rasse, die seiner ganzen Erscheinung anhafteten, machten ihn auf den ersten Blick sympathisch.
Von was er eigentlich lebte, war jedermann ein Geheimnis, vielleicht ihm selber ebenfalls. Vor langen Jahren war er einmal von einer großen Zeitung als Berichterstatter zu einem Kongreß nach Italien geschickt worden und von da nicht wieder heimgekehrt. Zwar hatte er wohl eine Zeit lang mit vielem Geschick den verschiedenen Redaktionen, mit welchen er in Verbindung stand, Vorschüsse zu entlocken gewusst, da aber seine versprochenen Korrespondenzen ausblieben, so versiegte diese Quelle. Dann fand er Freunde, die ihm für große, nie in die Wirklichkeit tretende Projekte Geld borgten, und mitunter, wenn ihm das Wasser wirklich an den Hals stieg, schrieb er ein gelegentliches Feuilleton oder einen witzigen Reisebericht, der ihm glänzend honoriert wurde, denn das Glück, das ab und zu mit ihm schmollte, kehrte doch immer wieder durch eine Seitentüre zu ihm zurück. Für gewöhnlich zog er es aber vor, seine guten Einfälle hinter dem Weinglas zu verpuffen, wo ihm nie ein dankbares Publikum fehlte. Ohne hervorragende Talente besaß er alle Eigenschaften eines unwiderstehlichen Gesellschafters, und da er sich nach der Schulzeit wohl gehütet hatte, seinen Kopf noch mit vielen Kenntnissen oder mit Lektüre zu beschweren, so gab sein gut geschontes Gedächtnis, sobald er im Zuge war, alles von sich, was seit den frühsten Jahren darin aufgespeichert lag: Anekdoten, Studentenwitze, den Monolog aus »Manfred«, den er schon auf dem Gymnasium zu deklamieren pflegte oder einen griechischen Chorgesang und das alles entquoll ihm zwar ohne Anknüpfung und Zusammenhang, aber so leicht und sprudelnd, dass der Hörer den Born für unerschöpflich halten musste. Andersen dagegen, der alles las, aber nichts behielt, und seinen Geist nie zur Hand hatte, wenn er ihn eben brauchte, lächelte heimlich oder ärgerte sich auch wohl mitunter über des Freundes leicht erworbene Triumphe, konnte aber selber seinen Umgang nicht missen. Karl Neubrunn seinerseits bewies seine Hochachtung vor Andersen dadurch, dass er sich unermüdlich von ihm Geld vorstrecken ließ, welches er mit unglaublicher Geschwindigkeit verbrauchte und niemals heimzahlte. Freilich stand dafür auch seine eigene Kasse Paul so gut wie allen andern Freunden zur Verfügung, wenn er gerade bei Geld war, aber der arme Kopist machte von dieser Möglichkeit, die auch wohlhabende Leute nicht verschmähten, keinen Gebrauch, und so sparsam er sonst war, das an Neubrunn gewendete Geld reute ihn niemals. Es erschien ihm nur als ein Teil der Naturordnung, dass für einen Rebstock, der nicht auf eigenen Füßen stehen kann, ein Ulmbaum wächst, an den er sich lehnt, dass für einen Seekrebs, der kein eigenes Haus zu bauen vermag, die Schnecke da ist, die ihm das ihrige überlässt, und für einen Karl Neubrunn, der nicht sparen kann, ein Paul Andersen, der ihm vorschießt. Übrigens teilten sämtliche Freunde mehr oder weniger diese Auffassung, und selbst die Hausfrau, die an jedem Termine rücksichtslos ihren Zins einzog und den Nichtzahler unbarmherzig auf die Straße gesetzt hätte, bewies gegen Karl Neubrunn allein eine unermüdliche Langmut; sie nahm seine Komplimente an Zahlungsstatt und bediente ihn so aufmerksam, wie keinen andern ihrer Mieter.
An einem sonnigen Frühsommermorgen war Paul Andersen ersichtlich mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bette gestiegen, denn es ging ihm an diesem Tage alles schief. Er hatte schon eine Rahmkanne der Hauswirtin zerbrochen und sein Tintenfass über ein frischgebügeltes Hemd ausgegossen, als er die Entdeckung machte, dass die Holztafel mit seinem raphaelischen Julius dem Zweiten in ihrer ganzen Länge zersprungen war. Er hatte sogar in der Nacht den Knall gehört, ohne sich Rechenschaft davon zu geben. Der Julius war eine seiner besten Arbeiten, Paul hatte volle vier Wochen mit Zusetzung all seiner Kräfte daran gemalt und Essen und Trinken darüber vergessen, denn das Bild war für einen reichen Liebhaber bestimmt, einen der seltenen wahrhaft Verständigen, der ihm weitere Aufträge in Aussicht gestellt hatte, und es musste morgen schon abgeliefert werden.
Was nun beginnen? Ein klaffender Riss lief senkrecht durch das ganze Bild und teilte das päpstliche Angesicht in zwei Hälften, ein zweiter kürzerer hatte noch das linke Auge gespalten. Die Versicherung des Schreiners, dass die Sprünge durch Zusammenschrauben und untergesetzte Leisten zu heilen seien, gewährte ihm nur geringen Trost, denn abgesehen vom Zeitverlust, war es kein beruhigender Gedanke, die noch feuchte Malerei unter Tischlerhänden auf der Hobelbank zu wissen.
Verstimmt lehnte er an einem Fenster, das auf die düstere Straße hinunter ging und gab seinen trübseligsten Gedanken Gehör. Er war von jeher ein Pechvogel gewesen. Seit zehn Jahren arbeitete er wie ein Lasttier, er gönnte sich keine freie Stunde, kein Ausspannen, keine Erholung. Und obwohl es ihm gelungen war, sich einen gewissen Namen zu machen, kam er um keinen Schritt vorwärts, ja in den letzten Jahren waren sogar seine Einnahmen zurückgegangen, denn zwei Winter lang hatten bösartige Epidemien in Florenz gewütet und die Fremden, von denen sein Erwerb abhing, ferngehalten.
Wenn er sich in solche Gedanken verbohrte, so lief er Gefahr, in einen krankhaften Kleinmut zu verfallen, der seine Tatkraft lähmte und ihn halbe Tage lang wehrlos und gebrochen aufs Kanapee niederstreckte, und er wusste dies. Um sich zu zerstreuen trat er einen Augenblick vor den Spiegel, der etwas geneigt zwischen beiden Fenstern hing und ihm seine Person in ganzer Höhe zeigte. Da überraschte es ihn, wie hager er geworden war und dass durch sein einst so schönes, braunes Haar schon da und dort die Kopfhaut schimmerte. Wo war seine blühende Jugendgestalt geblieben? Vor zehn Jahren – was für ein frischer, bildhübscher Junge hatte ihn aus demselben Spiegel angesehen! Ob Lydia wohl die Veränderung bemerkte, die mit ihm vorgegangen war? Und sie selbst? – Hatte nicht das lange Harren und Entbehren auch ihr schon seinen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt? Ohne die treue Neigung zu ihm wäre sie schon längst die glückliche Gattin eines andern, der seine Zeit besser zu nutzen gewusst und ihr eine sichere Stellung bieten konnte. Achtzehnjährig hatte sie sich mit ihm verlobt, nachdem sie frisch in Florenz angekommen war, um im Esselinschen Haus die Wartung des Erstgeborenen zu übernehmen. Unterdessen waren zehn Jahre vergangen, zehn lange Jahre voll Mühsal und Selbstverleugnung. Dem einen Sprößling waren sechs andere nachgefolgt, die alle von Lydia gewaschen, gewickelt und umhergetragen worden waren, und noch immer saß das liebe Mädchen wie eine arme Seele im Fegefeuer, und wartete, dass er sie erlöse.
Sie hatten sich vorgenommen, nicht eher zu heiraten, als bis sie gemeinsam einen Notpfennig zurückgelegt hätten; zuerst träumten sie von zwanzigtausend Franken, aber als sie sahen, wie schwer es hält, aus lauter kleinen Scheinen ein Tausendfrankenbillet zu machen, setzten sie die Summe auf die Hälfte herunter und nach zehnjährigem Warten und Arbeiten war das bescheidene Ziel noch nicht erreicht. Hätte er sie lieber gleich im ersten Jugendleichtsinn heimgeführt, dann wäre wenigstens das Leben nicht so ungelebt verflossen, sie hätten mit wenigem Haus gehalten und sich gemeinsam nach der Decke gestreckt. Freilich, wenn er an den Esselinschen Kindersegen dachte, pries er doch wieder seine Vorsicht, die ihn vor einem ähnlichen Geschick bewahrt hatte. Der armen gequälten Lydia stand es wenigstens jeden Tag frei, aus ihrer Stelle zu treten, während es aus dem Ehejoch kein Entrinnen mehr gab.
Schon halb getröstet schickte er sich eben zum Ausgehen an, als der Briefbote klopfte und ihm eine Anweisung auf hundertfünfzig Franken überbrachte, die Adressat persönlich auf der Post in Empfang zu nehmen habe.
Paul Andersen stand wie im Traum. Eine Geldsendung! Seit er dem Elternhaus entwachsen war, hatte er keine solche mehr erhalten, denn seine Bilder wurden ihm immer baar oder in Raten durch den Händler vorausbezahlt. Wer konnte ihm Geld zu schicken haben? Er drehte den gelben Wisch um und um, als könne er ihm sein Geheimnis abfragen, der aber verriet nichts weiter, als dass die Sendung aus Deutschland kam.
Mit seinem vollen Herzen eilte Andersen zu Neubrunn hinunter, um ihm das unerhörte Ereignis mitzuteilen.
Der stand noch im tiefsten Negligé bei seiner Douche und rief ihm schon von weitem entgegen:
»Pomona hat mich beleidigt! Sie muss Abbitte tun oder ich werde das Haus verlassen!«
»Pomona« nannte er die Hausvermieterin wegen der reifen Fülle ihrer Formen, im gewöhnlichen Leben hieß sie Signora Virginia und war eine imposante Dame in den besten Jahren.
Paul Andersen, immer gewohnt sein Ich hintan zu setzen, fragte teilnehmend was geschehen sei.
»Sie beklagt sich, ich bringe schlechte Gesellschaft ins Haus. Meine Carlotta schlechte Gesellschaft! Der Teufel hole die fette, heuchlerische Kröte!« Und indem er eine ganze Salve von weniggewählten Titulaturen über die unglückliche Wirtin ergoss, warf er in der Aufregung seinen Waschapparat durcheinander, zog die Schublade heraus und streute ihren Inhalt auf den Boden, wobei er beständig wiederholte:
»Ich ziehe aus! Ich ziehe aus!«
Paul Andersen wollte ihn beruhigen, aber er kam nicht zu Wort. Wohl ein halbes Dutzend Mal hintereinander und immer mit den gleichen Worten erzählte ihm der Freund die Beleidigung, die ihm widerfahren war, und er schloss jedes Mal:
»Abbitte muss sie tun – auf den Knien oder ich will nicht mehr Karl Neubrunn heißen.«
Paul empfahl sich rasch, er wusste seit lange, dass Neubrunn, sobald ihm eine eigene Angelegenheit quer ging, für nichts anderes mehr zu haben war.
Er musste sein Glück allein tragen und auch allein den ihm lästigen Gang zur Post machen, denn er hatte heimlich gehofft, Neubrunn, dem die Geldanweisungen geläufiger waren, würde ihn begleiten.
Zuerst eilte er aber zu seinem Tischler, wo er das Bild, das er selbst zum Schutz mit Seidenpapier überzogen hatte, schon geleimt und in der Hobelbank eingeschraubt sah. Sodann, um das Geld nicht den ganzen Tag in der Tasche herumzutragen, begab er sich voll froher Unruhe nach den Uffizien und pinselte bis zum sinkenden Abend an einem angefangenen Tizian.
Gerade vor Schalterschluss erschien er auf der Post, um sich die Geldsendung einhändigen zu lassen, und es bedurfte noch vieler Formalitäten, bis ihm hundertundzwanzig Mark in funkelnden französischen Goldstücken ausbezahlt wurden. Ein kurzes Begleitschreiben sagte, dass dieses Geld der fünfte Teil von dem Gewinn eines Lotterieloses sei, das Andersen einmal vor zehn und einem halben Jahre zusammen mit mehreren Freunden gekauft hatte. Das Los war ihm in den langen Jahren völlig aus dem Gedächtnis entschwunden; er hatte damals nur aus Gefälligkeit sich an dem Kauf beteiligt und nie gedacht, dass ein Pechvogel wie er einmal wirklich in der Lotterie gewinnen könnte. Nun kam er sich mit dem vom Himmel gefallenen Golde auf einmal wie ein reicher Mann vor. Alles Geld, was er verdiente, hatte immer im Voraus seine Bestimmung, jeder Frank war eigentlich schon ausgegeben, ehe er ihn einnahm. Heute zum ersten Mal in seinem Leben, fiel ihm das Unerwartete, der absolute Überfluss auf den Kopf und in seinem Jubel beschloss er, endlich auch einmal leichtsinnig zu sein.
Aber alles will gelernt sein, auch der Leichtsinn. Paul Andersen stand lange Zeit im Hof des Postgebäudes, seine Goldstücke fest in der geschlossenen Hand haltend und überlegte, was er eigentlich damit anfangen wollte. Für das tägliche Leben sollten sie nicht drauf gehen, seine Bedürfnisse waren für die nächste Zukunft gedeckt, aber ebensowenig wollte er sie auf Zinsen anlegen. Sie sollten behandelt werden wie ein Göttergeschenk, und etwas freudiges, erhebendes sollte ihre Frucht sein. Aber was? Nun, dafür wird Lydia Rat wissen. Jetzt nur auf der Stelle einen Wagen genommen und zu ihr hinausgefahren! Zwar sie wohnt außerhalb der »Barriera« und das kostet die doppelte Fahrtaxe, aber heute soll einmal gar nicht gerechnet werden. Und halt, noch etwas! Schon lang bekümmerte es ihn, dass seine Liebste kein Angebinde von ihm besaß, außer einem schmalen goldnen Reifchen, dem Andenken seiner verstorbenen Mutter, das sie immer am Finger trug. Jetzt wollte er ihr einen schönen Ring mit wertvollem Juwel oder besser noch ein goldenes Armband mit kleinen Brillanten besät, wie er es jüngst an der Pomona gesehen hatte, kaufen. Vom Wert eines solchen Gegenstandes hatte er keine Ahnung, sondern war überzeugt, dass ihm immer noch Geld genug übrig bleiben werde, um sich und ihr einen ganz köstlichen, ausgesuchten Tag zu bereiten, so einen Tag, der ein Gedächtnistag im Leben wird und auf Jahre hinaus seinen Sonnenschein festhält.
Vorsichtig zählte er sein Geld noch einmal ab und ließ die Goldmünzen langsam, Stück für Stück in seine Hosentasche gleiten, nachdem er zuvor mit dem Finger in jede Ecke gebohrt und sich überzeugt hatte, dass die Naht fest war.
Wenn nur die Juweliersläden noch offen sind – er muss jetzt eilen, denn es fängt schon zu dunkeln an.
Aber die beiden Droschkenkutscher, die in der Nähe stationierten, waren eben im Zank begriffen und beachteten sein Winken nicht. Da fuhr gerade der Omnibus in dieser Richtung ab und einem Zug der Gewohnheit folgend – Paul Andersen versicherte später unzähligemale, es sei nicht Sparsamkeit, sondern lediglich Gewohnheit gewesen – sprang er in den Omnibus. Es war ein Sommerwagen mit Stehplätzen, Andersen fand es zu heiß im Innern und lehnte sich zufrieden mit zusammengelegten Armen an die Rampe.
Es dunkelte stärker, und in dem Zwielicht, das alle Gegenstände in seine gleichfarbige Uniform kleidete, überkam ihn ein seliges, weltentrücktes Träumen.
Da erklang es unter ihm durch das schwere Rasseln des Wagens hindurch wie ein kleines feines Glöcklein – tin – tin – tin. Paul Andersen horchte, denn er war äußerst feinhörig, da klang es noch einmal auf dem Pflaster lauter und deutlicher – tin – tin – tin. Es ging so süß in sein Träumen über, und er lächelte als höre er die Stimmen seliger Geister. Halb unbewusst sagte er vor sich hin:
»Das sind die Kleinen Von den Meinen –«
und dem Verse folgend, stellte er sich vor, dass diese Stimmen ihn zur freien Lebens- und Tatenlust aufriefen. Er konnte ja eigentlich ebenso gut die kurze Lebensreise zu einer fröhlichen Spazierfahrt machen wie Karl Neubrunn, statt zu einer sauren, beschwerlichen Fußwanderung. Er brauchte nur ein wenig Leichtsinn zu lernen und nicht so viel nach dem kommenden Tag zu fragen. So gar schlecht war auch seine Lage nicht, es kam nur auf die Auffassung an, und wenn Lydia dächte wie er, so brauchten sie nicht länger jedes einsam seiner Wege zu gehen. Tin – tin – tin! Da klingelt es schon wieder.
»Klingle nur, Glöcklein, so klingelt das Glück, Goldene Löcklein –«
O Wunder, nun fing er gar zu reimen an, doch kam er nicht weiter, denn abermals klang die Glocke, aber diesmal laut, fast kriegerisch. – Ja so, sie waren jetzt in der Nähe des San Giorgio, da türmte sich der herrliche Koloß Or San Michele gerade hinan in das noch heitere Blau des Himmels. Erst gestern hatte noch Karl Neubrunn über die Kleinlichkeit des Munizipiums gewettert, dass es den schönen, jungen Kriegsmann aus der Nische, für die er geschaffen war, entfernt und eine elende Kopie an seine Stelle gesetzt hatte, um ihn zu schonen, wie sie sagten, als ob ein Kunstwerk ewig währen müsse, als ob man von den kommenden Jahrhunderten nicht erwarten könnte, dass sie neue Werke schaffen! – und Paul Andersen hatte ihm Recht gegeben, obwohl ein heimlicher Punkt ganz tief in seinem Innern mit dem vorsichtigen Munizipium sympathisierte, denn jede Art von Verschwendung ging ihm nun ein für allemal gegen die Natur.
Horch, das Glöcklein! diesmal klang es wieder so rein und golden wie eine Mozartsche Melodie. Paul Andersen liebte den Mozart über alles und hatte selbst in jüngeren Jahren Mozartsche Sonaten auf der Violine gespielt. Er wollte auch seine Violine wieder hervorholen, es sollte jetzt alles anders werden, denn es war doch unverzeihlich, dass er im Ringen um das nackte Dasein so lange all seinen Schmuck und höheren Gehalt vernachlässigt hatte.
Soeben rasselte der Omnibus an den Juweliersläden der Via Cerretani vorüber, und die ausgestellten Goldwaren flimmerten im Lampenlicht. Paul Andersen wollte aussteigen, aber ein seltsamer Bann hielt ihn fest, eine Regung, das Geld noch etwas länger zu behalten, die schönen goldenen Wesen noch nicht so schnell von einander zu trennen, Lydia sollte sie noch alle beisammen sehen, den Ring konnte er auch morgen kaufen, es war ja ohnehin schon so spät, wie leicht hätte er da bei der Wahl hintergangen werden können.
Abermals versank er in Träumereien, aus denen ihn der Glockenton aufstörte. Aber diesmal läutete es Sturm. Glücklicher Paul Andersen! Das Leben selber läutet mit allen seinen Glocken, mit goldenen Glockenzungen ruft es ihm: Komm! Eine Begeisterung erfasst ihn, er springt aus dem Omnibus und rennt eine ganze Straßenlänge voran. An der Ecke biegt er links ein, er ist schon vor der Stadt, er braucht nur noch das Stück Wiese zu durchqueren, so hat er den Fuß des Hügels erreicht, an den sich die Esselinsche Villa lehnt. So spät am Abend hat er freilich seine Verlobte noch nie besucht, aber heute wirft er einmal alle kleinlichen Rücksichten über den Haufen.
Sobald er die Klingel gezogen hatte, fuhr er in die Tasche, weil er gleich Lydias Hände mit dem Gold füllen und ihr die beste Verwendung desselben anheimstellen wollte. Sein Herz stand vor Schreck stille, das Geld war fort. Er durchsuchte die Tasche und zog sie heraus, er wusste ja, dass sie kein Loch hatte, wie sollte denn das Geld hindurchgefallen sein? Aber bei schärferem Hinsehen entdeckte er eine blöde Stelle, die in der Diagonale durchgewetzt war und da hatten sie sich hinausgeschoben, die kleinen scharfkantigen Fünfer voran – Paul erinnerte sich wohl des ersten feinen Glockenstimmchens – dann die größeren Zehner und ihnen nach die starken Zwanziger mit dem Sturmgeläut ihrer Goldglocken. Er hatte sie ja alle gehört, wie sie Abschied von ihm nahmen, nur in seinem Taumel war ihm nicht klar geworden, woher der Klang kam.
Ungesäumt rannte er zurück bis zu der Stelle, wo er den Omnibus verlassen hatte. Dort hatte es zum letztenmal und am stärksten geklingelt, aber der Weg war wie abgeleckt, denn jetzt waren schon die abendlichen Fegegeister am Werk, die mit den Laternen am kurzen Stock kreuz und quer über die Straße rennen, und jeden weggeworfenen Cigarrenstummel, der noch ihrer Beachtung wert scheint, vom Pflaster auflesen. Mit sinkender Hoffnung legte Paul Andersen langsam Schritt für Schritt den ganzen Weg zurück, den er vor kurzem in wachen Glücksträumen durchmessen hatte, er hielt sich an all den Stellen auf, wo das goldene Glöcklein geklingelt hatte, aber umsonst, seine schönen funkelnden Goldstücke waren wie vom Erdboden verschlungen, er fand ihrer keines wieder.
Hätte er nur wenigstens den Ring schon gekauft, zum dauernden Zeugnis, dass der goldene Traum einmal Wirklichkeit gewesen war! Verflucht die Kutscher, die sich eben streiten mussten, als er in die Droschke steigen wollte! Verflucht der Zug der Gewohnheit, – nicht der Sparsamkeit – der ihn in den Omnibus getrieben hatte! Im Wagen wäre sein Gold wenigstens nicht auf den Boden gerollt, er hätte es vielleicht zwischen den Polstern wieder gefunden. Verflucht vor allem sein Missgeschick, das ihm nicht eine glückliche Stunde gönnte!
Finster grollend trat er den Heimweg an, und in geringer Entfernung von seinem Hause stieß er auf Neubrunn, der eben nach einer Weinhandlung ging, um Champagner zu bestellen.
»Ich bin mit Pomona ausgesöhnt«, erzählte ihm dieser, »sie hat klein beigegeben – das war ihr Glück. – Was willst du – wenn man sich schon so lange kennt! – Wir sind jetzt wieder gute Freunde. Zur Feier der Versöhnung gibt sie heute Abend ein Essen und ich spende den Champagner, du wirst selbstverständlich auch erwartet. Ja, was ist dir denn? Du bist ja fahl wie Kreide?«
Paul wollte ihm im Weitergehen von seinem Missgeschick erzählen, aber Neubrunn blieb stehen und lachte unbändig. Das war ja ein köstliches Abenteuer, das durch seinen Humor den Verlust des Geldes reichlich aufwog. Die singenden Goldvögel bereiteten ihm ein unaussprechliches Vergnügen, und er nannte Paul Andersen den guten Genius der Gassenjugend, das Horn des Überflusses, den goldenen Regen. Aber plötzlich rief er:
»Teufel, das hab ich ganz vergessen! Oben ist deine Braut und wartet auf dich.«
Andersen erschrak heftig, er ahnte sogleich ein Unheil, denn nie noch hatte das Mädchen im Lauf von zehn Jahren seine Junggesellenwohnung betreten; höchstens dass sie ihn bei außergewöhnlichen Anlässen unten im Salon der Hausfrau erwartete.
»Was es auch sei, tragt es mit Philosophie«, mahnte Neubrunn, der plötzlich ernst geworden war, er schien zu wissen, um was es sich handelte. – »Du weißt, dass im Leben nichts feststeht, als das Ende.«
Oben auf der Terrasse fand Paul seine Lydia, die seit zwei Stunden auf ihn gewartet hatte.
Sie stürzte aufschluchzend an seine Brust.
»Lydia, Lydia, was ist geschehen?«
»Du weißt noch nichts? Es weiß es schon seit gestern die ganze Stadt!«
Nun erfuhr er, dass das Bankhaus, bei dem seine und ihre Ersparnisse niedergelegt waren, die Zahlungen eingestellt hatte. Vor drei Tagen noch hatte man dort eine Einzahlung von ihr ganz ruhig einkassiert, und gestern, als sie durch ein Gerücht erschreckt, ihre Papiere zurückziehen wollte, fand sie die Kasse geschlossen. Heute aber riefen es schon die Zeitungsverkäufer durch alle Gassen, dass Dufour und Sohn fallit seien.
Dieser neue Schlag traf den armen Jungen mit solcher Gewalt, dass er sich niedersetzen musste! Er saß lange schweigend, die Arme über die Stuhllehne zusammengelegt, bis es ihm einfiel, dass die Wirtin sich darüber aufhalten könnte, wenn er so lang mit dem jungen Mädchen im Dunkeln auf der Terrasse blieb. Mechanisch erhob er sich, um die Lampe anzuzünden, und über dieser Beschäftigung ordneten sich seine Gedanken. Er wollte Lydia auseinandersetzen, dass ihre Papiere, die als geschlossenes Depot auf der Bank lagen, nicht zu der Konkursmasse gehörten, sondern, sobald die Siegel gelöst würden, durch das Gericht zurückgegeben werden müssten. Aber Lydia schüttelte den Kopf und schluchzte immer stärker: man wusste bereits, dass ungeheure Unterschlagungen vorlagen, welche die halbe Stadt ruinierten, dass auch die Depots verschwunden waren, und dass der Bankdirektor sich dahin geflüchtet hatte, wo ihn das menschliche Gesetz nicht mehr erreichte.
Paul verstummte und wusste nichts mehr zu tun, als das Mädchen in die Arme zu fassen und mit ihr zu weinen. Den Kopf auf seiner Schulter und beide Arme herabhängend, lehnte sie an ihm, wie ein krankes, junges Bäumchen an seinem stützenden Pfahl und ihr erschütterndes Schluchzen löste sich nach und nach in ruhig rinnende Tränen.
»O Paul, Paul, dass wir so unglücklich sein müssen«, klagte sie leise.
»War es schon viel?« fragte er nach einer kleinen Weile.
»Fast die ganze Summe, es fehlte nur noch ein weniges, etwas über hundert Franken zu runden zehntausend.«
So nahe war ihnen das Glück gewesen. Paul hatte es wohl gewusst, obschon er nie darnach fragte. Wie Schatzgräber, die schon den emporsteigenden Kessel mit seinem blauen Schein in der Erde flimmern sehen, hatten sie all die Zeit schweigend gestanden, wie um durch kein vorschnelles Wort den Zauber zu brechen und jetzt war der Schatz doch versunken, und es brauchte vielleicht abermals zehn Jahre, bis sie wieder so weit kamen.
In dem großen Garten jenseits der Hofmauer, von dem man nur einige Baumwipfel sah, schlug jetzt eine Nachtigall an und warf ein paar schmetternde Rouladen in die laulichte Abendluft, in die Andersens Lilien und Orangenblüten um die Wette ihren Duft ergossen. Beide wurden still und horchten. Wer, den nur ein Hauch von Poesie gestreift hat, mag reden, wenn neben ihm die Nachtigall singt! Die schmolz jetzt hin in Flötentönen, worin die Liebe selber ihre Seele auszuströmen schien, wie lange goldene Tropfen fiel es nieder, plötzlich unterbrach sie sich mit einem halben Triller, wie mit einem Schrei und ihre Stimme erhob sich in einem Wirbel von Wohllaut: jubelnd, klagend, triumphierend – ein Sturm des Entzückens, der sich auflöste ins Unaussprechliche, ins Element.
Die beiden weinten jetzt nicht mehr, sie tauschten lange, lange Küsse. Sie vergaßen endlich ihr Leid und empfanden nur noch eines die Nähe des andern.
Lange hatten sie sich nicht mehr so gehalten. Sie waren sich zwar innig zugetan, diese beiden Stiefkinder des Glücks, aber das lange Warten und die strenge Übung der Konvenienz hatte den ersten Schmelz der Leidenschaft abgestreift. Jetzt aber fühlten sie sich um zehn Jahre verjüngt, wie in den ersten Tagen ihrer Liebe. Ein Trotz kam über den Mann, es mit seinem Unstern aufzunehmen, dem Schicksal zuwider dennoch glücklich zu sein, aber da durchfuhr ihn ein schreckhafter Gedanke.
»Und Esselins? Werden sie dich nicht vermissen?«
Nein – man hatte ihr den Abend freigegeben, um sich bei Freunden in der Stadt auszuweinen, weil sie heute doch zu nichts zu brauchen war.
Nun klopfte es laut an die Terrassentür und Karl Neubrunn erschien mit zwei Champagnerflaschen unter dem Arm.
»Habt ihr euch nun des Leids gesättigt und seid ihr imstand, ein vernünftiges Wort zu hören«, begann er. »So vernehmt: Pomona richtet soeben ihren Risotto an – sie hat Rigalia darein gewiegt und ihn mit Curry gewürzt – und zwei Wildenten drehen noch am Spieß. Was den italienischen Salat betrifft, so habe ich selbst seine Zubereitung überwacht, und damit ist alles gesagt. Vom Nachtisch nenne ich nur Ein Wort: Gorgonzola. Frau Pomona und ich bitten um das Erscheinen unsrer Gäste. Ihr Bengel sitzt mit bei Tische, also sind wir zu fünfen. Fräulein Lydia hat uns zwar noch nicht zugesagt, aber ihre Zusage wurde als sicher angenommen. Pomona setzt uns ihren Pomino vor – Verzeihung für das Wortspiel – und den Champagner trinken wir auf der Terrasse. Ich musste ihn auf deine Rechnung schreiben lassen, denn sie wollten mir nicht borgen. Aber du darfst nicht erschrecken, Paul, morgen wird er unfehlbar bezahlt, ich erwarte Geld.«
Paul lachte, Lydia lachte ebenfalls und eilte hinab, um der Wirtin beim Anrichten behilflich zu sein.
Das Essen, das auf Pomonas feinstem Porzellan serviert und mit ihrem ältesten Wein begossen wurde, brachte eine sanft gehobene Stimmung, die auf die beiden Kummervollen wie der erste milde Sonnenblick nach schwerem Hagelschlag wirkte, sie sahen sich leise um, was ihnen noch an Hoffnungen geblieben sei. Karl Neubrunn quoll über von Laune und Liebenswürdigkeit, wie immer, wenn er in Gesellschaft und bei gutem Weine saß. Die Räume wurden weiter, in denen er sich befand, man fühlte sich mit ihm in freier Luft, es schien, als müsse nun gleich ringsum alles zu grünen und zu blühen beginnen. Seine Nachbarin Lydia, deren gedrücktes Aussehen ihn erbarmte, überhäufte er mit den ritterlichsten Aufmerksamkeiten, wollte sie immer selbst bedienen und machte sie dadurch zum Mittelpunkt der Gesellschaft. Die Hausfrau ging schnell auf diesen Ton ein, indem sie recht als Italienerin damit anfing, Lydias körperliche Vorzüge herauszustreichen, sie lobte auch ihr schönes Italienisch sowie ihre Geschicklichkeit in häuslichen Dingen, und wunderte sich, dass man bei so großer Jugend schon so viel Reife und Haltung besitzen könne.
Dem anmutigen, verschüchterten Geschöpf ging das Herz auf, endlich auch einmal etwas zu bedeuten. Sie war sehr hübsch und schien auf den ersten Blick noch ganz jung, aber ihren überschlanken Formen fehlte schon die Rundung, und ihr Gesicht hatte einen heimlich leidenden Ausdruck, wie eine Rose, die seit mehreren Tagen im Wasser steht: sie bewahrt noch ihren Duft und Farbenschmelz und ist scheinbar unverändert, dennoch fühlt man ihr an, dass sie beim ersten Stoß zerblättern kann.
Jetzt aber färbte sich ihr blasses Gesicht mit einer sanften Röte, die ihr lieblich stand, und ihre schönen dunkeln Augen begannen zu glänzen. Paul Andersen war glückselig über den Erfolg der Geliebten und es fiel allgemein auf, dass die beiden einander ähnlich sahen; ohne die leuchtenden Blicke, die zwischen ihnen hin- und hergingen, hätte man sie für Geschwister halten können.
Nur Karl Neubrunns Unart, immer deutsch zu reden, ohne Rücksicht auf die Wirtin, verdarb dem zartfühlenden Andersen diesen schönen Abend ein wenig. Er trat alle Augenblicke dem Freund auf den Fuß und flüsterte: »Sprich doch italienisch« – aber dieser achtete nicht darauf, und Pomona, obgleich sie kein Wort verstand, hing mit gespannter Aufmerksamkeit an Neubrunns Mund und lachte fröhlich mit, wenn die andern lachten.
Vor allem war Neubrunn bemüht, die gute Lydia über den Geldverlust zu trösten, denn der moralische Gewinn, den sie aus diesem Vorkommnis ziehen werde, sei groß genug, um sich mit dem Schaden auszusöhnen.
»Es ist leider die natürliche Folge des unbedachten Geldanlegens«, sagte er, »man sollte dieser hässlichen Versuchung immer widerstehen, das ist nur gut für Menschen, die einen angeborenen Beruf zum Reichwerden haben. Ich selber hatte auch einmal eine kapitalistische Anwandlung, aber eine innere Stimme trieb mich, mein eingezahltes Geld schon des andern Tags von der Bank zurückzuholen und damit auf Reisen zu gehen, denn nur das Geld, das man aufbraucht, ist wahrhaft sicher angelegt.«
Pomona schien hier etwas verstanden zu haben, sie nickte mit dem Kopf und schaltete den Spruch ein: »Uomo allegro, Dio l’ajuta.«
Neubrunn beglückwünschte sie eifrig zu diesem Fund, und hatte diesmal sogar die Gefälligkeit, ihr seine Worte zu verdollmetschen.
»Es liegt die tausendjährige Weisheit eines sinnenfrohen Volks in diesem Sprichwort«, sagte er.
»Der trübsinnige Germane hat ein anderes erfunden, das so ungefähr das Gegenteil ausdrückt: ›Wenn es dem Esel zu wohl wird, so geht er aufs Glatteis tanzen‹.«
»Ach«, fuhr er mit einem Blick auf Paul Andersen fort, »es gibt manchen Esel, dem es niemals wohl wird, und der doch die Beine bricht; das, meine Freunde, ist der tragische Widersinn der Dinge! Ich hoffe«, setzte er schnell hinzu, »dass in diesem aufgeklärten Kreise kein Vorurteil gegen den edlen Vierfüßler besteht und somit meine Worte niemand verletzen können.«
»Nicht im Geringsten«, antwortete Andersen. »Ich war von je der traurige Esel mit den hängenden Ohren, der das Glatteis meidet und auf sicherer Chaussee zu Schaden kommt.«
Karl Neubrunn erwiderte wohlwollend:
»Es ist eine deiner besten Eigenschaften, dass du dich deiner Tugend nicht überhebst, sondern sogar hin und wieder so erleuchtet bist, sie für eine Lücke deines Wesens zu erkennen. Auch hast du die Entschuldigung des schwächlichen Beispiels, weil in deiner Heimat alle Menschen Tugendbolde sind. Darum: ego te absolvo.«
»Und nun«, fuhr er fort, »da wir bei diesem Thema sind, bitte ich um Erlaubnis, den anwesenden Freunden meine Lebensanschauung auseinanderzusetzen. Für mich zerfällt die Menschheit seit lange in zwei Hauptgattungen: Die Schuster und die Schneider.«
Andersen und Lydia starrten ihn verwundert an und Pomona bat um eine Übersetzung, was den Sprecher nun bewog, halb deutsch und halb italienisch fortzufahren.
»Ja, die breitspurigen, weitherzigen, sinnenfrohen, die Temperamentsmenschen, die Schustermenschen und die feinspurigen, spitzigen Schneider, die klugen, oft superklugen, spekulierenden, weit ausspähenden, rechnenden, auch sich verrechnenden, aber eben so oft gewinnenden Schneider. Diese beiden Naturen führen seit Beginn der Welt einen großen, wechselvollen, nie ausgefochtenen Krieg, in dem das Glück hinüber- und herüberschwankt. Fast alle großen geschichtlichen Ereignisse sind in ihrem letzten Urgrund zurückzuführen auf den heimlichen Kampf der Schuster und der Schneider, denn diese hassen sich mit dem tötlichsten Hass, sie müssen sich befehden, wenn auch eine Mutter sie geboren hat, weil ihre beiden Naturen einander aufheben. Und wir alle haben keine Wahl, wir müssen entweder Schuster oder Schneider sein.«
»Gibt es gar keine Ausnahmen?« fragte Lydia schüchtern.
»Es gibt, aber mit diesen haben wir nichts zu tun, das sind die ganz flauen und unbedeutenden, die weder Fisch noch Fleisch sind, oder aber die allergrößten und begabtesten, die in sich den Schuster und den Schneider vereinigen, wie z. B. Napoleon, aber wie gesagt, diese gehen uns nichts an, es sind Über- oder Untermenschen. Der Normalmensch – homo sapiens – gehört stets in die eine oder die andere Klasse.«
»Erlaube mir nur«, begann Paul Andersen, aber Neubrunn legte sich breit über den Tisch und fuhr, ohne auf ihn zu hören, fort: