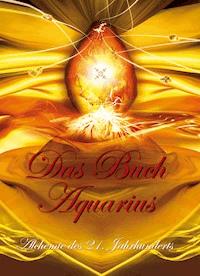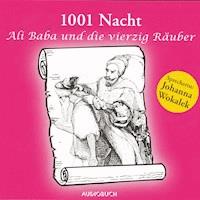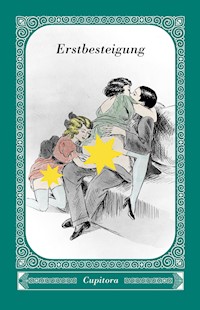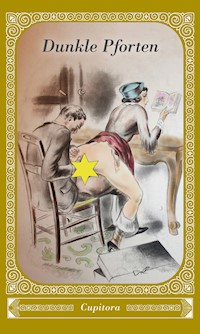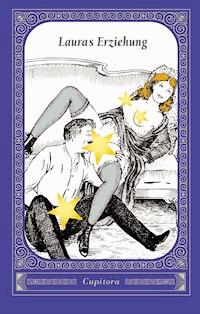Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)
- Sprache: Deutsch
SÂR DUBNOTAL Nr. 5 enthält zwei Geschichten: Die Gevierteilte von Montmartre In einem Pariser Fahrstuhl wird die gevierteilte Leiche einer Engländerin gefunden; die sogenannte "Schachbande" treibt ihr Unwesen. Sâr Dubnotal macht erneut Jagd auf den Verbrecher Tserpchikoff. Jack the Ripper Tserpchikoff entpuppt sich als "Jack the Ripper" und Sâr Dubnotal steht vor einem mörderischen Kampf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
1001 Edgar Rice Burroughs Caprona - das vergessene Land
1002 Ernst Konstantin Sten Nord - der Abenteurer im Weltraum
1003 Unbekannter Autor Jack Franklin, der Weltdetektiv
1004 Robert E. Howard Die Geier von Wahpeton
1005 Robert E. Howard Abrechnung in den Los Diablos
1006 Robert E. Howard Steve Costigan – Seemann und Boxer
1007 Murray Leinster Der tollwütige Planet
1008 Robert E. Howard Grabratten
1009 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 1
1010 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 01: Zurück vom Amazonas
1011 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 01: Das Spukschloss
1012 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 2
1013 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 3
1014 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 4
1015 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 02: Die Expedition
1016 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 5
1017 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 03: Im Dschungel
1018 Hein Patrik Kapitän Grant
1019 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 02: Der verhängnisvolle Brunnen
1020 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 03: Der blutige Streit
1021 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 04: Der Hypnotiseur
1022 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 6
1023 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 7
1024 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 05: Jack the Ripper
1025 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 06: Die Braut aus Gibraltar
1026 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 07: Die Vampire vom Friedhof
1027 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 08: Die Schlafwandlerin
Jack the Ripper
Sar Dubnotal 05
Kult Romane
Buch 24
Gerd Frank
Inhalt
Die Gevierteilte vom Montmartre
Ein sensationelles Verbrechen
Das merkwürdige Erlebnis des Nachtwächters
Sâr Dubnotal tritt auf den Plan
Wo ist die Leiche?
Die verwunschene Villa
Sâr Dubnotal und das Gespenst
Das Astralfoto
Das aufschlussreiche Zeichen
Schach und Matt!
Jack the Ripper
Die geheimnisvolle Hütte
Warnung via Telepathie
Ein gnadenloses Duell
Die Rettung
Zwischen Scylla und Charybdis
Fréjus denkt, dass er träumt
Eine unterhaltsame Anhörung
Der Mann von der Sûreté im Einsatz
Die Mausefalle
Das Ende eines Monsters
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Hans-Peter Kögler
Logo und Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-68984-060-0
1024 vom 15.09.2024
Die Gevierteilte vom Montmartre
Ein sensationelles Verbrechen
Am 15. Januar 1890 wurde das beliebte und dicht bewohnte Pariser Stadtviertel von Montmartre zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens, das die Hauptstadt und ganz Frankreich erschütterte. An jenem Morgen, es mochte gegen sechs Uhr – und noch vor Tagesanbruch – gewesen sein, machte die Brotausträgerin Louise Plache, die verschiedene Kunden in der Avenue de Clichy mit ihren Waren belieferte, eine schreckliche Entdeckung.
Die Frau wollte eben, wie jeden Morgen um diese Zeit, im Anwesen Nummer 357 läuten, als sich die Tür zur Eingangshalle unmittelbar vor ihr sperrangelweit öffnete. Unverhofft stürmte jemand aus dem Haus (möglicherweise ein Mann), rannte Louise Plache förmlich über den Haufen und flog geradezu die Straße entlang, die um diese frühe Stunde naturgemäß dunkel und menschenleer war. Die Brotausträgerin beabsichtigte nicht, dem Davonlaufenden zu folgen, obwohl sie sofort das ungute Gefühl hatte, dass der Flüchtling etwas auf dem Kerbholz haben musste. Vielleicht war er ein Einbrecher oder sogar etwas noch Schlimmeres. Angst befiel sie, doch mutig trat sie dennoch in das Haus. Sie nahm sich vor, die Concierge zu rufen, um sie zu befragen, was da vorgefallen war.
Die Eingangshalle war nicht beleuchtet. Sie ließ sich dadurch nicht beirren, klopfte ans Fenster und rief laut: „Madame Gosselin! Madame Gosselin!“ Doch die Concierge antwortete nicht. Louise Plache wiederholte ihre Rufe, hatte aber auch diesmal keinen Erfolg. Von dem anhaltenden Schweigen beunruhigt, lief sie daher wieder nach draußen, um nach einem Schutzmann Ausschau zu halten. Und tatsächlich entdeckte sie ein paar Häuser weiter – im 18. Arrondissement – einen Polizisten, den sie aufgeregt bat, ihr zu folgen. Die Brotausträgerin glaubte inzwischen fest daran, dass Madame Gosselin, der Concierge, etwas zugestoßen sein musste, möglicherweise war sie sogar von der flüchtenden Person, die sie beinahe umgerannt hätte, ermordet worden.
Der Polizist blieb ruhig und war keineswegs von den Vermutungen der Frau überzeugt, die er insgeheim für völlig aus der Luft gegriffen hielt. Dennoch folgte er ihr. Als man das Haus Nr. 357 erreicht hatte, zog er eine Taschenlampe hervor, schaltete sie ein und trat dann forsch in die Eingangshalle. Die Brotfrau folgte ihm auf dem Fuße. Beiden entrang sich, nahezu gleichzeitig, ein fürchterlicher Schreckensschrei. Im diffusen Schein der Lampe nahmen sie wahr, dass man dort, am Ende des Ganges, eine Frau im Nachtgewand mit beiden Handgelenken an die Kabine eines Aufzugs und deren Füße an die Säulen des Aufzugsschachts gefesselt hatte. Die Aufzugskabine befand sich etwa zwei Meter über dem Boden und hatte wohl, als sie diese Höhe erreicht hatte, die unglückliche Frau regelrecht in Stücke gerissen. Ihre grässlich gestreckten Gliedmaßen waren großenteils vom Körper abgetrennt, alles um sie herum schwamm im Blut.
Der Polizist und die Frau konnten ihre Blicke lange nicht von der scheußlichen Szene lösen, dann aber rannten beide wie von Furien gehetzt nach draußen. Dort fing sich insbesondere der Polizist wieder langsam, indem er versuchte, Haltung zu bewahren. Da das Opfer mit Sicherheit nicht mehr am Leben war, war es angebracht, zunächst einmal das Revier aufzusuchen und den übergeordneten Stellen Meldung von dem unglaublichen Vorfall zu machen. Bereits eine halbe Stunde später befanden sich der Kommissar, sein Assistent und mehrere andere Polizisten vor Ort. Bis zu diesem Zeitpunkt war man davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um Madame Gosselin, die Concierge, handelte.
Die fragliche Frau, eine kinderlose Witwe, war nämlich die einzige Bewohnerin der Portiersloge von Hausnummer 357. Und da sie auf die Rufe von Louise Plache nicht geantwortet hatte, erschien diese Annahme durchaus plausibel. Dessen ungeachtet irrte man sich. Sehr schnell stellte sich nämlich heraus, dass es sich bei der unglücklichen Frau um eine Mieterin handelte. Sie war vor etwa sechs Monaten in eine Wohnung des Erdgeschosses gezogen.
Die gute Madame Gosselin wurde allerdings gleichfalls tot aufgefunden – und zwar in ihrer Loge. Der Mörder war durch ein Fenster vom Hof her bei ihr eingedrungen und hatte sie erstochen. Ihr blutüberströmter Körper lag auf dem Bettvorleger neben ihrem Bett, worin sie offenbar geschlafen hatte. Der Körper der englischen Mieterin wurde nun unter großen Mühen von der Aufzugskabine gelöst. Dabei stellte man fest, dass sie der Mörder geknebelt hatte, am Körper selbst fanden sich keinerlei Wunden, außer denen, die der Aufzug verursacht hatte. Die unglückliche Frau war offenbar bei vollem Bewusstsein gevierteilt worden. Die Beamten waren nahe daran, sich zu übergeben, als sie das rekonstruiert hatten.
Zwischen der Sûreté und dem lokalen Polizeirevier wurde eine Sonderkommission gebildet, um die Hintergründe dieses scheußlichen Verbrechens aufzuklären. Von der Mieterin wusste man, dass es sich um eine gewisse Annie Stevens handelte – unter diesem Namen hatte sie sich im Hause Nr. 357 eingemietet. Sie war offenbar Engländerin und hatte vor kurzem ihre Eltern verloren, die ihr aber eine beträchtliche Summe Geldes hinterlassen hatten. Mit diesem Vermögen war sie nach Frankreich gekommen, um davon zu leben. Sie war hübsch, blond und ihre schwarzen Kleider hoben ihre Schönheit nur noch mehr hervor. Wie die meisten Engländerinnen, die im Ausland lebten, war sie also relativ unabhängig, verhielt sich aber in keiner Weise auffällig und war stets bemüht, sich ihrer Umgebung anzupassen. Die Nachbarn konnten nichts Nachteiliges über sie sagen, im Gegenteil schätzten sie sie sehr, trotz ihrer leichten Reserviertheit. Sie war unverheiratet und behalf sich mit den Diensten einer Zugehfrau, die jeden Morgen pünktlich zu ihrer Arbeit erschien.
Ihre Wohnung bestand aus vier Räumen: einem Salon, der auf die Avenue de Clichy hinaus lag, einem Schlafzimmer, das auf den Innenhof des Hauses lag, einem großen Badezimmer und einer kleinen Küche, die auch als Esszimmer genutzt wurde. Die Wohnung grenzte direkt an die geräumige Eingangshalle, die Eingangstür lag der zur Loge der Concierge genau gegenüber. Um in ihre Wohnung zu gelangen, musste die Frau an der Pförtnerloge vorbeigehen, eine Treppe oder den Aufzug brauchte sie dagegen im Prinzip nicht zu benutzen. Das Salonfenster lag nur etwa eineinhalb Meter über dem Bürgersteig. War der Mörder auf diesem Wege in die Wohnung der Engländerin eingedrungen? Aber der solide Rollladen, mit dem das Fenster ausgestattet war, wies keinerlei Spuren auf, die auf ein gewaltsames Eindringen schließen ließen. Dagegen war das Fenster des Schlafzimmers, das auf den Innenhof lag, offen – genauso wie die Tür zur Eingangshalle.
Daraus ergab sich, dass der Mörder von der Rückseite des Hauses her eingestiegen sein musste, vermutlich über eine niedrige Mauer, an die der Innenhof dort grenzte. Dann war er durch das Fenster bei der Concierge eingedrungen und hatte die unglückliche Frau erstochen. Anschließend sprang er wieder auf den Hof hinaus und brach bei der Engländerin ein, indem er erneut über ein Fenster eindrang – diesmal ins Schlafzimmer von Annie Stevens, die er gleichfalls im Schlaf überraschte. Der Lärm, den er möglicherweise verursachte, musste ihn nicht beunruhigen, da die Concierge zu diesem Zeitpunkt ja bereits tot war.
Bis zu diesem Punkt schien alles ganz klar zu sein. Für die Sonderkommission stand auch fest, dass er anschließend die Frau geknebelt und in die Halle gezogen hatte. Dann hatte er sie an die Fahrstuhlkabine gebunden, den Mechanismus in Gang gesetzt, absolut teuflisch in Kauf nehmend, dass das unglückliche Opfer dabei zerstückelt werden musste. Dass diese schreckliche Tat eventuell noch verhindert oder unterbrochen werden könnte, war nicht zu erwarten. Wurde er dennoch von einem unvorhergesehenen Besucher überrascht, so konnte er sich prob-lemlos mit einem einzigen Sprung nach draußen retten. Aber was war das Motiv für dieses Verbrechen gewesen? Weshalb kam es zu dieser beispiellosen und unmenschlichen Grausamkeit gegenüber einem der beiden Opfer? Hatte man die Concierge eventuell nur ermordet, um leichter bei der Engländerin eindringen zu können?
Dieses Rätsel schien unlösbar zu sein, zumal es sich ja um keinen Raubmord gehandelt hatte. Es fehlten keinerlei Wertgegenstände, weder aus der Wohnung der Engländerin noch aus der Loge der Concierge. So fand man beispielsweise im Schreibtisch der jungen Frau Bargeld und Schmuck in beachtlichem Umfang – andererseits fehlten alle persönlichen Schriftstücke und Papiere, die über die Engländerin Auskunft hätten geben können, zum Beispiel Briefe, Karten oder Dokumente; nichts davon war vorhanden. Am merkwürdigsten aber war, dass in der Küche, wo Annie gewöhnlich ihre Mahlzeiten zubereitete, Anstalten getroffen waren, ein exzellentes Essen für zwei Personen vorzubereiten. Auf dem Tisch lagen zwei Teller, die mit kaltem Braten, Rebhuhn und Pastete gefüllt waren, daneben standen zwei Flaschen Wein und Champagner, eine Flasche Chartreuse und ein Bukett mit weißen Rosen.
Welchen Besucher hatte Annie Stevens erwartet? Oder stammte das Mahl noch vom Vorabend und der Besuch war gar nicht gekommen? Man befragte die Hausgehilfin, doch die wusste nichts hiervon. Sie war sogar höchst erstaunt über das Gedeck. Sie hatte Frau Stevens immer als sehr einfach, eher anspruchslos, eingeschätzt, die niemals so üppig gegessen und getrunken hätte (ihre Lieblingsgetränke waren Milch und Tee). Zu ihren Aufgaben gehörte auch das Einkaufen, und sie beteuerte, nichts Derartiges besorgt zu haben. Auch das Blumenbukett hatte sie nicht hingestellt.
Die Angelegenheit wurde immer mysteriöser, erfüllte die Tragödie von Montmartre mit immer neuen Rätseln. Handelte es sich um ein Delikt aus Leidenschaft oder war der Täter ein Psychopath? Um diese Frage beantworten zu können, hätte man über weit mehr Informationen bezüglich des Vorlebens der Engländerin verfügen müssen; die mageren Angaben, die der Polizei vorlagen, reichten nicht aus, um irgendeine Theorie zu entwickeln. Alles, was man wusste, war, dass Annie Stevens weder Verwandte noch Freunde in Paris hatte, so dass es praktisch keine direkte Möglichkeit gab, in Erfahrung zu bringen, was für ein Leben sie in England geführt hatte.
Noch am gleichen Tag wurden die Leichen der Concierge und der Engländerin in das Gerichtsmedizinische Institut zur Autopsie gebracht; die zahlreichen Abendzeitungen ergingen sich in Form von Spezialausgaben in scheußlichen Einzelheiten und einer ausführlichen Darstellung der beiden Morde in der Avenue de Clichy. Die Polizei ließ verlauten, dass die Autopsie der beiden Opfer längere Zeit in Anspruch nehmen würde, und so wurde deren abschließendes Ergebnis mit großer Ungeduld erwartet. Vor allem beschäftigte die Ermittler die Frage, welche der beiden Frauen als Erste ermordet worden war, wenngleich alles dafür sprach, dass dies Madame Gosselin, die Concierge, gewesen sein musste.
Die Kriminalpolizei nahm sich zunächst vor, den Tathergang einigermaßen konkret zu rekonstruieren, denn man erhoffte sich dadurch eine minimale Chance, dem grausamen Täter auf die Spur zu kommen. Vielleicht würde man auf diese Weise auch Hinweise auf das Motiv entdecken. Kein Mensch konnte sich indes vorstellen, dass es im Verlauf der folgenden Nacht zu Vorgängen kommen sollte, die den Fall noch sehr viel mehr komplizierten.
Das merkwürdige Erlebnis des Nachtwächters
Bis noch vor relativ kurzer Zeit war es üblich, dass Leichen, deren Identität nicht geklärt werden konnte, in der Morgue, einem Schauhaus, hinter Glas öffentlich ausgestellt wurden. Die Menge defilierte direkt davor vorbei und machte entsprechende Bemerkungen, die von extra zu diesem Zweck abgestellten Beobachtern interessiert auf Brauchbarkeit aufgeschnappt wurden. Obwohl die Identität der Engländerin Annie Stevens noch nicht einwandfrei bewiesen werden konnte, hatten die Behörden dennoch beschlossen, von dieser Praxis geringfügig abzuweichen, um einen Ansturm neugieriger Besucher zu vermeiden. Deshalb hatte der Direktor der Morgue veranlasst, die beiden Mordopfer von Montmartre in einem großen Sarg aufzubahren, der im Kühlraum untergebracht wurde. Vielleicht aus Pietätsgründen, eventuell aber auch als Vorsichtsmaßnahme, hatte man die beiden Frauen in Tücher gehüllt. Sie bildeten doch einen zu grässlichen Anblick, insbesondere die unglückliche junge Frau, deren Gliedmaßen größtenteils vom Körper abgetrennt waren.
Nachdem das Leichenschauhaus an diesem Tag geschlossen worden war, zogen sich der Direktor und seine Angestellten zurück; lediglich ein Mann, den alle Welt nur Père Berton nannte, hielt sich noch in dem weitläufigen Gebäude auf. Er versah seinen Dienst bereits viele lange Jahre, hatte in seiner Jugend dem Tod schon sehr oft ins Auge geblickt: Er hatte im Krimkrieg und in Italien gekämpft, hatte an der Belagerung von Sewastopol und den Schlachten von Magenta und Solferino teilgenommen, während um ihn herum Russen, Engländer, Italiener, Österreicher und Franzosen gefallen waren. Aus diesem Grunde empfand er seine Tätigkeit, das heißt die ständige Beobachtung von Toten, auch nicht als makaber oder gar unheimlich. Er war froh, sein kärgliches Einkommen, das aus einer bescheidenen Militärpension bestand, durch diesen Dienst etwas aufbessern zu können.
„Das ist leicht verdientes Geld“, pflegte er zu seinen Freunden zu sagen. „Ich brauche nur da zu sein, gehe ein bisschen herum und rauche dabei mein Pfeifchen, das ist alles, was ich zu tun habe. Mit solchen Nachbarn hat man niemals Probleme oder gar Ärger. Tote schlafen fest.“ Und wenn ihm die Kälte des Kühlraumes gar zu sehr zusetzte, zog er sich in seinen Aufenthaltsraum zurück, wo es stets angenehm war.
„Berton“, sagte der Direktor an jenem Abend, „ich erwarte von Ihnen absolute Diskretion. Ganz Paris wurde von der Tragödie in der Avenue de Clichy aufgeschreckt, und eine Armee von Reportern ist unterwegs, um in diesem Fall zu recherchieren. Unter diesen Leuten gibt es immer auch sensationslüsterne, taktlose Typen, die ihre Nasen in all jenes stecken, das sie rein gar nichts angeht. Gehen Sie denen aus dem Weg, Berton! Ich wäre nicht überrascht, wenn Sie heute Nacht von einem solchen Menschen bedrängt werden sollten. Ich musste bereits einige von ihnen hinauswerfen, denn sie wollten die Toten um jeden Preis sehen, um sie fotografieren zu können. Das aber hat sich die Präfektur strengstens verboten und ich kann das auch gut verstehen. Stellen Sie sich also rechtzeitig darauf ein.“
„Was schlagen Sie vor, Herr Direktor?“, fragte der alte Mann.
„Verschließen Sie ganz einfach höchst sorgfältig alle Türen und öffnen Sie absolut niemandem. Wären diese Leute einmal im Inneren des Hauses, so würden sie wohl auch nicht davor zurückschrecken, das Verbot, keine Fotos zu schießen, zu missachten, um gewaltsam an ihr Ziel zu kommen.“
„Das möchte ich ja keinem raten!“, brummte der alte Soldat und machte ein grimmiges Gesicht. „Bei allen neunundneunzig Teufeln, lassen Sie sie ruhig kommen, ich werde ihnen schon heimleuchten.“
„Kein Grund, um Ihre alten Heldentaten wieder aufleben zu lassen“, beschwichtigte ihn der Direktor. „Begnügen Sie sich damit, die Rolle zu spielen, die ich Ihnen zugewiesen habe. Lassen Sie die Journalisten draußen stehen und gewähren Sie vor allem auch keinem von ihnen ein Interview.“
„Verstanden, Kapitän, äh-äh, Monsieur. Ich werde mich in meine Höhle hier zurückziehen und niemanden hereinlassen.“
Nachdem sich der Direktor auf diese Weise der Zuverlässigkeit seines Nachtwächters versichert hatte, verließ er beruhigt die Morgue und ließ Berton allein zurück. Der verschloss sorgfältig das Eingangstor, nicht ohne vorher auch noch die Rollläden aller Fenster heruntergelassen zu haben, entzündete seine Laterne, die immer nur einen gedämpften Lichtschein verbreitete, und zog sich wieder in seinen gemütlichen Aufenthaltsraum zurück, der zudem beheizt war. Mit sich und der Welt zufrieden, ließ er sich in seinen Korbstuhl plumpsen und entzündete sich eine Pfeife. „So kann man es aushalten“, brummte er vor sich hin. „Solch ein Feuerchen hätten wir damals in den Schützengräben vor Sewastopol gebraucht! Dort, in diesen verdammten Schneelöchern, waren keine Kühlräume nötig, um die Toten zu konservieren. Die meisten dieser armen Kerle mussten gar nicht an Kugeln sterben, sondern sind ganz einfach zu Schneemännern geworden.“
Nach diesem Vergleich lachte er lautlos vor sich hin. So vergingen mehrere Stunden in absoluter Ruhe. Der Direktor schien sich geirrt zu haben. Kein Journalist erschien an der Morgue, um nächtlichen Einlass zu begehren. Père Berton schichtete noch etwas Holz in den Ofen und schickte sich an, ein Nickerchen zu machen. Seine Toten brauchten ihn nicht und er war auch nicht verpflichtet, die ganze Nacht hindurch wachzubleiben. Das war in seiner aktiven Militärzeit freilich etwas anderes gewesen, damals, in den Fünfziger-Jahren, als die verdammten Russen und Österreicher die französischen Linien in der Dunkelheit unter Beschuss nahmen.
„Bei allen neunundneunzig Teufeln, wer hätte es damals gewagt, ruhig zu schlafen? Entweder wäre man erfroren, oder so ein riesiger slawischer oder teutonischer Teufel hätte einen mit dem Bajonett wachgekitztelt.“ Hier dagegen war Père Berton sicher, zumindest glaubte er das. Und kaum hatte er sich in eine alte Decke gehüllt, die er noch aus seiner Militärdienstzeit in seine alten Tage herübergerettet hatte, da war er auch schon eingeschlafen und begann laut zu schnarchen.
Es mochte gegen ein Uhr nachts sein und der Nachtwächter schlief noch immer, als vom Kühlraum her ein verdächtiges Geräusch zu vernehmen war, das ihn schnell aus dem leichten Schlummer riss. Es hörte sich fast so an, als sei ein Körper auf den Boden gefallen. „Was ist das denn?“, fragte er sich erstaunt und rieb sich die Augen. „Träume ich oder hat es einer meiner Nachbarn in seinem Sarg nicht mehr ausgehalten? Wollte er mal das Liegen auf dem Boden ausprobieren?“ Er spitzte die Ohren und vernahm nebenan erneut Geräusche, die er sich aber nicht erklären konnte. Zunächst vermutete er, dass der Direktor mit seinen Befürchtungen möglicherweise doch recht gehabt haben könnte. Vielleicht versuchte irgendein waghalsiger Journalist, um diese ungewöhnliche Zeit Einlass zu finden.
„Alle Teufel“, brummte er und ergriff einen Knüppel und seine Laterne. „Falls mich die Herren Journalisten überraschen wollen, werden Sie sich wundern! Kommt nur, ihr Burschen, ich will’s euch schon zeigen!“ Trotz dieser zuversichtlichen Worte nahm sich Père Berton vor, vorsichtig zu Werke zu gehen. Er war sich bewusst, dass er es mit seinen knapp fünfundsechzig Jahren in einer direkten Auseinandersetzung mit einem jüngeren, eventuell gut durchtrainierten Gegner nicht eben leicht haben würde. Er verbarg deshalb seine Laterne geschickt unter seinem Umhang und öffnete sacht die Tür seines Zimmers, die hinaus auf den Gang führte. Von dort aus warf er einen schnellen Blick auf den Haupteingang. Zu seiner großen Überraschung bemerkte er, dass dieser noch immer verschlossen war. Hatte er sich geirrt? War gar niemand in die Morgue eingedrungen? Dennoch vernahm er nun wieder das gleiche Geräusch wie schon vorher. Es klang ganz so, als ob jemand an den Särgen zugange sei.
Wer war dieser unheimliche Besucher? Und wie mochte er in das Gebäude gekommen sein? Obwohl er kein furchtsamer Mensch war, fühlte sich Père Berton unbehaglich. Er war mit seiner Weisheit am Ende; was mochte hier vorgehen? „Aber ja, das muss es sein! Warum habe ich bloß nicht früher daran gedacht.“
Plötzlich war ihm eingefallen, dass in kalten Winternächten oftmals ganze Legionen von Wasserratten, von der Seine herkommend, die Morgue befielen; vermutlich lockte sie der von den Leichen ausgehende Verwesungsgeruch an. Schon mehrmals hatte der Nachtwächter solche Angriffe abwehren müssen. Doch die Nagetiere waren immer dreister geworden. Schließlich hatte der Alte seine Vorgesetzten gebeten, ihm entweder eine Katze oder einen Hund zu verschaffen, um gegen diese Plage erfolgreicher vorgehen zu können. Sein Wunsch war nicht erfüllt worden, weil die Leitung der Morgue befürchtete, dass das Publikum an Haustieren gleich welcher Art Anstoß nehmen könnte. Aus diesem Grunde verfügte der alte Aufseher lediglich über einen Stock, mit dem er auf die Ratten einprügeln musste, wenn sie es gar zu arg trieben. Das war wenig genug, denn wenn die Nager hungrig waren, ließen sie sich kaum einschüchtern.
„Na wartet, ihr Viecher!“, knurrte er und öffnete die Tür zum Kühlraum. „Ich werde euch beibringen, wie ihr euch meinen Nachbarn gegenüber zu verhalten habt!“ Als er mit seiner Laterne in den Raum hineinleuchtete, sah er jedoch keine Ratten, sondern einen gleichfalls mit Laterne versehenen Mann, der einen Leinwandsack hinter sich her schleifte. Soweit er sich später noch an das Geschehen erinnern konnte, war der Mann sehr groß und breitschultrig gewesen, er hatte einen langen schwarzen Mantel und einen weichen, breitkrempigen Hut getragen, der einem Sombrero nicht unähnlich war. Die Hutkrempe war nach unten – über eine schwarze Samtmaske – gezogen, die das Gesicht des Fremden verbarg und dem Träger lediglich begrenzte Sicht gewährte. Auffallend waren seine brennenden, raubtierähnlichen Augen.
Der unheimliche nächtliche Besucher stand neben den aufgebahrten Särgen, in denen die Leichen der beiden Mordopfer gelegen hatten. Als er den Nachtwächter hereinkommen sah, drehte er sich abrupt um und fixierte Berton mit einem aggressiven starren Blick, der mehr Ärger als Enttäuschung verriet. Jetzt erst bemerkte der Aufseher, dass einer der beiden Körper auf dem Boden lag, gleichzeitig befiel ihn, je länger er seinem Gegenüber in die Augen sah, eine fürchterliche Angst, die er sich nicht zu erklären vermochte, gepaart mit Schwindelgefühl.