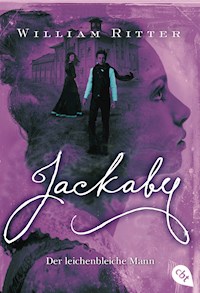
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die JACKABY-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kein Fall zu selten, keine Spur zu heiß!
New Fiddleham, 1892: Es ist zehn Jahre her, dass Jenny Cavanaugh ermordet wurde, doch sie hat noch lange keine Ruhe gefunden und lebt als Geist in Jackabys Haus weiter. Als sich in New Fiddleham auf einmal Mordfälle ereignen, die Jennys Fall verblüffend ähneln, nehmen Jackaby und seine Assistentin Abigail den Fall von damals wieder auf – mit der Absicht, den aktuellen Fall dabei ebenfalls zu lösen. Ihre Suche treibt sie in die Arme eines leichenbleichen Feindes …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Foto: © Katrina Santoro
Der Autor
William Ritter hat an der University of Oregon studiert und unter anderem Kurse in Trampolinspringen, Jonglieren und über das Italienische Langschwert aus dem 17. Jahrhundert belegt. Er ist verheiratet, stolzer Vater und unterrichtet englische Literatur. Jackaby ist sein Debütroman. Mehr zum Autor auch auf Twitter @Willothewords
Von William Ritter ist außerdem bei cbt erschienen:
JackabyJackaby – Die verschwundenen Knochen
Mehr zu cbj/cbt auch auf Instagram @hey_reader
William Ritter
JACKABY
Der leichenbleiche Mann
Aus dem Englischenvon Dagmar Schmitz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Januar 2019
© 2016 by William Ritter
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Ghostly Echoes. A JACKABY Novel« bei Algonquin Books, New York.
Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York.
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Dagmar Schmitz
Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
Coverdesign: Jacket art and design by jdrift designJacket photos
© BestPhotoStudio/Shutterstock (silhouette),
Shutterstock (man’s head), Robert Piacentini (building)
he · Herstellung: eR
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20915-5V001
www.cbj-verlag.de
1
Jackabys unordentliches Arbeitszimmer drehte sich um mich. Schwer auf den Schreibtisch gestützt, rang ich nach Luft. Mein Kopf pochte, als hätte sich ein Eiszapfen von einer Schläfe bis zur anderen gebohrt, aber der Schmerz ließ allmählich nach. Ich öffnete die Augen. Der Stapel Akten, den zu sortieren ich den Morgen verbracht hatte, war über den Teppich verstreut, und die Ente des Hauses hockte hinter der staubigen Kreidetafel und schob sich ängstlich von einem Schwimmfuß auf den anderen.
Bloß eine einzige Akte lag zu meinen Fingerspitzen auf dem Tisch – ein Wust aus verblassten Zeitungsausschnitten und grobkörnigen Fotografien. Mein Blut hämmerte gegen die Schädeldecke, und ich versuchte, meinen Herzschlag durch langsames Ein- und Ausatmen zu beruhigen. Ich hatte den Polizeibericht über den grausamen Mord an einer unbescholtenen jungen Frau und das rätselhafte Verschwinden ihres Verlobten vor mir. Darunter steckte das gedruckte Abbild eines Hauses: ein dreistöckiges Gebäude in einer Hafenstadt in New England – eben jenes Haus, in dem ich jetzt stand –, allerdings vor zehn Jahren. Es hatte schlichter und trauriger ausgesehen, damals im Jahr 1882. Außerdem waren da noch die gesammelten Notizen meines Arbeitgebers und daneben eine Fotografie von einem leichenblassen Mann, der die Lippen zu einem niederträchtigen Grinsen verzogen hatte. Hinter ihm standen seltsame Gestalten in langen Lederschürzen und mit dunklen Schutzbrillen. Meine Augen verweilten – wie sie es schon so oft getan hatten – auf der letzten Fotografie. Eine Frau.
Mir wurde schlecht. Erneut verschwamm mein Blick für einige Sekunden. Ich atmete tief durch und zwang mich hinzusehen. Die Frau auf dem Bild trug ein elegantes Abendkleid und lag, einen Arm ausgestreckt, den anderen angewinkelt, auf dem nackten Fußboden. Um ihren Hals hing eine Kette mit einem kleinen Medaillon aus Zinn. Ein dunkler Fleck umschattete ihre Brust und sammelte sich zu einer tintenschwarzen Lache um ihren Körper. Jenny Cavanaugh. Meine Freundin. Seit zehn Jahren tot und ein Geist, schon seit ich sie kannte.
Ein sanftes Schimmern im Raum lenkte mich ab und ich riss den Blick von dem grausigen Bild los. Eine Hand Halt suchend auf den Schreibtisch gestützt, hob ich das Kinn und richtete meine Bluse, während vor mir eine geisterhafte Erscheinung Gestalt annahm. Mein Herzschlag dröhnte mir nach wie vor in den Ohren, und ich fragte mich, ob Jenny ihn ebenfalls hören konnte.
»Alles in Ordnung. Es geht mir gut«, log ich. Es geht mir überhaupt nicht gut!, schrie jede Faser in mir. »Diesmal bin ich gewappnet.« Ich bin alles andere als gewappnet!
Ich holte tief Luft. Die geisterhafte Erscheinung sah nicht überzeugt aus. »Bitte«, sagte ich. »Versuch es noch einmal.« Das ist keine gute Idee! Es ist eine schrecklich dumme Idee. Es ist…
Und dann verschwand das Arbeitszimmer in einem gleißenden Nebel aus Eis und Schmerz.
Jenny Cavanaugh war tot und sie war nicht glücklich darüber. In einer Woche würde sich zum zehnten Mal der Tag jähren, an dem der Tod in ihr Haus gekommen war. Zum zehnten Mal würde sich der Tag jähren, an dem er sie in ihrem Zimmer hinterrücks überfallen und ihr Blut über die glänzend sauberen Holzdielen vergossen hatte. Howard Carson, ihr Verlobter, war in derselben Nacht verschwunden und mit ihm jeder Hinweis auf das Motiv oder den Verursacher des grausamen Verbrechens.
Vielleicht lag es am Näherrücken dieses makabren Jahrestages, aber in all den Monaten, die ich sie nun kannte, war Jenny noch nie so heftig von ihren Erinnerungen geplagt worden wie in der vergangenen Woche. Ihre unbeschwerte Art und ihr perlendes Lachen waren angespanntem Schweigen gewichen. Sie bemühte sich, den Anschein von Zuversicht zu wahren, und versicherte mir stets lächelnd, es ginge ihr gut. Doch ihre Augen verrieten den Aufruhr, der in ihr tobte – und es gab Zeiten, in denen die Maske vollends fiel. Was dahinterlag, war kein schöner Anblick.
R. F. Jackaby, mein Arbeitgeber und Spezialist für ungeklärte außergewöhnliche und übernatürliche Phänomene, nannte solche Momente Echos. Ich vermochte nicht annähernd zu erahnen, wie groß Jennys Seelenqual war, aber ich erhaschte jedes Mal einen flüchtigen Blick auf die eisige Schwärze in ihr, wenn ich Zeugin eines dieser Echos wurde. All das, was Jenny ausmachte, fiel dann von ihr ab, bis sie schließlich bloß noch ein schattenhaftes Abbild der letzten Augenblicke ihres Lebens war. Zorn und Angst überwältigten sie, weil sie das Geschehene erneut durchlebte, und rings um sie tobte ein Wirbelsturm aus Eis.
Die unergründlichen Kräfte, die für die Unversehrtheit der Seele sorgten, ließen Jenny in solchen Momenten im Stich, und was dann von ihr blieb, war nicht recht lebendig und kaum noch menschlich. Das erste Mal, als ich sie in diesen Zustand der Kälte versinken sah, war schon schlimm gewesen, aber längst nicht so schrecklich wie das letzte Mal. Je tiefer wir in ihren Fall vordrangen, desto häufiger und heftiger überfielen sie die Echos.
Wenn sie ihre Contenance schließlich wiedererlangt hatte, blickte Jenny stets mutlos und geknickt auf diese Momente zurück, verwirrt wie eine Schlafwandlerin, die aufwacht und sich auf einem Dach wiederfindet. Doch sie war zunehmend entschlossen, ihre Selbstbeherrschung zu vervollkommnen, um Antworten auf die Fragen zu finden, die sie seit ihrem Tod verfolgten, und ich war zunehmend entschlossen, ihr dabei zu helfen.
»Gehen Sie behutsam vor, Miss Rook«, mahnte Jackaby eines Abends, obwohl gewöhnlich er der Letzte war, der Vorsicht walten ließ. »Es hilft niemandem, Miss Cavanaugh dazu zu drängen, sich zu schnell oder zu weit vorzuwagen.«
»Ich bin sicher, sie vermag mehr, als wir ahnen, Sir«, sagte ich. »Wenn ich darf …«
»Sie dürfen nicht, Miss Rook«, sagte er. »Ich habe mich kundig gemacht, habe Mendels Abhandlung über halb Verstorbene gelesen sowie Havershams Gaelic Ghasts. Und Lord Alexander Reisfar hat ganze Bände über die verletzliche Seele der Untoten geschrieben. Seine Forschungsergebnisse sind wahrhaft nichts für Zartbesaitete. Wir dringen in ein Gewässer vor, das wir nicht zu stark aufwühlen sollten, Miss Rook. Um Jennys und um unseretwillen.«
»Mit Verlaub, Sir, aber Jenny ist keines der Versuchsobjekte des pedantischen Lord Reisfar. Sie ist Ihre Freundin.«
»Sie haben recht. Weil nämlich Lord Reisfars Erkenntnisse damit einhergingen, geisterhafte Versuchsobjekte dazu zu zwingen, über ihre Grenzen hinauszugehen, nur um herauszufinden, was mit ihnen geschieht – und das ist nichts, was ich zu tun beabsichtige.«
Ich stutzte. »Was geschah denn mit seinen Versuchsobjekten?«
»Was geschah«, antwortete Jackaby, »ist der Grund dafür, warum Lord Reisfar nicht mehr zugegen ist, um es Ihnen persönlich zu erzählen.«
»Sie haben ihn umgebracht?«
»Gewissermaßen. Ein wenig. Nicht im wirklich eigentlichen Sinne. Es ist kompliziert. Seine Nerven haben versagt, daher gab er die Nekropsychologie zugunsten einer weniger enervierenden wissenschaftlichen Fachrichtung auf und wurde kurz darauf vom Mantikor eines Kollegen gefressen. Möglicherweise spukt er nach wie vor in einem kleinen Rhabarberbeet in Brüssel herum. Die Kryptozoologie ist eine höchst unberechenbare Disziplin. Aber ich bleibe bei meinem Standpunkt.«
»Sir …«
»Die Angelegenheit ist entschieden. Jennys Zustand ist bestenfalls labil. Auf schmerzliche Antworten zu stoßen, ehe sie dazu bereit ist, könnte sie über eine innere Schwelle befördern, von der es kein Zurück gibt.«
Ich glaube nicht, dass meinem Arbeitgeber bewusst war, dass Jenny bereits eine innere Schwelle überschritten hatte. Bis vor Kurzem hatte sie noch gezaudert, im Fall ihres eigenen Todes zu ermitteln, und war vor stichhaltigen Antworten zurückgescheut wie ein gebranntes Kind vor dem Feuer. Als Jackaby damals mit seiner Detektei in ihr Haus eingezogen war, in das Haus, in dem sie gelebt und den Tod gefunden hatte, war Jenny alles andere als bereit gewesen. Die Suche nach der Wahrheit war zu viel für ihre Seele. Schließlich hatte sie jedoch einen Entschluss gefasst: Sie wollte unsere Dienste in Anspruch nehmen, um ihren eigenen Mord aufzuklären – und einmal getroffen, war dieser Entschluss zu ihrer treibenden Kraft geworden. Sie hatte lange genug gewartet.
Nun war es Jackaby, der die Entscheidung, ihr zu helfen, ständig hinausschob, doch sein Zögern bestärkte Jenny nur darin, sich selbst zu helfen. Zu ihrem großen Verdruss konnte Entschlossenheit allein ihr nicht zu einem Körper verhelfen, und ohne Körper konnte sie entmutigend wenig tun, um die Aufklärung ihres Falles voranzutreiben. Weshalb sie an mich herangetreten war.
Unsere ersten spirituellen Übungen waren recht harmlos gewesen, aber Jenny fühlte sich dennoch wohler, wenn wir sie durchführten, während Jackaby außer Haus war. Jenny und ich kannten uns zwar erst sechs kurze Monate, aber sie war schnell wie eine Schwester für mich geworden. Es war ihr peinlich, die Kontrolle über sich zu verlieren, und Jackaby mit seiner zunehmenden Überfürsorglichkeit machte es nur schlimmer.
Wir begannen mit dem Bewegen leichter Gegenstände, als er eines Nachmittags unterwegs war. Jenny konnte lediglich solche Dinge berühren, die zu Lebzeiten zu ihren Besitztümern gehört hatten, und nur in wenigen Ausnahmefällen hatte sie es geschafft, diese Regel zu durchbrechen. Wie wir feststellten, waren weder Konzentration noch reine Willenskraft das Entscheidende, sondern vielmehr der Blickwinkel, aus dem sie die Dinge betrachtete.
»Ich schaffe es nicht«, sagte sie, nachdem wir es eine Stunde lang versucht hatten. »Ich kann es nicht bewegen.«
»Was denn?«, fragte ich.
»Dein Taschentuch.« Sie fuhr mit der Hand durch das hauchzarte Tüchlein, das zusammengeknüllt vor ihr auf dem Tisch lag. Es kräuselte sich nicht einmal unter dem leisen Lüftchen.
»Nein«, erwiderte ich. »Nicht meins. Du kannst dein Taschentuch nicht bewegen. Ich habe es dir geschenkt.«
»Dann eben mein Taschentuch«, sagte sie. »Mein Taschentuch wird mir von großem Nutzen sein, wenn ich es mir nicht einmal in die Tasche stecken kann!« Sie versetzte ihm entmutigt einen Schlag mit dem Handrücken, worauf sich das Batistknäuel öffnete.
Fassungslos starrten wir das Stück feinen Stoffs an. Schließlich hob Jenny langsam den Kopf. Unsere Blicke begegneten sich und wir lächelten. Die Bewegung war kaum wahrnehmbar gewesen, aber sie war der zündende Funke. Danach ließen wir kaum eine Gelegenheit zum Üben aus.
Nicht jede Sitzung war so fruchtbar wie die erste, aber mit der Zeit machten wir Fortschritte. In den folgenden Wochen gingen etliche Geschirrstücke zu Bruch und die Enttäuschung über ihr Scheitern trieb Jenny mehr als einmal in ein Echo. Mit jedem kleinen Rückschlag jedoch wurden die Erfolge größer.
Wir dehnten unsere Versuche darauf aus, das Haus zu verlassen, was Jenny seit ihrem Tod nicht mehr getan hatte. Dies erwies sich als eine noch zermürbendere Aufgabe. Bestenfalls schaffte sie es, einen Fuß auf den Gehsteig zu setzen – und brauchte anschließend fast den ganzen Nachmittag, um wieder Gestalt anzunehmen.
Als der Weg nach außen nicht zu den erhofften Resultaten führte, begann ich, den nach innen zu erkunden. Obwohl ich wusste, dass es womöglich sogar noch gefährlicher war, dieses Terrain zu betreten, bat ich Jenny am folgenden Tag, an den Abend ihres Todes zurückzudenken und mir zu erzählen, woran sie sich erinnern konnte.
»Ach, Abigail, ich möchte lieber nicht …«, begann sie.
»Nur solange du dich wohl dabei fühlst«, sagte ich. »Lediglich kleine belanglose Einzelheiten. Denk nicht einmal an das Schlimme.«
Jenny atmete tief durch. Nun, sie atmete nicht wirklich; es war wohl eher eine symbolische Geste, in der sie Trost fand. »Ich war dabei, mich umzukleiden«, sagte sie. »Howard wollte mich ins Theater ausführen.«
»Das klingt gut«, sagte ich.
»Ich hörte unten ein Geräusch. Die Tür.«
»Ja?«
»Sie haben hier nichts zu suchen«, sagte Jenny.
Mir lief ein eisiger Schauer über den Rücken, noch ehe ich die jäh einsetzende Kälte spürte. Ich kannte diese Worte schon. Sie kamen von diesem finsteren Ort in Jennys Innerem.
»Ich weiß, wer Sie sind.« Ihr Abendkleid war elegant und makellos weiß, doch zugleich war es plötzlich am Ausschnitt eingerissen und nahm einen dunkleren Ton an. Sie begann bereits zu zerbrechen. Jennys Echos waren wie eine schaurige Variante der kleinen Geschenke, die meine Mutter für die Gäste ihrer Abendgesellschaften zu besorgen pflegte: an einem Stab befestigte Kärtchen, auf deren Vorderseite ein Vogel abgebildet war und auf der Rückseite ein leerer Käfig. Wenn man den Stab schnell drehte, war der Vogel plötzlich gefangen. Eine optische Täuschung. Als Jenny vor mir zu flackern begann, eine graziöse und zugleich groteske Gestalt, verschmolzen die beiden Erscheinungen zu einer, aber ein Teil meines Verstandes wusste, dass sie nicht zusammengehörten. Ihre Stirn war angespannt gerunzelt, in ihren Augen standen Zorn und Verwirrung.
»Jenny, ich bin es. Abigail«, sagte ich. »Dir geschieht nichts. Hier ist niemand …«
»Sie arbeiten mit meinem Verlobten zusammen.«
»Komm zurück, Jenny. Es ist alles in Ordnung. Dir geschieht nichts.«
»Nein!«
»Dir geschieht nichts.«
»NEIN!«
Als sie wieder sie selbst war, hatte ich alle Glasscherben aufgekehrt und sämtliche Möbel an ihren ursprünglichen Platz gerückt. Sie kehrte stets zurück, aber es dauerte immer eine Weile, bis sie sich von einem Echo erholt hatte. Ich lenkte mich in der Zwischenzeit von meinen Sorgen ab, indem ich mich meinen Pflichten widmete. Ich sah alte Quittungen und staubige Akten durch, die mein Vorgänger Douglas angelegt hatte. Douglas war ein seltsamer Vogel. Als Jackabys Assistent hatte er eine gestochen saubere Handschrift besessen. Das war natürlich zu einer Zeit gewesen, als er noch Hände gehabt hatte – nicht, dass er sie zu vermissen schien, nachdem sie nun Flügel waren.
Wenn ich sage, Douglas war ein seltsamer Vogel, meine ich das im wörtlichen Sinne. Seine Verwandlung in einen Wasservogel war während der Ermittlungen in seinem letzten Fall geschehen. Die Arbeit für R. F. Jackaby ging mit einzigartigen beruflichen Gefahren einher.
Meist hockte Douglas auf dem Bücherregal, um mir bei der Arbeit zuzusehen. Hin und wieder stieß er ein missbilligendes Quaken aus oder sträubte sein Gefieder, wenn ich etwas falsch einordnete. Er schien das Leben als Vogel zu genießen, aber das machte ihn nicht weniger bis zur Unerträglichkeit penibel, als er es als Mensch gewesen war.
Jenny hatte dieses Mal nur langsam Gestalt angenommen; als ich ihre Anwesenheit bemerkte, war sie zunächst lediglich ein silbriger Schimmer in der Ecke des Zimmers. Ich ließ ihr Zeit.
»Abigail«, sagte sie schließlich. Sie war durchsichtig und in dem gedämpften Licht kaum zu sehen. »Geht es dir gut?«
»Natürlich.« Ich setzte den Stapel Akten auf dem Schreibtisch ab. Jennys lag geöffnet daneben. »Dir auch?«
Sie nickte schwach, aber düstere Gedanken umwölkten ihre Stirn wie Gewitterwolken.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Ich hätte nicht … Ich werde aufhören, dich zu bedrängen.«
»Nein.« Ihre Gestalt verdichtete sich ein wenig. »Nein, ich möchte weiter üben.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Ich habe nachgedacht.«
»Ja?«
»Ich bin nicht so stark wie du, Abigail.«
»Ach Unsinn …«
»Doch, es stimmt. Du bist stark und ich bin dankbar für deine Stärke. Du hast mir bereits mehr davon gegeben, als zu erbitten ich das Recht habe, nur …«
»Nur was?«
»Nur … ich frage mich, ob ich dich um noch etwas bitten darf.«
Inbesitznahme. Sie wollte versuchen, von mir Besitz zu nehmen, und in meinem törichten Eifer hatte ich eingewilligt. Ich schaffte es, mir einzureden, ich sei gewappnet, Jenny Cavanaughs Geist in mein Bewusstsein eindringen zu lassen und meinen Körper mit ihr zu teilen – aber nichts hätte weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Es gab nichts, womit ich mich gegen die auf mich einstürmenden Empfindungen hätte wappnen können. Jenny ging sanft und behutsam vor, aber es war, als hätte ich einem reißenden Strudel aus Schmerz und Kälte Einlass in meinen Kopf gewährt. Ich sah nur ein endloses weißes Nichts. Es fühlte sich an, als wären meine Augen gegen Eisklumpen ausgetauscht worden. Falls ich schrie, so konnte ich meine eigene Stimme nicht hören. Ich konnte überhaupt nichts hören. Es gab nichts als Pein.
Unser erster Versuch war ebenso schnell zu Ende, wie er begonnen hatte. Mir war schwindelig, in meinem Kopf pochte ein stechender Schmerz, und meine Sicht war verschwommen. Der Stapel Akten, den ich sortiert hatte, war über den Boden verstreut – alle bis auf Jennys. Ihre Fotografie, das Bild aus der Mordakte, lag ganz oben auf Jackabys Schreibtisch. Jenny war vor mir, ehe ich meine fünf Sinne wieder vollständig beisammenhatte. Sie blickte zerknirscht und besorgt drein.
»Alles in Ordnung. Es geht mir gut«, log ich und tat mein Bestes, die Lüge wahr werden zu lassen, indem ich mich auf dem Schreibtisch abstützte und versuchte, nicht vornüberzukippen und mich auf den Teppich zu übergeben. »Diesmal bin ich gewappnet. Bitte versuch es noch einmal.«
Ich war nicht gewappnet. Ebenso wenig wie sie.
Jenny zögerte einen Moment und schwebte dann näher, sanft und anmutig wie stets. Ihre Haare wehten hinter ihr wie Rauch im Wind. Sie streckte ihre zierliche Hand nach meinem Gesicht aus, und ich hätte schwören können – wenn auch nur einen Wimpernschlag lang –, ihre Finger über meine Wange streicheln zu spüren. Es war eine zärtliche Berührung, wie die meiner Mutter, wenn sie mich abends zu Bett gebracht hatte. Und dann kehrte jäh die beißende Kälte zurück. Jede Faser meines Körpers schrie: Das ist keine gute Idee! Es ist eine schrecklich dumme Idee. Es ist…
Das Arbeitszimmer verschwand in gleißendem Weiß und gemeinsam fielen wir hinein in eine Welt aus Nebel und Eis und Schmerz …
… und auf der anderen Seite wieder heraus.
2
Es schien erst gestern gewesen zu sein, als ich mich daheim in England darauf vorbereitet hatte, mein Studium zu beginnen. Hätte mir zu dem Zeitpunkt jemand prophezeit, dass ich stattdessen meinen Koffer packen, Reißaus nehmen und schließlich nach Amerika auswandern würde, wo ich mich mit einem Geist anfreunden, mit einer Ente sprechen und einem kauzigen Detektiv dabei helfen würde, übernatürliche Mordfälle zu lösen, hätte ich denjenigen entweder für einen Lügner gehalten oder ihn für verrückt erklärt. Gedanklich würde ich ihn mit solchen Menschen in eine Kategorie gesteckt haben, die an Gläserrücken oder Seeungeheuer glauben oder an den Wahrheitsgehalt der Aussagen von Politikern. Derlei Torheiten waren nichts für mich. Ich hielt mich an wissenschaftlich belegte Fakten. Das Unfassbare überließ ich anderen.
In wenigen kurzen Monaten kann sich vieles ändern.
Die Schmerzen waren einem Taubheitsgefühl gewichen und die gleißende Helligkeit war verblasst. Obwohl ich mich nicht erinnerte, ins Foyer gegangen zu sein, fand ich mich plötzlich dort wieder. Ich blinzelte. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich stand im Eingangsbereich von Jackabys Detektei in der Augur Lane 926 – daran gab es keinen Zweifel –, aber der Raum war kaum wiederzuerkennen. Anstelle der leicht ramponierten Holzbank stand dort nun ein weich gepolsterter Diwan. Die Gemälde mit den Sagengestalten waren durch geschmackvolle Landschaftsbilder ersetzt worden, und das mit bizarren Masken und okkulten Gegenständen vollgestopfte lange Bücherbord war gänzlich leer – selbst Ogdens Terrarium fehlte. Der Gestank des kleinen Frosches, der sich aufblähte und durch seine Augen ein übel riechendes Gas ausstieß, sobald er sich bedroht fühlte, hatte mich an meinem ersten Tag aus dem Haus getrieben. Ich hätte nicht erwartet, dass mich seine Abwesenheit derart verstören würde, aber nun fand ich sie doch in höchstem Maße beunruhigend. Der Schreibtisch stand an seiner üblichen Stelle, allerdings war er ungewöhnlich sauber und leer. Dahinter stapelten sich Kisten und etliche mit Schnur zusammengebundene Papierbündel. Hatte Jackaby gepackt? Zogen wir um?
Plötzlich schwang die Haustür auf, und R. F. Jackaby stand im Rahmen – in dem für ihn typischen kunterbunt zusammengewürfelten Aufzug. Sein Mantel war von unzähligen vollgestopften Taschen ausgebeult und sein absurd langer Schal schleifte beim Eintreten hinter ihm über die Schwelle. Auf dem Kopf saß seine Strickmütze, eine labbrige Scheußlichkeit aus unregelmäßigen Maschen und schreienden Farbtönen. Insgeheim war ich erleichtert gewesen, als dieses spezielle Teil seiner Garderobe während der Ermittlungen in unserem letzten Fall bei einer barbarischen Feuersbrunst eingeäschert worden war. Sie war doch verbrannt, oder?
»Mr Jackaby?«
»Ja. Dies dürfte meinen Zwecken vollauf genügen«, sagte Jackaby und kam auf mich zu.
Ich öffnete den Mund, aber bevor ich etwas sagen konnte, trat mein Arbeitgeber durch mich hindurch, als wäre ich gar nicht da. Ich schaute an mir herab und stellte zu meiner großen Bestürzung fest, dass ich es tatsächlich nicht war.
»Selbstverständlich werde ich einige Veränderungen vornehmen müssen.«
Ich drehte mich um und sah, dass er mit Jenny sprach. Sie schwebte neben dem Fenster und musterte Jackaby mit verhaltener Neugier. Hinter ihr wehte schwerelos ihr durchscheinendes Haar. Ihr Kleid war mondhell, sein Saum kräuselte sich in sanften Wellen über dem Boden. Ihre Haut schimmerte beinahe ebenso perlmuttern und ätherisch wie ein Sonnenstrahl.
»Keine allzu drastischen, hoffe ich?«, sagte sie. »Ich verstehe es natürlich. Sie müssen das Haus zu Ihrem eigenen machen. Im Jahr meines Einzuges habe ich die Küche umgestalten lassen, sie ist wunderhübsch so, wie sie jetzt ist.«
»Ich bin sicher, Sie werden die Veränderungen kaum wahrnehmen.« Jackaby öffnete die Tür zu dem schmalen, verschachtelten Flur und hielt inne. »Ich werde dieses Haus zu meinem eigenen machen, Miss Cavanaugh.« Er wandte sich zu ihr um. »Aber denken Sie nicht, dass es dadurch weniger das Ihre sein wird. Sie werden hier stets Ihren Raum haben. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«
Jenny lächelte verwirrt und dankbar. »Sie sind ein außergewöhnlicher Mann, Mr Jackaby. Wie soll ich Ihnen das jemals vergelten?«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es gibt da in der Tat etwas, das Sie für mich tun könnten.«
Jenny zog eine Augenbraue hoch. Der Raum begann sich mit Nebel zu füllen, doch keiner von beiden schien es zu bemerken. »Was denn?«, fragte sie.
»Versprechen Sie mir«, Jackabys Stimme wurde leiser, »dass Sie niemals …«
Von einem Moment auf den anderen war der Nebel verschwunden und ich war wieder im Arbeitszimmer. Allerdings lag ich auf dem Rücken und Douglas stand auf meinem Brustkorb. Er reckte den Hals und musterte mich mit seinen schwarzen Knopfaugen von Kopf bis Fuß. Ich scheuchte ihn herunter und setzte mich auf. Mein ganzer Körper fühlte sich matt und taub an und ein heißes Kribbeln kroch mir durch Arme und Beine. Ich befand mich wieder in der Gegenwart, fühlte mich aber, als hätte ich den ganzen Tag im Schnee verbracht und wäre anschließend in ein heißes Bad gestiegen.
Jenny erschien über mir. »Das war fantastisch! Es hat funktioniert! Oh Abigail, geht es dir gut?«
Versuchsweise wackelte ich mit Fingern und Zehen und betastete mein Gesicht. Abgesehen von dem Taubheitsgefühl schien alles in Ordnung zu sein und auch das schwand bereits. »Alles bestens. Was ist gerade passiert?«
»Beine! Ich hatte schon seit zehn Jahren keine richtigen Beine mehr, auf denen ich tatsächlich stehen konnte! Und du bist so warm, Abigail – ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt, Blut in den Adern zu haben. Es ist, als wäre man innerlich in ein warmes weiches Tuch eingehüllt.« Jenny drehte eine Pirouette und schwebte glücklich seufzend nach oben zur Decke. Ich hatte sie seit Wochen nicht so unbeschwert gesehen.
»Es hat also geklappt?« Ich richtete mich auf und musste mich am Schreibtisch festhalten, weil mir schwindelig wurde. »Du meinst, du hast mich in Besitz genommen? Du bist in meinem Körper herumspaziert und all das?«
»Nun ja, nicht unbedingt herumspaziert. Ich habe uns aber fast eine Minute lang vor dem Hinfallen bewahrt. Konntest du es denn nicht sehen?«
»Ich habe … etwas anderes gesehen«, sagte ich. »Nämlich dich und Jackaby. Es muss der Tag seines Einzugs gewesen sein. Er versprach dir, dass du in diesem Haus stets deinen Raum haben würdest.«
»Das hat er tatsächlich gesagt.« Jenny ließ sich wieder auf meine Höhe herabsinken und betrachtete mich nachdenklich. »Du hast also in meine Erinnerungen geschaut? Was hast du noch gesehen?«
»Nicht viel. Er bat dich im Gegenzug um ein Versprechen … aber in dem Moment bin ich auch schon wieder hierher zurückgekehrt. Was war es, das du ihm versprechen solltest, niemals zu tun?«
»Ein Versprechen?« Jenny überlegte kurz. »Ich erinnere mich nicht.« Sie runzelte die Stirn. »Meinst du, du könntest mehr sehen, wenn wir es noch einmal versuchen?«
»Ich nehme es an.« Jenny wirkte absolut beherrscht, ja sogar gestärkt. Aber mir ging Jackabys Mahnung nicht aus dem Kopf, ich solle sie keinesfalls dazu drängen, sich zu schnell oder zu weit vorzuwagen. »Findest du es nicht verstörend zu wissen, dass ich in deinen Erinnerungen war?«
»Was ich verstörend finde, ist das Wissen, dass ich womöglich Geheimnisse in mir berge, die ich selbst nicht kenne.« Jenny sah mich flehend an. »Es könnte die Lösung sein, Abigail.«
Das könnte es tatsächlich, wie ich zugeben musste. Mit ein wenig Übung könnte die Inbesitznahme meines Körpers es Jenny ermöglichen, das Haus zu verlassen und Geheimnissen nachzuspüren, die ihr lange verborgen geblieben waren – und gleichzeitig würde es mir Möglichkeit geben, die Geheimnisse aufzudecken, die sich in ihr verbargen.
»Also gut«, sagte ich. Douglas wippte auf und ab und blickte sehr viel missbilligender drein, als es einer Ente eigentlich zusteht. Ich beachtete ihn nicht. »Versuchen wir es noch einmal.«
Dieses Mal war ich auf den Schmerz vorbereitet, und je weniger ich mich dagegen wehrte, desto schneller ging er vorüber. Das gleißend helle Nichts kehrte zurück, doch als sich der Nebelschleier lichtete, befand ich mich nicht im Foyer der Augur Lane 926, sondern in einem mir unbekannten Herrenzimmer. Draußen herrschte Dunkelheit und im Raum ein dämmriges Licht. Ich war in eine andere Erinnerung eingedrungen.
»Nein. Das genügt nicht. Die Leistung wird halb so hoch ausfallen wie gewünscht«, sagte eine Männerstimme.
»Sie wird doppelt so hoch sein, wie sie sein sollte. Es gibt keine Möglichkeit, sie in dieser Höhe konstant zu halten.«
Unmittelbar vor mir standen zwei Gestalten, deren Aufmerksamkeit auf mehrere auf einem großen Schreibtisch ausgebreitete Zeichnungen gerichtet war. Sie kamen mir irgendwie bekannt vor. Einer von ihnen war ein energiegeladener, gut aussehender Mann. Unangenehmerweise fühlte ich mich zu ihm hingezogen, wobei ich nicht sagen konnte, warum. Auf einmal lächelte er, und in dem Moment wusste ich es: Es war Howard Carson. Jennys Verlobter. Der Mann, der sie geliebt hatte und der verschwunden war.
Ihm gegenüber stand ein schmächtiger Mann mit weißblonden Haaren. Er trug eine mürrische Miene zur Schau und einen dreiteiligen Anzug, der ihm perfekt auf den dürren Leib geschneidert schien. »Sie werden darüber nicht erfreut sein«, sagte er.
»Sie werden noch viel weniger erfreut sein, wenn ihnen das Ganze um die Ohren fliegt«, entgegnete Howard Carson. Der dünne Mann zog eine Grimasse, als Howard fortfuhr, über Leitfähigkeit und Zugkraft zu reden.
In einem Sessel hinter ihnen saß ein dritter Mann, korpulent, mit einem rundlichen Gesicht und einem Schnurrbart, dessen Enden mit Wachs zu zwei imposanten Kringeln hochgezwirbelt waren. Er schwieg, während er eine unangezündete Zigarre unruhig von einer Hand in die andere nahm und die beiden anderen beobachtete. Neben ihm stand eine ausdruckslos dreinblickende, streng gekleidete Frau mit pechschwarzen Haaren, die ein Klemmbrett und einen Bleistift in Händen hielt. »Haben Sie das?«, fragte sie der korpulente Mann leise.
»Ja, Mr Poplin, jedes Wort.« Sie verzog keine Miene, ihr Stift kratzte über das Papier.
»Sehr gut.«
»Vergessen Sie die Rohrleitungen nicht«, erklang eine Stimme hinter mir. Bevor ich mich umdrehen konnte, ging eine Frau mit braunen Locken geradewegs durch mich hindurch Richtung Schreibtisch. Ich schauderte oder hätte es getan, wenn ich einen Körper gehabt hätte. An das Gefühl, ohne Körper zu sein, würde ich mich bestimmt nie gewöhnen. »Die Kupferrohre des Prototyps haben nach einer Weile an Leitfähigkeit eingebüßt. Silber wird zwar mehr kosten, aber auf lange Sicht erhöht es die Leistung.«
Der dünne Mann zog eine Grimasse. »Was wissen Sie denn schon?«
»Sie weiß sogar eine ganze Menge«, sagte Howard Carson. »Ich sagte Ihnen ja bereits, dass mir meine Verlobte bei der Arbeit assistiert. Sie ist klüger als wir alle zusammen.«
Jenny Cavanaugh trat hinter den Schreibtisch und wandte das Gesicht dem Raum zu. Wäre ich zu diesem Zeitpunkt im Besitz meiner Kinnlade gewesen, wäre sie mir vermutlich herabgesackt. Die Jenny, die ich kannte, war eine wunderschöne Geistergestalt – aber die Frau, die nun vor mir stand, mit einem wahrhaftigen Körper und geröteten Wangen, sah wie ein vollkommen anderer Mensch aus, so strahlend und lebendig war sie. Die dunklen Haare umrahmten ihr Gesicht, anstatt schwerelos in silbrigen Wellen hinter ihr zu schweben. Sie trug ein hübsches praktisches honiggelbes Kleid und um den Hals eine Kette mit einem kleinen Schmuckmedaillon aus Zinn.
»Sie ist äußerst scharfsinnig, müssen Sie wissen«, sagte Howard Carson. »Und sie hat recht, was die Rohrleitungen anbelangt.«
»Danke, Howard.« Jenny und Howard schauten sich nur kurz an, aber ihre gegenseitige Zuneigung war unübersehbar.
»Das haben wir doch schon besprochen«, sagte der blonde Mann entschieden. »Wir werden mit Kupfer weitermachen.« Ich mochte ihn nicht. Es lag nicht nur an seinem scheinheiligen Grinsen. Jenny hegte eine tiefe Abneigung gegen ihn, also konnte ich ihn auch nicht leiden.
»Wenn Sie darauf bestehen.« Howard Carson holte tief Luft. »Kupfer genügt selbstverständlich auch.«
Jenny war nicht zufrieden. »Es würde uns allen viel Zeit und Arbeit ersparen, wenn wir den genauen Zweck unserer Bemühungen erfahren würden.«
Der Mann starrte sie erbost an. »Unsere Gönner haben uns sehr klare Maßgaben erteilt.«
»Maßgaben sind nicht dasselbe wie ein Ziel. Was planen Ihre Gönner?«
»Jenny«, sagte Howard Carson mahnend.
»Die Zukunft!«, verkündete eine neue Stimme, und aller Augen wandten sich zur Tür. »Wir errichten die Zukunft, junge Dame. Ein glänzendes Rädchen greift ins andere.« Der Mann, der im Rahmen stand, war korpulent und unrasiert und hatte kohlrabenschwarze Haare. Er trug eine zerschlissene lange schwarze Jacke über einer dunklen Weste. Abgesehen von seinem blauschwarzen Bartschatten und den dunklen Ringen unter den Augen war seine Gesichtsfarbe auffallend bleich.
Ich kannte dieses Gesicht. Es war das Gesicht, nach dem wir auf unserer Reise nach Gad’s Valley und wieder zurück in New Fiddleham vergeblich gefahndet hatten. Es war das Gesicht, in das unsere Klientin, die arme Mrs Beaumont, im Sterben als Letztes geblickt hatte. Ich sah, wie sich seine blassen Lippen zu einem verschlagenen Grinsen verzogen.
»Klingt das nicht aufregend?«, sagte der leichenbleiche Mann.
3
»Du hast ihn gekannt?«, keuchte ich, als der dämmrige Raum verschwand und Jackabys Arbeitszimmer wieder zum Vorschein kam, durch dessen Fenster die Mittagssonne hereinströmte. Abrupt stand ich aus dem Ledersessel auf und bereute meine Entscheidung sofort. Mein Blick verschwamm und mir wurde schwindelig. Ich setzte mich wieder hin.
Jenny schwebte silbrig und durchscheinend vor mir in der Luft. Bis gerade eben hatte sie noch glücklich gestrahlt, aber ihr Lächeln verblasste zusehends. »Wen gekannt?«
Ich atmete tief ein und aus und hielt mich an den Armlehnen fest, um nicht aus dem Sessel zu kippen. Allmählich drehte sich meine Umgebung etwas weniger schnell und die Taubheit wich aus meinem Körper. »Wie bin ich denn … warst du die ganze Zeit in meinem Körper, während ich im Sessel saß, Jenny?«
Sie nickte, aber aller Stolz war aus ihrem Gesicht gewichen. »Ich kannte wen, Abigail?«
»Diesen Mann. Den auf der Fotografie.«
Diesmal erhob ich mich vorsichtiger und trat an den Schreibtisch zu Jennys geöffneter Akte. Meine Schläfen pochten und der Raum schien langsam trudelnd zum Stehen zu kommen. Während ich noch versuchte, mein Gleichgewicht wiederzufinden, war Jenny neben mich geschwebt. Als meine Umgebung endlich aufhörte, sich zu drehen, schaute ich auf und sah, dass Jenny den Blick unverwandt auf eine der Fotografien gerichtet hielt. Ihre durchscheinende Hand strich über das Bild ihrer ausgestreckt auf den Bodendielen ihres Zimmers liegenden Leiche.
»Jenny …«
»Dieses Medaillon hat mir Howard geschenkt«, sagte sie. »Es ist nicht mehr da. Ich habe es im ganzen Haus gesucht. Innen hatte es eine Gravur: ›Von Howard, in Liebe‹. Nichts Besonderes, bloß ein kleiner Anhänger aus Zinn, aber es sind stets die kleinen Dinge, die man vermisst.«
»Bleib bei mir, Jenny«, sagte ich sanft. »Bitte. Es ist wichtig.«
Sie löste den Blick von der Fotografie. »Ich bin bei dir, Abigail.«
Ich nahm das Bild von dem bleichen Mann aus der Akte und hielt es hoch, damit sie es betrachten konnte. Es war grobkörnig und hatte einen sepiabraunen Farbstich, aber das Gesicht darauf war unverwechselbar. Ich hatte diesen Mann an der Straßenecke stehen und zu meinem Fenster hochstarren sehen und dann noch einmal, als er auf der Schwelle zum Bahnsteig herumlungerte. Nun hatte ich ihn in Jennys Erinnerung aus nächster Nähe gesehen und nicht ein Haar an ihm hatte sich in den vergangenen zehn Jahren verändert.
Auf der Fotografie stand der bleiche Mann im Vordergrund und lächelte eingebildet. Er war nicht allein. Im Hintergrund sah man fünf Männer um einen Arbeitstisch in einem Gebäude versammelt, das eine Fabrik zu sein schien. Heller Lampenschein beleuchtete ihre Gesichter und warf scharfe Schatten an die Mauer hinter ihnen. Die Männer trugen dunkle Arbeitsschürzen, dicke Handschuhe und getönte Schutzbrillen, die sie sich auf den Kopf hochgeschoben hatten. Der Mann in der Mitte war Howard Carson.
Es gab keine anderen Bilder von Howard im Haus – weder an den Wänden in Jennys Zimmer noch auf ihrem Nachttisch. Sie sprach liebevoll, aber selten von ihm und stets mit einer gewissen Bangigkeit, als würde sie sehr behutsam um einen Bluterguss herumtasten.
Am unteren Bildrand standen eng geschrieben sechs Worte: Für die Nachwelt. Die bescheidenen Anfänge…
»Er hat mit meinem Verlobten zusammengearbeitet.« Jennys Stimme war ruhig.
Ich verkrampfte, meine Nackenhaare stellten sich auf. »Jenny? Bist du noch da?«
Sie presste die Lippen zusammen und nickte. »Ich erinnere mich jetzt.« Ich schwieg und wagte nicht, das empfindliche Gleichgewicht zu stören. Als sie sprach, war ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. »Er hieß Pavel.«
Die Fotografie befand sich schon seit Jahren in ihrer Akte, aber bisher hatte Jenny weder den leichenblassen Mann noch sonst jemanden außer Howard Carson identifizieren können. Zwar löste irgendetwas an dem Bild stets ein diffuses Unbehagen bei ihr aus, aber die Erinnerung blieb leider ebenso wenig greifbar wie Jenny selbst. Die Bilder zu lange zu betrachten, versetzte sie in einen Zustand der Zerbrechlichkeit, dennoch versuchte sie es. Als ich in dem bleichen Mann auf der Fotografie den Schurken wiedererkannt hatte, dessen Spur der Verwüstung wir quer durch Gad’s Valley gefolgt waren, hatte sie sich umso mehr bemüht, ihren inneren Dämonen etwas abzuringen – irgendein Detail, einen Namen –, aber die Anstrengung hatte jedes Mal nur bewirkt, dass sie zu echoen begonnen hatte. Bis jetzt.
»Ist er …?«, wisperte ich. »Ist er derjenige, der …?«
Jenny kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und konzentrierte sich. Eine kalte Brise kroch mir unter den Kragen. Mein Ausflug in ihre Gedanken mochte kurzzeitig ein Licht in Jennys Erinnerungen zum Aufflackern gebracht haben, aber die Gänge dieses Labyrinths lagen nach wie vor in schwarzem Dunkel. »Vielleicht sollten wir eine Pause machen«, sagte ich.
»Er war hier. Wieso war er hier?« Jennys silbrig schimmerndes Haar wurde jäh von einer Böe aufgepeitscht, obwohl die Fenster fest geschlossen waren. »Ich kann ihn nicht leiden. Ich traue ihm nicht.«
»Ich auch nicht, Jenny. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber aufhören.«
»Er kommt zum Haus. Er ist an der Tür. Er weiß, dass Howard hier ist.«
»Hör auf, Jenny.«
»Ich kann ihn nicht leiden.« Sie blinzelte, ihr Blick ging durch mich hindurch, ohne auf einen bestimmten Punkt gerichtet zu sein, dann wurde er plötzlich eisig, und sie starrte mich an. »Ich weiß, wer Sie sind. Sie arbeiten mit meinem Verlobten zusammen.«
Ich stopfte sämtliche Fotografien, Zeitungsausschnitte und Notizen wieder in die Akte zurück und schlug sie zu, als mir auch schon ein bitterkalter Windstoß in den Rücken fuhr. Als ich mich umdrehte, war Jenny bereits verschwunden.
»Jenny?«, rief ich in die Stille hinein. Die Stille vertiefte sich.
»Lassen Sie ihr Zeit.«
Beim Klang der Männerstimme fuhr ich zusammen und griff mir erschrocken ans Herz. »Mr Jackaby!«, keuchte ich. »Wie lange sind Sie schon …?«
»Ich bin eben erst nach Hause gekommen und werde nicht lange bleiben. Ich hatte nicht erwartet, in eine Eiskammer zurückzukehren.« Er setzte seinen Rucksack mit einem dumpfen Geräusch ab, nahm Jennys Akte in die Hand und ging hinter den Schreibtisch. »Seien Sie vorsichtig, Miss Rook. Bildlich gesprochen hat unsere nicht gänzlich dahingegangene Freundin einen Stachel in ihrer Pfote stecken und wir befinden uns mitten in der Höhle des Löwen.« Er stopfte die Akte in eine Schreibtischschublade und schob sie krachend zu. »Ich versichere Ihnen, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Stachel zu entfernen – aber ich habe nicht die Absicht, ihn ihr noch tiefer ins Fleisch zu treiben und für unsere Bemühungen in Stücke gerissen zu werden. Geduld und Sorgfalt haben oberste Priorität.«
»Mit Verlaub, Sir, zehn Jahre des Wartens sind eine mehr als hinreichende Umschreibung für den Begriff Geduld. Sie verbringt bereits eine ganze Dekade in ihrem Leben nach dem Tod.«
Er starrte auf die am Boden verstreut liegenden alten Akten und Quittungen. »Gleichwohl müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Stachel und Löwe eins sind.«
»Sir?«
Er begegnete meinem verwirrten Blick und seufzte. »Geister sind unzufriedene Wesen, Miss Rook. Die Untoten bleiben durch ihre unerledigten Angelegenheiten an diese Welt gebunden. Entweder unser Vorhaben misslingt, weil es uns unmöglich gelingen kann – weil nämlich ihre Seele niemals Frieden finden wird …«
»Oder es gelingt uns«, sagte ich, als mir dämmerte, was seine Worte im Umkehrschluss bedeuteten. »Und somit wären Jennys Angelegenheiten in dieser Welt erledigt.«
»Und sie würde letztendlich von uns gehen.« Jackaby nickte. »Das jedoch ist allein ihre Entscheidung. Sie sagt, sie sei bereit. Wir werden ihr so gut wie möglich helfen, Antworten auf ihre Fragen und damit ihren Frieden zu finden, aber es hat wenig Sinn, dies zu überstürzen.« Er glitt in den Sessel und stützte sich schwer auf den Schreibtisch, in seinen wolkengrauen Augen stand Kummer.
»Sir?«
»Mir missfällt die Vorstellung eines Daseins ohne Miss Cavanaugh.«
»Haben Sie ihr das schon gesagt?«
»Sie hat zurzeit eigene Sorgen.«
»Sie kann mehr aushalten, als Sie denken, Sir. Sie macht beachtliche Fortschritte.«
»Der Zustand meines Arbeitszimmers verkündet etwas anderes. Übrigens habe ich die Glasscherben im Papierkorb bemerkt. Es ist wohl nicht ihr erstes Echo heute, nehme ich an. Wie lange war sie bei dem vorangegangenen außer sich?«
Ich zögerte. »Nur eine Stunde. Vielleicht zwei. Es war bloß ein kleines Echo.« Sein Blick huschte zu meiner Wange und verweilte dort auf der feinen Narbe. Sie war nicht besonders tief und bereits zu einer zarten rosafarbenen Linie verblasst, aber sie war ein Andenken an einen Zusammenstoß, der beinahe katastrophal verlaufen wäre: meine Begegnung mit Rosie, einem stymphalischen Vogel – ein Geschöpf, dessen übernatürliche Kräfte ich kläglich unterschätzt hatte. Jackaby dazu zu bringen, mich nicht wie etwas Zerbrechliches zu behandeln, war schon schwierig genug gewesen, ohne die Mahnmale vergangener Fiaskos ins Gesicht eingebrannt zu haben. Da half es auch nicht, dass mir besagte Narbe lediglich durch eine von Rosies Federn beigebracht worden war. Ich lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. »Jenny hatte eine Offenbarung.«
»Eine Offenbarung.« Jackaby nickte seufzend. »Großartig. Weil ja in Offenbarungen niemals etwas Schlimmes geschieht.«
»Der bleiche Mann heißt Pavel. Sie hat sich wieder an ihn erinnert.«
Jackabys Blick zuckte hoch, aber er verbarg sein Interesse rasch wieder. »Pavel? Lediglich ein Vorname. Vermutlich nicht sein richtiger, sondern ein Deckname.«
»Sie kann noch mehr herausfinden.«
»Aber sie sollte es nicht. Es ist zu gefährlich, Miss Rook. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen halte ich es für das Beste, wenn wir bei den Ermittlungen gänzlich auf Miss Cavanaughs Mitwirkung verzichten.«
»Wie bitte? Das ist absurd! Es ist Jennys Fall!«
»Eben deshalb! Sie ist emotional viel zu sehr darin verstrickt, um die Ergebnisse verkraften zu können. Mit jeder neuen Wendung riskieren wir, sie wieder in ein Echo zu stürzen, und wir können nicht vorhersehen, was uns hinter der nächsten Biegung erwartet. Es war schon schwer genug für sie, diesen Weg zu beschreiten, als die Spur noch kalt war.«
»Sie ist stärker denn je!« In meiner Enttäuschung hätte ich ihm beinahe von unseren heimlichen Übungen und von unserem bemerkenswerten Erfolg bei Jennys Inbesitznahme meines Körpers erzählt – aber ich biss mir auf die Zunge. Unser Geheimnis auszuplaudern oblag nicht mir allein und Jackaby war im Augenblick außerordentlich starrköpfig. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Etwas war geschehen.
»Moment, warten Sie. Welche jüngsten Entwicklungen?«, fragte ich.
»Schauen Sie selbst.« Jackaby öffnete seinen Rucksack und reichte mir einige handbeschriebene Seiten über den Tisch. Sie waren am oberen Rand zerfranst, als hätte man sie aus einem Block herausgerissen.
»Lieutenant Dupin von der Polizei in New Fiddleham hat mir freundlicherweise seine Aufzeichnungen zu dieser Angelegenheit überlassen.«
»Weiß Lieutenant Dupin, dass er Ihnen freundlicherweise seine Aufzeichnungen überlassen hat?«
Jackaby zuckte mit den Schultern. »Ich bin sicher, er wird es sich früher oder später zusammenreimen. Marlowe beschäftigt ihn nicht ohne Grund.«
Ich schüttelte den Kopf, wandte aber meine Aufmerksamkeit den Notizen zu.
Die Leiche von Mrs Alice McCaffery wurde heute am frühen Morgen von einer Rosa Gaines, 32, Hausmädchen bei den McCafferys, gefunden. Mrs McCaffery war erst tags zuvor bei mir auf der Wache gewesen, um ihren Gatten Julian McCaffery als vermisst zu melden. Bin jetzt zu Ermittlungen unterwegs.
Kurz vor 8 Uhr am Haus der McCafferys angekommen. Drinnen ist alles so, wie es Miss Gaines beschrieben hat. Alice McCaffery liegt tot auf dem Fußboden ihres Zimmers. Ihr Kleid ist am Ausschnitt eingerissen und weist offenkundige Kampfspuren auf. Todesursache ist eine einzelne tiefe Wunde am Oberkörper. Rings um die Leiche ist eine große Blutlache eingetrocknet. Auf mein Wort, eine wahrhaft große Menge Blut.
Wie betäubt starrte ich auf das Geschriebene. Ich konnte verstehen, warum Jackaby gezögert hatte, uns diese Neuigkeit mitzuteilen. Der vermisste Mann, der Kampf im Schlafzimmer, die Tote, das Blut. Ebenso gut hätte ich die Akte in Jackabys Schreibtischschublade lesen können. Die Beschreibung glich dem Mord an Jenny bis ins kleinste Detail.
»Was halten Sie davon?«, fragte Jackaby.
»Es kommt mir auf gespenstische Weise bekannt vor, Sir.«
»Mehr, als Sie ahnen«, sagte Jackaby. »Julian McCaffery war Wissenschaftler und Forscher, ähnlich wie Jennys Verlobter Howard Carson. Carson und McCaffery haben beide an der Universität von Glanville bei Professor Lawrence Hoole studiert, wenn auch nicht zur gleichen Zeit, sondern im Abstand von einigen Jahren.«
Ich schluckte. »Das sind furchtbar viele Zufälle, Sir. Wird nicht auch Professor Hoole vermisst? Ja, ich erinnere mich. Vor ein paar Wochen stand eine Meldung im Chronicle.«
Jackaby nickte. »Im nächsten Eintrag von Lieutenant Dupin taucht er ebenfalls auf.« Er gestikulierte zu den Papieren in meinen Händen. Ich blätterte zur nächsten Seite und las vor:
»Es ist noch nicht einmal Mittag und mir wird schon die zweite Leiche präsentiert. Sie wurde von Daniel und Benjamin Mudlark entdeckt. Die Jungen, zwei Brüder im Alter von 7 und 9, gaben ihr Wissen gegen die Zahlung einer Entschädigung preis. Sie waren mit 5 Cent einverstanden und führten mich zum Fundort.
Der Tote scheint mit den Abwässern am Nordufer des Inky angespült worden zu sein. Der Beschreibung in der Vermisstenanzeige und den Papieren zufolge, die der Verstorbene bei sich trug, handelt es sich um Lawrence Hoole, Alter 56, Professor an der Universität von Glanville. Obwohl die Leiche im Wasser gelegen hat, schätze ich angesichts der geringen Verwesung, dass er nicht länger als zwei Tage tot ist. Die einzig erkennbare Verletzung ist eine Stichwunde am Halsansatz, umgeben von einem ovalen Bluterguss.
Der Professor hinterlässt eine Ehefrau, Cordelia Hoole. Die Polizeibehörde in Glanville reagierte umgehend auf meine Anfrage, teilte mir jedoch mit, Professor Hooles Witwe sei …«
Ich blätterte die Seite um, aber das war alles. »Professor Hooles Witwe sei … was?«
»Leidgeprüft?«, schlug Jackaby vor. »Verzweifelt? Irgendetwas Gramvolles, könnte ich mir vorstellen. Vermutlich ›in tiefer Trauer‹. Lieutenant Dupin ist äußerst sparsam in der Verwendung seiner Adjektive.«
»Diese armen Menschen«, sagte ich. »Ein einzelner Einstich und ein ovaler Bluterguss – das ist Pavels schmutziges Werk, so viel steht fest. Es besteht zweifellos ein Zusammenhang.«
»Was ist denn nun mit Cordelia Hoole?« Jennys sanfte Stimme überraschte uns beide. Ich wirbelte herum und sah sie vor dem Fenster schweben, die Sonne strömte in glitzernden Strahlen durch ihre ätherische Gestalt hindurch.
»Jenny«, sagte ich. »Seit wann bist du …«
»Bedaure, Miss Cavanaugh«, fiel mir mein Arbeitgeber ins Wort. »Aber wir müssen diese Hinweise erst sehr viel eingehender überprüfen, bevor wir dich mit den Details behelligen. Ich möchte nicht, dass …«
»Ich bitte dich, Jackaby. Vor zehn Jahren verschwand mein Verlobter und ich wurde ermordet. Gestern verschwand Julian McCaffery und Alice McCaffery wurde ermordet. Professor Hoole war sowohl der Mentor von Julian McCaffery als auch der meines Verlobten. Er war ebenfalls spurlos verschwunden und wurde, wie wir jetzt erfahren, ebenfalls ermordet, und du willst … was? Darauf warten, dass sich ein vollständiges Muster bildet? Du bist zehn Jahre zu spät, um mich zu retten, mein Lieber. Du kommst einen Tag zu spät zur Rettung von Alice McCaffery. Die Frage lautet: Was ist mit Cordelia Hoole?«
4
Die Nachmittagsluft war heiß und drückend, als Jackaby und ich von der Augur Lane 926 ins Stadtzentrum aufbrachen. Anfang des Jahres hatte ich ein schneeverwehtes New Fiddleham kennengelernt, eine Hafenstadt, in der vereiste Gebäude im Laternenschein wie Diamanten funkelten und durch deren Gassen ein eisiger Wind pfiff. In der Hitze der Sommersonne, die nun auf die Pflastersteine herabbrannte, pfiff New Fiddleham allerdings weniger, als dass es schwer keuchte – mit feuchtem, klebrigem Atem.
In seinen unförmigen Mantel gehüllt, hetzte Jackaby unberührt von der brütenden Hitze mit der üblichen Zielstrebigkeit durch die Straßen.
»Mit Verlaub, Sir«, sagte ich. »Ich glaube nicht, dass Lieutenant Dupin besonders entgegenkommend sein wird, nachdem wir das wenige, das wir über den Fall wissen, aus seinem Schreibblock gestohlen haben.«
»Ausgeliehen«, korrigierte mich Jackaby. »Wir haben uns das wenige, das wir wissen, von ihm ausgeliehen. Aber ich stimme Ihnen zu. Ich bezweifle, dass Lieutenant Dupin für unseren Teil der Ermittlungen noch von Nutzen sein wird. Dupin ist lediglich eine Arterie.«
»Er ist eine was?«
»Eine Arterie«, sagte Jackaby. »Und zwar eine gute. Aber er ist nicht das Herz. Nein, wir müssen mit Commissioner Marlowe persönlich sprechen. Wenn irgendetwas Ungebührliches in dieser Stadt geschehen ist, wird Marlowe davon wissen.«
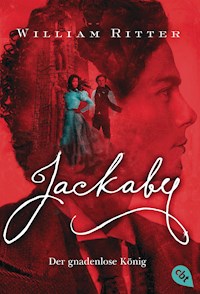
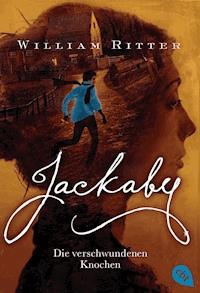













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













