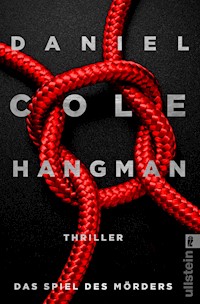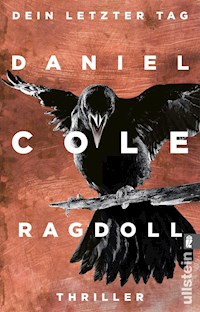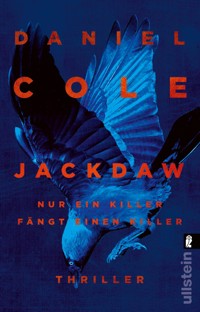
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Detective Constable Scarlett Delaney, Tochter eines Serienmörders, heute bei der Polizei und dort aus naheliegenden Gründen mit schwerem Stand, wittert ihre Chance. Um den mysteriösen Killer Jackdaw zu fassen und damit endlich die Anerkennung zu bekommen, die ihr zusteht, ist sie zu allem bereit. Auch zur Zusammenarbeit mit Henry Devlin, einem zwielichtigen Privatdetektiv. Doch als sie sich immer tiefer in eine düstere Welt voller Halbwahrheiten und Lügen wagt und immer mehr Grenzen übertritt, wird Scarlett klar, dass sie nicht nur einen Mörder jagt. Sie steht auf seiner Liste. Und es könnte ein tödlicher Fehler gewesen sein, den Menschen in ihrer Umgebung zu vertrauen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jackdaw
DANIEL COLE wurde 1983 geboren. Seine Romane erschienen in 34 Ländern. Bevor er mit dem Schreiben begann, hat er als Sanitäter, Tierschützer und Seenotretter gearbeitet. Nach der Ragdoll-Trilogie erschien zuletzt sein Thriller Die Muse. Cole lebt im sonnigen Bournemouth in Südengland.
Von Daniel Cole sind in unserem Hause erschienen: Ragdoll • Hangman • Wolves • Die Muse
Er ist ein Sammler.Und Du seine Trophäe.Detective Constable Scarlett Delaney ist die Tochter eines Serienmörders. Bei der Polizei hat sie deshalb einen schweren Stand. Doch als der mysteriöse Killer Jackdaw einmal mehr eine Prominente höchst medienwirksam tötet, wittert sie ihre Chance, um endlich die Anerkennung zu bekommen, die ihr zusteht. Zu allem bereit schreckt sie auch vor der klandestinen Zusammenarbeit mit Henry Devlin, einem zwielichtigen Privatdetektiv, nicht zurück. Sie übertritt mehr und mehr Grenzen, gerät immer tiefer in die düstere Welt Henrys und des Killers hinein. Bis sie erkennt, dass sie nicht die Einzige ist, die auf der Jagd ist. Sondern selbst auf der Liste des Mörders steht.
Daniel Cole
Jackdaw
Thriller
Aus dem Englischen von Sybille Uplegger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Februar 2025
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstr. 126, 10117 Berlin 2025
© 2023 by Daniel Cole
Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Jackdaw bei Storm Publishing, UK
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und DataMining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © mauritius images / © Malcolm Schuyl / Alamy / Alamy Stock Photos (Dohle) / © FinePic®, München
Autorenfoto: © Ellis Parrinder
E-Book Konvertierung powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3296-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Epilog
Epilog
Epilog
Eine Nachricht vom Autor
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Bestimmt gibt es schlimmere Jobs da draußen, machte Matt Lewis sich selbst Mut, auch wenn ihm spontan keiner einfiel.
Er war als Content-Manager bei einem international tätigen Unternehmen im Bereich Social Media tätig und kämpfte sich nun schon seit über zwei Stunden durch eine Flut von Hass, Gewalt und Perversionen, die tagtäglich ihre Plattformen überschwemmte.
Füße. Er nickte und löschte einen erschütternd rassistischen Post auf einer Charity-Seite, die erstellt worden war, um Geld für ein kleines Mädchen mit Leukämie zu sammeln. Er hasste Füße. Podologe. Fußpfleger … Schuhverkäufer: So was könnte er niemals machen.
Als Nächstes widmete er sich dem wesentlich kleineren Account eines elfjährigen Jungen mit gerade einmal acht Followern, zu denen auch seine eigene Großmutter zählte. Seit nunmehr über einer Woche hielt sich dort eine Nachricht, in der dem Jungen mitgeteilt wurde, dass er »ein hässliches Stück Scheiße« sei, das »der Menschheit einen Gefallen tun und sich umbringen« solle.
Löschen!
Zähne! Widerlich. Er wäre rein körperlich nicht in der Lage, den ganzen Tag lang in die Münder fremder Leute zu starren. Nicht für alles Geld der Welt.
Pornografische Inhalte: Löschen!
Hassbotschaften … Löschen!
Matt konnte nicht von sich behaupten, dass er das Gefühl hatte, etwas Gutes zu tun, indem er mithalf, die digitale Welt zu einem Ort zu machen, an dem man sein Leben etwas angenehmer vertrödeln konnte. Im Gegenteil, er kam sich schmutzig vor, wie ein Teil des Problems, nichts weiter als ein Lakai, der dafür bezahlt wurde, die Wahrheit zu verschleiern, damit andere Menschen sich nicht mit den unschönen Realitäten auseinandersetzen mussten.
In Wirklichkeit ging es bei dem, was er tat, in erster Linie darum, den eigenen Arsch zu retten – den Nachweis zu erbringen, dass »angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen« worden waren, sollte irgendwo ein Elfjähriger tot in seinem Zimmer aufgefunden werden. Das war wesentlich unkomplizierter, als Ressourcen dafür bereitzustellen, dass er die professionelle Hilfe erhielt, die er benötigte. Aber Hass verkauft sich gut, und die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine Beziehung zu einem Produkt aufbauen, ist höher, wenn Empörung oder Provokation im Spiel sind. Dies ist das Fundament, auf dem alle solche Unternehmen gebaut sind. Und sie machen keinen Hehl daraus. Denn unter jedem verzweifelten Schrei nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, der in die Welt hinausgesendet wird, wartet der Dislike-Button – sein einziger Zweck: zum Diskurs anzuregen.
Gähnend machte Matt weiter …
»O mein Gott!«, keuchte er und fiel fast vom Stuhl, so eilig hatte er es, Abstand zwischen sich und das Bild zu bringen, das soeben auf seinem Monitor erschienen war. »Justin!«, rief er, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.
Seine Kollegen beobachteten ihn beunruhigt, als er aufsprang und quer durchs Büro in Richtung eines leeren gläsernen Raums rannte. »Wo ist er?!«, fragte er die kratzbürstige Assistentin seines Chefs.
»Konferenzraum … Aber du darfst da nicht rein!«, rief sie ihm nach, als er den Flur entlangrannte und in das Besprechungszimmer platzte, in dem der von ihm gesuchte Justin sich gerade mit einer Gruppe ihrer einflussreichsten Investoren unterhielt.
»Matt!«, rief sein Chef erstaunt, fasste sich jedoch rasch wieder. »Darf ich Ihnen Matthew Lewis vorstellen – einer unserer begabtesten Mitarbeiter. Matt, was kann ich für dich tun?«
»Entschuldigen Sie die Störung, aber ich brauche dich … jetzt sofort.«
Ohne ihn um weitere Details zu bitten, wandte sich der CEO erneut an seine Gäste. »Meine Damen und Herren, ich fürchte, Sie müssen mich kurz entschuldigen.« Mit diesen Worten folgte er seinem Mitarbeiter gemessenen Schrittes nach draußen. Kaum dass sich die Tür des Konferenzraums hinter ihnen geschlossen hatte, sprinteten die beiden Männer los.
»Zeig’s mir!«, befahl Justin und tönte per Knopfdruck die Fensterscheiben seines Büros, während Matt den verstörenden Post auf den großen Bildschirm an der Wand projizierte. Ihm wurde schlecht, als er die Fotos sah. Das erste: Auf einem taubengrauen Teppich lag eine wunderschöne Frau im goldenen Glitzerkleid. Das Seidentuch, mit dem ihr die Luftröhre zerquetscht worden war, hing noch um ihren Hals. Ihre berühmten grünen Augen quollen aus den Höhlen hervor und waren durch unzählige geplatzte Blutgefäße gerötet. Das makellose Gesicht war von fünf tiefen Schrammen entstellt, als hätte ihr jemand als letzte Demütigung mit den Fingernägeln die Wange zerkratzt.
Doch es war das zweite Foto, von dem Matt wusste, dass es ihn bis an sein Lebensende verfolgen würde …
2,1 Millionen Reposts, und kein Ende in Sicht.
Er musste würgen und schnappte sich den Papierkorb. »Soll ich es löschen?«, fragte er zwischen betont langsamen Atemzügen. Seine Finger lagen bereits auf der Maus, doch sein Boss schien ihn gar nicht zu hören. Er sah zu, wie die Zahlen unaufhaltsam in die Höhe kletterten, während die Welt die Neuigkeit vom Aufstieg einer D-Prominenten in den Celebrity-Himmel immer weiter verbreitete.
»Soll ich es löschen?«
2,2 Millionen … 2,3 Millionen.
»Warte noch«, gab der Mann zurück, der Flipflops zum schicken Anzug trug. Er hatte die Hand wie nach einem imaginären Schalter ausgestreckt.
… 2,4 Millionen …
»… Warte noch …«
»Um Himmels willen, Justin!«
»… Okay. Jetzt!«
Im nächsten Moment wichen die abstoßenden Bilder einem allgemein gehaltenen Benachrichtigungstext, dass der Post wegen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Seite entfernt worden sei. Der Counter darunter war bei knapp über 2,5 Millionen Views stehen geblieben. Mit einem Seufzer der Erleichterung kehrte Matt zu seinem Platz und dem Mülleimer zurück, von dem er vermutete, dass er ihn vielleicht noch brauchen würde, während sein Chef das Handy zückte und die Nummer der Nationalen Einheit gegen Cyberverbrechen aufrief, mit der er zu seinem Leidwesen in regelmäßigem Kontakt stand.
»… Hi, Karen? Hier ist Justin Strong von … ja, genau … Nicht direkt. Ich dachte nur, Sie wollen es bestimmt als Erste wissen …« Er machte eine Pause, damit seine unaufrichtige Bestürzung auch richtig wirken konnte. »Wir haben schon wieder eine.«
Eins
Das hübsche, reiche Mädchen, das unweigerlich den Kopf verlor
Die Metalltüren öffneten sich.
… Stille.
Ein Netz aus dunstigem Sonnenschein erhellte das Eingangsfoyer. Staubkörnchen tanzten in den einzelnen Strahlen, als Detective Constable Scarlett Delaney das geräumige Penthouse in Knightsbridge betrat.
»Hallo?«, rief sie. Ihre Stimme erfüllte mühelos den gesamten Raum. Sie klang voller und selbstbewusster, so als gehörte sie zu einer ganz anderen Person. Die Akustik des spärlich möblierten Zimmers sorgte beinahe für ein Echo.
… Stille.
Von der Aussicht jenseits der doppelt mannshohen Fenster angezogen, überquerte sie das Parkett und blickte hinaus auf das vormittägliche London, das, vom Dach der Stadt aus gesehen, trügerisch ruhig wirkte. Eine verzerrte Perspektive, wie man sie sich nur für acht bis zehn Millionen Pfund erkaufen konnte.
Als die Sonne hinter einer Wolke verschwand, materialisierte sich eine gespenstische Spiegelung in der Scheibe, und Scarlett wunderte sich über den Stich der Traurigkeit, der sie durchfuhr, als sie sah, wie fehl am Platz sie in einer derart luxuriösen Umgebung wirkte. Die abgewetzten Converse All Stars taten wenig, um ihr Outfit aus zerrissenen Jeans und grauem Kapuzenpullover aufzuwerten. Auf einmal befangen, band sie sich in dem behelfsmäßigen Spiegel rasch einen Pferdeschwanz. Blasse Haut und tiefrotes Haar, um das sie mehrmals den Gummi schlang.
»Scarlett?«, dröhnte eine Stimme durchs Apartment. »… Hier drinnen.«
»Ich komme!«, antwortete sie und musterte sich ein letztes Mal, ehe sie sich auf den Weg machte.
Im Wohnbereich waren stellenweise noch die Überreste einer ausschweifenden Party zu sehen, als sie unter einer gläsernen Treppe hindurchging, die, den Gesetzen der Physik trotzend, im Zickzack hinauf zu einer atemberaubenden Küche im Zwischengeschoss führte. Leere Champagnergläser bildeten eine kristallene Dekoration auf dem Kaminsims, und der Steinway-Flügel hatte als Serviertisch für Häppchen herhalten müssen, die Scarlett zum Großteil nicht einmal identifizieren konnte.
Sie zog ein paar Einmalhandschuhe aus ihrer Tasche und folgte dem Kamerablitzlicht des Tatortfotografen ins Schlafzimmer.
»Tut mir leid, dass du an deinem freien Tag kommen musstest«, krächzte Detective Sergeant Frank Ash, der mit dem Rücken zu ihr stand.
»Schon gut«, gab Scarlett zurück, streifte sich die Handschuhe über und umrundete das Bett, um die grausige Szene in Augenschein zu nehmen, die sie auf der anderen Seite erwartete.
Sie blieb wie angewurzelt stehen. Der Anblick raubte ihr den Atem … doch äußerlich ließ sie sich nichts anmerken.
»Ach, übrigens: Mach dich auf was gefasst«, sagte Frank fünf Sekunden zu spät, während er ihr für die Arbeit gänzlich unpassendes Outfit begutachtete.
»Sieht … bequem aus«, lautete sein Kommentar. Sein Schmunzeln, kombiniert mit der Angewohnheit, freie Sommertage lesend am Pool zu verbringen, ließ sein ledriges Gesicht so zerknittert aussehen wie seine Leinenhose.
»Ja. Danke«, gab sie zurück. Doch ihr säuerlicher Ton war nur ein Scherz, ein Zugeständnis an den Mann, der sie seit Beginn ihrer noch jungen Karriere immer unterstützt hatte … und schon lange davor.
»Es sind definitiv wieder dieselben«, sagte er und trat beiseite, um Scarlett einen besseren Blick zu ermöglichen. Die Sonne, die durchs Fenster hereinfiel, badete sie in Licht, als sie den neuen und dennoch auf unheimliche Weise vertrauten Tatort auf sich wirken ließ. »Nummer drei. Genauso wie immer: mit einem Seidentuch stranguliert, fünf Kratzer im Gesicht. Und ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber sie wurde enthauptet – der Körper ist unerklärlicherweise verschwunden.«
Beide fuhren zusammen, als der Fotograf eine weitere sorgsam strukturierte Aufnahme von einer durch und durch unstrukturierten Blutlache machte. »Sorry«, entschuldigte sich der Mann und entfernte sich.
»… Unerklärlicherweise?«, hakte Scarlett nach.
»Es wurden zwei Fotos nahezu zeitgleich von ihrem eigenen Smartphone aus auf Social Media hochgeladen. Auf dem ersten, das allem Anschein nach kurz nach der Tat gemacht wurde, war die vollständige Leiche zu sehen, als wollte der Täter aller Welt präsentieren, was er getan hat. Auf dem zweiten, das später, nämlich bei Sonnenaufgang, aufgenommen wurde, lag ihr enthaupteter Leichnam genau hier.«
»Okay.«
»Das einzige Fenster war von innen zweifach verriegelt.«
»Okay?«
»Der Freund lag da drüben im Bett.«
»O…kay.«
»Und drei Freunde, die nach der Party nicht nach Hause gegangen waren, haben die ganze Nacht direkt nebenan gesessen.«
»Oh!«
»Genau … oh!«
»Wissen wir schon, was er mitgenommen hat?«, wollte Scarlett wissen.
Frank zückte sein Telefon und tippte mit ungeschickten Fingern auf dem Display herum, bis er eine Kopie des mittlerweile gelöschten Posts gefunden hatte. Er reichte es ihr. »Finde den Unterschied.«
»Du meinst, abgesehen von der Tatsache, dass …«
»Ja, abgesehen von der Enthauptung und der fehlenden Leiche.«
Sie nickte, wie um zu sagen: Wollte nur sichergehen. Dann ging sie in die Hocke, um sich den Kopf auf dem blutdurchtränkten Teppich aus der Nähe anzusehen, wobei sie achtgab, nicht die Jeans zu berühren, die daneben auf dem Boden lag. Sie zoomte auf den Fotos näher heran.
»… ihre Ohrringe?«
»Bingo!«, sagte Frank, ehe Scarlett ihm sein Telefon zurückgab.
»Jackdaw hat wieder zugeschlagen.«
Sie runzelte missbilligend die Stirn, weil er den Spitznamen benutzte, den die Presse dem Täter gegeben hatte. Sie mochte die schamlosen Versuche der Medien nicht, ein gefährliches und gestörtes Individuum in den Bereich des Mythischen zu heben. Damit machten sie das Leiden der Opfer zu billiger Unterhaltung für die Massen. Aber die Fähigkeit des Mörders, sich scheinbar in Luft aufzulösen, sowie seine Angewohnheit, vom Tatort etwas Funkelndes als Trophäe mitzunehmen, waren schlichtweg zu verlockend gewesen.
»Das waren die Fotos, die auf Social Media hochgeladen wurden?«, fragte sie.
»Jup.«
»Hat die jemand gesehen?«
»Nur ein oder zwei …«, antwortete er, woraufhin Scarlett erleichtert nickte. »… Millionen.«
»O Gott … Wer ist sie?«
»Das weißt du nicht?« Frank klang verwundert. »Die hier kenne selbst ich, und ich bin fast zwanzig Jahre älter als du: Francesca Labelle.«
Scarlett war keinen Deut schlauer.
»Offiziell ist sie eine Fashio…narista.«
»Fashionista«, korrigierte ihn der Fotograf. Etwas an seinem Tonfall suggerierte, dass er in einer perfekten Welt Fotos von glamourösen Frauen gemacht hätte statt von den Blutlachen, die sie nach ihrem Tod hinterließen.
Frank nickte und deutete lebhaft in Richtung des Mannes. »Genau. Das, was er gesagt hat. Sie war Teilnehmerin in dieser Promi-Datingshow, da ist sie mit diesem bärtigen Typen aus dieser einen Band zusammengekommen.« Scarlett zuckte die Achseln. »Du weißt schon. Der mit dem Video … mit den Emus.« Sie wandte sich Hilfe suchend an den Fotografen. Doch dann räusperte sich Frank, während er unsicher von einem Fuß auf den anderen trat, und begann, schief einen Song zu singen: »I didn’t do it … No. No. No. I didn’t do-ooo it.«
»Na, das passt ja wie die Faust aufs Auge«, ertönte scheinbar aus dem Nichts eine trockene Stimme.
Verwirrt stellte Scarlett sich auf die Zehenspitzen. Erst jetzt sah sie die Beine, die unter dem Bett hervorlugten.
»Rechtsmediziner«, erklärte Frank auf ihren fragenden Blick hin.
»… und inoffiziell?«, fragte sie, bevor noch jemand aus seinem Versteck springen oder ein Liedchen schmettern konnte.
»Ist sie die reiche, verwöhnte Tochter von …«
Aus dem Wohnbereich drangen laute Stimmen zu ihnen, gefolgt vom Klang sich nähernder Schritte.
»Wenn man vom Teufel spricht«, brummelte Frank und eilte aus dem Zimmer, um die Person abzufangen, wobei er die Tür hinter sich zuzog.
Obwohl Scarlett nur einzelne Wörter der hitzigen Diskussion aufschnappte, war der Schmerz eines trauernden Elternteils unverkennbar. Sie spitzte die Ohren, als die Aggression allmählich nachließ und die Stimmen leiser wurden.
»Edgar Crews«, beendete der Rechtsmediziner Franks Satz, ehe er unter dem Bett hervorkam, um einen blutigen Abstrich einzutüten.
»Hieß sie nicht Labelle mit Nachnamen?«, fragte Scarlett. Ihre Abneigung gegen den kleinen Mann, an den sie sich noch gut von einem früheren Fall erinnerte, war weniger stark als ihre Neugierde.
Er zuckte gleichmütig mit den Schultern. Das Sonnenlicht, das sich auf seiner Glatze spiegelte, ließ kleine Reflexe vor ihren Augen tanzen.
Dankbar für jeden Grund, der es ihr ermöglichte, die kurze Interaktion zu beenden, beschloss sie, sich den Fotos zuzuwenden, die auf der Kommode verstreut lagen: das Opfer, umringt von einer Schar schöner Menschen; in diversen Designer-Outfits; Urlaubsbilder mit türkisblauem Wasser und einer Jacht, die ungefähr fünfmal so groß war wie ihr eigenes bescheidenes Häuschen.
Besonders sorgfältig widmete sie sich den wenigen Bildern, die es wert gewesen waren, gerahmt zu werden: ein sehr struppig aussehender Border Collie, eine junge Francesca, die die Arme um eine ältere Frau geschlungen hatte, und ein vergilbtes Foto von ihr als Kind, wie sie lachte, während ihr Vater sie huckepack trug.
Schwere Schritte wurden lauter, bis Frank abermals im Türrahmen auftauchte. »Du müsstest Mr Crews bitte nach Hause fahren«, sagte er zu Scarlett. Er vergewisserte sich, dass der Milliardär außer Hörweite war, ehe er fortfuhr: »Er ist sehr aufgewühlt, aber finde trotzdem raus, was du kannst. Vielleicht ist es der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um mit ihm zu reden …«
»Oder der allerbeste.« Sie nickte, während sie eine der unzähligen Perlen der Weisheit zitierte, die er ihr im Lauf der Jahre geschenkt hatte.
»Ganz genau. Ruf mich an, wenn …«
Erneut wurden sie geblendet, als die Kamera des Fotografen klickte.
Frank warf dem Mann einen verärgerten Blick zu. »Muss das sein?« Er rieb sich die Augen, ehe er sich wieder an Scarlett wandte. »Ruf mich an, wenn du auf dem Heimweg bist.«
»Wird gemacht.«
Während Frank seine Aufmerksamkeit wieder auf den Tatort richtete und mit dem Ächzen eines alten Mannes neben dem Kopf der Getöteten in die Hocke ging, verließ Scarlett das Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich.
»… Das war die irre Delaney«, hörte sie den unangenehmen Rechtsmediziner sagen, als sie draußen im Flur stand.
»Für Sie immer noch Detective Constable Delaney«, gab Frank spitz zurück, woraufhin sie schmunzeln musste.
Sie presste das Ohr an die Tür.
»Und Sie sind … na ja, Sie sind Sie.«
»Meines Wissens ja.«
»Ist das nicht ein bisschen … heikel?«
»Wir kommen gut miteinander aus.«
»Aber waren Sie nicht derjenige, der …«
»Ich sagte, wir kommen gut miteinander aus!«, knurrte Frank. Das unangenehme Schweigen, das daraufhin eintrat, war fast mit Händen zu greifen.
Dennoch blieb Scarlett, wo sie war. Sie lauschte, während der abstoßende kleine Mann sich vermutlich wieder der körperlosen Leiche widmete, ehe er nach einer Weile all seinen Mut zusammennahm, um ein halblautes »Das sieht man« zu murmeln.
Zwei
Die Charme-Offensive
Mit seinem klassischen Dreiteiler aus der Savile Row, Budapestern in der Farbe von poliertem Holz und den bis auf einige vorwitzige Strähnen aus dem Gesicht gekämmten dunklen Haaren war Henry optisch der Inbegriff eines englischen Gentlemans, als er das Restaurant des berühmten Erstwhile House in Mayfair betrat.
»Schönen guten Tag, Mr Fairchild«, grüßte ihn die attraktive und perfekt zurechtgemachte Frau am Empfang, während sie aufstand, um ihm den Aktenkoffer abzunehmen.
»Tag, Jennifer«, erwiderte er mit einem Lächeln. Sie errötete, weil er sich ihren Namen gemerkt hatte. »Ach, wissen Sie was? Ich glaube, heute behalte ich den bei mir.« Er tätschelte das Leder, ehe er sich zu ihr beugte und die Stimme senkte. »Ich habe eine kleine Neunmillimeter in der Innentasche für den Fall, dass das Meeting nicht nach Plan läuft.«
Sie lachte glockenhell über den bestenfalls durchschnittlichen Witz, dann fragte sie: »Das ist eine Pistole, oder?«
»Ganz genau.« Er nickte, woraufhin sie erneut lachte. »Ich finde den Weg allein.«
Er begab sich in den luxuriösen Speisesaal, an dessen blättergeschmückter Decke kleine Lichter wie Sterne funkelten und ein Jazz-Quartett für unaufdringliche Beschallung sorgte.
Wie immer ließ er interessiert den Blick über die Tische schweifen. Hier trafen sich jeden Tag zur Mittagszeit die mächtigsten Menschen des Landes. Bei exquisiten Speisen und feinen Weinen besprachen sie Angelegenheiten, die Auswirkungen auf das Leben von Millionen hatten, lachten schallend und verschütteten ihre Drinks wie fette kleine Götter.
»Ah, Mr Lampert!«, grüßte ihn ein rotgesichtiger Gast, als Henry an ihm vorbeiging.
»Mr Peterson. Gut sehen Sie aus«, gab Henry zurück und schüttelte dem Mann die Hand. Er setzte seinen Weg fort, kam allerdings nur zehn Schritte weit, ehe er erneut angehalten wurde, diesmal vom exzentrischen Besitzer des Restaurants. Mit seiner hinreißend fleckigen Schürze, die er sich wie eine kugelsichere Weste über das weiße Hemd gebunden hatte, sah er aus wie ein Mann, der sich nicht recht zwischen Geschäft und Leidenschaft entscheiden kann.
»Monsieur Chavasse!«, rief er mit ausgeprägtem französischen Akzent, obwohl er in Burton-upon-Trent geboren und aufgewachsen war. Er präsentierte Henry eine Schüssel mit einer dampfenden orangefarbenen Flüssigkeit darin. »Probieren Sie! Probieren Sie!«, drängte er aufgeregt.
Pflichtschuldig kostete Henry einen Löffel voll von der Suppe und schloss die Augen, um der Kreation des Mannes seine volle Aufmerksamkeit widmen zu können.
Nach einem Moment nickte er. »Jacques, die ist perfekt. Ungelogen.«
»Fehlt nicht noch Pfeffer?«
»Auf keinen Fall.«
»Mehr Koriander?«
»Nein! Ändern Sie bloß nichts mehr daran. Schauen Sie sie nicht einmal mehr an. Sie ist absolut vollkommen.«
Hocherfreut und voller Zuneigung tätschelte ihm der Mann den Rücken, ehe er zurück in die Küche eilte.
Henry, der überlegte, ob es womöglich an der Zeit war, sich einen neuen Treffpunkt zu suchen, nahm Kurs auf eine abgeschiedene Ecke des Saals, wo ein untersetzter Mann mit pockennarbigem Gesicht saß und auf sein Handy starrte.
Henry trat zu ihm an den Tisch und räusperte sich. »Mr Pavlov, nehme ich an?« Er streckte dem Mann die Hand hin.
»Dmitry«, antwortete dieser, allerdings ohne seinen Highscore-Versuch bei Candy Crush zu unterbrechen. Als er wenige Augenblicke später sein letztes Leben verlor, fluchte er lautstark auf Russisch, ehe er das Handy auf den Tisch legte, um seinen gut gekleideten Gast zu mustern. »Und Sie müssen Mr Devlin sein?«
»Henry.« Er lächelte, schüttelte dem Mann kräftig die Hand und nahm Platz.
»Sie trinken mit mir«, sagte der Russe. Es klang eher wie ein Befehl als eine Einladung.
»In Ordnung«, sagte Henry. Er hatte nichts dagegen einzuwenden. »Einen doppelten Scotch mit …«
»Sie! … Sie da!«, blökte der Mann und schnippte auf unausstehliche Weise mit den Fingern, als wollte er einen Hund zu sich rufen. Henry hatte Mühe, sich seine Verachtung nicht anmerken zu lassen.
»Ja, Sir?«, sagte der Kellner, der es offenbar nicht gewohnt war, quer durch den Speisesaal angebrüllt zu werden.
»Noch mal dasselbe«, sagte der Russe und deutete auf sein leeres Glas. »Für mich und meinen Freund hier.«
»Sehr wohl, Sir.«
Als der junge Mann sich entfernen wollte, packte der Russe ihn am Arm. »Warum bringen Sie nicht gleich die ganze Flasche?«
Mit einem knappen Nicken ging der Kellner davon.
Der Russe wandte sich wieder an Henry. »Der beste Wodka der Welt. Aus meinem Heimatland«, erklärte er stolz und schlug sich mit der Faust gegen die Brust wie ein Gorilla. »Hundert Pfund pro Glas!«
Henry zog die Augenbrauen hoch und versuchte, ein höflich beeindrucktes Gesicht zu machen.
Mehrere Augenblicke vergingen, in denen der Russe ihn lediglich anstarrte, ohne etwas zu sagen. Statt der gängigen Einschüchterungstaktik nachzugeben, wartete Henry ab und hielt dem Blick seines Gegenübers stand, bis der Kellner zurückkehrte, um ihnen je ein Glas Wodka einzuschenken, ehe er die Flasche auf den Tisch stellte. Die zwei Männer hoben gleichzeitig ihr Glas und tranken es in einem Zug aus. Auch diesmal musste sich Henry zusammenreißen, um seine wahren Gefühle zu verbergen.
»Sie sind nicht so, wie ich Sie mir vorgestellt habe«, teilte ihm der Russe mit, ehe er ihnen zwei weitere Gläser des Teufelszeugs einschenkte.
Henry lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und wartete auf eine Erklärung.
»Die meisten Männer in unserer Branche …« Er verstummte mit einem verächtlichen Achselzucken. Sein Gesicht war voller alter Narben, seine Hände blau von noch älteren Tattoos. »Aber Sie … Sie sind hübscher als die eingebildete hübsche Schwester meiner hübschesten Geliebten.«
Henry, der eine Weile brauchte, bis er dieses umständliche und zugleich herabwürdigende Kompliment begriffen hatte, lächelte bescheiden. »Nun, ich gebe gut auf mich acht. Das ist einer der Vorteile an unserer Arbeit … und an den lukrativen Deals, die wir machen«, sagte er bedeutungsvoll, um das Gespräch wieder auf Kurs zu bringen.
Der Russe funkelte ihn an. Er schien zu überlegen, ob er beleidigt sein sollte. »Sie haben recht! Genug geplaudert«, meinte er und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich habe siebenunddreißig Mädchen auf einem Frachter, die sind jetzt gerade auf dem Weg hierher … gute Qualität«, fügte er lüstern hinzu.
»Unsere Vereinbarung sah achtunddreißig vor.«
Der Mann lachte leise. »Transportschaden. So was passiert. Sie müssen sie nicht bezahlen.« Er goss sich noch ein Glas ein.
»Nationalität?«
Der Russe sah ihn verständnislos an.
»Des Mädchens, das es nicht geschafft hat«, hakte Henry nach.
Der andere quittierte die Frage mit einem Stirnrunzeln. Er begriff nicht, inwiefern das eine Rolle spielte. »Polin, glaube ich.«
Henry nickte, scheinbar zufriedengestellt.
»Und die Bezahlung?«
Henry langte unter den Tisch und holte seinen Aktenkoffer hervor. Er ließ die Schlösser aufschnappen und achtete darauf, dass beim Öffnen der braune Lederdeckel in Richtung seines Geschäftspartners zeigte. Er warf einen kurzen Blick auf den Griff des Neun-Millimeter-Revolvers, der aus der Innentasche ragte, und nahm schließlich einen dicken braunen Umschlag heraus, den er vor sich auf den Tisch legte.
»Eine Hälfte jetzt, die andere bei Lieferung, so wie abgemacht«, erklärte er und schob dem Russen den Umschlag hin.
»Können Sie mir nicht einfach den Koffer geben?«, fragte der, während er den Inhalt des Umschlags prüfte.
»Das ist mein Lieblingskoffer«, erwiderte Henry. »Er passt zu meinen Schuhen.«
»Warum haben Sie dann keinen anderen Koffer mitgebracht?«
»Weil … er dann nicht zu meinen Schuhen gepasst hätte, richtig?«
Der Russe, dem darauf keine Erwiderung einfiel, beschloss, das Thema zu wechseln. »Wir liefern morgen Abend um zwanzig Uhr dreißig … plus minus«, sagte er und rief dann nach der Rechnung.
»Zwanzig Uhr dreißig, in Ordnung … Die Bar im Park Chinois, wie klingt das für Sie?«
»Als hätten Sie sich das ausgesucht … Das Mendeleev?«
»Wunderbar«, sagte Henry mit einem gutmütigen Lächeln, ehe der Russe sich dicht zu ihm beugte. »Sie mögen respektabel und anständig aussehen und reden vielleicht wie die Queen persönlich, aber am Ende des Tages sind Sie genauso ein dreckiges Stück Scheiße wie ich.« Er lachte. »Man kann nie wissen, was?«
»Man weiß nie«, pflichtete Henry ihm bei, ehe er, ganz der Gentleman, aufstand, um sich von seinem Gast zu verabschieden.
»Dann bis morgen Abend, Mr Devlin«, sagte der Russe und stürzte den letzten Schluck seines Wodkas hinunter, ehe er mit wiegenden Schritten den Speisesaal verließ.
Henry setzte sich wieder hin, wischte sich die Hände an einer Serviette ab und holte sein Handy aus der Tasche, an dem ein rotes Licht blinkte, während es weiterhin Hintergrundgeräusche aufzeichnete. Die belastende Audiodatei sah aus wie eine digitale Gebirgskette voller Gipfel und Täler.
»Sir.« Der missmutige Kellner legte die Rechnung neben die unerklärlich teure Flasche Wodka.
Henry warf die Serviette auf den Tisch und griff widerwillig nach seiner Brieftasche. »Verdammter Mistkerl.«
Drei
Krokodilstränen
Scarlett kam sich ein bisschen unzulänglich vor, als sie in ihrem Fiat 500 durch das Tor von Edgar Crews’ weitläufigem Anwesen in Sussex fuhr. Auf beiden Seiten der schmalen Allee neigten sich die Bäume wie in Ehrerbietung für ihren heimkehrenden Herrn zueinander und bildeten einen schattigen Tunnel, der bis zum Haus führte.
Sie hielt an und betrachtete das stattliche Anwesen, das aussah, als stammte es direkt aus dem Märchen: Kletterrosen und Efeu bedeckten jeden Zentimeter des Mauerwerks. Um Professionalität bemüht, gab sie keinen Kommentar ab, als vor ihnen zwei Pfauen über die Einfahrt stolzierten. Vor ihrem Haus streunte höchstens eine Ratte herum, die ihr mal einen Schuh geklaut hatte.
Sie warf einen Blick zu Crews auf dem Beifahrersitz. Obwohl er Poloshirt und Chinos trug, passte er mit einer Selbstverständlichkeit an diesen Ort der Extravaganz, von der Scarlett wusste, dass sie sie niemals erreichen würde. Da war etwas an der Art, wie er sich gab, wie er ging, das selbst in seinem gegenwärtigen Zustand vollendetes Selbstvertrauen ausstrahlte. Er schien nicht gemerkt zu haben, dass sie angehalten hatten, sondern starrte, tief in Gedanken versunken, auf seine Hände.
»Mr Crews? … Mr Crews?!«
Er räusperte sich, rieb sich die Augen und richtete sich auf, ehe er sich mit der Hand durch sein grau meliertes Haar fuhr und zu ihr umdrehte. »Ja. Verzeihung. Haben Sie vielen Dank.«
»Irgendwann müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen«, sagte Scarlett sanft. Während der fünfzigminütigen Fahrt stadtauswärts war es ihr nicht gelungen, ihm nützliche Informationen zu entlocken.
»Selbstverständlich«, gab er mit spröder Stimme zurück.
»Sind Sie morgen Vormittag zu Hause?« Crews nickte. »Dann komme ich noch mal wieder.«
Nach einem höflichen Lächeln stieg er aus und ging die Stufen zur imposanten Eingangstür hinauf.
Die Fahrt war komplette Zeitverschwendung gewesen. Ehe sie den Gang einlegte, vergewisserte sich Scarlett dreimal, dass kein bunt schillernder Vogel unter ihren Reifen saß. Das tiefe Kiesbett knirschte wie eine Gerölllawine. Als sie langsam auf den Wendekreis zurollte, bemerkte sie zwei Hausangestellte, die neben den Garagen standen und sich unterhielten. Nachdem sie sich mit einem Blick in den Rückspiegel davon überzeugt hatte, dass Crews im Haus verschwunden war, hielt sie neben ihnen an und stieg aus.
Die Frau, schätzungsweise Ende fünfzig, trug eine Haushälterinnen-Uniform, und man sah deutlich, dass sie geweint hatte. Bei ihrem ungepflegten Kollegen musste es sich dem Dreck zufolge, der unter seinen abgekauten Nägeln saß, um den Gärtner handeln. Wie Teenager, die man beim Rauchen hinter dem Fahrradschuppen erwischt hatte, versteckten sie hastig ihre Zigaretten, als sie näher kam.
»Was dagegen, wenn ich mich zu Ihnen geselle?«, fragte Scarlett und rieb sich die Stirn auf eine Art und Weise, die suggerieren sollte, dass sie einen harten Tag hatte. Der Mann zögerte, aber dann bot er ihr die Schachtel an und gab ihr Feuer. »Danke. Das habe ich gebraucht«, sagte sie und lehnte sich gegen die Wand, während sie einen tiefen Zug nahm. »Entschuldigung, wie unhöflich, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Detective Constable Delaney … Scarlett«, fügte sie mit einem Lächeln hinzu.
»Detective?«, fragte die ältere Frau begierig, als hätte sie darauf gehofft, jemand von der Polizei würde sich zwischen Holzlager und Garage verirren.
»Annette!«, warnte der Mann brummig.
»Aber sie hat sie gesehen!«, hielt die Frau dagegen, ehe sie sich an Scarlett wandte. »Das stimmt doch, oder? Sie haben sie gesehen?«
»Tu dir das nicht an«, riet der Gärtner wissend. »Sie darf uns sowieso nichts verraten, stimmt’s?«, fragte er, nachdem er sich ebenfalls zu ihr umgedreht hatte.
Scarlett schüttelte bedauernd den Kopf. »Tut mir leid.«
»Siehst du?«
Enttäuscht heftete die Frau den Blick wieder auf den Boden.
»Ich habe Mr Crews nur nach Hause gefahren«, erklärte sie. Bei der Erwähnung ihres Arbeitgebers schnaubte die untröstliche Haushälterin. »Sie mögen Ihren Chef wohl nicht besonders? Das kenne ich.«
»Ich mag keine Eltern, die ihre Kinder im Stich lassen, so wie dieser Mann es getan hat.«
»Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Annette«, murmelte der Gärtner.
»Wann denn dann?!«
»Sprechen Sie von Francesca?«, fragte Scarlett.
»Wir haben sie seit mindestens anderthalb Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen … Oder?«
Ihr Kollege nickte mit einem genervten Seufzen. »Ja. So ungefähr.«
»Wir haben das Mädchen praktisch großgezogen«, fuhr die Frau fort. »Nicht nur wir zwei … alle Angestellten hier. Gott weiß, dass ihr Vater nie einen Finger für sie krumm gemacht hat. Und dann sagt er ihr aus heiterem Himmel, dass sie in ihrem eigenen Elternhaus nicht mehr willkommen ist. Seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen … Und das werden wir jetzt auch nie mehr.« Sie brach in Tränen aus.
»Was ist mit ihrer Mutter?«, fragte Scarlett und ließ ihre Zigarettenkippe zu den Dutzenden anderen auf die Erde fallen.
»Die ist gestorben, als Francesca noch ein Kind war. Autounfall.«
Obwohl kein Zweifel daran bestand, dass es sich bei Francescas Mord um das Werk eines gesuchten Serienmörders handelte, wurde Scarlett hellhörig. Sie war stolz auf ihre Menschenkenntnis und hatte Edgar Crews’ verhaltene Trauer für echt gehalten. »Was war der Grund für das Zerwürfnis?«
»Alles«, antwortete der Gärtner.
Die Haushälterin zuckte mit den Schultern. »Sie war jung – ein Teenager, der plötzlich im Rampenlicht stand.«
»Sie hat alles getan, um dem Geschäft ihres Vaters zu schaden, während sie gleichzeitig in Saus und Braus leben wollte.«
Der Mann hatte ganz offensichtlich ein grundlegenderes Problem, auch wenn Scarlett nicht sagen konnte, womit: mit Reichen im Allgemeinen? Mit mangelndem Respekt gegenüber Älteren – auch wenn besagte Ältere wohlhabend und privilegiert waren? Damit, dass Francesca gegen ihren Vater aufbegehrt und versucht hatte, sich einen eigenen Platz in der Welt zu erobern? Wahrscheinlich wusste er es selbst nicht genau.
»Sie war eine Idealistin«, meinte die Haushälterin.
»Und dass jede gute Sache, für die sie eintrat, sich gegen eine seiner Firmen richtete, war reiner Zufall?«, gab der Mann ungläubig zurück. »Ich bitte dich.« Dann wandte er sich wieder an Scarlett. »Sie hat sich gerne als ›Aktivistin‹ bezeichnet«, meinte er lachend und verschränkte seine erdverschmierten Arme vor der Brust. »Aber glauben Sie mir: Für welche Menschengruppen, Bäume oder Meere sie auch gerade gekämpft hat – im Grunde waren ihr die völlig egal.«
»Wie kannst du nur so was Schreckliches sagen?«, entrüstete sich die Frau. »Sie fand vieles von dem, was sie ihren Vater tun sah, nicht richtig und hat versucht, es wiedergutzumachen. Wie sollte man ihr das verübeln?«
Es war klar, dass der mürrische Mann des Gesprächs allmählich überdrüssig wurde. Scarlett nutzte die eintretende Pause, um sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Sie schloss die Augen, als eine angenehme, nach frisch gemähtem Gras duftende Brise über das Grundstück wehte. Sie hätte den ganzen Tag hier stehen können, und plötzlich erkannte sie, weshalb: Bis auf die Geräusche der Schafe auf der Weide nebenan war es vollkommen still. Sie lebte schon so lange in der Hauptstadt, dass sie ganz vergessen hatte, wie sich das anfühlte.
»Sie glauben also, das bei Mr Crews sind bloß Krokodilstränen?«, fragte sie ihn nach einer Weile.
»Na ja, so weit würde ich nicht gehen«, stellte der Gärtner klar. »Der Mann hat schließlich seine Tochter verloren. Aber wenn Mr Crews in diesem Szenario das Krokodil ist, dann hat irgendwer gerade das Jagdboot versenkt … Sie entschuldigen mich.« Er schnippte den Zigarettenstummel weg, bevor er um die Ecke der Garage verschwand.
Vier
Mundgeruch-Kenny
»Ich gehe mal kurz nach nebenan«, verkündete Frank, weil er nicht länger den wachsamen Blicken des abgetrennten Kopfes ausgesetzt sein wollte.
Seine Knie knackten, als er aufstand. Er ging in Francesca Labelles sonnendurchflutetes Wohnzimmer und ließ sich dort gegen die Wand sinken. Die Hand an die Schläfe gepresst, schloss er die Augen und wünschte, seine Kopfschmerzen würden nachlassen. Neuerdings bekam er sie immer häufiger.
»Detective Ash?«, fragte jemand besorgt vom Balkon her. Ihm war da draußen niemand aufgefallen. Sofort richtete er sich auf, tat so, als müsste er gähnen, und schenkte dem jungen Officer ein wenig überzeugendes Lächeln. »… Ist alles in Ordnung, Sir?«
»Alles gut. Was gibt’s?«
»Der Anwalt des Freundes ist auf dem Weg nach Hyde Corner und möchte wissen, wann wir ungefähr da sind.«
»Aha«, sagte Frank gleichgültig.
»Und die Freunde von der Party – die, die die Lei…, das Opfer gefunden haben, sitzen immer noch gegenüber im Café und warten.«
Das Wort Café war das Einzige, das bei ihm hängen blieb. Er traf eine Entscheidung. »Okay. Dann gehe ich jetzt rüber und rede mit ihnen. Falls man mich braucht, bin ich mobil erreichbar.«
Beim Betreten des Coffeeshops erspähte Frank sofort den Tisch mit den übernächtigten Augenzeugen. Nach einer Nacht voller Ausgelassenheit und Alkohol hatten sie ihr Lager in einer Nische ganz hinten aufgeschlagen. Bei einer Frau war das dunkle Make-up verschmiert und sah aus wie eine Kriegsbemalung, weil sie geweint hatte, während eine andere sich die gefährlich hohen Schuhe ausgezogen und auf den Tisch gestellt hatte. Ihnen gegenüber lag, mit einer Lederjacke zugedeckt und einer Ray-Ban-Brille anstelle einer Schlafmaske, eine dritte Person und schien zu schlafen. Da er noch immer bohrende Kopfschmerzen hatte, beschloss Frank, zunächst an den Tresen zu gehen. Ihm knurrte der Magen, als er die diversen Speisenangebote in der Vitrine betrachtete. »Könnte ich ein Speckbrötchen und einen …«
»Ähhhh, wir sind ein veganes Café«, fiel ihm der Mann an der Kasse ins Wort. Er machte ein Gesicht, als hätte Frank mitten in seinem Lokal einen Haufen gesetzt.
»Oh! Aha! Dann vielleicht … Eier?«, fragte er zaghaft.
»Zum zweiten Mal: Wir sind ein veganes Café … Sir.«
Mit einem Schnaufen widmete sich Frank erneut der aufwendig gestalteten Auslage, um sich das Appetitlichste herauszusuchen, das er finden konnte.
»Was ist das da … ganz hinten?«
»Das ist unser berühmtes Sandwich mit Kichererbsen, Linsen und Hummus auf Roggenbrot«, teilte der Mann ihm voller Stolz mit.
»Heilige Muttergottes!«, stieß Frank hervor und verzog angewidert das Gesicht. »Vergessen Sie’s. Ich nehme nur einen Cappuccino.«
»Wie Sie wollen«, gab der Mann säuerlich zurück. »Mit Soja-, Mandel- oder Kokosmilch?«
Frank starrte ihn an. »… Soja?«, sagte er verunsichert.
»Das macht dann fünf Pfund.«
»War ja klar.« Frank nickte und hielt seine Karte vor das Lesegerät. »Sie haben nicht zufällig eine Aspirin oder Paracetamol?«
Dem Mann fiel die Kinnlade herunter, und Kaffee spritzte über den Boden.
»… Sie sind ein tierversuchsfreies Café?«, riet Frank. »Geben Sie mir einfach meinen verdammten Kaffee.«
Der entsetzte Mann warf ihm fast die Tasse hin.
»Danke. Und viel Erfolg mit Ihrem … Geschäft«, rief Frank spöttisch, ehe er auf die erschöpfte Gruppe in der Ecke zusteuerte.
»Tag«, grüßte er sie und stellte seinen Kaffee neben die Schuhe, um zunächst einen Blick in sein Notizbuch zu werfen. »Lilliana, Coco und … Howard?«, fragte er.
Ein braunes Augenpaar sah ihn über den Rand der dunklen Sonnenbrille hinweg gelangweilt an. »Howie.«
»Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Ich bin Detective Inspector Ash … Frank«, fügte er mit einem Lächeln hinzu, um nahbarer zu wirken – ein Trick, den er gleich am ersten Tag an Scarlett weitergegeben hatte. »Darf ich?«
Die Gruppe rückte umständlich zur Seite, um ihm Platz zu machen. Der arme Howie musste sich tragischerweise sogar aufrecht hinsetzen wie ein richtiger Erwachsener.
Dann begann Frank, seine Routinefragen zu stellen.
Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? – Nein.
War irgendjemand auf der Party, den Sie nicht kannten? – Ja, mehrere Leute.
Wie hat Francesca auf Sie gewirkt? – Ganz normal.
Und so weiter und so fort …
»Kiffer-Pete, Big Al, Little Al …«, ratterte die barfüßige junge Frau herunter, damit Frank eine Liste der Partygäste zusammenstellen konnte. »Ach ja, und Mundgeruch-Kenny! … Den nennen wir so, weil …«
»Er Mundgeruch hat?«, beendete Frank den Satz.
»Ähhh, ja, genau! Kennen Sie ihn?«, fragte sie verblüfft.
»… Aber sicher doch«, murmelte er. Drauf und dran, jeden Lebensmut zu verlieren, legte er seinen Stift auf den Tisch. »Sie wissen nicht zufällig die echten Namen dieser Leute, oder?«
Ratlose Gesichter.
»… Dann vielleicht wenigstens ihre Kontaktdaten?«, fuhr er fort und kritzelte Telefonnummern, Instagram-Accounts und Twitter-Handles neben seine Liste mit dreißig Namen.
»Da waren aber auch noch andere«, sagte Schmierauge. »Freunde von Freunden, wissen Sie? So wie …« Sie brach mitten im Satz ab, um auf ihrem Smartphone herumzuwischen, bis sie das Foto eines übergewichtigen Mannes in einem rosafarbenen Tutu geöffnet hatte, der bewusstlos in einer Badewanne lag.
Da Frank vermutete, dass es sich bei diesem Mann nicht um den Killer handelte, fügte er ihn der Liste hinzu:
Bewusstloser Badewannen-Tutu-Mann.
Immerhin bot dies eine recht geschmeidige Überleitung zu seiner nächsten Frage:
»Haben Sie noch mehr Fotos des gestrigen Abends?«, wollte er von der Frau mit den schwarz verschmierten Augen wissen.
»Ein paar«, antwortete sie, um dann erneut auf ihr Telefon einzustechen. »So ungefähr … sechzig.«
Frank hätte sich beinahe an seinem grauenhaften Kaffee verschluckt. »Sechzig?!«
Sie nickte.
»Sie haben sechzig Fotos nur von gestern Abend?« Wieder nickte sie. Offensichtlich verstand sie nicht, was daran für den alten Mann so schwer zu begreifen war. »Das letzte, das ich gemacht habe, war von einem Schmetterling in meinem Rosenstrauch vor zwei Monaten«, sagte er mit einem ungläubigen Kopfschütteln.
»Das ist … schön?«, sagte sie, während sie Hilfe suchend zu ihren Freunden schielte.
»Hätte schön werden können«, pflichtete Frank ihr bei, »wenn ich den Finger nicht auf der Linse gehabt hätte. Was ist mit Ihnen?«, wandte er sich an Frau Barfuß. »Fotos?«
»Ja. Ich habe … zweiundvierzig.«
»Und Sie?«
Howie schnaubte, nahm sein Telefon und schrieb möglicherweise ein oder zwei Messenger-Nachrichten, ehe er antwortete. »Nur achtundzwanzig. Sorry«, sagte er und warf das Gerät wieder auf den Tisch.
»Okay«, sagte Frank. »Wir machen jetzt Folgendes: Die Fotos sind Beweisstücke in einem Mordfall.«
»Mord?!«, keuchte Barfuß. Diesmal warfen selbst ihre Freunde ihr einen irritierten Blick zu; es erschien ihnen höchst unplausibel, dass Francesca sich selbst den Kopf abgeschnitten und danach noch die Mühe gemacht hatte, ihren Körper vom Tatort zu entfernen.
Frank ignorierte die Frage. »Sie dürfen keins davon löschen. Verstanden?«
Die drei nickten verunsichert.
»Ich meine es ernst«, sagte er. »Ich werde sie zählen, und ich erwarte sechzig, zweiundvierzig und achtundzwanzig Fotos. Es wird sich heute noch jemand bei Ihnen melden, der Ihnen erklärt, wo Sie sie hochladen müssen. Oder runterladen. Okay? … Okay. Sie können jetzt gehen.«
Sobald die drei das Café verlassen hatten, schloss Frank die Augen, ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und tastete blindlings nach den schwindelerregend hohen Schuhen, kurz bevor er das Tappen nackter Füße hörte.
»Danke schön!«
»Gern geschehen.«
Fünf
Oxblood oder Cherry Velvet?
Scarletts Telefon klingelte genau in dem Moment, als sie aus dem Fahrstuhl in Francesca Labelles Apartment trat.
Mark (Freund)ruft an …Annehmen Ablehnen
Einen Moment lang schwebte ihr Daumen unschlüssig über dem Display. Dann eilte sie durch den Wohnbereich auf den Balkon und tippte auf Annehmen. »Hey.«
»Selber hey. Ich habe schon mehrmals versucht, dich anzurufen.«
»Ja. Sorry. Ich saß im Auto. Was gibt’s?«
»Nichts Besonderes. Ich wollte nur mal hören, wie dein Tag so läuft.«
»Gut. Und deiner?«, fragte sie, während sie ungeduldig mit dem Fuß tippte.
»Gut … gut. Bin vor etwa einer halben Stunde nach Hause gekommen. War gerade unter der Dusche.«
Sie runzelte die Stirn. »Du hast dir aber nicht wieder ein Handtuch um den Kopf gewickelt wie eine Frau, oder?«
Eine vielsagende Pause. »… Nein.«
»Ich hasse es, wenn du das machst.«
»Ich habe sehr volles Haar. Wäre es dir lieber, wenn ich es einfach abrasieren würde?«
»Natürlich«, antwortete sie verdutzt und zuckte mit den Achseln.
»Tja. Mache ich aber nicht.« Ein Windstoß blies Scarlett ein paar lose Haarsträhnen ins Gesicht. »Und? Wo bist du?«, wollte er wissen.
»Knightsbridge.«
»Nicht übel. Genießt du deinen freien Tag?«
»Mhm«, antwortete sie bewusst vage. »Ich bin auf einer … Veranstaltung … mit einem Bekannten.«
Sie hatte noch nie gut lügen können.
»Ist dieser ›Bekannte‹ rein zufällig Frank?«
»… Ja.«
»Und die Veranstaltung, auf der du dich so gut amüsierst?«
»Eine Enthauptung.«
»Du hast es mir versprochen!«
»Hey, druck dir gerne meinen Dienstplan aus, dann kannst du ihn Jackdaw geben, falls ihr euch jemals begegnen solltet.«
»Was auch immer.«
»Jetzt schmoll nicht.«
»Tue ich nicht. Darf ich heute Abend wenigstens für dich kochen?«
»Das wäre toll, aber jetzt muss ich auflegen.«
»Na gut. Ich liebe dich!«
»Ja … okay. Ja«, erwiderte sie, beendete das Gespräch und steckte das Handy zurück in ihre Hosentasche.
»Wickelt er sich immer noch einen Turban?«, fragte Frank von der Tür her.