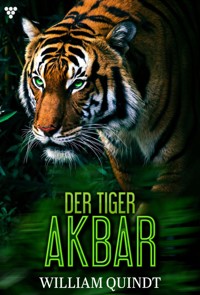
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Tiger Akbar
- Sprache: Deutsch
Peter Petersen, einem kleinen Angestellten einer Hamburger Importfirma, liegt die Lust zum Abenteuer im Blut. Als er eines Tages Zirkusluft schnuppert, erhält er den entscheidenden Anstoß, aus seinem bisherigen eintönigen Leben auszubrechen. Er beschließt, Raubtierdompteur zu werden. Als ihm die schöne Frau seines Lehrmeisters beinahe zum Verhängnis wird, verlässt er die bunte Zirkuswelt. Er schließt sich einer Expedition an, die ihn auf Tigerjagd in den indischen Dschungel führt. Dort fängt er den Tiger Akbar, ein besonders schönes und kluges Tier, der eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen wird. In den undurchdringlichen Urwäldern Indiens kommt Peter Petersen seiner Begleiterin, der geheimnisvollen, faszinierenden Artistin Daphne Dennys näher, in die er sich leidenschaftlich verliebt. Dieser farbige, fesselnde Roman führt an internationale Schauplätze. Die Geschichte des Tigers, den die Menschen »Akbar« nannten, hebt an mit dem Duft üppig blühender Syringen. Mit diesem hellen und süßen Duft, der aus dem stillen, in sich verkapselten Knaben Peter Petersen einen Mann machte, der jählings und scheinbar unmotiviert dem Zwinger seiner bürgerlich eingeengten Existenz entsprang, um sich – stark, giervoll und sehnsuchtbesessen – in ein buntes und verwirrend gefährliches Leben der Abenteuer zu stürzen. Ein Abend im Frühling. Das Rot der versunkenen Sonne färbt den westlichen Himmel, spiegelt sich schwach auf den sanften Wellenkämmen des Sees. Peter Petersen sitzt am Rande einer zart geschwungenen Bucht des Alsterufers. Sitzt auf einer leuchtend braun gestrichenen Holzbank und liest in einem groß gezeichneten und vielfach gestempelten Buch der städtischen Leihbücherei. Weiße Segel ziehen langsam und stetig über das glänzende Wasser, dessen bewegtes Dunkel allmählich siegt über den verflackernden Purpur der letzten Sonnenglut. Farbenfrohe Boote tragen in weichen Kissen hell gewandete Mädchen, die lässig und lachend mit den rudernden Liebsten flirten. Auf dem Steg des Brutkastens, den man in der Bucht errichtet hat, kraxeln drollige graue Schwanenküken, aufgeregt umkreist von den schimmernd weißen Eltern. Durch die warme Abendluft wehen leise die Melodien des Bläserorchesters im Uhlenhorster Fährhaus. Rings sind die Bänke besetzt: einige ältere Ehepaare, die korpulent und behaglich den Abendfrieden genießen, ein paar junge Menschen, abwesend und unlustig in Büchern und Magazinen blätternd, zwei Liebespärchen, die mit sichtlicher Ungeduld auf das Dunkel warten, um sich endlich küssen zu können. Hinter den Büschen der Anlagen hupt auf dem Fahrdamm der Prachtstraße mitunter ein schnell dahinflitzendes Auto, mahnt an die Unrast der nahen Stadt. Peter Petersen fügt sich gut in dieses Bild spießerlicher Abendruhe. Einundzwanzig Jahre ist er alt und so recht das, was man einen braven Burschen nennt. Ist niemals sitzen geblieben in der Schule, hat die kaufmännische Lehre mit Auszeichnung bestanden, ist nun schon drei Jahre Gehilfe in der Firma Wilkens & Companie, Häute-Import. Die Mutter ist seit vielen Jahren tot, nun lebt er neben dem Vater her, und die Schwester führt ihnen den Haushalt. Er verträgt sich gut mit beiden, ist pünktlich, stets gefällig und immer freundlich. Liest viel in seinen freien Stunden, geht wöchentlich zweimal ins Kino und einmal im Monat in ein Theater. Mehr als dies begehrten seine Sinne bis heute nicht vom Leben. Heute hat er sich durch den ganzen Tag seltsam bedrückt und verworren gefühlt. Nicht wie sonst ist ihm die Arbeit glatt und leicht von der Hand geflossen, er hat sich dazu zwingen müssen, und sie ist ihm zur Qual geworden. Der Vater hat ihn freilich verlacht, als er zu ihm von seinen Nöten gesprochen, hat lustig mit den Augen gezwinkert und gemeint, ihm stecke wohl der Frühling im Blut … Aber abends ist es noch schlimmer geworden mit ihm. So müde fühlte er sich, so schwach und merkwürdig weich in allen Gliedern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Aufbruch
Zirkus
Manege
Duell
Café
Daphne
Meer
Indien
Matschan
Akbar
Heimat
Gier
Debüt
Eifersucht
Artisten
Sehnsucht
Nächte
Nacht
Mord
Aufbruch
Der Tiger Akbar – 1 –Jagd im indischen Dschungel
William Quindt
Aufbruch
- 1 -
Die Geschichte des Tigers, den die Menschen »Akbar« nannten, hebt an mit dem Duft üppig blühender Syringen. Mit diesem hellen und süßen Duft, der aus dem stillen, in sich verkapselten Knaben Peter Petersen einen Mann machte, der jählings und scheinbar unmotiviert dem Zwinger seiner bürgerlich eingeengten Existenz entsprang, um sich – stark, giervoll und sehnsuchtbesessen – in ein buntes und verwirrend gefährliches Leben der Abenteuer zu stürzen.
Ein Abend im Frühling. Das Rot der versunkenen Sonne färbt den westlichen Himmel, spiegelt sich schwach auf den sanften Wellenkämmen des Sees. Peter Petersen sitzt am Rande einer zart geschwungenen Bucht des Alsterufers. Sitzt auf einer leuchtend braun gestrichenen Holzbank und liest in einem groß gezeichneten und vielfach gestempelten Buch der städtischen Leihbücherei.
Weiße Segel ziehen langsam und stetig über das glänzende Wasser, dessen bewegtes Dunkel allmählich siegt über den verflackernden Purpur der letzten Sonnenglut. Farbenfrohe Boote tragen in weichen Kissen hell gewandete Mädchen, die lässig und lachend mit den rudernden Liebsten flirten. Auf dem Steg des Brutkastens, den man in der Bucht errichtet hat, kraxeln drollige graue Schwanenküken, aufgeregt umkreist von den schimmernd weißen Eltern. Durch die warme Abendluft wehen leise die Melodien des Bläserorchesters im Uhlenhorster Fährhaus.
Rings sind die Bänke besetzt: einige ältere Ehepaare, die korpulent und behaglich den Abendfrieden genießen, ein paar junge Menschen, abwesend und unlustig in Büchern und Magazinen blätternd, zwei Liebespärchen, die mit sichtlicher Ungeduld auf das Dunkel warten, um sich endlich küssen zu können. Hinter den Büschen der Anlagen hupt auf dem Fahrdamm der Prachtstraße mitunter ein schnell dahinflitzendes Auto, mahnt an die Unrast der nahen Stadt.
Peter Petersen fügt sich gut in dieses Bild spießerlicher Abendruhe. Einundzwanzig Jahre ist er alt und so recht das, was man einen braven Burschen nennt. Ist niemals sitzen geblieben in der Schule, hat die kaufmännische Lehre mit Auszeichnung bestanden, ist nun schon drei Jahre Gehilfe in der Firma Wilkens & Companie, Häute-Import. Die Mutter ist seit vielen Jahren tot, nun lebt er neben dem Vater her, und die Schwester führt ihnen den Haushalt. Er verträgt sich gut mit beiden, ist pünktlich, stets gefällig und immer freundlich. Liest viel in seinen freien Stunden, geht wöchentlich zweimal ins Kino und einmal im Monat in ein Theater. Mehr als dies begehrten seine Sinne bis heute nicht vom Leben.
Heute hat er sich durch den ganzen Tag seltsam bedrückt und verworren gefühlt. Nicht wie sonst ist ihm die Arbeit glatt und leicht von der Hand geflossen, er hat sich dazu zwingen müssen, und sie ist ihm zur Qual geworden. Der Vater hat ihn freilich verlacht, als er zu ihm von seinen Nöten gesprochen, hat lustig mit den Augen gezwinkert und gemeint, ihm stecke wohl der Frühling im Blut … Aber abends ist es noch schlimmer geworden mit ihm. So müde fühlte er sich, so schwach und merkwürdig weich in allen Gliedern. Er hat sein Buch in der Kohlhöfen-Bibliothek umgetauscht, hat dann, wie so oft, an der Alster entlang zum Stadtpark gehen wollen, zu seiner Lieblingsbank am Pinguinen-Brunnen. Aber die Beine haben ihn gar nicht recht tragen wollen, und so hat er schon hier, in der Bucht am Alsterufer, endgültig Station gemacht.
Still sitzt er auf seiner Bank und versucht vergebens, in seinem Buch zu lesen. Die schwarzen Druckzeilen sperren sich kalt und tot über das weiße Papier, sein Hirn vermag sie nicht zu beleben. Wieder und wieder versucht er es von Neuem – und immer wieder kommt er nicht über den Anfang hinaus.
»Es war ein sonniger Tag der schwülen Zeit, als in der Stadt der Athener eine schlanke, jugendliche Frauengestalt, begleitet von einer Sklavin, eiligen Schrittes ihren Weg über die Agora nahm.« Das hat er nun schon mehr als zwanzigmal gelesen, und das Bild geht ihm nicht auf. Das Buch in seinen Händen bleibt stumm – es spricht nicht zu ihm.
Die Mücken spielen über dem flachen Wasser der Bucht. Freche Spatzen hüpfen possierlich vor den Menschen auf den Bänken, schilpen aufdringlich, wollen gefüttert werden. Es riecht nach jungem Gras, nach den aufbrechenden Knospen der Bäume, nach dem klaren, sonnenerwärmten Wasser der Alster. Aber alle diese Düfte verstummen unter dem süßen, schmeichelnden Gesang der blühenden Syringen.
Peter Petersen überlässt sich diesem Duft, der ihn einhüllt wie die weichen, warmen Wellen eines köstlichen Bades. Der Kopfschmerz des Tages schwindet in diesem Bad, und die Müdigkeit der Glieder weicht einer eigenartig unter der Haut prickelnden Erregung. Er muss seine ganze Kraft zusammennehmen, damit das Buch nicht seinen zitternden Händen entfällt. Dabei fühlt er sich verlegen und hilflos, wie wenn tausend Augen ihn peinlich beobachteten. Fest drückt er mit der Linken das Buch gegen seinen Leib, streicht sich mit der rechten Hand über das Haar, zwängt die Finger hinter den Halskragen, der ihm zu eng dünkt, zupft und zerrt durch Minuten an der blauweiß gemusterten Krawatte.
Und abermals beginnt er zu lesen: Es war ein sonniger Tag der schwülen Zeit, als in der Stadt der Athener … Aber wieder kommt er nicht weiter, und mit einem jähen Entschluss, der ihn in seiner Plötzlichkeit selbst erschreckt, klappt er heftig das Buch zusammen, hebt den Kopf.
Sein Blick fasst die Alster, das nun dunkel glänzende Wasser, die ziehenden weißen Segel, die bunten Boote, die Gesten der Rudernden, die kraftlos geblähten Schwingen des Schwanenmännchens, das seine Jungen umkreist. Er weiß: Man hat dem Schwan die Flügel gebrochen, er kann nicht fliegen, kann nie fliegen …
Peter Petersen blickt lange auf die weißen gesträubten Schwanenfedern, und dann – dann durchzuckt es ihn wie ein elektrischer Schlag: Er ist wie dieser Schwan – er kann nicht fliegen …
Und wie Gischt einer stürmenden Flut an das Wehr des Dammes, schlägt eine wild schäumende Gedankenwelle durch ihn hin. Da – auf der Straße, hier – auf den Bänken, dort – auf dem Wasser: Überall ist Leben, starkes, frohes, waches, von sich selbst entzücktes Leben. Das Mädchen ihm gegenüber, lehnend im Arm des Geliebten, ihn anschauend mit zärtlichen Augen: es lebt. Der blonde Mann dort im bunten Pullover, der sein Kanu mit raschen Schaufelschlägen dahinschaukeln lässt, quer über die Wellen, welche die Schraube des Passagierbootes aufgeworfen hat: er lebt. Das dunkelhäutige Mädchen in den grellfarbigen Bootskissen, Zigaretten rauchend, hingegeben treibend im Rhythmus der sanften Alsterwellen: es lebt. Der Mann dort, der hinter dem Steuer seines Autos über den Asphalt saust, geduckt, unbeweglich, die Hornbrille vor den Augen, grell hupend: er lebt.
Peter Petersen hat bis heute nicht gelebt. Neben dem Leben hat er gestanden, hat gesehen, wie es sich abrollt. – Nein, nicht einmal das hat er getan! Bücher hat er gelesen, Filme hat er gesehen – von dem eigentlichen Leben hat er bis heute nichts gewusst …
Eine neue Welle brandet gegen den zitternden Deich. Gischt sprüht auf – Bilder, Gedankenfetzen: Die Bucht von Rio de Janeiro. Die Niagara-Fälle. Das verschwemmte Ufer des Amazonas. Das endlose Grasmeer der Pampas. Cowboys auf steigenden Pferden, lassoschwingend, mit dem Revolver auf hundert Schritt das Ass aus der Karte schießend. Rennen in Auteuil, bunte Jockeys über gestreckten Pferdehälsen, schöne Frauen in den letzten Pariser Toiletten. Elegants im grauen Gehrock. Blumenkorso in Nizza, Hunderte von Autos, halb vergraben unter der Last tausendfarbiger Blüten.
Was ist das? Woher kommen diese Bilder? Woher weiß er dies alles? – Ach, er weiß es aus Büchern, weiß es aus Filmen, die er irgendwann gesehen. Diese und tausenderlei anderes noch, das funkelnd wie die Sterne einer abgeschossenen Rakete im Dunkel der Nacht sein Hirn glühend durchzuckt: auftaucht, brennt, verzischt ist im Augenblick.
So viel weiß er, so viel hat er gesehen, so viel hat er gelesen. Aber ganz voll musste er sich erst trinken, ehe das alles aufbrach, das Leuchten seiner Farben zeigte. – Wie das Tor einer Schleuse ist die Pforte seines Herzens gewesen, fest und dicht verschlossen. Nicht ein Tropfen hat durch den Spalt dringen können. So hat sich das Wasser gestaut und gestaut, bis er dann endlich das Tor gesprengt hat, weit aufgerissen die beiden erzenen Flügel. – Und mit Brausen und mit Dröhnen springen die Wellen nun herein, füllen die Kammer, deren enge Wände tönend erzittern unter dieser rasenden Bewegung. Und bis in alle Himmel spritzt der weiße, in tropfenden Perlen zurückfallende Gischt.
Peter Petersen legt rasch das Buch neben sich auf die Bank, krallt sich, vornübergebeugt, mit beiden Händen an das starke Holz. Kauert mit pochenden Schläfen, brennendem Blut, fieberndem Hirn – wie damals vor langen, langen Jahren, als er, ein Knabe, zum ersten Mal in der großen Russenschaukel fuhr: in grässlicher Angst, in marternder Erwartung irgendeines schauderhaft nahen, furchtbaren Unglücks – und auch mit diesem gleichen süßen Ziehen und Zerren an allen Nervensträngen …
Das Leben – ah, das einmalige Leben! Dahin geht es, unaufhaltsam, Minute nach Minute, Stunde nach Stunde, Tag nach Tag, Monat nach Monat, Jahr nach Jahr. Und einmal dann, in irgendeinem Jahr, wird er sterben und wird nicht gelebt haben!
Hineinspringen muss man in das Leben, kopfüber! In seine stärkste Brandung muss man sich werfen, Arme und Beine rühren! Ob man versinkt oder triumphierender Sieger bleibt – was tut’s, wenn man nur im Kampf gestorben ist! Niederlage oder Sieg: Beides ist Leben, ist spürbares Sein.
Er hat nicht gelebt, er hat sein Dasein nie gespürt. Gearbeitet hat er, gelesen, gegessen, geschlafen. Aus dem Bett ins Büro, um fünf Uhr nachmittags vom Büro nach Hause, Spaziergang im Sommer, am Ofen gehockt im Winter. Und der Vater ist stets bei seinen Stammtischbrüdern, und die Schwester häkelt und strickt ewig an ihrer Aussteuer herum. Ist das Leben? Kaum ein Vegetieren ist’s! Und soll das so bleiben für immer? Nur mit dem Unterschied, dass er sich irgendwann einmal eine Frau nimmt – vielleicht die Ilse Müller, die oft zu Besuch kommt und ihm schöne Augen macht – Kinder mit ihr zeugt, um schließlich am Ende als Prokurist bei Wilkens & Companie kurz nach dem fünfzigsten Dienstjubiläum zu sterben?
Er lacht laut und bitter auf, dass die Menschen von den Bänken erstaunt zu ihm herübersehen. – Dann lieber gleich tot! Welche Lücke wäre, wenn er nie zur Welt gekommen, wenn er heute noch stürbe? – Dabei liegt draußen irgendwo die Welt, wartet auf ihn mit brennenden Farben, bezaubernden Düften – artet mit tausend Abenteuern das Leben! – Nein, nicht da draußen wartet es! Hier ist es! Alles um ihn lebt, ist, erfüllt sich. Er allein bleibt leer, bleibt tot, er – Peter Petersen.
Leise raunend plätschern die Wellen über den flachen Strand, fragen sie, fragen sie nicht: Was hast du aus deinem Leben gemacht, Peter, was – was – was? Und ehe er sich stellen kann, kommt die Antwort, ein weich und dunkel schwingendes Mädchenlachen aus dem Boot, das mit unhörbaren Ruderschlägen längs der schmalen Landzunge in seinem Rücken vorübergleitet. Das Leben fragt – ein fremdes Lachen gibt die Antwort …
Er springt auf, läuft davon, dass der trockene graue Sand unter seinen harten Schritten aufwölkt. Die Menschen rings sehen ihm erstaunt nach. Ein dicker Mann, glatzköpfig, den Panama auf den starken Schenkeln, hebt seinen Stock, deutet auf die verlassene Bank, ruft ihm etwas zu. – Peter achtet nicht darauf, rennt weiter.
Nach hundert Schritten erst fällt ihm ein, dass das Bibliotheksbuch auf der Bank liegen geblieben ist. Er schimpft laut vor sich hin, dass die Spaziergänger mit erstaunten Augen stehen bleiben. »Soll es der Teufel holen! Soll es der Teufel holen!«
Aber dann durchzuckt ihn doch, einen Herzschlag lang, der Schrecken: Er wird das Buch bezahlen müssen, Robert Hamerling, »Aspasia«, broschiert fünf Goldmark … Doch schon in der nächsten Minute ist die kleine Angst wieder ausgewischt, zertreten unter dem rasenden Amoklauf neuer Visionen.
Der Geldschrank im Hauptkontor! Immer steht er offen, und immer sitzt der spindeldürre, von den Tropen ausgelaugte Herr Wilkens mit dem Rücken davor. Hinein zu ihm in der Mittagsstunde, ihm den bronzenen Büffel, den er als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch stehen hat, in die Glatze getrieben! Über sein Röcheln an den Schrank! Zehntausende – Hunderttausende vielleicht an einem günstigen Tag! Und fort damit – hinein in das Abenteuer, in das Leben, in die Welt!
Ilse Müller: zwanzigjährig, blond, blauäugig, volle Brust und runde Hüften. Wie er mit ihr die Treppen hinuntergeht, das Haustor aufzuschließen, verlöscht das Dreiminutenlicht. Da reißt er auf den Stiegen die Entsetzte an sich, zwingt sie – er, Peter Petersen, der bis heute keine Frau berührt hat – stößt die Schluchzende dann hinaus auf die Straße, sperrt hohnlachend die Tür hinter ihr ins Schloss! Leben – o Leben!
Die Visionen verdichten sich, satt leuchten die Farben der wirbelnden Bilder, gierig verbeißt sich Peter Petersen in die Tollheiten seines ausschweifenden Hirns. Ist ein Räuber, ein Mörder, ein Schänder, ein tollkühner Desperado, ein hohnlachender Rebell. Stürzt als Führer des brüllenden Mobs in die Banken, Tausendmarknoten flattern, Blut fließt darüber hin, Mädchen kreischen, von seinen Soldaten über die Tische gezerrt … Die Schulen steckt er in Brand, die Kasernen, die Justizgebäude, öffnet die Zuchthaustore, drückt den in die Freiheit Stürzenden Gewehre in die Hand, Säbel, schickt sie zum Gemetzel auf die winselnde Schar der Bürger. Die Kirchtürme schleift er, schmeißt die goldenen Monstranzen der jubelnden Plebs vor die kotigen Füße … Und auf dem Rathausmarkt richtet er die Guillotine auf, lässt sie rasseln Tag und Nacht. Tausend Köpfe spuckt die Maschine tagsüber in die Körbe. Herrn Wilkens lässt er hinrichten, den Lehrer Fickel, der ihm in den Algebrastunden so zugesetzt hat – jeden, der ihn nur einmal schief angesehen im Leben …
Ein Raubtier ist in seinem Blut, ein brüllender Panther, ein funkelnder Leopard. Schlägt um sich, rennt mit dem Schädel gegen das Gitter, brüllt und brüllt … Wieder und wieder zuckt zwischen seinen Schreien die kleine Scham des Handlungsgehilfen Peter Petersen in ihm auf, dem dies alles so fremd ist, beängstigend und fern – aber immer wird sie wieder niedergetreten, verbrennt, verlodert sie in den stürmenden Flammen der wilden Seele, die in ihm zu nie geahnt starkem Leben erwacht ist.
Ein scharfes Hupensignal lässt ihn zurückprallen. Um Zentimeterbreite flitzt das Auto mit dem fluchenden Chauffeur an ihm vorbei. Jäh ernüchtert blickt er sich um, sieht den drohend fuchtelnden weißen Handschuh des Verkehrspolizisten, biegt scheu links ab von seinem Weg.
Er schämt sich. Recht wäre ihm geschehen, wenn ihn das Auto überfahren hätte. Diese Gräuel, an die er sich verloren, haben mit dem Leben nichts zu tun. Nur weil sie ihm ganz fremd sind, weil ihm stets geschaudert, wenn er von dergleichen gelesen, hat er sie jetzt zum Halt seiner ziellosen Sehnsüchte gemacht. – Nein, so nicht – so fing er das Leben nicht! Das waren Fieberträume, erzeugt im Hirn eines, der allzu lange gehungert, wenn er auch nie gewusst hat um sein hungerndes Blut. – Träume aber führen nicht in das Leben, sie führen weit weg von ihm. Einen andern, ganz andern Weg muss er gehen, um das zu finden, was er sucht: Erleben, das ihn erfüllt, das ihn ausfüllt, das ihn leben macht.
Sein von Häusern und Bäumen geengter Blick weitet sich wiederum. Die Lombardsbrücke. Unter den grauen Schleiern des jungen Abends liegt stumpf und blank die Binnenalster. Drüben auf dem Jungfernstieg zischen die Bogenlampen auf, fressen sich weißglühend in die matte Dämmerung. Der Alsterpavillon ruht unter dem Licht von tausend Birnen, die seine Fassade umranken. Und Segler auch hier auf dem Wasser, über das gelb der Schein der Laternen huscht, Ruderboote.
Tausendmal in seinem Leben hat Peter Petersen dieses Bild gesehen. Und nie ist ihm seine Schönheit so aufgegangen wie heute, nie hat er sie so mit seinen Sinnen gespürt. Alles ist voll Lockung, alles atmet hundertfältigen Reiz. Selbst die riesigen Geschäftshäuser, die das Ufer der Alster flankieren, stumm und dunkel sich in die hereinbrechende Nacht türmen, verlocken seine Fantasie zu tollen Sprüngen, scheinen ihm voll von tausend Geheimnissen.
Aber wieder fällt störend und weckend ein Mädchenlachen in den Fluss seiner Träume. Aus dem Brückenbogen unter seinen Füßen treibt ein rotes Kanu hervor. Eine junge Frau liegt in den bunten Kissen, schwarzhaarig, großäugig, im weißen Kleid, das ihre von Seide umschmeichelten Beine bis über das Knie hinaus sehen lässt. Peter Petersen sieht auf diese Seidenbeine, und das Blut klopft hart und heiß in seinen Schläfen. Dass ein Mädchen so schön sein kann …
Die Brücke bebt. Die Bremsen des Vorortzuges heulen hinter ihm auf. Peter lässt das Geländer, setzt sich eilig wieder in Bewegung. Er muss weiter, weiter. Das Leben wartet auf ihn, irgendein Erleben, ein alle Sehnsucht erfüllendes Abenteuer. Angst schüttelt ihn, es zu versäumen, es nicht zu erreichen.
Rasch geht er nun dahin, recht wie einer, der sein festes Ziel hat und fürchtet, zu spät zu kommen. Dabei wandern seine Augen gierig hin und her, raffen in heißem Hunger alles Erreichbare an sich. Und jedes Bild glüht hinter den Augen auf in den sinnlichsten Farben. Eine Frau im Pelz und hängendem Schleier. Ein Herr mit braunem scharf geschnittenem Gesicht, in dessen linker Augenhöhle das geschliffene Monokel wie eingehämmert blitzt. Ein dunkelgrünes Auto, als Maskotte einen grimassenschneidenden Affen auf dem glänzenden Nickel des Kühlers. – »Haerlin«, ist hell erleuchtet. Hinter den dünnen Stores gleißt der weiße Damast der Tischtücher auf. Kristall und Silber. Rote Polstermöbel mit weißem Rand. Damen in ausgeschnittenen Kleidern. Gepflegte Haut schimmert. Juwelen brechen in blitzenden Garben das Licht der hundert Lampen. Herren in schwarzen Röcken. Wie helles Herzblut leuchtet der Wein in den geschliffenen Gläsern.
Vor den »Vier Jahreszeiten« hält ein schwerer Packard an. Eine Dame im weichen weitfaltigen Reisemantel entsteigt der schmutzbespritzten Karosserie. Schlägt den Schleier zurück, kommandiert Portier, Chauffeur, Hotelpagen. Hochgewachsen, sehr schlank und braun, Türkise in den Ohren, gelblederne Handschuhe mit weiten Stulpen an den schmalen Fingern. Koffer werden abgeschnallt, in das Haus getragen. Ein Herr im Cutaway naht sich mit tausend Verbeugungen. Der helle, großkarierte Wollmantel verschwindet im marmorschimmernden Vestibül. – Süßer, erregender Hauch der Fremde, lockender Dunst der tausend Abenteuer.
Aber weiter, weiter! Irgendwo wartet die Lust dieser Nacht auf den Knaben Peter Petersen. – Nun hat er den Alsterpavillon erreicht. Weiße Tische und Stühle auf dem Pflaster, grüne Efeuwände. Gespräche in zwei Dutzend Sprachen. Heller Geigensang schwingt aus den geöffneten Fenstern. Buntschillernde Getränke auf den Tischen. Zigarettenrauch wölkt blau auf. Mädchen und Frauen in knappen Kostümen, gepudert, karminrot leuchtende Lippen, glänzende Augen, seidene Haare, seidene Kleider. Männer, die lachend nach ihren Herrlichkeiten greifen.
Hier nicht! In diese Welt passt der schlichte blaue Anzug des kleinen Handlungsgehilfen nicht. Weiter, weiter! – Straßenzüge im aschgrauen Licht des Abends. Bisweilen brandet die Flut einer erleuchteten Auslage über das Pflaster. Eine üppige Schlafzimmereinrichtung. Glitzernde Steine hinter den engen Drahtmaschen des Sicherungsnetzes. Wachsbüsten mit ondulierten Frisuren.
Dann dunkelt zur Seite eine schmale Schlucht. Holpriges Pflaster steigt sacht bergan. Engbrüstige Häuser, handtuchschmale Fußsteige, Unrathaufen in den Rinnsteinen: das Gängeviertel. – Ungezählte Katzen röhren und schreien in der Nacht, ordinäre Gerüche brodeln, aus Kneipen brüllen schmetternde Orchestrions. Und in den engen Türen der zerbröckelnden Hütten lehnen verlorene Frauen.
Peter Petersen nagt verzagt an seiner Unterlippe. Ist hier, ist hier das Leben? Kann er es hier fassen, bei diesen, in diesen namenlosen Mädchen und Frauen? – Soll er – soll er sich eine dieser Frauen kaufen? … Sie sind billig, einen Taler oder auch nur die Hälfte … Leben – leben – oh, das ist Tun, ist Handeln! Irgendetwas muss er tun – warum nicht dieses?! – Er hat seine Reinheit noch, hat sie nicht gerade gehütet bis heute, aber es ist bis heute auch noch niemand gekommen, der sie ihm entrissen, oder dem er sie gern zum Geschenk dargebracht hätte. – Vielleicht gibt ihr Verlust ihm all das, nach dem er sich heute so brennend, so verzehrend sehnt!
Diese Frauen jedoch … Noch ist nicht Nacht, noch kann er sehr deutlich ihre Gesichter sehen, ihre grellbunten, billigen Kleider. – Schrecklich sind diese Gesichter. Elend und Laster haben mit scharfen Griffeln tiefe, gemeine Furchen hineingerissen. Gierige Augen, die in den Rocktaschen der vorüberstreichenden Männer nach Geld spähen. Und die Leiber sind abgegriffen, verbraucht und ordinär …
Ekel fasst Peter Petersen. Nein, das hier ist unmöglich, ist absurd, ist von einer schrill kreischenden, monströsen Hässlichkeit. Wenn verkommene, vertierte Männer zu diesen Frauen gehen – er kann es nicht, dieses nicht. Dann lieber Ilse Müller, die Blonde, Weichhüftige, Spießige, die ihn heiraten möchte.
Er eilt, läuft schließlich, bis er dem übel berüchtigten Viertel entronnen ist. – Weiter! Wieder Straßen, Plätze. Dann rauschen Baumkronen im sanften Abendwind, führt der Weg bergab. Ein Platz öffnet sich. Drüben streckt sich lang und geduckt die Mauer der Landungsbrücken, zeigt die schwarzen Mäuler ihrer Tore …
Über den Platz, durch den dunkelnden Tunnel – und nun auf und ab mit den Menschen auf den knarrenden Brettern des Pontons. – Die Flut drückt in den Strom, schaukelt auf starken Wellen die hundert Fahrzeuge, Motorboote, Pinassen, die Werftfähren, gefüllt mit Arbeitern, die zur Nachtschicht fahren. Von drüben aus den Docks schallt das harte, rasselnde Klopfen der Nieter, die mit Lufthammer und Stemmer Schiffswände ineinanderfügen – tausend Lichter über der Elbe: rot, grün, blau, gelb. Passagierdampfer laufen ein, breite, niedrige Kähne mit schmetternder Blechmusik. Aus Finkenwerder kommen sie, aus Wittenberge, von Cuxhaven. Hundert Meter entfernt liegt die »Cobra« vor Anker, der Helgolanddampfer. Und dort ganz hinten, verschwindend fast im dichter und dichter werdenden Dunkel der hereinbrechenden Nacht, die Lichter der »Cap Polonio«, des luxuriösen Überseeriesen.
Hafen, Brückenkopf der Ferne, Spiegel weiter, schöner, wilder und fremder Welt, Brennpunkt der Sehnsucht, erster Takt im Lied der Abenteuer: Hafen!
Peter Petersen muss sich an einem der Brückenpfeiler halten, so übermannt es ihn. Ein Fischerboot streicht lautlos und schnell an ihm vorbei. Helles Netzwerk glänzt nass auf im gelben Lampenlicht: das merkwürdige Wurfnetz, das breit ausgeworfen wird, um geschlossen, tütenspitz, gefüllt mit zappelndlebendigem Inhalt, wieder emporgewunden zu werden. Wie ein Banner trägt das Boot sein Netz am Bug. – Ein Fischer sein! Ach, nur ein Fisch, lebend im Element, sterbend im Netz, an der Angel! Nur etwas sein, etwas anderes sein als Peter Petersen, Handlungsgehilfe bei Wilkens & Companie, Hamburg-Raboisen, Häute-Import …
Wiederum jedoch schreckt ihn ein Mädchenlachen aus seiner Versunkenheit. Es gilt nicht ihm. Zwei kleine Ladnerinnen lachen über irgendetwas, das sie komisch finden. Aber den von seiner Sehnsucht zerquälten Jüngling treibt dieses Lachen, das ihn zu verfolgen scheint, in noch größere Erregung – und treibt ihn davon.
Zurück auf demselben Weg, den er gekommen. Nun hat er den Rhythmus des Hafens im Blut, der großen Stadt. Alles ist Strom, von Lichtern überschmeichelt, alles ist Welle, ist Bewegung, ist Leben. Was ist er? Nichts! Treibholz vielleicht – nein, weniger noch: Stein auf dem Grunde, bewegungslos, trockener Kern in all der strömenden Flut.
Er ballt die Fäuste, gräbt die Nägel tief in das Fleisch der Handflächen, zernagt die Lippen. Wann kommt es ihm: das weckende Erleben, das große Abenteuer, das süß und zärtlich in sein Blut geht und darin verharrt? – Menschenleer die Straßen, erschöpft lehnt er sich an den Mast einer Straßenlaterne, zum Umfallen, zum Sterben müde. Tränen kommen ihm.
Ein schneller, elastischer Schritt. Hart klappen Stöckelabsätze gegen das Pflaster. Zart weht ein Duft über ihn hin, eine schöne Frau streicht vorbei mit raschem Seitenblick. Ganz in Weiß. Weiß sind Schuhe, Strümpfe, Kleid, Hut, Handschuh. Weiß und seiden das plissierte Cape, das ihr weich im kaum spürbaren Wind nachweht. Dunkle Haarwellen drängen unter der runden Toque hervor. Und ihr Parfüm ist wie der Duft der Syringen am Alsterufer …
Den Müden belegt jäh straffste Energie. Ist dieser Duft nicht eine Mahnung? Diese Frau gibt ihm das Leben, damit er leben lernen soll. Diese Frau ist Anfang und Erfüllung. In den seidenen Falten ihres Capes, im geschmeidigen Rhythmus ihres Schrittes schlummern tausend Abenteuer, warten auf ihn. Diese Frau … Er denkt nicht weiter, er hat genug geträumt an diesem Abend, er springt ihr nach. Rasch hat er sie eingeholt, reißt den Hut an ihrer Seite, spricht – irgendwelche Phrasen, die er aus irgendwelchen Büchern weiß.
Die schöne Frau bleibt stehen, wendet sich ihm zu, der mit gezogenem Hut wie ein Bettler vor ihr steht. Dunkelste Augen, blass das Gesicht, kühn die Bogen der Brauen, schmaler, stolzer Nasenrücken, ein herrischer Zug um den leicht geschminkten Mund. – Peter Petersen zittern die Knie. So schön ist diese Frau! Er schämt sich, und Furcht ist in ihm. Und doch hat er das selige Wissen: Sie nimmt ihn an, sie nimmt ihn gnädig auf.
Da lacht die schöne Frau, belustigt, spöttisch, mit einem deutlichen Unterton von Mitleid: »Sie? – Sie kleiner, dummer Junge!«
Peter Petersen prallt zurück wie gestoßen. Das – das ihm? Nun singt sein Blut nicht mehr von Sehnsucht und Abenteuer, nun kreischt es auf in irrem Hass. Rote schwirrende Kreise vor seinen Augen, violettes Flimmern, von purpurnen Blitzen zerstückt – und blass und unaussprechlich schön darin das hohnlachende, verächtliche mitleidige Gesicht der Frau im weißen Seidencape.
Nein, er duckt sich nicht, nimmt die Niederlage nicht hin wie Prügel in der Schule. – Wut, Hass, Rachgier zischen auf in ihm, reißen seine Arme hoch. Weit holt er aus – und dann schlägt er mit ganzer Kraft seine volle Hand in das schöne Gesicht, auf dem das Lächeln jäh erstirbt.
Etwas stürzt zu Boden, etwas schreit grell in die Nacht. Irgendetwas Weißes bäumt sich zu seinen Füßen. Von fern nähern sich die schnellen Schritte laufender Menschen.
Da springt Peter Petersen über die schöne Frau, die er niedergeschlagen, springt über ihren Schrei hinweg in das Dunkel der abendlichen Büsche, das ihn birgt und entkommen lässt.
Zirkus
- 2 -
Auf der Reeperbahn fängt er sich wieder ein: dumpfen Wirbel im Hirn, das keinen Gedanken zu halten vermag. Zittern in allen Gliedern, weiche Schwäche in den Kniekehlen und ein schnürendes, leeres Gefühl in der Magengegend. Es dauert lange, bis er sich wieder zurechtgefunden, bis er weiß, dass er sich im abendlichen Sankt Pauli befindet. Dann lässt er sich langsam treiben im Strom der flanierenden Menschen.
Aber er bleibt abwesend und seltsam benommen. Immer noch zuckt sein Körper in der brutalen und gemeinen Geste des Schlages, immer noch fühlt er in der Handfläche die weiche Wärme des schönen Frauengesichts. Immer wieder hört er den Schrei, sieht er die weiße seidene Frau auf dem Pflaster zu seinen Füßen. Und immer wieder rennt – ein erstickend heißer, ein tötend kalter Strom – die Scham durch seinen Leib.
Er rafft sich gewaltsam zusammen, zwingt sich, nicht mehr zu denken an die Szene, die vergessen sein soll, gibt sich gierig den Bildern des Vergnügungsviertels hin.
Bäume rauschen, Autos hupen, Radfahrer flitzen lautlos – polternd, knatternd ein Motorrad. Ein junges Mädchen auf dem Rücksitz, die verschnittenen Haare wehen ihr nach, das Licht der Bogenlampen schmeichelt ihren geöffneten Knien.
Frauen an den Häuserwänden, dick geschminkt, im wiegenden Schlenkerschritt die Handtaschen schwenkend. Ein Trupp Chinesen: kleine, schmächtige Gestalten, Schlitzaugen, junge gelbe Gesichter. Weite blaue Leinenanzüge tragen sie, europäische Hüte, doppelsohlige Schuhe. Ein Farbiger, von Kopf bis zu den Füßen schreiende Konfektionseleganz von vorvorgestern, dreht sein Stöckchen, sieht grinsend einer hochgeschürzten Kokotte nach, summt: »Louisiana – Louisiana – Louisiana – Lou!« Matrosen mit braunen, nach Alkohol und Frauen hungrigen Gesichtern. Spießer, würdig ihre vom Bier aufgeschwemmten Bäuche vor sich hertragend. Verwegen aufgeputzte junge Mädchen, geschniegelte Jünglinge mit drolligen Lebemannsallüren.
Operettenhaus, Panoptikum, unzählbare Kinos, Frühstücksstuben, Singspielhallen, Bierlokale, Kneipen, Kaschemmen. Drüben, die andere Seite, ist vornehmer: Bürgerliche Cafés, Kabaretts, der »Alkazar«. Aber dann auch ein wilder Hexensabbat von Lokalen, hinleitend zum irren Vergnügungstaumel der »Großen Freiheit«.
Peter Petersen bleibt stehen, wendet sich mit hartem Entschluss. Nein, er will das nicht, dieses nicht. Hier ist alles gemein, weil hier alles käuflich ist. Und er weiß: das Abenteuer, das ihm das Tor zum Leben öffnen soll, das ist nicht käuflich, darf, kann nicht käuflich sein.
Fast eilig geht er zurück. Für einen Augenblick lockt ihn ein Film, den ein Kino mit schreienden Plakaten ankündigt. Aber dann geht er mit geducktem Kopf weiter. Nein, auch das nicht! Das ist Altes, längst Bekanntes. So sehr gut kennt er es: durch Stunden auf dem Klappsitz, im Dunkeln, allein im Geflüster, Getuschel, Papierrascheln ringsum. Die flirrenden Bilder fesseln, interessieren – und schläfern langsam ein. Zwei Tage erinnert man sich noch, entsinnt sich des Bruchstücks einer Handlung, der Geste eines Frackherrn, des Augenzwinkerns der Diva. Und dann ist alles tot – und nie wieder denkt man an das Geschehene zurück.
Räderknarren, müder Hufschlag eines Pferdes, klingelnde Glöckchen. Peter Petersen wendet sich: ein Reklamewagen kommt im langsamen Zockeltrott daher. Bemalte Leinenwände, von innen erleuchtet. Fußhohe Buchstaben: »Zirkus Kaiser! Größte Schaustellung Europas! Zwei Manegen, eine Bühne, eine Rennbahn! Dreihundert Artisten! Fünfhundert exotische Tiere! Jeden Abend von acht bis elfeinhalb Uhr!«
Das Pferdchen ist fantastisch aufgeputzt, der Kutscher trägt einen breiten Schlapphut und die Fellhosen der Cowboys. Und das Wort Zirkus hat einen märchentiefen, zauberhaft starken Glanz …
Peter Petersen sieht rasch auf seine Nickeluhr: halb neun, das Spiel hat längst begonnen. Aber das macht ja nichts – es geht doch bis halb zwölf! Das sind noch fast drei volle Stunden …
Schon springt er über den Fahrdamm, eilt am Millerntor vorüber, und dann leuchtet ihm – mystischer Märchenberg, von innen erleuchtet und von tausend Lampen festlich umkränzt, leise bebend im schwachen Abendwind – das zweikuppelige Zirkuszelt entgegen.
Eine lichtüberladene Fassade. Spaziergänger stehen davor und bekritteln die im Halbrelief wiedergegebenen Figuren fremder, wilder Tiere. Musik bricht durch das dünne Zelt, Lärmen, Peitschenknall, Händeklatschen – vor dem Zirkuszaun steht ein großer, schwer gepanzerter Wagen. »Cassa«, leuchtet ein gläsernes Schild von seinem Dach. Ein Schalter ist noch offen und erleuchtet, Peter Petersen bekommt sein Billett, fasst das Papierstückchen, steckt das erhaltene Wechselgeld achtlos in die Hosentasche, treibt durch die Sperre, schlägt den roten Plüschvorhang zurück – und ist in einer zaubervoll fremden Welt.
Es steht in einer tiefen Schlucht. Links und rechts türmen sich die Sitzreihen bis hoch an den Rand der leinenen Wände, laufen spitz zu gegen die Mitte des Riesenraumes. Stangen, Maste, Versteifungen, Seile überall – und das wahnsinnsstarke Licht ungezählter Jupiterlampen. Dazu rast eine wilde Kapelle Synkopen.
Und durch das Wirrsal der gespannten Taue fliegt ein Chinese im leuchtend bunten Gauklerkostüm, rotierende Papierschirme in den Händen, lustig kreischend. Aufgehängt am Zopf, der ein Rädchen hält am Ende – das surrt über das schräg die Arena durchquerende Drahtseil.
Dann aber stürzt von irgendwoher ein Farbiger auf Peter Petersen zu, sehr groß und breitschultrig, im grünen langschößigen, üppig mit Gold verschnürten Paraderock – nimmt ihm die Karte ab, zerreißt sie, drückt ihm den einen Fetzen wieder in die Hand, führt ihn zu seinem Platz.
Peter setzt sich still, nimmt sich keine Zeit, die Umgebung zu mustern, ist bereits gebannt von dem Spiel in den beiden Manegen. In dem einen großen gelben Sandrondell liegt ein Chinese auf dem Rücken, streckt die nackten Fußsohlen nach oben, die halten einen endlos langen, starken Bambusstab. Und an jedem Ende dieser Stange hängt ein Körbchen, und in jedem Körbchen sitzt ein kleines gelbes Chinesenkind. Nun setzt der Mann langsam die Stange in Bewegung, sie dreht sich zuerst träge, rasch und rascher dann, bis sie endlich pfeifend schnell über seinen nackten Fußsohlen rotiert. Und die kleinen gelben Kinder lachen vergnügt aus ihren schräg geneigten Körbchen, werfen zärtlich vergnügte Kusshändchen in das Publikum.
In der anderen Manege ein noch gefährlicheres Spiel. Dort stellt ein Chinese einen starken Holzreifen auf, steckt drei Dutzend scharfe Messer hindurch, lange, starke, geschliffen spitze Messer. Ein Kreis von knapp einem halben Meter Durchmesser bleibt in der Mitte. Der Chinese tritt zurück, wirft den Kimono ab – knochig und sehr hager ist seine Figur im grasgrünen Trikot – schlägt Rad und Purzelbaum auf der Erde, übermütig wie ein spielender Bengel, dreht Flic-Flac und Salto und ist dann mitten aus dem tollen Gliedergewirbel heraus mit einem eleganten Schwung durch den engen Kreis der gefährlich starrenden Messer gesetzt.
Auf der Bühne – rotsamtenes Podium zwischen den beiden Manegen – agiert ein malabarischer Taschenspieler. Lässt aus einem Blumentopf ein Magnolienbäumchen wachsen bis zur Manneshöhe, lockt grüne Blätter hervor und süße, schimmernde Blüten. – Stellt dann eine lange Bambusstange vor sich, klettert daran hinauf, legt sich mit dem Leib auf die sich krümmende Spitze – und dreht sich schnell wie ein Propeller. Dabei schraubt er sich an der Stange auf und ab, jeder in der großen Menge ringsum sieht, dass der Bambus ihm oft halbmeterlang aus dem Rücken ragt, Sonnenschirme streuen seine Hände, bunte Fächer, Blumen und flatternde Tauben …
Dann ist der bunte Spuk mit einem Schlage wie weggewischt. Uniformierte Diener springen, harken den gelben Sand – und schon stampfen Elefantenherden in die beiden von rotem Plüsch gesäumten Ringe. Sie stellen sich auf die Hinterbeine, drehen sich im Walzertakt, langsam, plump – und doch überwältigend grandios. Einer packt den Dompteur mit dem Rüssel, reißt ihn hoch in die Luft, setzt ihn behutsam, zärtlich fast, auf seinen Nacken. Holt ihn wieder herunter, stellt ihn sacht auf den Sand, dankt mit schwänzelndem Rüssel für den Beifall ringsum. Dann bauen sie komplizierte Pyramiden, schreiten vorsichtig über den lang im Sand liegenden Dresseur, kauern sich über ihn, dass er vollkommen verschwindet unter ihren Fleischgebirgen, krümmen ihm kein Härchen dabei. Und verschwinden, wie sie gekommen sind: stampfend, leise schaukelnd, mit hochgerecktem Rüssel.
Wieder die harkenden Diener – und dann prescht mit Geschrei und Pistolenschüssen eine Horde tscherkessischer Reiter herein. Männer und Frauen im gleichen fantastischen Kostüm: Juchten-Stiefel, weite schwarze Kniehosen, die Tscherkesska unter langschößigem Rock, den Kinschal an der Hüfte, die große Pelzmütze, der weiße, flatternde Mantel. – Keinen Augenblick der Ruhe. Geschrei und rasendes Tempo. Sie reiten wild und mit unvergleichlichem Elan: jetzt gestreckt auf dem Sattel stehend, nun unter den Pferdebäuchen hängend, dann im Sand schleifend. Zeigen ihre Künste im Schießen, im Werfen der nadelspitzen Dolche. Lassen Pulvergeruch hinter sich, zerwühlten Sand und den Schrecken eines mörderischen Lärms. Noch denkt Peter Petersen an die volle Brust der einen schönen Reiterin, die schwer wie reife Früchte aus dem knappen Rock drängte – da ist der Sand voll von Clowns.
Lange, grotesk magere Gestalten, kleine von monströser Korpulenz. Keinem passen die Kleider. Die Großen treten sich auf die Schöße ihrer Fräcke, und den Kleinen sitzen die Taillenknöpfe dicht unter den Ärmeln. Die Gesichter sind toll geschminkt: grellweiße Backen, glühend rote Nasen, tiefschwarze Augenhöhlen. Sie prügeln sich. Die Ohrfeigen knallen laut wie Kanonenschläge, und jeder Schlag wirft den Getroffenen auf den Hintern, lässt seine Beine hilflos in der Luft rudern. Einer trägt eine dreifach gezipfelte brandrote Perücke, auf dem mittelsten Schopf sitzt ein knallgelber Kanarienvogel und flötet den letzten Gassenhauer. Sehr ängstlich behütet der Rothaarige seinen Vogel, dem die andern bösen Buben mit allen Listen und großer Gemeinheit nachstellen. Einer klettert eine Trittleiter hinauf, vorsichtig einen vollen Eimer Wasser balancierend. Auf der anderen Seite fällt er herunter. Aber der ihm diesen Streich spielte, freut sich zu früh: er bekommt den Inhalt des Eimers über den Kopf. – Melancholisch stolpert ein Chaplin durch dieses wüste Treiben, dreht sein Stöckchen und purzelt mit beseeltem Augenaufschlag graziös über alle ihm gestellten Beine.
Dann entweicht die ganze Horde schreiend in wilder Flucht. – In würdevoller Prozession kommen die Sioux-Indianer hereingezogen. Bunter Federschmuck, lautlos schreitende Mokassins, blitzende Tomahawks, besticktes Lederzeug. Der Häuptling an der Spitze, die Unterhäuptlinge hinter ihm, die Krieger dann, die Frauen endlich. Zum Schluss die Kinder. Ein rechter Dreikäsehoch – man sieht an dem reichen Schmuck, dass er der Kronprinz, der Sohn des Häuptlings ist – reckt frech seine Zunge, so weit es nur gehen mag, gegen das Publikum. Der Vater sieht es, grinst stolz und zufrieden – und aus der Menge kreischt es vor Vergnügen.
Die Indianer lagern sich, zünden ein Feuer an. Da zeigt sich ein Weißer im Hintergrund, ein Cowboy, der mit gespannter Büchse anschleicht. Jäher, ohrenzerreißender Lärm, Tohuwabohu, aus dem Pfeile flitzen, Lassos schwirren. Der Trapper, jäh gefesselt, wird über die Erde geschleift. Kriegstänze nach der simplen, hämmernden Melodie des untergegangenen Stammes. Dann binden sie den Gefangenen an den Marterpfahl und zeigen ihre Kunstfertigkeit mit dem Tomahawk. Zum Schluss skalpiert der Häuptling den jämmerlich winselnden Cowboy. – Aber schon brechen einige Dutzend anderer Blassgesichter herein, seinen Tod blutig zu rächen. Geschrei, Schüsse, Kampf, an dem sich auch die Frauen beteiligen und alle Kinder. Der Sioux-Kronprinz hat einen Dolch, doch der ist aus Holz und sehr stumpf. Aber mit strahlendem Gesicht zieht er eine Stecknadel aus seinem Wams – und mit der sticht er einen wildbehaarten Cowboy, der gerade einen Sioux-Krieger niedergeworfen hat und ihm das Messer durch die Kehle zieht, sticht ihm derb ins Sitzfleisch, dass der herkulische Mann schreiend aufspringt und den kleinen, längst fortgesprungenen Indianerjungen einen »Lausebengel«, nach dem andern schimpft – die heitere Täuschung des erregenden Spieles damit wiederherstellend … Die Sioux unterliegen. Leichen besäen die Walstatt. Im Triumph ziehen die Sieger mit den Gefangenen ab. Die Toten liegen unbeweglich – bis die Diener mit den Harken kommen. Da springen sie schnell auf, stecken grinsend den Applaus ein, verschwinden.
Pause. – Die Musik schweigt. Dem Auge sind jäh die wirren und überbunten Bilder entzogen. Peter Petersen besinnt sich, wo er ist, was ihn bewegt. Und nun ist vor seinen Augen wieder das schöne, spöttisch-hochmütige Gesicht der Frau, die er niedergeschlagen hat. – Er will nicht daran denken, will nicht. Aber selbst das eilig gekaufte Programm lenkt ihn nicht ab. So lässt er das Blatt sinken, sieht sich um im Zirkus.
Schöne Frauen in den Logen, die sommerlich hellen Pelze locker umgehängt. Frauen und Mädchen auch überall auf den Bänken der anderen Plätze. Männer wohl auch, o ja, aber Peter Petersen sieht nur die Frauen … Und jetzt denkt sein Hirn klar das, was er dunkel gefühlt: am Alsterpavillon, der Frau im Seidencape gegenüber, auf der Reeperbahn. Spricht sein Mund fast laut hinaus den uralten, den schamlosen Gedanken aller verwirrten jungen Männer: »So viele schöne Frauen, so viele – und nicht eine, nicht eine einzige für mich!«
Das also – das also soll es sein, was sein Blut aufgewühlt hat heute? Was ihn in diese süße, verzehrende Verwirrung geschleudert? Was seine Wünsche ins Maßlose gesteigert und ihn zu einer verabscheuungswürdigen Tat getrieben hat? Soll nicht mehr sein als die heiße Sucht nach einer Frau?
Neues Leben in den beiden Manegen. Die Diener tragen Gitter herein, schlagen sie auf, befestigen sie, verwandeln die gelben Sandkreise in feste Käfige. Die Musik fällt jubelnd ein. Durch die niederen Laufgänge preschen Bestien herein: zwölf Löwen springen in die eine Manege, zwölf Tiger betreten die andere.
Die Löwen locken Peter Petersen wenig. Irgendwo hat er gelesen, dass der Wüstenkönig feige ist und sehr verfressen. Aber die Tiger scheinen ihm über alle Beschreibung schön. Das Gold ihres Felles, die samtschwarzen Streifen darin, das Weiß des Bauches, der kurzen Halskrause, das brennende Rot des geöffneten Rachens …
Ein Uniformierter tritt rasch durch die doppelt gesicherte Tür zu ihnen in die Arena, lässt die Peitsche knallen, treibt die Säumigen mit dem Stachel an der langen Holzstange. Sie brüllen, fauchen und sitzen dann doch artig auf ihren Plätzen, rings am Gitter der Manege. Einer tritt vor aus dem Halbkreis, beklettert fauchend eine große Kugel, die im gelben Sand liegt, der Bändiger knallt und knallt mit der Peitsche, der Tiger brüllt und faucht – und setzt die Kugel in Bewegung, lässt sie quer durch die Arena rollen, bleibt oben, bewahrt sicher sein Gleichgewicht. Ein Fleischstückchen bekommt er am Stachel gereicht – zur Belohnung. Er schlingt es gierig, faucht noch einmal, kehrt schnell auf seinen Platz zurück, brüllt dann wütend.
Andere zeigen ihre Künste, springen durch papierverklebte und durch brennende Reifen, bauen Pyramiden. Jede ihrer Bewegungen ist vollendet, schön, graziös, elegant. Sie fauchen, brüllen – und der strenge Dunst ihrer Leiber füllt die weite Zirkushalle. Berückend schön, berauschend gefährlich: Peter Petersen fühlt, dass in diesen Tieren ein heißeres Leben ist, ungeheure Möglichkeiten, nie geahnte Erfüllungen. Ein Tiger sein! – Gewiss nicht in der Gefangenschaft, nein, in, der Freiheit der Dschungel … Die Bilder verschleiern sich, Peter Petersen träumt von dem Duft, dem Glanz und dem Farbenrausch tropischer Ferne. – Aber wie er sich wieder zusammenreißt, fühlend, dass er eine schöne Wirklichkeit ungenossen verstreichen lässt, ist die Piece auch schon zu Ende, gleiten die Raubkatzen rasch und geschmeidig durch den engen Laufgang hinaus, und der Dompteur verbeugt sich wieder und wieder vor dem begeistert applaudierenden Publikum.
Abgerichtete Eisbären folgen. Sie sind weiß und drollig, laufen auf den Kugeln, schaukeln sich, gehen sicher über aufgestellte Flaschen – aber was bedeuten ihre zottigen Felle gegen die wilde Schönheit der verschwundenen Tiger?
Dann reiten Herren im Frack und Zylinder edle Pferde in allen Gangarten der Hohen Schule, lassen sie steigen und tanzen, wundervoll schreiten und anmutig chaussieren.
Artisten folgen ihnen. Flirrender Leiberwirbel hebt an unter der Zirkuskuppel. Schlanke, muskulöse Gestalten in leuchtenden Trikots fliegen beherrscht und sicher von Trapez zu Trapez, zwanzig Meter über dem Sand der Manege. Die Musik schweigt, nur das »Eh!«, und »Ole!«, der springenden Männer und Frauen zischt messerscharf durch das angstvolle, atemlose Schweigen.
Langsam besteigt eine schöne Frau im brokatenen Abendmantel den blutroten Samt der Bühne. Lässt das Cape zu Boden gleiten, breitet lächelnd die weißen Arme nach allen Seiten. Schön und schlank im sehr eleganten Abendkleid, gepudert, geschminkt und eine große weiße Perücke auf dem Kopf. Ein Strick senkt sich auf sie herab. Diener befestigen einen kleinen, birnenförmigen Knebel an einem Karabinerhaken. Sorgsam prüft die schöne Frau die Vorrichtung auf ihre Festigkeit. Dann nimmt sie das helle Leder der Birne in den Mund, beißt fest die Zähne übereinander. Breitet die Arme aus – da legen die Diener sich in die Winde. Langsam schwebt die Frau in die Höhe … An den Bogenlampen vorbei, an Seilen und Sparren, an den Rahmen der Trapeze, hinauf bis in die äußerste Spitze der Kuppel.
Dort hängt sie still, dreht sich nur halb um sich selbst, wieder und wieder, hin und zurück, eins mit dem Seil, weit ausgebreitet die Arme. Peter Petersen wirft einen raschen Blick in die Mittelspalte des Programms. »Madame Fernande!«, liest er. »Die schwebende Dame unter der Zirkuskuppel. Unerreichte Zahnequilibristin!«
Wie er wieder den Kopf hebt, sieht er sie das Abendkleid abstreifen. Weich und seiden flattert es herab. Dessous folgen. Wie die schwebende Frau endlich nach den Achselbändern der Kombination greift, kichern rings die Mädchen, starren die Männer belustigt und gespannt. Der zartrosa Seidenglanz gleitet über die schönen Beine, schwebt zu Boden. Im smaragdgrünen Trikot hängt da oben die schöne Frau, wie eine seidene Haut legt es sich über die schönen und edlen Linien des vollendeten Körpers. Schillernd grüne Seide und die weiße Perücke. Und nur ein blauer Farbfleck noch am Ausschnitt: ein kleiner Veilchenstrauß. Den löst die Hängende mit rascher Hand, schleudert ihn hinein in das Publikum – und Peter Petersen fängt ihn, ganz jubelndes Glück über das köstliche Geschenk des Augenblicks.
Der Wurf ist Signal gewesen: sehr schnell lassen die Diener die Frau nun wieder herab. Einer legt ihr den Brokatmantel über die Schultern, sie rafft ihn eng zusammen, neigt sich viele Male vor dem lärmenden Publikum, hochrot unter der Schminke. Schlüpft dann mit den anderen Artisten schnell hinaus, und ein Uniformierter trägt ihr die Kleider nach.
Nun erst kommt Peter Petersen dazu, mit beglückten Augen den kleinen Blumenstrauß in seinen Händen zu betrachten. Er hebt ihn gegen sein Gesicht, sieht dann verwundert auf die blauen Blüten. Sie duften nicht, nicht nach Veilchen – der Duft von Syringen ist an ihnen. Er dreht und wendet das Bukett. Gold blitzt auf: eine Nadel hält die blassen Stängel zusammen, eine schmale, zierliche Spange mit drei wasserklaren Steinen auf dem gewölbten Rücken.
Er fühlt es im Augenblick: Das wollte die schöne Frau nicht, das ist für sie ein Verlust, der sie betrüben wird. Und dann durchzuckt es ihn schon: Er wird ihr die Spange zurückbringen! Seligkeit, sich der Schönen, Fremden, Fernen nähern zu dürfen! Die Künstlerin, an der eben zehntausend Augen gehangen haben, wird mit ihm sprechen, mit ihm, Peter Petersen!
Schon ist er von seinem Platz. In der Manege produzieren sich jetzt indische Gaukler, schöne Schlangentänzerinnen – er achtet mit keinem Blick auf ihre Künste. Nur ein Gedanke brennt in seinem Blut: Madame Fernande!
Die Menschen rings sehen ihn erstaunt an. Der goldüberladene Farbige am Eingang mustert ihn mit offensichtlicher Befremdung. Peter tritt rasch auf ihn zu, reckt ihm die Nadel entgegen, stottert zuerst, fasst sich dann, wie er das Grinsen auf dem Gesicht sieht, spricht schnell und glatt.
Der Farbige streckt die Hand aus, aber Peter gibt die Nadel nicht. Nein, er will sie der Dame selbst überreichen! Da geht der Uniformierte voran, fordert ihn auf, ihm zu folgen. Spießrutenlaufen durch den halben Zirkus, bis ihn endlich auf der anderen Seite der Eingang zu den Ställen schützend aufnimmt. Der Farbige geht sehr schnell. Peter hat alle Mühe, ihm zu folgen. Dabei sieht er links und rechts in eine unerhört neue, fremde, verwirrende Welt.
Artisten im Trikot, Ballettmädchen, Tierwärter in schmutzigen Drillichjacken. Inder, Indianer, Jockeys, die Pferde am Zügel. Und dann die endlose Reihe der Ställe. Der Panzer eines Flusspferdes glänzt nass in der überstarken Beleuchtung. Eine Schlange klebt am feucht beschlagenen Fensterglas, Bären hinter Gittern, verschlafen an ihren Pfoten schmatzend. Löwen, zusammengerollt in der braunen Torfstreu, mit blinzelnden Augen. Ein großer, starker Tiger wirft sich nervös gegen die Eisenstäbe, faucht die Vorübergehenden wütend an. Weiße muskelbepackte Kampfstiere, Messingkugeln auf den Spitzen ihrer weit ausladenden, hohen Hörner. Pferde und wieder Pferde. Schwarzweiß, leuchtend und gepflegt, zierliche Zebras. Giraffen sehen neugierig über hohe Holzgatter. Die grauen Schiefergebirge der Elefanten. Schwüler Dunst und ein gellend scharfer Geruch.
Dann reißt der Farbige irgendwo die Leinwand in die Höhe, Peter stolpert in die klare Nachtluft, muss sich nun fast an den Rock des Führers klammern, um ihn nicht zu verlieren. Kreuz und quer durch die Burg der Zirkuswagen. Dunkel – Wenig erleuchtete Jalousien. Offen stehende Garderobentüren. Gruben und Löcher in der Ede, Eisenpfähle. Am tiefdunklen Nachthimmel funkeln die Sterne.
»Hier!«, sagt der Schwarze, »einen Moment!«, springt eine schräge, niedere Treppe hinauf, klopft an die Tür eines erleuchteten Wagens. »Ja?«, antwortet zögernd von innen eine weiche Frauenstimme. Der Farbige öffnet die Tür einen Spalt, schiebt seinen Kopf hindurch: »Hier ist ein junger Mann, Madame, der sagt, eine Brosche sei an Ihrem Veilchenstrauß gewesen. Er will sie Ihnen nur persönlich abgeben!«
Peter wundert sich, wie fließend der Farbige deutsch spricht und findet es überaus komisch, dass der Schwarze noch dazu stark sächselt.
Drinnen ist eine Weile Stille. Peter fühlt fast körperlich, wie die schöne Frau nach ihrem Brustausschnitt tastet, die Nadel nicht findet …
»Aber ja!«, sagt nun sehr hell die weiche Stimme. »Ja, das ist wahr! Wie nett von dem Herrn! Lassen Sie ihn eintreten, Bob!«
Der Farbige fasst Peter am Ärmel, zieht ihn die Stufen hinauf, schiebt ihn in den Wagen, schließt von außen die Tür hinter ihm.
Peter sieht nichts von der Einrichtung in dem schmalen Raum, sieht nur die Frau. Sie hat noch den Brokatmantel über den Schultern, steht halb abgewandt, nimmt vorsichtig die weiße Perücke von dem schwarzen gescheitelten Haar, setzt sie vor sich auf den Garderobentisch, wendet sich ihm dann lebhaft zu: »Ich finde es wirklich ganz reizend …« Sie bricht ab, das süße Lächeln auf dem geschminkten Gesicht erstirbt, die dunklen Augen weiten sich im überrumpelnd jähen Schrecken. Der Mantel sinkt zu Boden, sie weicht zurück, verfängt sich in seinen Falten, fällt auf einen Stuhl, streckt abwehrend die Hände gegen ihn aus, stöhnt: »Sie … Sie …«
Hinter ihr, an der Wand, leuchtet seiden ein plissiertes, weißes beschmutztes Cape. Peter Petersen erstarrt im namenlosen Schreck: die Artistin ist die Frau, der er ins Gesicht geschlagen! – Einen Augenblick wünscht er sich zum Erdmittelpunkt in bohrender Scham, dann aber kommt eine harte, mannhafte Entschlossenheit über ihn. Er tritt vor, legt die Nadel auf den Tisch neben die weiße Perücke. Wie er zurücktritt, steht die Frau hart vor ihm: »Sie haben mich geschlagen!«
»Ja«, sagt er kurz. – »Warum? Warum? Wie kamen Sie dazu?«, faucht sie, wutbebend, ihre Finger in die Aufschläge seines Rockes krallend. – Er sieht in das Schwarz ihrer Augen. Die sind trotz des verzehrenden Zornes weich und tief. Sind dunkel wie eine sternenlose Nacht, in die man seine Sehnsucht verschluchzt.
Da spricht Peter Petersen, spricht hinein in diese guten, weisen Augen, die weicher und weicher werden unter seinen Worten. Sagt, wer er ist, wer er war bis heute. Und spricht von dem Duft der Syringen, der Schlafendes in ihm weckte. Spricht von den Visionen des Lebens, die sein Hirn so jäh durchrauschten, von der qualvollen Verwirrung, in die ihn die Sehnsucht nach Leben und Abenteuer geschleudert. Er fühlt, dass er gut spricht. Kein kleinstes Geheimnis hat er vor diesen klugen, dunklen Augen. Die weißen Hände geben ihn frei, die Frau tritt zurück, lehnt an der Kante des Tisches. So schön, so wunderbar schön in dem glänzend grünen Trikot. Und ihre Augen sind sehr weich nun, voll Verstehen, und Mitleid wacht zart in ihnen. – Peter bittet um Verzeihung und neigt den Kopf, sein Urteil zu erwarten.
Kein Laut. Dann sagt eine tiefe, starke Bassstimme: »Bravo, junger Mann!« Entsetzt schnellt Peter hoch, sieht sich um. Ein Mann im gleichen Raum! Ein Fremder, vor dem er sich entblößt hat! Nur zu dieser Frau hat er gesprochen, irgendetwas bindet ihn mit ihr, macht sie ihm vertraut und verwandt. Kein Dritter aber hatte das Recht, seine Beichte anzuhören! – Hinter einer spanischen Wand sehen zwei derbe braune Schnürstiefel hervor. Mit einem Sprung ist Peter bei ihnen. Da sitzt ein großer, breitschultriger blonder Mann auf einem Hocker, stopft sich gemächlich seine Shagpfeife, sieht ihn lachend an mit gesundem schnurrbärtigem Gesicht …«
»Wie können Sie sich erdreisten?«, dringt Peter auf ihn ein …
»Entschuldigen Sie man gütigst!«, lacht der Blonde. »Ich bin nur der Mann von Madame Fernande!«
Die stimmt lustig ein in sein Lachen, stellt mit betonter Fröhlichkeit vor: »Herr Peter Petersen, ein ziemlich aggressiver Kavalier– Herr Fred Martini, Dompteur, mein Mann!« – Peter hat bereits den Tigerbändiger erkannt. Scham und Trotz quirlen in ihm.
Der Blonde erhebt sich, streckt ihm die Hand hin: »Freut mich sehr, Herr Petersen, Sie kennenzulernen. Eigentlich hatte ich mir ja geschworen, Ihnen die Knochen zu brechen. Nun freue ich mich, dass ich Ihnen zugehört habe. Genauso hab ich auch mal gesprochen – vor zwanzig Jahren, vor meinem Vater, dem ich zehn Mark gemopst hatte, um ins Bordell gehen zu können. Mein Gott, ich denke heute noch an die Senge, die ich da gekriegt habe. – Aber hören Sie mal zu: vielleicht kann ich Ihnen helfen! Sie sind gerade gewachsen, haben Muskeln und Courage – ich könnte Sie gebrauchen. Mein Assistent hat sich hier festgeliebt. Irgendeine kleine Köchin, mit ihren Ersparnissen wollen sie einen Grünkramladen aufmachen. Meinetwegen, er war schon immer ein Kohlkopf. – Wollen Sie einspringen für ihn? Ich zahle – was kriegen Sie eigentlich bei Ihrem Lederfritzen? Hundertachtzig Mark? – Na, ich zahle Ihnen dreihundert für den Anfang. Aber mindestens die erste Zeit müssen Sie im Wagen schlafen. Ich mag das nicht mehr, wissen Sie, ich brauche Platz. Und da für alle Eventualitäten immer ein Dresseur auch nachts bei den Viechern sein soll, werden Sie derjenige sein, welcher! – Aber ich nehme Sie nur mit väterlicher Einwilligung, verstehen Sie? Bis zum Monatsletzten haben Sie Zeit. Wollen Sie? Sie sehen etwas von der Welt, abenteuerlich ist’s vielleicht auch– aber arbeiten müssen Sie wie noch nie in Ihrem Leben, das sage ich Ihnen gleich! Hier ist meine Hand – wie ist das nun?!«
Peter Petersen ist ein Knabe. Die große Russenschaukel dreht sich, schnürt ihm die Eingeweide, presst seinen Magen in die Kniekehlen, lässt sein Gehirn rotieren – und sein Herz schreien vor Glück. Zirkusleben – die Tiger – die schönen Tiger – Madame Fernande, die schönste Frau – Reisen – von Stadt zu Stadt – Zirkus … Herrgott, dieses unglaubliche Glück!!!! Mit beiden Händen stürzt er sich über die ihm entgegengestreckte Rechte des Dompteurs: »Und ob ich will!«, jauchzt er.
Der Mann klopft ihm auf die Schulter: »Man sachte, sachte – bloß nicht so stürmisch: Sie werden schon noch einsehen, dass alles halb so glänzend ist, wie es sich von einem guten Sitzplatz bei abendlicher Beleuchtung ausnimmt! Wundern werden Sie sich! Aber wenn Sie brav sind, sollen Sie’s gut haben bei Alfred Martens. Das bin nämlich ich. Fred Martini bin ich nur auf dem Programmzettel. – Aber das sage ich Ihnen noch: Die Ohrfeige, die Sie meiner Frau verabreicht haben – die kriegen Sie mit Zins und Zinseszins zurück in Ihrer Lehrzeit! Und nun kommen Sie, wir wollen draußen ein bisschen frische Luft schnappen, bis Madame sich angezogen hat. Und dann wollen wir zusammen einen anständigen Schnaps trinken gehen – ich engagiere Sie nämlich mit Familienanschluss, müssen Sie wissen!«
In Peter Petersens Herzen jubeln tausend Geigen. Er ist ganz beschwingte Seligkeit. Dieses Glück – dieses große Glück!!! Schreien möchte er, in die Luft springen, irgendwie dem übervollen Herzen Luft machen.
Dann aber beugt er sich nur still über die ihm lachend gebotene Hand der schönen Frau, zieht sie an seine Lippen, und während er tief in das weiche Dunkel ihrer zärtlichen und heiteren Augen versinkt, küsst er andachtsvoll ihre weißen schlanken Finger, lange – sehr lange …
Der Mann an der Tür brummt belustigt: »Hören Sie lieber auf, old boy! Sonst verdoppele ich noch die Ihnen zugedachte Anzahl von Kopfnüssen! Und die ist schon recht stattlich, verlassen Sie sich darauf! – Kommen Sie endlich!«
Manege
- 3 -
Peter Petersen kommt am hellen Morgen heim. Längst ist das Hotel zum Leben erwacht, und nahe am Eingang sitzt auch schon der aussätzige Bettler, streckt seinen Armstumpf vor, der blutig ist und einem rattenzernagten Tierknochen gleicht. Und vor den Küchenfenstern im Souterrain drängen sich die herrenlosen und doch wohlgenährten Perahunde, warten, verhalten winselnd, auf ihr erstes Frühstück.
Der Montenegriner in seiner goldbedeckten Portieruniform sieht grinsend dem jungen Deutschen nach, der elastisch die Vorhalle durchquert, in den Lift springt. Der blonde Franke hat die Nacht nicht im Hotel geschlafen – nur bei einer Frau kann er gewesen sein!
Peter sperrt sein Zimmer auf, entkleidet sich, lässt das kühle Wasser in die Badewanne springen, planscht fröhlich darin herum, duscht ausgiebig, frottiert sich dann, bis er rot wie ein Indianer ist. Nackt tritt er vor den hohen Spiegel, reckt sich, lacht sein Bild im Glas an. Groß ist er, schlank in den Hüften, breit in den Schultern, braun und stark. Und das reiche, farbige, doch strenge Leben der drei Zirkusjahre, die hinter ihm liegen, hat ihm das Gesicht eines herrischen, selbstbewussten Mannes gegeben.
Mit viel Sorgfalt macht er dann Toilette, kleidet sich wieder an, geht auf und ab in seinem Zimmer, öffnet schließlich die Balkontür, tritt hinaus.
Der Bosporus leuchtet in der Morgensonne wie flüssiges Silber, windet sich, eine gleißende Schlange, zwischen den grünen Hügeln, zwischen schimmernden Palästen und dunkelnden Gärten dahin – hinauf zum Schwarzen Meer. Die bunte Spielzeugschachtel dahinten heißt Skutari. Dampfer auf dem Wasser, Fähren, Barkassen und hundert flink flitzende Kaiks. Huschende Wolkenfetzen über ihnen: das sind die Schwärme der Möwen.
Unwahrscheinlich blau spannt sich der Himmel über das zu seinen Füßen liegende Stambul, macht seine heiteren Farben glänzend und stark. Der Wald der Minarette, marmorne Stämme schlanker Palmen, die Kuppeln der tausend Moscheen, weiße Häuser, flache Dächer und smaragden leuchtende Gärten, in denen Lorbeersträucher rauschen, Olivenbäume und Platanen. Und wenn Peter Petersen sich weit über das verschnörkelte Eisengitter beugt, dann kann er in der Ferne den nachtdunklen Streifen von Eyubs Zypressen sehen, die flüsternd mit den toten Sultanen Zwiesprache halten, die seit Jahrhunderten in ihrem stillen Schatten träumen.





























